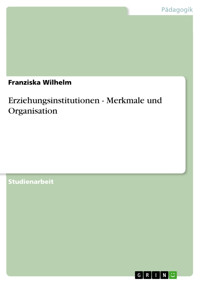14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Millas Familie, das sind die dominante Großmutter Lucia und ihre in die Jahre gekommene Mutter Rosana - eine Dorfschönheit, die für jeden, der wegen ihres Lächelns nicht auf dem Bahngleis endet, mit dem Zitronenmesser eine Kerbe in den Tresen ritzt. Und dann gibt es noch Millas Onkel Jano, mit dem Milla am liebsten den öden Kneipenalltag hinter sich lassen würde. Janos und Millas Beziehung ist eng - zu eng, wie Großmutter Lucia meint. Als die beiden eines Abends beim Tête-à-tête erwischt werden, bekommt Jano kalte Füße und verschwindet. Milla bleibt allein in Strottenheim zurück. Ausgerechnet mit einem Paketfahrer, der noch mehr in Schwierigkeiten steckt als sie, macht sie sich auf, Jano zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
FRANZISKA WILHELM
MEINE MUTTER SCHWEBT IM WELTALL UND GROSSMUTTER ZIEHT FURCHEN
ROMAN
Leseprobe
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Fotos von © getty images, Fotolia
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93992-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10576-6
Dieses E-Book beruht auf der 1. Auflage 2014 der Printausgabe
WILLKOMMEN IM CAFÉ ENDERS
Bei Leuten, die sich vor einen Zug schmeißen wollten, war Strottenheim eine große Nummer. Die Bahnstrecke lief über eine Anhöhe, von der man einen guten Blick auf den Strottenheimer See hatte. Wenn es dunkel war, leuchteten die vielen kleinen Lichter des Elektrizitätswerks in der Ferne. Wenn es noch nicht dunkel war, konnte man die umliegenden Felder sehen, die hier und da durch Pappeln unterbrochen wurden und am Horizont in flache Hügel mündeten. Neben den Gleisen gab es ein paar hochgewachsene Mirabellenbüsche, hinter denen man sich verstecken konnte, bis der Zug nahe genug heran war. Die Selbstmörder, die mit dem Auto kamen, parkten meist auf dem kleinen Schotterplatz unterhalb des Bahndamms. Vom Schotterplatz waren es nur wenige Schritte bis zum Zigarettenautomaten. Wer neben der letzten Zigarette noch ein Bier haben wollte, der kam bei uns vorbei. Bei uns, das war das Café Enders. Über dem Eingang des Café Enders stand noch immer »Sportlokal zum Muskelkater«. Das war so geblieben, seit meine Familie die Sportplatzkneipe vor sieben Jahren übernommen hatte. Mein Onkel Marek war die treibende Kraft im Innenausbau gewesen. Er hatte mit den Deckenplatten angefangen, weil man »immer oben anfängt, wenn man etwas richtig machen will«. Das war sein Spruch gewesen. Onkel Marek hatte auf der obersten Sprosse der Leiter gestanden, den Spachtel in der rechten Hand, das Eimerchen mit dem Kleister im linken Armwinkel. Ich wartete, bis er eine ausreichend große Fläche mit der braunen Paste bestrichen hatte, und reichte ihm dann eine neue Platte aus der Packung nach oben. Hin und wieder hielt Onkel Marek bei der Arbeit inne und sagte etwas wie: »Stell dir mal vor, Milla, helle Holzauskleidung, asymmetrisch angeordnete Sitznischen, ein indirekt beleuchtetes Billard-Séparée. Wie findest du das?« »Großartig«, hatte ich geantwortet, denn ich war mir sicher, dass alles großartig wurde, was von Onkel Marek kam.
Fünf Monate später war Onkel Marek tot. Er hatte sich vor einen Zug geworfen, wie all die anderen. Auf seiner Beerdigung wurde viel über das Café Enders, über die Sitznischen und das Billard-Séparée gesprochen. Nach der Beerdigung hatten meine Mutter, Jano und ich nur noch die restlichen Deckenplatten festgeklebt. Damit war der Umbau beendet gewesen. Es hatte keinen weiter gestört. Wer ins Café Enders kam, kam nicht wegen der Einrichtung. Wer ins Café Enders kam, kam, weil es die einzige Kneipe im Ort war. Und wegen meiner Mutter. Jeden Abend stand sie am Tresen und bediente die Leute. Sie zapfte Bier mit viel zu viel Schaum, konnte sich nie merken, wer einen Kurzen und wer einen Doppelten bestellt hatte. Aber sie lächelte und fuhr sich ab und zu durchs lange braune Haar oder strich sich das Kleid glatt, und alle waren zufrieden. Es gab immer wieder Männer, die über das Zapfen und Gläserspülen meiner Mutter den Zug verpassten, vor den sie sich werfen wollten. Wenn die letzte Bahn des Abends an Strottenheim vorbeigezogen war, ritzte meine Mutter für jeden Geretteten mit dem Zitronenmesser eine kleine Kerbe in das Furnierholz des Tresens. Meist hörte sie dann für die nächste halbe Stunde auf zu bedienen. Während Jano das Zapfen übernahm und ich die leeren Gläser spülte, fuhr sie mit dem Daumen über die neue Rille.
Es war ein Samstagabend im August 1998, Jano und ich saßen am Familientisch schräg neben der Bar und aßen Toast Hawaii. Meine Mutter stand am Tresen und zapfte Bier für einen Mann, dem man auf hundert Meter ansah, dass er wegen der Bahnstrecke gekommen war. Er trug eine abgewetzte grüngraue Lederjacke mit Bund, die ihm fast bis zu den Knien reichte und deren Nähte an den Ärmeln schon aufplatzten. Sein Unterkiefer bewegte sich unruhig auf und ab. Männer, die sich vor einen Zug schmeißen wollten, sahen immer aus, als ob sie heimlich Zwieback kauten. Jano meinte, das läge daran, dass sich die Entscheidung durch den ganzen Kopf durcharbeiten müsse. Eine Erklärung für die Lederjacken hatte Jano nicht. Aus irgendeinem Grund war es den meisten Leuten ein Bedürfnis, in einer Lederjacke zu sterben. Im Laufe der Jahre hatten wir im Café Enders die unterschiedlichsten Modelle gehabt: schwarz, braun, kurz, halblang, Glattleder mit Felleinsatz am Kragen, Wildleder mit Wollstoff an der Schulter, speckig mit Nieten, speckig ohne Nieten, rötlich, bestickt, nagelneu.
Der Mann mit der viel zu großen Lederjacke drehte uns den Rücken zu. Der Kragen war hochgeschlagen, das rotblonde Haar am Hinterkopf leicht gewellt. »Ein arbeitsloser Elektromonteur«, sagte Jano. »Ein Landschaftsgärtner«, meinte ich. Selbstmörder-Beruferaten – das war unser altes Spiel. Wenn es meine Mutter schaffte, dass sich der Mann an diesem Abend nicht vor den Zug warf, konnten wir später zu ihm an den Tresen gehen, Gläser spülen und unauffällig nachfragen, was er so machte oder was er zumindest mal gelernt hatte. Falls einer von uns richtig getippt hatte, musste der andere beim nächsten Spiel den Grill übernehmen. Der Grill war das Nervigste überhaupt. Man stand stundenlang im Bratwurstqualm, ohne dass jemand kam. Dann, in der Spielpause, kamen alle auf einmal und regten sich auf, dass es nicht schnell genug ging.
Draußen rauschte der 20.27er-ICE vorbei. Der Mann mit der Lederjacke hob leicht den Kopf. Jetzt konnte er nur noch den ICE um 21.27 Uhr kriegen. Es gab auch noch drei Regionalzüge, die bis kurz vor Mitternacht fuhren, aber die Leute aus der Gegend nahmen fast immer den ICE. Das war so etwas wie eine Frage der Ehre. Mein Onkel Marek war einer der Letzten gewesen, der sich noch vor einen Regionalzug hatte werfen müssen. Erst ein halbes Jahr nach seinem Tod waren die ersten Schnellzüge durch Strottenheim geleitet worden. »Das ist einfach nicht fair«, hatte sich Jano bei Großmutter Lucia beschwert, als der erste ICE über die Anhöhe rauschte, und Großmutter Lucia hatte zum ersten Mal in ihrem Leben zu einer Sache nichts gesagt.
Meine Mutter rief nach mir. Hardy wollte eine Bockwurst. Hardy war der Kapitän der Alten Herren. Er wog mindestens zwei Zentner und hatte eine Schuppenflechte am Rücken, die man immer sah, wenn er sich nach einem Foul theatralisch über den Rasen rollte. Aber weil er früher auf die Sportschule gegangen und sogar einmal Kreismeister geworden war, machte sich niemand über ihn lustig. Jeden Dienstag und Donnerstag scharten sich die Fußballherren nach dem Training um ihn herum an den Stammtisch, hörten sich seine Witze an und wollten dazu Bockwurst oder Toast Hawaii oder Soljanka oder alles zusammen. Es war kein Wunder, dass sie alle immer fetter wurden.
Ich lief in die Küche, um Hardys Bockwurst zu holen. Jano begleitete mich. Nicht um mir zu helfen, sondern um mir Gesellschaft zu leisten. Er weigerte sich, für die »Vereinsidioten«, wie er sie nannte, Salatbeilagen zu drapieren. Wir hatten uns damit abgefunden.
Ich brachte Hardy die Bockwurst und setzte mich wieder an den Familientisch. Jano holte uns zwei große Diesel. Der Mann mit der Lederjacke hatte sich kein weiteres Bier bestellt. Das sah nicht gut aus für meine Mutter. Drüben, am Sportlertisch, hörte ich Hardys grölendes Lachen. Er war einer der wenigen aus der Mannschaft, der einen richtigen Job hatte, und das machte ihn besonders laut. Er prostete meiner Mutter mit seinem Bier zu. Der Mann in der Lederjacke legte ein paar Münzen auf den Tresen und erhob sich vom Barhocker. Er war etwas früh dran für den 21.27er-Zug, aber vielleicht wollte er noch eine rauchen, ganz in Ruhe, ohne Hardys Gegrunze im Hintergrund. Meine Mutter schaute ihm nach. Ich wusste, dass sie sich gleich umdrehen würde, zum Guinness-Spiegel, der hinter der Bar hing, obwohl wir überhaupt kein Guinness verkauften. Sie würde durch ihr Haar fahren und dann mit Daumen und Zeigefinger über ihr Gesicht streichen, als wolle sie eine verirrte Wimper entfernen. Sie würde schauen, ob sich etwas an ihr verändert hatte, wie so oft in letzter Zeit. Sie war jetzt fast dreiundvierzig.
Der Mann mit der Lederjacke verließ den Raum. Ich hatte schon einige Männer so durch unsere Kneipe gehen sehen. Ich konnte das schlurfende Geräusch, das ihre Schuhsohlen machten, unter der Musik hindurch hören, egal wie laut das Radio aufgedreht war.
»Der bringt sich nicht um«, sagte ich zu Jano, der dem Mann durch das Fenster nachsah.
»Da wär’ ich mir nicht so sicher.«
»Vergiss es! Der Typ hat gar nicht den Mumm dazu. Der wird mit seiner riesigen Lederjacke irgendwo im Gestrüpp hängenbleiben und das als Zeichen nehmen.«
Jano grinste. Es war sein bitteres Grinsen. Mit den Mundwinkeln nach unten.
»Er wird es durchziehen«, sagte er und senkte den Kopf.
Es kamen hin und wieder Leute in unsere Kneipe, die Jano an Onkel Marek erinnerten. Sie mussten nicht unbedingt Ähnlichkeit mit ihm haben. Es ging um etwas anderes, etwas, das sie ausstrahlten. Jano hatte es mir mal genauer zu erklären versucht, aber ich hatte es nie ganz verstanden. Klar war mir nur, dass er ausgerechnet in dem Mann mit der lächerlich großen Jacke einen von diesen Menschen sah. Und das ärgerte mich.
»Ich geh’ ihm jetzt hinterher und schau’ nach«, sagte ich zu Jano, um ihn zu provozieren. Seit Onkel Mareks Tod mieden wir den Bahndamm. Jano entgegnete nichts. Er nickte nur.
Langsam stand ich auf und lief nach draußen. Der Himmel war taubenblau, es dämmerte bereits. Vor der Tür wartete ich ein paar Minuten, damit der Mann nicht mitbekam, dass ich ihm folgte. Gleichzeitig hoffte ich, Jano würde sich noch dazu entschließen, mir nachzukommen. Ich konnte ihn durch das Fenster sehen. Er saß vor seinem Diesel und rührte sich nicht. Also zündete ich mir eine Zigarette an und lief los. Ich nahm den Weg durch die Gartenanlagen. Die Strecke war kürzer als die durch die Bahnhofstraße, und man kam nicht direkt am Schotterparkplatz vorbei.
Es war 21.12 Uhr, als ich den Bahndamm erreichte. Ich stellte mich hinter einen Mirabellenbusch, von dem aus ich die Bahnstrecke und den Schotterparkplatz gut im Blick hatte. Der Mann lehnte an einem ziemlich verrosteten weißen Bulli und rauchte. Er stand seltsam schief da. Es sah aus, als hätte ihn irgendjemand einmal in der Hüfte durchgeknickt. Sein Kiefer arbeitete immer noch.
21.16 Uhr. Es wurde langsam kühl. Ich strich über meine Oberarme, legte die Daumen in die Kuhlen meiner Achseln. Der Mann in der Lederjacke trat seine Zigarette aus und kletterte die Böschung nach oben. Beim Gehen bog er mit den Fingerspitzen einzelne Zweige und Ranken beiseite. Einmal knackste es unter seinen Füßen. Er zuckte zusammen und fluchte leise. Wahrscheinlich hatte Jano mit seinem arbeitslosen Elektromonteur doch ins Schwarze getroffen. Ein Landschaftsgärtner war er auf jeden Fall nicht.
Auf dem Bahndamm angekommen, drehte sich der Mann in meine Richtung. Ich trat ein Stück weiter in den Mirabellenbusch hinein. Die Blätter verdeckten mir die Sicht, aber ich hörte seine Schritte auf dem Gleisbett näher kommen. Er ging nicht besonders schnell. Trotzdem würde es nur noch wenige Augenblicke dauern, bis er an mir vorüberlief. Ich drückte mich immer tiefer in den Mirabellenbusch hinein. Der Mann trat aus dem Gleisbett und kam auf meinen Busch zu. Ich schloss die Augen, versuchte mich nicht zu bewegen und möglichst leise zu atmen. Kaum zwei Meter von mir entfernt, hörte ich, wie er den Reißverschluss seiner Lederjacke zuzog. Er hatte auf der gegenüberliegenden Seite des Busches Position bezogen. Langsam öffnete ich die Augen. Durch eine Lücke im Geäst konnte ich seine runde Stirn und die schnurgeraden, buschigen Brauen erkennen. Konzentriert blickte der Mann in die Ferne. Es war noch nicht ganz dunkel. Der See lag blaugrau und ohne jede Bewegung vor uns. Die Lichter des Elektrizitätswerks leuchteten wie ein Schwarm Glühwürmchen am Nordufer. Dahinter begann die Bahnstrecke.
Ich konnte den Atem des Mannes hören. Er war überraschend ruhig. Ich überlegte, ob er meinen Atem auch hörte. Vielleicht wusste er, dass da kaum zwei Meter von ihm entfernt noch jemand war. Doch der Mann schaute einfach weiter geradeaus. Die Ruhe, die nach und nach in seinen Körper einkehrte, machte mir Angst. Vorhin, in der Kneipe, war ich mir sicher gewesen, dass er nicht einmal die Böschung hochsteigen würde. Jetzt stand er hier neben mir und jede seiner Bewegungen war von einer stillen Entschlossenheit, die mich an Onkel Marek erinnerte, der mittags noch präzise wie immer die Zwiebeln, die Gurken und die Kartoffeln für den Kartoffelsalat geschält und sich dann später ohne Ankündigung und ohne Abschiedsbrief das Leben genommen hatte. Wahrscheinlich hatte er an seinem letzten Abend an der gleichen Stelle wie wir gestanden und gewartet. Ich bekam Angst, dass Jano den Typen doch besser eingeschätzt hatte als ich.
Der Mann mit der Lederjacke trat einen Schritt nach vorn. Mit den Augen folgte ich dem Bogen, den die Gleise um den See machten. Es musste bestimmt schon 21.27 Uhr sein. Ich traute mich jedoch nicht, meinen Arm zu heben, um auf die Uhr zu schauen. Ob ein Selbstmörder erleichtert oder verärgert war, wenn der Zug, vor den er sich werfen wollte, Verspätung hatte? Ich wusste es nicht. Es war auch nicht mehr wichtig. Am Ende der Strecke tauchten die Lichter des ICEs auf. Der Zug machte eine Kurve um das westliche Ende des Sees. Ich sah die vielen beleuchteten Fenster und hörte das Vibrieren der Schienen. Mit einem Mal spürte ich, wie der Mann auf der anderen Seite des Mirabellenbuschs zu schwitzen begann. Sein Schweiß lief mir den Nacken herunter. Ich fühlte das Gewicht seiner Lederjacke auf meinen Schultern. Meine Beine begannen zu zittern. Als er auf die Gleise trat, verlor ich das Gleichgewicht. Vergeblich versuchte ich, mich an den Zweigen des Mirabellenbuschs festzuhalten. Es knackste und raschelte. Ich stolperte nach vorn. Der Mann mit der Lederjacke drehte den Kopf in meine Richtung. Hinter mir begannen die Bremsen des Zuges zu quietschen. Ich hörte sie seltsam gedämpft, wie durch eine Wand. Doch ihr Geräusch brachte den Boden unter mir ins Schwanken, die Mirabellenzweige, die langen Gräser, die Kieselsteine im Gleisbett, alles schien plötzlich gegeneinanderzuschlagen. Nur der Mann mit der Lederjacke stand vollkommen ruhig in der Landschaft. Die Scheinwerfer des Zuges tauchten sein Gesicht in ein blasses gelbes Licht. Ich drehte mich um, sah die Lok und die schwarze Führerkabine, die in Sekundenschnelle immer näher kamen.
Nein!, dachte ich, Nein!
Dann begannen meine Beine zu laufen, die Böschung hinunter, durch Gestrüpp und Buschwerk und Brennnesseln, hinein in die Nacht, die endlich angekommen war.
MEINE MUTTER SCHWEBT IM WELTALL
In unserer Familie waren die Frauen schon immer größer als die Männer. Als das Hochzeitsfoto meiner Großeltern geschossen wurde, hatte mein Opa Hermann auf einem kleinen Podest gestanden, damit sein Kopf mit dem von Großmutter Lucia auf gleicher Höhe war. Man sah das Podest auf dem Bild nicht, aber meine Mutter hatte mir davon erzählt, und die wusste es von Opa Hermann selbst. Keiner der Enders-Söhne schaffte es je, an die Höhe von Großmutter Lucia heranzukommen: weder mein Onkel Marek, der sich vor einen Zug geworfen hatte, noch Jano, der nur drei Jahre älter war als ich. Allein meine Mutter war genauso groß geworden wie Großmutter Lucia, nämlich einen Meter achtundsiebzig. Mit einem Wachstumsschub um meinen vierzehnten Geburtstag herum durchbrach ich die Höhenlinie unserer Familie. Einen Meter einundachtzig hatte meine Mutter gemessen, oberste Marke im Türrahmen. Großmutter Lucia hatte mich mit einem langen, von unten nach oben wandernden Blick betrachtet, einem Blick, mit dem andere Leute Fliegerdenkmäler, antike Säulen oder Dinosaurierskelette begutachten. »Jetzt ist aber mal genug«, hatte sie gesagt. Es war eine Drohung gewesen. Großmutter Lucia war eine Meisterin im Drohen, ihr Blick und der Tonfall ihrer Stimme legten meine Wachstumshormone lahm. Mein Körper blieb bei einem Meter einundachtzig stehen. Später dachte ich oft darüber nach, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Großmutter Lucia schon früher etwas zu meiner Größe gesagt hätte. Es war seltsam für mich, die Jüngste zu sein, aber über alle hinauszuragen. Jano meinte nur, dass man das mit der gemessenen Größe nicht zu ernst nehmen dürfe, weil Zentimeterangaben niemals den Kern einer Sache träfen. Im Hinblick auf meine Mutter und meine Großmutter musste ich ihm da absolut recht geben. Sie teilten sich einen Strich im Türrahmen. Neben dem Strich stand: Lucia + Rosana, 5. September 1971. Ich nahm an, dass dieser Strich noch von Opa Hermann gezogen worden war, der dabei wahrscheinlich wieder auf einem Podest gestanden hatte. Ich nahm auch an, dass es das erste, einzige und letzte Mal gewesen war, dass jemand meine Mutter und meine Großmutter unter einem Strich zusammengefasst hatte. Ich selbst hatte meinen Großvater nie kennengelernt, weil er starb, bevor ich geboren wurde, aber mit dem Strich hatte er mich beeindruckt.
Es gab keine zwei Menschen im Dorf, die sich so unähnlich waren wie meine Mutter und meine Großmutter. Am deutlichsten wurde das, wenn man hinter ihnen durch den Schnee ging: Großmutter Lucias Haar war schwer und rauh wie Pferdehaar. Sie trug einen dicken straff gebundenen Dutt, dem kein Wind etwas anhaben konnte. Großmutter Lucia sagte, ihr Haar sei so stark, weil sie einen so starken Willen habe, und der käme ja auch aus dem Kopf. Sie trug sommers wie winters einen dunkelbraunen Rock mit Gummizug und hatte für eine Frau ein überraschend breites Kreuz. Großmutter Lucia war so fest im Boden verankert, dass sich ihre Füße beim Gehen nur wenige Millimeter von der Erde lösten. Großmutter Lucias Fußabdrücke waren keine Fußabdrücke, sondern Furchen.
Die Spuren meiner Mutter waren ganz anders. Wenn sie einen Weg entlanglief, sah man hier und da nur kleine Dreiecke im Schnee. Meine Mutter trat nie mit dem ganzen Fuß auf, sondern, wenn überhaupt, nur mit der Spitze. Beim Gehen blieb der linke Arm, der Tablettarm, fest an einer Stelle, der rechte schwang langsam und gleichförmig vor und zurück. Alle Bewegungen meiner Mutter waren langsam, schwingend und gleichförmig. Wenn sie neben meiner Großmutter ging, wirkte sie schwerelos.
Es war unumstritten, dass meine Mutter die schönste Frau war, die je in Strottenheim gelebt hatte. »So schön wie Romy Schneider«, behauptete meine Großmutter nicht ohne Stolz, aber ich glaubte, dass die Schönheit meiner Mutter nichts mit der Schönheit von Romy Schneider zu tun hatte. Die Schönheit meiner Mutter konnte man nicht auf Fotos festhalten, die Schönheit meiner Mutter konnte man nur spüren.
Ich stellte mir meine Mutter oft im Weltraum vor. In etwa so: Rosana schwebt hinter einem Tresen, der sich direkt im All befindet. Neil Armstrong steigt aus seiner Rakete und bestellt eine Jim Beam Cola. Meine Mutter bringt die Bestellung mit der von Juri Gagarin durcheinander, der schon eine halbe Stunde auf seinen doppelten Wodka wartet. In dem Moment, in dem die Männer anfangen, wütend zu werden, streicht sich meine Mutter das Haar hinters Ohr und sagt: »Das Blaue da unten, das ist übrigens die Erde.« »Tatsächlich«, antworten Armstrong und Gagarin gleichzeitig und sehen erst auf die Erde, dann auf meine Mutter, die in ihrem grünen Kleid hinter dem Weltraumtresen schwebt. Später stoßen sie mit schaumigem Bier, das sie gar nicht bestellt haben, erst auf die Erde und dann auf meine Mutter an, und alles ist irgendwie gut.
Meine Mutter hatte dunkelbraunes Haar, das sanft im Wind wehte, auch wenn kein Wind wehte, und Augen, die je nach Jahreszeit die Farbe wechselten. Sie war für jeden Mann unerreichbar und trotzdem für alle da. Es gab immer Rolfs und Rauls und Manfreds und Ralfs, die um meine Mutter herumschlichen, ihr Blumen brachten und die sie mal näher und mal weniger nah an sich heranließ. Schon ein Lächeln oder eine kleine Berührung von ihr konnte die Rolfs und Rauls und Manfreds und Ralfs so glücklich machen, dass sie unsere Obstbäume beschnitten, die Eistruhe und gebrochene Fliesen reparierten oder neue Elektrokabel verlegten.
Meine Großmutter Lucia ist in ihrem ganzen Leben nur für einen Mann da gewesen und das bis zum Schluss. Das erzählte sie häufig und am liebsten, wenn meine Mutter in der Nähe war. Wir alle konnten die Geschichte von Opa Hermanns Krankheit mitsprechen. Aber eigentlich konnte Großmutter Lucia froh sein, dass es so war, wie es war mit meiner Mutter, weil all die Sachen, wie die Fliesenreparaturen oder die Elektrokabelverlegungen, ja gemacht werden mussten.
Auf ihre Weise waren meine Mutter und meine Großmutter ein gut eingespieltes Team. Durch ihre Unterschiedlichkeit nahmen sie nur sehr viel Raum ein. Wenn meine Mutter und meine Großmutter nebeneinander durchs Dorf liefen, ging ich meistens hinterher, weil neben ihnen kein Platz mehr war. Ich konnte über ihre Köpfe hinwegsehen und passte auf, dass der Abstand zwischen uns nicht zu groß wurde. Manchmal schaute ich auf das schmale Stück zwischen ihren Körpern. Der Arm meiner Großmutter war beim Gehen immer leicht angewinkelt. Von Zeit zu Zeit berührte ihr Ellenbogen die Taille meiner Mutter, nicht zu fest, sondern gerade so, dass meine Mutter die Spur nicht verlor und meine Großmutter wusste, dass sie noch da war.
NACHT IN STROTTENHEIM
Als ich über den Schotterplatz rannte, schlugen mir die Schnürsenkel meiner Turnschuhe gegen die Knöchel. Kletten und Gräser hatten sich in ihnen verfangen. Doch ich hatte keine Zeit anzuhalten. In ein paar Minuten würde die Feuerwehr hier sein, und ich wollte nicht, dass sie mich entdeckten. Im Laufen drehte ich mich noch einmal kurz zum Bahndamm um. Jemand war aus dem Zug gestiegen, wahrscheinlich der Schaffner. Ich ärgerte mich, dass ich nicht zu den Gartenanlagen geflüchtet war, sondern zum Bahnhof hin. Die Rettungsleute kamen immer von der Bahnhofsseite. Ich rannte schneller. Auf dem Bahndamm leuchteten die Scheinwerfer der stehenden Lok. Ich wollte ihr hässliches kaltes Licht nicht mehr sehen. Hastig bog ich in den Triftweg und dann rechts in die Feldstraße ein, da hörte ich schon das Heulen einer Sirene. Schnell versteckte ich mich hinter einem parkenden Auto. Als das Geräusch langsam verstummte, ließ ich mich auf den Bordstein sinken. Ich lehnte mich gegen den Kotflügel des Wagens und schloss die Augen. Alles in mir pochte, klopfte und pumpte. Ich dachte an den Mann auf dem Gleisbett, an sein rundes, gelb beleuchtetes Gesicht. Wie alt mochte er wohl gewesen sein? Ende dreißig vielleicht. Onkel Marek war bei seinem Tod achtunddreißig gewesen. Wahrscheinlich war das ein gefährliches Alter für normale Menschen. Kaputte Künstler starben mit siebenundzwanzig, alle anderen verzweifelten Seelen raffte es mit achtunddreißig dahin. Sie hatten elf Jahre mehr. Dafür starben sie im Stillen, denn die Zeitungen aus der Gegend hatten irgendwann aufgehört, über die Selbstmörder zu berichten. Aus Angst vor Trittbrettfahrern schrieben sie lieber über die Aktiventreffen des Kaninchenzüchtervereins. Selbst die Alte-Herren-Mannschaft tauchte regelmäßig im Ortsblatt auf, meistens war Hardy im Bild. Fett und grinsend. Was den Angehörigen blieb, war die Seite mit den Traueranzeigen. »Unser lieber XY ist aus dem Leben gerissen worden« stand dann da oder: »Er ging viel zu früh und ohne Abschied«. Für die Familien, die eine aufwendiger gestaltete Annonce aufgeben wollten, gab es sogar ein Ornament, das an blumenumrankte Schienen erinnerte. Eine Zeitlang hatte ich solche Anzeigen gesammelt, heimlich natürlich.
Großmutter Lucia hatte sich nach Onkel Mareks Tod gegen einen Nachruf entschieden. Jano und ich hatten sie dafür gehasst. Wir hassten sie ohnehin in dieser Zeit. Und wir fürchteten uns vor ihr. Sie weinte nicht um ihren Sohn. Nicht an dem Abend, als sie von seinem Tod erfuhr, nicht an dem Tag, an dem die Beerdigung stattfand, und auch nicht später, als sie seine Sachen zusammenpackte und in Kisten auf dem Dachboden verstaute. Großmutter Lucia war schon immer ernst und kühl gewesen, aber Mareks Selbstmord ließ in ihrem Herzen einen Eisberg wachsen. Jeder, der versuchte, sich ihr zu nähern, zerschellte daran.
Die Entwicklung, die meine Mutter vollzog, war ähnlich beängstigend. Auch sie weinte nicht. Obwohl sie sonst bei jedem dämlichen Schmonzettenfilm mit glasigem Blick auf der Couch hockte, ein zerknülltes Taschentuch in den Händen, blieben ihre Augen trocken und ihre Bewegungen leicht. Ihr Mund lächelte unentwegt. Sie ignorierte einfach, dass Marek gestorben war. »Sie hat einen Schock oder so etwas«, versuchte Jano mich damals zu beruhigen. Doch die Veränderungen, die in meiner Mutter und meiner Großmutter vorgingen, machten mir so viel Angst, dass ich nicht mehr mit ihnen unter einem Dach schlafen wollte. Eines Nachts flüchtete ich aus dem Haus und klopfte an Janos Gartenhütte. Jano hatte bis dahin nie viel mit mir zu tun gehabt. Ich war für ihn seine brave, langweilige Nichte Milla gewesen, mit der er sich nicht abgeben wollte. An jenem Abend allerdings öffnete er mir die Tür, umarmte mich und ließ mich neben ihm in seinem Bett schlafen. Wir taten uns auf eine Weise leid, die furchtbar und gut zugleich war. Wir heulten ganze Nächte durch. Wir litten. Wir schluchzten. Wir krallten uns ineinander und rollten dabei vom Bett auf den Boden. Wenn uns in diesen Tagen jemand gesehen hätte, hätte er sicher gedacht, wir seien nicht ganz bei Trost. Waren wir ja auch nicht. Wir hatten Marek verloren.
Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter und schrak zusammen. Jemand legte seinen Finger auf meinen Mund. Es war Jano.
»Der Elektromonteur hat wohl Ernst gemacht?«, fragte er und ließ mich wieder los.
»Sieht so aus«, sagte ich und kniff die Augen zusammen. »Was machst du hier?«
»Ich habe die Sirenen gehört und bin dich suchen gegangen. Ich dachte, wir könnten mal wieder bei Hardy vorbeischauen.«
Neben dem Selbstmörder-Beruferaten war das unser zweites Spiel. Während Hardy bei uns in der Kneipe herumsaß, hingen wir in seinem Haus ab. Besonders viel Zeit konnten wir uns dort lassen, wenn sich wieder jemand vor einen Zug geworfen hatte. Denn Hardy liebte es, das Geschehen am Bahndamm zu beobachten, wahrscheinlich, weil er früher einmal Feuerwehrmann hatte werden wollen. Von der Kneipe aus bekam man ganz gut mit, was auf den Gleisen passierte. Hardy setzte sich meist auf einen Stuhl direkt am Fenster und blieb bis zum Schluss. An solchen Abenden brachte er uns ziemlich viel Umsatz. Deshalb duldete Großmutter Lucia es auch, dass er andauernd laut kommentierte, was er sah.
Ich pflückte die Kletten von meinen Schnürsenkeln und band mir die Schuhe zu. Meine Hände zitterten noch. Trotz der Dunkelheit bemerkte es Jano. Er setzte sich neben mich und fuhr mit seiner Hand an meinem Ohr entlang. Es war eine sanfte Berührung, bis er mein Ohrläppchen erreichte. Er kniff es in einer schnellen Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen. Das machte er manchmal, wenn er mit etwas nicht einverstanden war.
»Wir hatten mal gesagt, dass wir da nicht mehr hingehen, zum Bahndamm.«
Ich nickte und schwieg. Janos Hand wanderte von meinem Ohr über meinen Hals zu meiner Schulter. Ein paarmal ließ er sie auf meinem Rücken auf- und abgleiten, dann umfasste er meinen Arm. »Lass uns gehen!«, sagte er und zog mich mit sich nach oben.
Hardys Haus lag keine drei Minuten entfernt. Auf dem Weg dorthin pfiff Jano leise vor sich hin. Ich hatte das Gefühl, als wolle er mich damit beruhigen. Doch der Mann mit der Lederjacke ploppte immer wieder irgendwo in meinem Kopf auf.
Jano drückte die Klinke von Hardys Eingangstor. Rocky kam uns entgegen, wedelte mit dem Schwanz, fiepte leise und sprang zur Begrüßung an mir hoch. Ich kraulte sein weiches Fell. Jano hatte ihm über die Jahre beigebracht, nicht zu bellen, wenn wir kamen. Wir zogen das Tor leise hinter uns zu und schlichen zum Haus. Unter der Stufe zur Eingangstür gab es einen Hohlraum, dort lag der Schlüssel. Bevor wir die Tür aufschlossen, suchte Jano nach einem Stöckchen. Er warf es weit in den Garten hinein, Rocky rannte mit wehenden Ohren hinterher. »Was für ein schräger Hund«, sagte Jano und steckte den Schlüssel ins Schloss.
Im Flur roch es nach Plastikfolie und Holzlamellen. Hardy verkaufte Rollläden und Jalousien. Er hatte den unteren Teil des Hauses zu einem Büro mit Lagerraum umgebaut.
»Ich muss jetzt was trinken«, sagte Jano und lief die Treppe hinauf. Ich folgte ihm. Wir fingen immer in der Küche an. Jano öffnete den Kühlschrank.
»Möchtest du einen Schluck?«
Hardys Frau Sabine hatte einen großen Rumtopf im Kühlschrank, den sie je nach Saison mit frischen Beeren auffüllte. Jano liebte dieses Zeug.
»Nee, danke«, sagte ich und setzte mich an den Küchentisch. Jano schaute wieder in den Kühlschrank, griff nach irgendetwas, schlug die Tür zu und kam zu mir. Er hielt eine Schmelzkäseecke in Silberfolie in der Hand, eine mit Schinkengeschmack. Langsam pulte er erst das hellblaue Papier mit dem Schinkenbild und dann die Silberfolie vom Käse. Ich schaute ihm dabei zu. Ich mochte seine Hände. Sie waren kantig und schlank. Bis auf den Daumen hatte jeder Finger eine ganz gerade, flache Kuppe. Ich mochte auch Janos Zweihügelstirn. Hügel eins, Furche, Hügel zwei, Haaransatz. Es gefiel mir, mit der Hand darüberzufahren.
»Möchtest du mal abbeißen?« Jano streckte mir die entpellte Schmelzkäseecke entgegen. Ich schüttelte den Kopf. Er knüllte das Silberpapier zusammen und steckte es in seine Hosentasche.
»Dann lass uns rübergehen und den Fischen beim Schlafen zusehen.«
Direkt vor dem Wohnzimmerfenster stand eine Straßenlaterne, die ein orangefarbenes Licht in den Raum warf. In der Ecke neben der Tür blubberte das Aquarium. Ich setzte mich aufs Sofa, schlüpfte aus meinen Schuhen und legte die Füße auf einen Sessel. Jano kam zu mir. Er schob seine rechte Hand an meinem Nacken vorbei auf meine Schulter. Ich lehnte meinen Kopf an seinen Hals und konzentrierte mich auf Janos Geruch. Jano roch nach Gras, nach Deo, nach Kneipe und nach Schmelzkäsezubereitung. Es war ein guter Geruch.
»Denk nicht mehr an vorhin«, sagte er.
»Ist schon wieder okay«, antwortete ich.
Jano griff nach meinem Arm und zog mich ein Stück näher zu sich heran. Eine Weile lagen wir nur still nebeneinander. Auch Jano schien etwas durch den Kopf zu gehen. Ich fragte nicht nach. Er grübelte ohnehin zu viel. Tagelang konnte er über Dinge nachdenken, ohne auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Manchmal musste man ihn auffangen, bevor er sich ganz und gar darin fallen ließ.
Ich streifte Janos T-Shirt ein Stück nach oben und strich mit den Fingerspitzen über seine Brust. Sofort hielt er meine Hand fest.
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Nichts«, sagte er.
Ich zog meine Hand aus seiner und richtete mich ein Stück auf, so dass mein Gesicht genau über seinem war. Sanft rieb ich meine Wange an Janos Lippen entlang. Ich versuchte, mich nur auf dieses Gefühl zu konzentrieren. Es sollte die Bilder vom Bahndamm aus meinem Kopf verjagen. Ich wollte nicht mehr darüber nachdenken. Stück für Stück schob ich meine Hand weiter unter sein T-Shirt. Ich wollte Janos Haut spüren, die immer rauh war. Ich wollte seine Rippen spüren, von denen sich jede einzelne so deutlich abzeichnete. Langsam ließ ich meine Hand über seine Brust nach unten gleiten. Dann knöpfte ich seine Jeans auf.
Mit sechzehn hatte Jano alle Mädchen im Umkreis gevögelt, selbst die dicken. Er sprach nie darüber, aber ich bekam es natürlich trotzdem mit. Mit neunzehn und nach dem Tod von Onkel Marek hatte er genug von all den »hirnlosen Ischen«, wie er sie nannte. Seitdem berührten wir uns. Jano hatte entschieden, dass es für uns nicht mehr als ein Berühren geben durfte. Schließlich sei ich biologisch gesehen immer noch seine Nichte. Auch wenn er nur drei Jahre älter war als ich. Ich hatte ihm schon öfter erklärt, dass es vom Ergebnis her dasselbe sei, ob wir miteinander schliefen oder uns nur anfassten, doch er blieb bei seiner Meinung.
Während ich meine Finger langsam auf- und abgleiten ließ, spürte ich Janos Atem auf meiner Haut. Erst hatte er versucht, meine Hand wegzuschieben, dann waren seine Atemzüge schneller geworden. Immer noch schwebte mein Gesicht über seinem. Jano schaute mich an. Ich versuchte, die Pupillen in seinen schwarzbraunen Irisringen auszumachen, aber es war zu dunkel. Mein Blick streifte über Janos Stirn: Haaransatz, Hügel, Furche, Hügel, Haaransatz. Alles war gut. Alles war so, wie es sein sollte.
Jano kam in meiner Hand.
Er suchte nach einem Taschentuch, fand aber keines. Ich zog mir eine meiner Socken aus und hielt sie ihm hin. Jano wollte gerade danach greifen, als wir hörten, wie unten die Tür geöffnet wurde.
»Ich komme gleich, Sabine«, rief Hardy aus dem Erdgeschoss. Jano sprang auf, packte meinen Arm und zog mich hinter das Sofa. Das Licht wurde eingeschaltet. Sabine stand im Türrahmen. Sie hatte uns schon gesehen. Jano schloss den Reißverschluss seiner Hose und richtete sich auf. Sabine bewegte sich nicht. Sie schien nicht einmal mehr zu atmen. Wie immer waren ihre winzigen, schmalen Augen dick mit Kajal umrandet. Auf der rechten Seite war die Schminke schon verlaufen. Die schwarzen Schlieren gaben ihr ein seltsam fremdes Aussehen. Ich versuchte herauszufinden, was in ihr vorging – ohne Erfolg. Ihre Augen verrieten nichts, ihr Mund blieb ein verschlossener dünner Strich. Ich räusperte mich vorsichtig. Sabines Lippen öffneten sich, doch sie sagte kein Wort. Jano schaute mich an. Ich verstand seinen Blick. Wir mussten so schnell wie möglich aus diesem Wohnzimmer verschwinden. So wie es sich anhörte, war Hardy unten in seinem Büro. Ich schaute auf den Boden. Zwischen Sabine und uns lagen meine Turnschuhe. Vorsichtig trat ich hinter dem Sofa hervor, griff danach und schlüpfte hinein. Ich machte mir nicht die Mühe, die Socke, die ich die ganze Zeit in meiner Hand gehalten hatte, vorher überzuziehen, sondern stopfte sie einfach in meine Hosentasche. Jano trat ebenfalls ein paar Schritte nach vorn. Etwas zu hastig allerdings. Er blieb am Wohnzimmertisch hängen und stolperte auf Sabine zu. Sabine erwachte aus ihrer Starre und schlug mit der flachen Hand gegen den Türrahmen. Das Geräusch des Aufschlags fuhr laut und dumpf durchs Haus.
»Sabine?«, rief Hardy von unten herauf.
»Es tut uns leid«, flüsterte Jano, „wir wollten nichts …« Sie schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Sabine?«, brüllte Hardy wieder.
»Alles in Ordnung«, rief Sabine zu ihm hinunter. Ihre Stimme klang seltsam blechern.
Sabine wischte sich mit dem Handrücken über die verschmierten Augen. Ihr Hals hatte rote Flecken bekommen. Sie überlegte wohl, was sie mit uns tun sollte. Ich traute mich nicht mehr, mich zu bewegen. Auch Jano stand einfach nur da. Bis auf das Blubbern des Aquariums war es furchtbar still im Raum. Nach ein paar unendlich langen Augenblicken setzte sich Sabines kleiner, stämmiger Körper in Bewegung. Sie kam auf uns zu, griff mich und Jano am Arm und führte uns die Treppe hinunter. Ich spürte ihre Fingernägel auf meiner Haut. Es überraschte mich, wie fest sie zupacken konnte. Wir liefen so leise wie möglich an Hardys Bürotür vorbei. Sabines Mund war wieder zu einem festen Strich verschlossen. Erst als wir draußen waren, begann sie zu sprechen.
»Ich habe keine Ahnung, was ihr hier tut, aber ich rate euch …« Sabine stockte. Sie schaute hinüber zu Hardys Bürofenster. Hardy hatte das Licht ausgeknipst und lief nun durch den Flur. Er hatte mitbekommen, dass Sabine nach draußen gegangen war. »Ich rauch’ noch eine mit«, rief er laut, und wir hörten ihn von innen auf die Haustür zukommen. »Weg jetzt, weg hier!«, zischte Sabine.
Wir rannten los.
ENTDECKT WERDEN
Erst als wir vor Janos Gartenhütte standen, traute ich mich wieder zu sprechen.
»Sie werden den Türschlüssel nicht mehr unter die Stufe legen.«
»Das ist unser geringstes Problem«, sagte Jano barsch und verschwand in seiner Hütte. Die Holztür schlug direkt vor mir zu. Jano verriegelte sie von innen. Ich verstand nichts mehr. Er konnte mich doch jetzt nicht einfach so hier draußen stehen lassen! Ich begann, gegen den blätternden grünen Lack zu klopfen, erst mit den Händen, später mit meinem Turnschuh, aber Jano öffnete nicht. Mit dem Schuh in der Hand lief ich durch die Kneipe und in die obere Etage unseres Hauses, in der meine Mutter und Großmutter Lucia schon schliefen. Vom Klofenster aus konnte ich den Bahndamm sehen. Alles war dunkel und ruhig dort. Fast als ob überhaupt nichts vorgefallen wäre.
Ich legte mich in mein Bett und knipste das Licht aus. Dann schaltete ich es wieder ein, stand auf und schaute durch das Fenster hinunter zur Gartenhütte. Dort waren die Jalousien fest geschlossen. Ich ärgerte mich. Ich verstand Jano nicht. Warum wollte er mich jetzt nicht bei sich haben? Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis unser Spiel aufflog. Wie oft hatten wir wohl schon in Hardys Wohnzimmer gesessen? Zwanzigmal vielleicht. Oder öfter? Im Prinzip ging es doch darum, entdeckt zu werden. Irgendwann. Ich erinnerte mich, wie vorsichtig wir das erste Mal die Stufen zur Stube hochgestiegen waren. Ich hatte sogar darauf bestanden, dass wir die Schuhe auszogen. Nachdem wir das erste, das zweite und das dritte Mal unentdeckt geblieben waren, waren wir mutiger geworden. Wir hatten begonnen, uns selbstverständlicher durch die Zimmer zu bewegen. Wir öffneten den Kühlschrank, schnitten uns Stücke von der Salami ab, tranken vom Rumtopf. Es ging doch darum, eine Fährte zu legen. Kleine, feine Zeugnisse unserer nächtlichen Besuche. Aufspürbar, wenn man nur genau hinschaute. Und jetzt war der Tag gekommen, an dem sie uns bemerkt hatten. Es war nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war passiert. Ich hatte keinen Hardy gesehen, der außer sich war vor Wut, der auf Jano losging und vielleicht auch auf mich. Es hatte nur eine Sabine gegeben, die bestimmt und still geblieben war, die uns, warum auch immer, geschützt hatte. Dennoch waren wir entdeckt worden. Wenn man es logisch betrachtete, war damit ein Ziel erreicht. Und nun wussten wir nicht, was geschehen würde. Es würde Ärger geben, so viel stand fest. Gerade deshalb mussten wir doch zusammenhalten. Wir sollten beide eingeschlossen in Janos Hütte sitzen. Wir drinnen und die Welt draußen. So lange bis der Sturm vorbei war. Doch Jano ließ mich nicht zu sich, er kapselte sich ab. Vielleicht hatte ich zu viel erwartet. Ich hatte angenommen, dass wir zusammengehörten. Auf unsere spezielle Weise. Aber Jano war auch mir gegenüber der geblieben, der er allen anderen gegenüber war. Der Unerreichbare. Jano hatte in letzter Konsequenz immer sein eigenes Ding durchgezogen, egal, was irgendwer anderes davon hielt. Er hatte mit elf angefangen zu rauchen und in der Achten mit der Schule aufgehört, obwohl ihm Großmutter Lucia jedes Mal die Hölle heißgemacht hatte. Vor ein paar Jahren hatte er aus einer Laune heraus beschlossen, nie wieder Socken und geschlossene Schuhe zu tragen. Zwei Winter lang war er nur in Biolatschen durch die Gegend gelaufen. Seine Zehen hatten furchtbar ausgesehen. Lila. Hardy hatte ihm zu Weihnachten eine leere Margarinedose geschenkt, in der er seine Zehen sammeln sollte, sobald sie abfielen. Das Seltsame war, dass Jano in diesen zwei sockenlosen Wintern vollkommen gesund geblieben war. Nicht mal einen Schnupfen hatte er sich geholt.
Jano war zäh und stur. Ihm war egal, was die Leute dachten. Ich konnte mir nicht erklären, warum es ihn also jetzt so aufbrachte, dass Sabine uns entdeckt hatte. Schämte er sich dafür, dass er mit mir, seiner Nichte, auf der Couch erwischt worden war? Das passte doch gar nicht zu ihm.
Ich legte mich wieder ins Bett und vergrub mich unter meiner Decke. Eine unendlich lange Zeit versuchte ich einzuschlafen, aber es gelang mir nicht. Mein Körper fand keine Ruhe. Mein Kopf auch nicht. Wie ein kaputter Videorekorder hing er sich immer wieder an der Stelle in Hardys Haus auf. Jano und ich hinterm Sofa. Sabines Hand im Türrahmen. Hardys Schritte im Flur.
Irgendwann stand ich auf und ging erneut zum Fenster. In Janos Hütte war nach wie vor alles dunkel und verriegelt. Wie eine kleine schwarze Festung stand sie in unserem Garten. Ich wickelte mir meine Decke um die Schultern und öffnete das Fenster. »Gute Nacht«, sagte ich in die Nacht hinein, und niemand antwortete.
Hat Ihnen diese Leseprobe gefallen?
Das E-Book erscheint am 21. Januar 2014
ISBN: 978-3-608-10576-6, € 14,99
Informationen zur Autorin
© Hauschild
Franziska Wilhelm, 1981 in Erfurt geboren, lebt in Leipzig. 2011 erhielt sie das Förderstipendium der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen. Mit ihren Erzählungen war die Autorin u.a. Preisträgerin beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen, beim sächsischen »poet bewegt« und beim »Eobanus Hessus«-Schreibwettbewerb sowie Finalistin des Nachwuchsautorenwettbewerbs von KulturSpiegel und Thalia.
Besuchen Sie auch die Homepage der Autorin: www.franziska-wilhelm.de