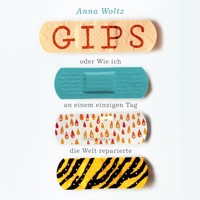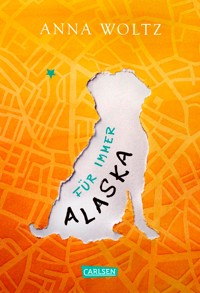7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Gleich am ersten Tag in den Ferien bricht sich Samuels Bruder den Fuß. Na, das kann ja ein schöner Urlaub werden. Aber beim Dorfarzt auf Texel lernt Samuel die Tochter der Sprechstundenhilfe kennen, Tess. Sie hat sandfarbene Haare und fragt ihn, ob er Trompete spielen kann oder schon mal einen Schnitzkurs gemacht hat. Nein, das kann er nicht, aber trotzdem freunden sich die beiden an. Und Samuel hilft Tess bei ihrem verrückten Plan, ihren Vater kennen zu lernen, von dem sie bisher nicht mehr als den Namen weiß. Sie hat ihn zusammen mit seiner Freundin Elise für eine Woche in ihr Ferienhaus eingeladen und lauter verrückte Sachen für ihn organisiert. Natürlich ohne ihm zu verraten, dass sie seine Tochter ist. Und auch ihre Mutter hat sie nicht eingeweiht. Tess will erst einmal herausfinden, ob sie ihn überhaupt als Vater will. Der Plan geht gründlich schief und am Ende fliegt alles auf, aber eines ist klar: Tess möchte ihren Vater haben und ihr Vater möchte Tess haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CARLSEN-Newsletter: Tolle neue Lesetipps kostenlos per E-Mail! Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Dieses Buch wurde mit Unterstützung des Nederlands Letterenfonds, Amsterdam, veröffentlicht.
Alle deutschen Rechte CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2015
Originalcopyright © 2013 by Anna Woltz Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B. V.
Originaltitel: »Mijn bijzonder rare week met Tess«
Umschlag- und Innenillustrationen: Regina Kehn
Umschlagtypografie: Regina Kehn und formlabor
Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann
Lektorat: Katja Maatsch
Satz und E-Book-Umsetzung: Zeilenwert GmbH 2014
ISBN: 978-3-646-92748-1
Für Jefta, den liebsten Hund der Welt
2001–2012
1
Ich sah es kommen.
Papas roter Pulli und mein Ringelshirt waren das Tor. Die Sonne schien mir auf die Arme und der Wind vom Meer spielte heimlich auch mit. Ich rannte, bis ich nicht mehr konnte, und blieb dann keuchend stehen.
In der Ferne sah ich Jorre. Er machte nichts. Er spazierte einfach nur über den leeren Strand und schaute in aller Seelenruhe in den Himmel. Zu den schneeweißen Wolken, die über die Insel trieben. Als wäre er vierzig und nicht zwölf.
»Samuel«, rief Papa mir zu. »Los, mach schon, wir sind mitten im Spiel!«
»Ja-ha«, rief ich zurück.
Aber ich blieb stehen. Ich spürte, wie der trockene Sand zwischen meinen Zehen hinaufkroch. Ich war eine verkehrt herum laufende Sanduhr. Ich brauchte nur ein paarmal mit den Zehen zu wackeln und schon hatte ich wieder ein paar Minuten mehr.
»Samuel!«, rief Papa wieder.
Ich schaute noch einmal zu Jorre, und dann passierte es. Er setzte den Fuß auf, aber dort, wo Sand hätte sein müssen, war Luft. Mit rudernden Armen purzelte er in eine riesige Kuhle.
Es war großartig.
Ganz kurz jedenfalls, denn dann fing mein Bruder an zu schreien. Mein Mund lachte schon fast, aber damit war es schnell vorbei.
Der Wind rauschte und die Wellen rollten, aber Jorres Gebrüll übertönte alles. Meine Knochen wurden ganz kalt. Er klang nicht mehr wie ein Junge, sondern wie ein Tier.
Papa und ich rannten gleichzeitig los. So schnell wir konnten, kämpften wir uns durch den lockeren Sand. Wir konnten Jorre nicht mal mehr sehen, es war, als hätte die Erde ihn verschluckt.
»Jorre!«, schrie ich.
»Wir sind gleich bei dir!«, rief Papa.
Und dann standen wir am Rand der Kuhle. Mein Bruder lag auf dem Boden und hielt sein Bein fest. Sein Gesicht war verzerrt und die Haare hingen ihm vor den Augen. Alles, was mich in den letzten Wochen so an ihm genervt hatte, war verschwunden.
Als er uns sah, hörte er auf zu brüllen. Keuchend sah er Papa an.
»Ich habe gehört, wie es knackte«, rief er. »Als ich aufprallte. Da hat es knack gemacht.«
Ich schüttelte mich. Es war erst Anfang Mai. Viel zu kalt, um mit bloßen Armen auf einem zugigen Strand zu stehen.
Papa stieg hinunter. Als er aufrecht in der Kuhle stand, reichte ihm der Sand fast bis zur Taille. So ein tiefes Loch hatte ich bislang erst ein einziges Mal gesehen. Das war drei Wochen her, also wusste ich es noch ganz genau. Die ganze Klasse durfte weiße Rosenblätter in das Loch werfen. Händeweise. Ich hatte Angst gehabt, die Blätter könnten alle sein, bevor ich dran war, aber sie hatten noch einen Reservekorb. Ich durfte als Erster aus dem neuen Korb nehmen.
Papa kniete sich neben Jorre und schob das Hosenbein von dem Knackebein hoch.
»Vorsicht!«, rief ich.
Mein Bruder sagte nichts.
»Du tust ihm weh!«, schrie ich. Ich traute mich nicht, nah an den Rand der Kuhle zu treten. Sicher würde gleich die Wand einstürzen.
Papa löste Jorres Schnürsenkel, und ich sah, wie mein Bruder zusammenzuckte. Aber noch immer sagte er nichts.
»Gib mir dein Telefon«, rief ich Papa zu. »Dann rufe ich 112 an. Sie sollen einen Krankenwagen schicken.«
»Jetzt mach mal halblang«, sagte mein Vater.
»Aber er hat Schmerzen! Das siehst du doch? Er sagt nichts, aber es ist doch wohl klar, dass er ins Krankenhaus muss?«
Papa nickte. »Wir gehen zum Arzt.«
»Aber er kann nicht laufen.«
»Ich trage ihn über den Strand«, sagte Papa. »Und dann fahren wir mit dem Auto ins Dorf.«
»Du bist verrückt«, rief ich wütend. »Was ist, wenn du stolperst? Dann verschieben sich seine Knochen und er kann nie wieder gehen. Oder er humpelt, dann kriegt er nie eine Freundin ab …«
»Halt doch die Klappe«, sagte Jorre plötzlich.
Er strich sich die Haare aus den Augen und sah mir direkt ins Gesicht. Jetzt war er wieder der neue Jorre. Der nervige Jorre aus den vergangenen Wochen.
»Das tut weh genug, auch ohne dein Kindergartengeplärre in den Ohren.«
Ich trat einen Schritt zurück.
Still sah ich zu, wie Papa Jorre unter die Achseln griff und hochzog. Jorres Gesicht war blass und ich sah, wie er die Zähne zusammenbiss. Aber er sagte nichts, und ich wusste jetzt, dass auch ich den Mund halten musste.
Ich durfte nicht für ihn schreien. Ich durfte keinen Krankenwagen rufen. Er war zwei Jahre älter als ich, und schon als ich geboren wurde, war es eigentlich zu spät. Es war ein mächtiger Fehlstart gewesen, aber keiner hatte gesagt: Dann fangen wir eben noch mal von vorn an.
Ich bückte mich und hob ein paar weiße Muscheln auf. Eine nach der anderen warf ich in die Kuhle. Die letzte landete auf Jorres Kopf.
2
Ich rannte zurück zu unseren Pullis, während Papa Jorre aus der Kuhle zog. Er nahm ihn huckepack und wankte mit ihm über den Strand. Bei jedem Schritt keuchte mein Vater und mein Bruder stöhnte. Zusammen klangen sie wie ein alter Dinosaurier.
Ich durfte mich im Auto nach vorn setzen, denn Jorre brauchte die ganze Rückbank. Wir waren gestern Abend erst spät angekommen und hatten eigentlich noch gar keine Ahnung, wo wir waren. Unser grünes Ferienhaus stand versteckt mitten in den Dünen. Aber der Arzt wohnte natürlich im Dorf. Also rasten wir an Läden voller bunter Strandeimer und Gummi-Delfine vorbei. An überfüllten Straßencafés, triefenden Eiskarren und wehenden Fähnchen.
Ab und zu drehte ich mich zu meinem Bruder um. Ich schaute auf sein Bein und versuchte mir vorzustellen, wie es sich anfühlte. Da drinnen, zwischen seinen Muskeln und dem hämmernden Blut.
»Was denkst du«, fragte ich, »sind das die schlimmsten Schmerzen, die du jemals gehabt hast?«
»Bloß, weil du ununterbrochen nachdenkst«, sagte Jorre, »heißt das nicht, dass wir das alle so machen.«
Ganz am Ende des Dorfes fanden wir einen Arzt. Die Praxis befand sich in einem niedrigen grauen Gebäude, das nicht nach Ferien aussah. Papa ließ uns im Auto sitzen und rannte alleine hinein. Ich schaute auf meine Uhr. Nach drei Minuten und fünfzehn Sekunden kam er mit einem Rollstuhl zurück.
»Uff!«, sagte er außer Atem. »Die Arzthelferin ist eine echte Kneifzange! Sie hat mir fast die Nase abgebissen, als sie hörte, dass wir keinen Termin haben. Jetzt müssen wir warten, bis der Doktor Zeit hat.«
»Aber Jorre hat Schmerzen!«, rief ich. »Da setzen wir uns doch nicht gemütlich ins Wartezimmer, bis der Doktor irgendwann mal Zeit hat?«
Papa zuckte mit den Schultern. »Diese Frau ist Leute mit Schmerzen gewohnt. Wenn man nicht fast stirbt, muss man eben warten.«
Er half Jorre aus dem Auto und in den Rollstuhl.
»Darf ich schieben?«, fragte ich sofort.
Papa zögerte.
»Ich bin ganz vorsichtig«, sagte ich. »Wirklich. Ich weiß, dass es kein Einkaufswagen ist.«
Jorre grinste kurz. Nicht zu doll, natürlich, denn er hatte ja Schmerzen.
»Hmm«, machte mein Vater. »Zum Glück hat Mama mir nie erzählt, was ihr so alles mit Einkaufswagen anstellt.« Er trat einen Schritt zur Seite. »Okay. Aber nicht zu schnell.«
Es war schwierig, den Rollstuhl geradeaus zu lenken, aber ich stieß fast nirgendwo gegen. Die strenge Arzthelferin fand es eher nicht so toll, dass ich schob. Sie hatte kurze blonde Haare und knallrote Lippen, und sie wedelte mit der Hand wie ein Verkehrspolizist.
»Hier entlang! Und pass auf mit den Türrahmen, die sind gerade frisch gestrichen.«
Das große Wartezimmer war voller Leute, die supergesund aussahen. Sie trugen kurze Hosen und bunte Flipflops mit Blumen. Ich parkte Jorre neben einem Tisch mit Lego und setzte mich zu Papa auf die harte Bank. An der Wand gegenüber hingen Fotos von sieben Sorten Strandgras. Es roch nach Pflaster.
Ich versuchte unauffällig zu den anderen Leuten zu gucken, weil ich wissen wollte, was die hatten. Warum saßen sie beim Arzt, während draußen die Sonne schien? Man sah ihnen nichts an. Trotzdem waren sie hier.
Ohne es zu wollen, musste ich wieder an Bellas Vater denken. Als er im Herbst auf dem Sportfest geholfen hatte, hatte ihm niemand etwas angesehen. Und trotzdem war er damals schon krank gewesen.
Ich rutschte hin und her und wartete.
Und wartete noch länger.
»Papa?«, flüsterte ich dann. »Meinst du, der letzte Dinosaurier wusste, dass er der letzte war?«
»Wie meinst du das?«, fragte er leise.
»Als der letzte Dinosaurier starb«, sagte ich, »wusste er da, dass er ausstarb? Wusste er, dass nach ihm keine neuen mehr kommen würden?«
Jorre schaute sich das Strandgras an und tat, als würde er nicht zu uns gehören.
»Das hoffe ich nämlich«, sagte ich. »Wenn er wusste, dass er der letzte war, dann fand er es bestimmt nicht so schlimm zu sterben. Dann war er sowieso ziemlich einsam.«
Papa nickte. »Ja, das glaube ich auch.«
Vielleicht hatte er gehört, was ich sagte. Aber vielleicht auch nicht. Das konnte er gut: antworten, ohne nachzudenken. Er war ein lieber Vater-Roboter.
»Jorre?«, fragte ich. »Glaubst du, dass ein Dinosaurier mit anderen Tieren befreundet sein konnte, also mit anderen Arten? Zum Beispiel mit einem …«
»Jetzt hör doch mal auf!«, sagte Jorre laut.
»Aber ich dachte …«
»Mir tut alles weh, kapierst du das nicht? Dieses Bein versaut mir die ganzen Ferien.« Er schüttelte den Kopf. »Es ist nicht zu glauben. Zur Hälfte bist du ein Professor. Und zur anderen Hälfte ein fünfjähriges Mädchen. Ich will nicht über einen einsamen Dino reden, der einen Igel zum Kaffeekränzchen besucht!«
Ein Mann mit einem Urwald aus Haaren auf den Beinen grinste, und ich schaute zu Boden. Natürlich hörte uns das ganze Wartezimmer zu.
»Dann setze ich mich eben ins Auto«, sagte ich.
Es war totaler Unfug, dass Jorre mich Professor nannte. Um Professor zu werden, musste man erst zum Gymnasium gehen und danach noch ganz viele Jahre zur Universität. Ich war erst in der vierten Klasse. Das hatte ich Jorre gerade letzte Woche erklärt, aber es war ihm egal. Er sagte es immer wieder.
Ich stand auf und Papa gab mir die Autoschlüssel.
»Nicht wegfahren, ja?«, sagte er betont fröhlich.
Ich nickte, dann ging ich nach draußen, in die Sonne.
3
Draußen waren noch immer Ferien. Ich stand mitten zwischen den Häusern und trotzdem schmeckte die Luft salzig. Die sonnigen Gehwegplatten waren mit einer dünnen Sandschicht bedeckt. Kleine Häufchen Strand, mitgenommen von Flipflops, nassen Handtüchern und Gummitieren.
Ich steckte die Autoschlüssel ein und ging los. Natürlich war ich nicht so doof, mir dabei den Himmel anzusehen. Ich hatte nicht vor, in eine Kuhle zu fallen.
Die Schlüssel klimperten in meiner Hosentasche. Mein Kopf war leer. Manchmal denke ich viel. Und manchmal denke ich nichts. Bei mir gibt es wenig dazwischen. Ich schlenderte über den Parkplatz neben dem grauen Gebäude, und dann blieb ich stehen.
Die Hintertür der Arztpraxis führte auf eine kleine Terrasse, und mitten auf dieser Terrasse stand ein Tisch mit einem Laptop, einer Zimmerpflanze und einer Schreibtischlampe. Das Lampenkabel schlängelte sich ein Stück über die grauen Platten und hörte dann auf. Der Stecker endete im Nichts.
An dem Tisch saß ein Mädchen mit sandfarbenen Haaren und einem ernsten Gesicht. Ich drehte mich schnell um, aber sie hatte mich schon gesehen.
»Warte mal«, rief sie.
Ich drehte mich halb zu ihr.
»Weißt du was über Zebrafische?« Ihre Stimme war genauso ernst wie ihr Gesicht.
»Eigentlich nicht«, sagte ich.
»Spielst du vielleicht Trompete?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Hast du mal einen Schnitzkurs gemacht?«
Ich schüttelte wieder den Kopf und sie seufzte.
»Dann kann ich dich nicht gebrauchen. Geh ruhig weiter.«
Erstaunt blieb ich stehen. Ich sah mir noch mal den losen Lampenstecker an und die verstaubte Zimmerpflanze ohne Blüten.
Und dann schaute ich mir vorsichtig das Mädchen an. Das ging, weil sie gerade auf den Bildschirm ihres Laptops starrte. Sie war älter als ich, das sah ich sofort. Und sie war bestimmt keine Touristin. Sie trug glänzende braune Stiefel und eine Lederjacke. Alle auf der Insel spielten Sommer, nur sie nicht.
»Halt!«, rief sie plötzlich, während ich reglos dastand. »Ich brauche dich doch. Kannst du tanzen?«
Eigentlich war es ganz einfach. Ich konnte mich umdrehen und weggehen. Aber sie hörte nicht auf zu reden.
»Standardtänze, meine ich, wie Leute auf einem Ball. Oder auf einer Hochzeit. Kannst du das?«
»Nein!«, sagte ich laut. Sie sollte wissen, dass ich nicht nur nicht tanzen konnte, sondern es auch nicht wollte.
Sie lachte mich an. »Ich kann es auch nicht.« Sie stand auf. »Dann lernen wir es.«
Sie tippte auf ihrem Laptop, klickte ein paarmal hin und her, und plötzlich ertönte Musik. Altmodische Musik voller Geigen, die nicht zu dem halb leeren Parkplatz und der Meeresbrise passte.
»Ich bin übrigens Tess«, sagte das Mädchen. »Wir fangen mit dem Wiener Walzer an.«
Sie kam zu mir und stellte sich vor mich. Ich wollte wegrennen, aber sie nahm meine Hand. Sie war mindestens einen Kopf größer als ich und hatte klebrige Finger. Ich spürte ihren Atem auf meiner Stirn.
»Die rechte Hand legst du auf meinen Rücken«, sagte sie, als wäre sie die Inselchefin persönlich. »Ich habe es alles im Internet nachgelesen, aber ich hatte niemanden zum Üben.«
Sie legte die linke Hand auf meine Schulter.
»Hör auf!«, rief ich. Ich machte mich los und trat einen Schritt zurück. »Das ist verboten. Du darfst nicht einfach so Leute anfassen, die du nicht kennst.«
Tess trat einen Schritt vor und ich machte schnell zwei Schritte zurück. Die altmodische Musik spielte weiter. Schwebend, kreiselnd, vornehm, aber trotzdem auch fröhlich. »Ich bin zehn«, sagte ich. »Wenn du mich noch ein einziges Mal anfasst, gehe ich zur Polizei.«
»Du bist zehn?« Sie klang erstaunt. »Ich dachte, du wärst neun. Oder acht.« Sie ging ein wenig in die Knie. »Ich bin elf, aber alle halten mich für älter.«
Wieder trat sie einen Schritt vor.
»Lass das«, sagte ich, aber Tess schaute fröhlich. Sie bohrte mir einen ihrer Klebefinger in die Schulter.
»Die Polizei lacht dich aus, wenn du da hingehst. Ein elfjähriges Mädchen darf einen zehnjährigen Jungen anfassen, ganz bestimmt.«
Ich verschränkte die Arme. »Aber ich will es nicht.«
Ihr Gesicht wurde wieder ernst. »Bitte?«, fragte sie. »Es ist sehr wichtig, dass ich bis heute Abend tanzen kann.«
»Das glaube ich nicht.«
»Der Rest meines Lebens hängt davon ab.«
Sie schaute mich an, ohne wegzusehen. In ihren braunen Augen waren helle Pünktchen. Sie war kein Roboter, sondern ein echter Mensch. Sie sah mich an.
»Was meinst du …«, fing ich an. Ich räusperte mich. »Fand der letzte Dinosaurier es schlimm zu sterben?«
Sie dachte nach. Eine ganze Weile, bis die Musik zu Ende gespielt hatte und wir nur noch die Möwen über uns hörten.
»Ich fände es immer schlimm zu sterben«, sagte sie dann. »Der Gedanke, dass dann alles aufhört …« Sie biss sich auf die Lippe. »Aber wenn ich die Allerletzte wäre, dann wäre es vielleicht etwas weniger schlimm. Dann wäre ich ja doch ziemlich einsam.«
Sie schaute mich mit ihren Pünktchenaugen an und ich nickte. Zögernd trat ich einen Schritt vor.
»Stell dir vor«, sagte sie. »Wenn ich die Letzte wäre, dann hätte ich niemanden zum Tanzen.«
Sie rannte zum Laptop und tippte schnell darauf herum. Die Musik setzte wieder ein. Diesmal war es Drehorgelmusik, aber irgendwie doch nicht.
»Ich heiße Samuel«, sagte ich.
Sie nahm meine Hand fest in ihre. Die Musik machte mich schwindlig.
»Mit dem rechten Fuß machst du einen Schritt nach vorne«, sagte Tess.
Das tat ich, und gleichzeitig setzte sie den linken Fuß einen Schritt zurück.
»Jetzt mit links einen Schritt zur Seite.«
Ihr anderer Fuß bewegte sich zusammen mit meinem.
»Und jetzt anschließen mit rechts.«
Das machte ich, und ihr linker Fuß folgte. Sie lachte. »Das ist alles. Wir tanzen!«