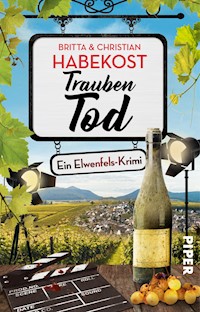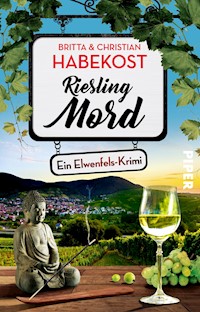12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Julien Vioric ermittelt
- Sprache: Deutsch
In den Bars feiern die Pariser ausgelassen zu den betörenden Klängen des Jazz, doch auf den Straßen treibt ein grausamer Serienmörder sein Unwesen …
Paris 1925: Während die Klänge von Jazzmusik durch die schmalen Gassen von Montmartre wehen, wird auf dem Friedhof Père Lachaise eine grausame Entdeckung gemacht. Ein menschliches Herz wurde vor Frédéric Chopins Grab niedergelegt. Ermittler Julien Vioric erinnert der groteske Anblick an den einzigen ungelösten Fall seiner Karriere – einen skandalumwitterten Fund vor zwölf Jahren. Seine Recherchen führen ihn in die Kreise junger Exilanten und zur rechtsextremen Action française, die immer wieder gewaltsame Überfälle organisiert. Inmitten des Chaos taucht plötzlich eine weitere Leiche auf und Vioric weiß, dass weitere Tode folgen werden …
»Britta Habekost schreibt sehr ausdrucksstark und bildgewaltig, manchmal poetisch, dann wieder brutal realistisch. Ihr Paris ist eine Stadt voller Gewalt, Vergnügungssucht und Hysterie.« NDR Kultur über Stadt der Mörder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Britta Habekost, geboren 1982 in Heilbronn, studierte Literatur sowie Kunstgeschichte und arbeitete unter anderem als Museumsführerin. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für surrealistische Dichter, die sie in ihrem historischen Kriminalroman Stadt der Mörder gekonnt durch die Szenerie wandeln lässt. Auch in Melodie des Bösen verwebt die Autorin Fakten mit Fiktion und erzählt bildgewaltig von der Ära des Jazz.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
BRITTAHABEKOST
Melodiedes
Bösen
KRIMINALROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sarvin Zakikhani
Covergestaltung: Favoritbüro
Covermotive: © Bernard Jaubert/ArcAngel,
© Elisabeth Ansley/Trevillion Images,
© Shutterstock (Malivan_Iuliia, Katrina Brown)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28689-7V001
www.penguin-verlag.de
Für Christian
One love.
Auch in Europa wächst die Zahl der freidenkerischen Geister, welche den Zauber der neuen Musik Afroamerikas spüren können und ängstlich auf das kratzende und knisternde Orakel lauschen, das sich auf ihren Grammophonen dreht, auf dass auch keine Silbe verloren gehe.
Robert Goffin
PROLOG
30. Mai 1913, Arrondissement d’Élysée, frühmorgens
Das Gewicht eines menschlichen Herzens ist erstaunlich gering.
Er hatte immer geglaubt, es hätte eine eindrucksvolle Masse, die seiner Funktion im Getriebe eines Menschen auch entsprach. Vielleicht wog es innerhalb eines lebenden Körpers mehr. Aber so, wie es nun in der Schachtel in seinen Händen lag, war es enttäuschend gewichtslos, nicht schwerer als ein Apfel. Ebenso leicht war es gewesen, an das Herz zu kommen, auch wenn ihn diese Tat immer noch innerlich vor Grauen beben ließ.
Aber dass er nun hier in der Avenue Montaigne stand, im milchigen Zwielicht eines sehr frühen Morgens, mit einem menschlichen Herz in einer Pappschachtel, war nur ein weiterer logischer Schritt in seinem Leben. Für einen Moment ergriff ihn ein bitterer Schmerz. Ursprünglich war er doch einmal dafür gemacht gewesen, etwas unendlich Schönes zu bewirken.
Aber von Schönheit wollte in dieser verdammten Stadt niemand mehr etwas wissen. Was er zu tun im Stande gewesen war, hatten sie in den Staub getreten wie das Spitzentaschentuch, das jetzt im Rinnstein vor ihm zwischen all dem anderen Abfall schmutzig weiß aufblitzte. Er sah sich um. Offenbar waren die Straßenkehrer noch nicht da gewesen, um die Überbleibsel der letzten Nacht zu beseitigen.
Der Abschnitt vor dem Theater glich einem Schlachtfeld. Zwei zertrümmerte Stühle mit dunkelblauem Samtbezug lagen dort neben etlichen zerbrochenen Flaschen und, wie ein eigentümliches Zeugnis menschlicher Enthemmtheit, sogar einige Herrenschuhe aus schwarzem Lack. Irgendwo in der Stille schepperte eine Mülltonne und vermischte sich mit einer Erinnerung an die vergangene Nacht, die wie ein fiebriger Blitz durch seine Gedanken schoss.
Er sah wieder die Balletttänzer mit ihren unschönen, bäuerlichen Kostümen vor sich, deren stampfende Bewegungen nichts anderes im Sinn zu haben schienen, als die Bühne unter ihren Füßen in Kleinholz zersplittern zu lassen. Das anfängliche missbilligende Pfeifen der Zuhörer, das sich in Fassungslosigkeit und Empörung steigerte. Dazu die dissonanten Kanonenschläge und schrägen Tonläufe aus dem Orchester. Der Dirigent, der stoisch wie ein Unterwelt-Fährmann die gesamte Darbietung durch die aufgepeitschte Wut des Publikums hindurch steuerte, bis zum bitteren Ende.
Obwohl nun alles wieder ruhig um ihn war, schien dieser befremdliche Tonstrudel immer noch an ihm zu zerren. Gestern Abend war es ihm vorgekommen, als würde etwas Riesiges seinen Kopf unter Wasser drücken, aber unter der Oberfläche war es nicht still und dumpf, sondern unerträglich laut und disharmonisch.
Er blieb stehen und betrachtete die Verwüstung. Man hätte meinen können, das Chaos auf der Bühne hätte sich auf diesen Teil der Avenue Montaigne ausgeweitet. Aber nichts von diesen Überbleibseln konnte wirklich von den Abgründen künden, die sich gestern hier aufgetan hatten. Das ungläubige Entsetzen darüber ließ ihn erneut schaudern.
Weder herrenlose Schuhe noch Scherben oder zerbrochene Stühle taugten als Symbol für das, was nur das Herz in seinen Händen zeigen konnte.
In der zaghaften Morgendämmerung ertönten nun die fernen Schritte früher Passanten, aber er nahm sie lediglich am Rande seines Blickfeldes wahr. Sie waren nur dahinhuschende Gespenster.
Das Erschütterndste an dieser vergangenen Nacht war jedoch nicht das provozierende Geschehen auf der Bühne und auch nicht der Aufruhr im Publikum gewesen. Sondern der Moment, als er sie ansah, um sich ihrer Reaktion zu vergewissern. Sie war zu kultiviert, um ihre Abscheu in die Schreie der anderen zu mischen, auch wenn so mancher Adeliger und einige andere noble Herrschaften sich aufgeführt hatten wie prügelfreudige Matrosen. Aber er war sich sicher gewesen, dass sie vor Abscheu erstarrt wäre, sich vielleicht sogar erhob und ihm ein beklommenes Zeichen machte, den Saal zu verlassen. Doch während um sie herum Stühle flogen und das Publikum sich gegenseitig an den Kragen ging und versuchte, die Balletttänzer von der Bühne zu brüllen, saß sie bebend vor Bewunderung immer noch auf ihrem Stuhl wie festgezaubert. Und in ihren Augen dieses Staunen.
Ihr ergriffener Blick brannte immer noch auf seiner Netzhaut. Er kannte diesen Blick, wenn Musik sie in ihrer Tiefe berührte. In ihren Augen tauchte dann immer dieses Glitzern auf, als würde sie vor Rührung weinen.
Die Schlaglichter der Erinnerung an das, was dann kam, ließen ihn erneut zittern. Der Garten ihrer Eltern, als sie von der Premiere zu ihrem Palais zurückgekehrt waren. Die kühle Nachtluft, die ihm jedoch keine Ruhe brachte, sondern nur neues Entsetzen.
Ihr Mitleid, mit dem sie ihn verhöhnte. Und der Moment, als ihm klar wurde, dass er betrogen worden war.
Er riss die kühle Morgenluft in seine Lungen und schüttelte den Kopf, um das entsetzliche Bild zu vertreiben. Seine Hände zitterten und in seinem Magen stieg Übelkeit auf.
Er würde nie wieder in ihre Augen sehen, das war ihm nun wieder in schrecklicher Endgültigkeit bewusst. In seinem Inneren rang der Schmerz über ihren Verlust mit niederträchtiger Genugtuung, dass sie ihn nie wieder so mitleidig ansehen würde.
Er blickte auf die weiße Fassade des Théâtre des Champs-Élysées. Vor Kurzem noch war dieses Haus ein edler Hort hoher Erwartungen gewesen, ein Tempel der Kunst. Jetzt war es nur noch ein Grab für die Überreste seiner untergegangenen Welt. In der Stille ringsum erschien ihm der Aufruhr hinter diesen Mauern, dessen Zeuge er geworden war, beinahe irreal. Was geschehen war, würde die Realität, seine Realität für immer verändern. Für ihn hatte sich eine Tür geschlossen, die jeglichen Rückweg in sein bisheriges Leben für immer versperrte.
Er betrachtete die Schachtel mit dem Herzen in seinen Händen. Mit einem Mal kam es ihm vor, als hätte es sich mit dem Albtraum der vergangenen Nacht vollgesogen und er konnte gerade noch zupacken, ehe ihm die Schachtel aus den Händen rutschte. Er wollte sie und ihren Inhalt nun so schnell wie möglich loswerden, aber nicht hier, nicht zwischen all dem Unrat. Was er an diesem Ort hinterlassen würde, war weit mehr als nur ein Zeichen von entfesselter Empörung.
Er setzte sich in Bewegung. Am Rand eines kleinen Brunnens regten sich verschlafen ein paar Tauben. Er stolperte über eine herumliegende Flasche, die mit lautem Klirren gegen den Fuß einer Laterne stieß. Irgendwo schlug eine Kirchenglocke sechsmal, was ihn daran erinnerte, dass er sich beeilen musste.
Als er das Eingangstor des Theaters erreicht hatte, in dem seine Welt zugrunde gerichtet worden war, lag das Herz noch schwerer in seinen zittrigen Händen. Als wollte es ihn noch einmal den Schmerz und das Grauen der vergangenen Nacht fühlen lassen.
Er nahm sein Taschentuch und hob das Herz aus der Schachtel. Ihn schauderte, als er das weiche, kaum mehr feuchte Gewebe durch den dünnen Stoff hindurch spürte. Rasch legte er es auf die weiße Marmorstufe des vermeintlichen Musentempels, in dem ihm gestern der Teufel begegnet war.
Er richtete sich wieder auf und ging davon.
Eine klirrende Nüchternheit vertrieb nun den Schmerz in seinem Inneren. Plötzlich war es, als wäre hinter ihm eine Brücke eingestürzt. Und am zurückliegenden Ufer verschlang ein dichter Nebel gnädig die Nachwehen der letzten Nacht. Weit hinter ihm verschwamm der scharfe Klang des Orchesters, die Hetzjagd der Geigen. Die ekstatische Gewalt der Tänzer verringerte sich zu einem sanften Pochen, seinem eigenen Herzschlag nicht unähnlich. Und auch die schmerzhaften letzten Jahre, die sich vergangene Nacht in ihrem Blick verdichtet hatten, rückten von ihm ab.
Er atmete tief die feuchte Morgenluft ein.
1
Zwölf Jahre später
8. Mai 1925, Rue Chaptal, spätnachts
Julien Vioric presste sich das Kissen auf seine Ohren, aber der Trompeter torpedierte die Nacht mit einer Penetranz, die Vioric sonst nur von besonders hartnäckigen Wespen kannte. An Schlaf war nicht zu denken. Wenn diese Trompete im Stockwerk über ihm wenigstens etwas gespielt hätte, das ihm vertraut gewesen wäre, hätte er sich ein wenig in der Melodie verlieren können, während er gegen die dunkle Zimmerdecke starrte. Stattdessen glaubte er, in der rasenden Aneinanderreihung der Töne so etwas wie ein spöttisches Lachen zu hören. Als wollte diese Musik seinem Geist ein unlösbares Rätsel aufgeben. Und etwas an diesen abstrusen Klängen schien ihn auch herauszufordern. Ohne Zweifel zum Tanzen, was das Ganze noch nervenaufreibender machte. Warum spielte dieser Trompeter sie in einem privaten Wohnhaus mitten in der Nacht und nicht in einem der vielen Musik-Clubs der Umgebung? Vioric dachte wehmütig an seine alte ruhige Wohnung im sechsten Arrondissement, in der das Lauteste, was seine Nacht hätte stören können, der Hustenanfall eines Nachbarn war oder streitende Katzen unten im Schatten von Saint-Sulpice. Aber er hatte die Wohnung aufgegeben und vermietet, um von den Mieteinnahmen leben zu können, ehe er eine genaue Vorstellung davon hatte, wie es mit seinem Leben weitergehen sollte. Für die Zwischenzeit hatte er sich eine günstige Wohnung am Montmartre besorgt. Das Haus wurde hauptsächlich von Einwanderern aus Amerika und der Karibik und einigen Theaterschauspielern bewohnt, und die meisten dieser Bewohner waren nachts nicht zu Hause. Nun, das erklärte, dass niemand sonst im Haus sich von der entfesselten Trompete gestört fühlte.
Vioric sprang aus dem Bett, zog sich etwas über und lief die Stufen bis zur Mansarde hoch. Er hämmerte gegen die Tür, an der kein Name angebracht war, aber die Trompete ließ sich dadurch nicht beirren. Die Töne hüpften, glucksten und plärrten, und Viorics Ruhelosigkeit steigerte sich. Er wollte schlafen, doch bei diesem rasenden Rhythmus würde er noch bei Sonnenaufgang aufrecht im Bett sitzen und mit den Füßen den Takt mitwippen. Ein pochender Schmerz kroch in seinen Hinterkopf. Für einen Moment spielte Vioric mit dem Gedanken, die Tür seines Nachbarn einzutreten und ihm seine Trompete von den Lippen zu reißen.
Das Holz zitterte unter seinen Schlägen. Ganz plötzlich erstarb die Melodie. Die Tür wurde aufgerissen. Das Erste, was Vioric auffiel, war die Tatsache, dass der Mann hinter der Tür offenbar noch andere Menschen zu gewalttätigen Fantasien anregte.
Auf seiner Stirn prangte ein schlampiger Verband und Vioric sah auf der Brust tiefviolette Blutergüsse. Der Mann trug nur eine lose blaue Leinenhose und war barfuß. Das spärliche Licht, das aus der Mansarde ins Treppenhaus fiel, lag wie Goldstaub auf seiner dunklen Haut. Die Trompete ließ er fast aufreizend in der linken Hand baumeln und sein Blick traf Vioric nur aus einem Auge. Das andere war halb zugeschwollen. Vioric starrte seinen neuen Nachbarn verblüfft an. Dieser betrachtete sein Instrument, als wäre es ein Kind, das einmal mehr für Ärger gesorgt hatte. »Ich bin zu laut, was?«
Vioric nickte. »Monsieur, ich weiß zwar nichts von Trompeten, aber ich gehe davon aus, dass man sie nicht leise spielen kann. Zumindest nicht so leise, dass andere Leute währenddessen ein Stockwerk drunter schlafen können.«
»Sie wollen schlafen?« Der Mann sah ihn an, als hätte Vioric ihm gerade von einem seltenen, schrecklichen Laster berichtet.
»Es ist halb drei. Was denken Sie denn, was ich um diese Uhrzeit will?«
»Tanzen. Lieben. Vielleicht beides?«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Monsieur …?«
Der Mann lächelte Vioric entschuldigend zu.
»Sie können mich Jean nennen. Ich bin alles, aber gewiss kein Monsieur.«
Jean, der alles, aber kein Monsieur war, öffnete die Tür noch weiter und gestattete Vioric einen Blick in das schummrig beleuchtete Mansardenzimmer. Auf den ersten Blick sah er mehrere übereinanderlappende Teppiche, einen Sessel, ein schmales Eisenbett, Notenstapel und noch drei weitere dieser blechernen Ungeheuer, die aus aufgeklappten Lederkoffern blitzten. Vioric war entwaffnet. Was nicht nur an den Blessuren seines Nachbarn lag, sondern auch daran, dass er ihn an einen jungen surrealistischen Dichter erinnerte, den Vioric im letzten Winter kennengelernt hatte. Jean stellte mit Tönen ungefähr das an, was Louis Aragon mit Sprache gelang. Etwas Freches, Unerhörtes, das Vioric sich alt fühlen ließ, das ihn aber auch kitzelte und auf eine nicht unangenehme Weise provozierte.
»Haben Musiker keinen Proberaum oder etwas in der Art, wo sie spielen können, wann immer ihnen danach ist?« Vioric rieb sich die brennenden Augen.
Das Lächeln des Mannes verschwand. »Verschaffen Sie mir einen solchen, dann sind Sie mich los. Aber normalerweise stehe ich um diese Zeit ohnehin auf einer Bühne. Aber nicht so.« Er deutete auf seine Verletzungen.
»Was genau ist Ihnen zugestoßen?« Viorics geschultes Auge verriet ihm, dass die Prügel, die der Mann eingesteckt hatte, nicht von einer gewöhnlichen Kneipenschlägerei stammten. Die Verletzungen sahen brutal und gezielt aus. Etwas Gehetztes und zugleich Verstohlenes war in den Blick des jungen Mannes getreten, als er an Vioric vorbei ins Treppenhaus spähte. Sein unversehrtes Auge verengte sich. »Sind Sie von der Polizei?«
»Ich bin einfach nur ein Nachbar, der versucht, freundlich zu sein.« Vioric hob ergeben die Hände, aber er fühlte sich ertappt. Jean starrte ihn an. Das Lächeln kehrte nicht zurück. Vioric ließ die Arme sinken.
»Sie haben Recht. Ich war früher bei der Polizei.«
Jean senkte den Blick. Seine Finger strichen geistesabwesend über das Mundrohr seiner Trompete.
»Wissen Sie, die Leute hier sind nachts meistens außer Haus«, sagte er.
»Ich wusste nicht, dass jemand hier ist, den die Musik stören könnte. Ich werde den Dämpfer nehmen. Dann können Sie schlafen.«
Vioric betrachtete seinen Nachbarn nachdenklich. »Wissen Sie, so müde bin ich eigentlich gar nicht mehr.«
Das war gelogen, aber die Vorstellung, nun wirklich ungestört in seinem Bett zu liegen, erfüllte Vioric mit Unruhe und Widerwillen. Die Stille würde sich einmal mehr mit den Erinnerungen an die letzten vier Monate füllen, an Antibes und an Nicolette. Immer wieder: Nicolette. Er müsste sich erneut fragen, warum er es nicht geschafft hatte, sie anzusprechen. Sich ihr auch nur zu nähern. Er hätte nur von dieser Bank am Hafen aufstehen und Nicolette auf sich aufmerksam machen müssen. Allerdings hätte er dann auch diesem jungen und unzweifelhaft gut aussehenden Arzt in die Augen blicken müssen, der sie sonntags über die Mole spazieren führte. Vioric hatte Nicolette nur mit klopfendem Herzen hinterhergesehen, unentschlossen wie Nieselregen. Vier Monate lang hatte er sich gefühlt wie die unansehnliche Vase, die in seiner Pension auf der alten Kommode gestanden hatte – so gänzlich von feinen Rissen durchzogen, dass es ihm unmöglich gewesen war, sie fester anzupacken oder irgendetwas an ihrem Standort zu ändern, ohne sie vollkommen zu zerstören. Aber dann war ihm klar geworden, dass Nicolette nur der äußere Anlass war, seinem Leben in Paris auf dieser Hafenbank in Antibes eine längere Pause zu verordnen. Er hatte in den vergangenen Jahren nicht nur von Nicolette geträumt und sich immer wieder Vorwürfe wegen ihrer dramatischen Trennung gemacht. Nein, es waren auch die salzigen Gerüche dort am Hafen, das gleichmütige Lachen der Möwen und die Monotonie des Meeres, nach der er sich gesehnt hatte. Nach dem weichen Licht an der Küste. Andere Leute fuhren in die Berge, um zur Ruhe zu kommen. Und in dieser Ruhe am Hafen war Vioric allmählich etwas klar geworden. Er brauchte seine garstige, prächtige, aufreibende Großstadt. Er sehnte sich nach Paris wie nach einer anspruchsvollen und launischen Geliebten. Und er gestand sich ein, dass ihm das Leben, das er Nicolette damals vor seiner Beförderung an die Préfecture versprochen hatte, nun unerträglich eintönig erschienen wäre. Er folgte ihr mit seinen Blicken und sah sich in der Gestalt des jungen Arztes. Dort ging die Antwort auf seine nagende Frage, ob seine Liebe zu Nicolette in Wirklichkeit die nie endende Sehnsucht nach einem Glück war, für das er nicht gemacht war. Er war nicht dieser Mann, der am Sonntag eine Frau spazieren führte und diese Einsicht hatte ihn der kalte Hafen von Antibes gelehrt. Auch der Beginn des Frühlings, als die Luft seidig wurde und die Nebel das Meer aus ihrem winterlichen Gewicht entließen, hatte an seinem Entschluss nichts geändert.
Und so war Julien Vioric vor ein paar Tagen nicht ganz aus freien Stücken nach Paris zurückgekehrt, sondern weil dieser prachtvolle Moloch der einzige Ort war, an den er aus Antibes hatte fliehen können.
Vioric deutete auf die Blutergüsse am Oberkörper seines neuen Nachbarn. »Wer hat Ihnen die verpasst?«
Jean verzog das Gesicht. »Was kümmert es Sie?«
Vioric lächelte beschwichtigend. »Reiner Eigennutz. Je unversehrter Sie sind, desto ruhiger ist es im Haus, nicht wahr? Nichts für ungut.«
Jean befühlte seinen Unterkiefer. »Ich kann von Glück sagen, dass die Schweine mir nicht den Kiefer gebrochen haben, sonst könnte ich womöglich nie wieder spielen. Hören Sie, Monsieur …« Vioric winkte ab.
»Bitte, nennen Sie mich Julien.«
»Was machen Sie überhaupt in einem Haus wie diesem? Ein ehemaliger Polizist?«
»Ein Freund hat mir die Wohnung im dritten Stock anempfohlen, um genau zu sein …«
Julien Vioric dachte an seinen alten Freund und Kollegen Lieutenant Paul Tusson, der sich vor amüsierter Schadenfreude sicherlich gekrümmt hätte, wäre er Zeuge dieser Szene geworden. Tusson, der in den vergangenen Jahren vergeblich versucht hatte, Vioric mitzureißen in das ach so legendäre Pariser Nachtleben. Aber Vioric fühlte sich nicht in der Lage, von einer Champagner-Welle umspült in die Sorglosigkeit zu planschen, wie Tusson es ausdrückte. Dabei schien gerade alle Welt nach Paris zu strömen, um sich in einem geschmeidigen Tanz aus Alkohol und Freizügigkeit den Krieg und seine Nachwirkungen aus den Knochen zu schwitzen, und dieses heilsame Fieber heizte den Tanzenden jede Nacht gehörig ein. Vor allem die zehntausend liberalen Amerikaner, die vor der Prohibition nach Paris geflohen waren, wollten unterhalten werden.
Tusson war den Nächten zwischen Jazz-Lokalen, Bordellen, Tanz-Revuen und Boxclubs geradezu verfallen und behauptete, längst wieder friedlich schlafen zu können, falls er denn dazu kam. Er hatte nie verstanden, warum Vioric sich nicht ebenfalls dieser speziellen Pariser Kur anvertraute, die dem Tod ins Gesicht lachte. Aber Vioric wollte dem Tod überhaupt nicht trotzen. Er fühlte sich schlicht nicht berechtigt, ein unbeschwertes Leben zu führen. Es gab Dinge im Leben, die verspielte man und bekam sie nicht zurück. So wie Nicolette. So wie diesen einen unbeschwerten Sommer in Antibes vor langer Zeit. Aber als sie ihn nach dem schrecklichen Unfall am meisten gebraucht hätte, hatte er sie tot geglaubt und dann war der Krieg ausgebrochen. Und in den Schützengräben hatte er sie aufgegeben, weil er sich im Angesicht des allgegenwärtigen Todes nicht ausmalen konnte, dass Nicolette den Unfall überlebt hatte. Er hatte sie verraten, und dann war sie ohne ihn genesen und nun hakte sich jeden Sonntag dieser Arzt bei ihr ein und nicht etwa Julien. Erneut rieb er sich die geröteten Augen und seufzte innerlich. Nein, er hatte das Recht auf Liebe verspielt, und die Zerstreuung in irgendeinem famosen Jazzclub oder sonst eine Vergnügung würde ihm diese Tatsache nur umso schmerzhafter bewusst machen.
Für einen kurzen Moment bereute er es nun doch, dass er nach Paris zurückgekommen war, anstatt einen Dampfer in ferne, aber doch französische Welten zu besteigen. Indochina zum Beispiel oder die Karibik. Irgendwohin, wo ein geschlagener Feigling wie er nicht weiter auffiel. Aber dann hatte Paris ihn doch wieder aufgesogen.
Seit drei Tagen übte er sich nun schon in nichts anderem als in der alten Kunst des Flanierens. Paul Tusson hatte ihm eine übergangsweise Behausung ausgerechnet in der Rue Chaptal am Fuß des Montmartre beschafft.
Ganz in der Nähe befand sich das Casino de Paris, dessen Klientel und Künstler den Ton der Gegend angaben. An jeder Ecke stieß man auf Jazzclubs und die Nachbarschaft bestand vornehmlich aus Schwarzen Amerikanern oder Leuten aus den Kolonien und sie alle schienen die Lokale, Clubs und größeren Bühnen mit jener Musik zu beliefern, die die Pariser zu hören nicht müde wurden: mit Jazz. Vioric konnte mit dieser Musikrichtung nichts anfangen, verstand aber durchaus, was die Leute daran liebten. Es war eine kühne, ungezügelte und vor allem uneuropäische Musik, neu und aufreizend und in allen Köpfen und allen Beinen.
Tusson hatte bei der Empfehlung der freien Wohnung dieses verschmitzte Grinsen auf dem Gesicht gehabt, das Vioric eigentlich hätte verraten können, dass ein Hintergedanke seinen Freund amüsierte. Der gerissene Kerl hatte genau gewusst, dass Vioric bei dieser Nachbarschaft dem süßen Leben ausgeliefert wäre. Ob er auch von Jean gewusst hatte? Der sah ihn noch immer entschuldigend an, grinste inzwischen aber auch leicht erheitert. Offenbar wirkte Vioric ein wenig verloren in diesem Viertel.
»Julien, wenn ich wiederhergestellt bin, kommen Sie einfach mal zu einem meiner Auftritte, und dann verstehen Sie den Jazz schon ganz von selbst …«
»In Ordnung«, nickte Vioric.
»Ich nehme Sie beim Wort, Julien.« Jean zögerte, als fiele ihm noch etwas ein. »Warum sind Sie denn nicht mehr bei der Polizei?«
Viorics schluckte die aufkommende Bitterkeit in seiner Kehle herunter und lächelte die Frage einfach weg. »Gute Nacht, Jean. Auf gute Nachbarschaft.«
Kurz darauf lag er wieder in seinem Bett und lauschte in die Nacht. Auf der Straße war es still. Im Haus ertönte kein Laut. Plötzlich tat es ihm leid, dass er Jean nicht mehr hören konnte. Was war schon sein hohler Schlaf gegen die Leidenschaft dieses jungen Musikers? Vioric rollte sich seitlich zusammen. Doch sein Kopf wollte keine Ruhe geben. Die üblichen Bilder drängten sich ihm auf. Antibes. Das erbarmungslose Wintermeer. Nicolette. Einmal war sie sogar so dicht an ihm vorbeigelaufen, dass er ihren Geruch auffangen konnte. Ein Geruch nach Bergamotte. Aber Vioric war den letzten Schritt nicht gegangen. Denn Nicolette sah glücklich aus, wie sie mit ihrem Arzt an ihrer Seite über den Hafen flaniert war. Die Brise hatte ihr leises Lachen bis zu ihm herübergetrieben, und als sie ihren Kopf an seine Schulter gelegt hatte, ganz kurz, war irgendwo in seinem vom Grübeln wunden Gehirn ein Draht durchgeglüht, so wie sich der Schmerz auch jetzt wieder durch seinen Schädel bohrte. Die Trompete ertönte, doch dieses Mal war es ein leiser, warmer und tiefer Ton, der wie ein sanftes Wort bis in seine Wohnung fiel, direkt in seine Schlaflosigkeit hinein. Die raunende Melodie besänftigte Vioric augenblicklich, und er schloss die Augen. Jeans Wiegenlied verfehlte seine Wirkung nicht.
2
9. Mai 1925, Rue Chaptal, sehr früh am Morgen
Das Hämmern an seiner Tür riss ihn aus dem Tiefschlaf. Es war immer noch dunkel. Vielleicht ein paar betrunkene Heimkehrer, die sich im Stockwerk geirrt hatten. Vioric drehte sich auf die andere Seite und dämmerte wieder zurück ins wohlige Schwarz. Nur ganz langsam drang dieses eine Wort zu ihm hindurch, das Vioric selbst schon so oft gegen irgendwelche Türen gebellt hatte, ebenfalls gerne nachts. »Polizei!«
Er taumelte, als er aufstand und sich hastig ein Hemd überzog. Ein alter Reflex aus früheren Zeiten ließ ihn glauben, dass man ihn aus dem Bett holte, um ihm zu sagen, dass es irgendwo einen Mord gegeben hatte. Aber er war kein Lieutenant mehr, und sein Herz hämmerte ungute Ahnungen in seine Gedanken. Er öffnete die Tür und sah sich zwei Männern in Uniform gegenüber. »Julien Vioric?«, fragte der eine, sein Gesicht so gefühllos wie eine Gewehrmündung.
»Wer will das wissen?«
»Mitkommen!«, befahl der andere. Vioric atmete tief ein und steckte sich sorgfältig das Hemd in die Hose.
»Nicht, solange Sie reden, als würden Sie ein Telegramm aufgeben. Was wollen Sie von mir?«
»Das erfahren Sie noch rechtzeitig«, schnarrte es ihm entgegen.
Seine Ungläubigkeit über diese absurde Situation entlud sich in einem Lachen, das selbst Vioric überraschte. »Also bitte, Messieurs, Sie führen sich ja auf wie eine Karikatur, die manch einer von der Pariser Polizei im Sinn hat. Ich lasse mich meinetwegen verhaften, aber dann nennen Sie mir doch wenigstens den Grund!«
Die wie aus Seife geschnitzten Gesichter der beiden zeigten keine Regung und Vioric war versucht zu glauben, dass diese Begegnung nur ein Albtraum war, den sein Gehirn ihm anbot, um endlich aufzuwachen. Zwei menschenähnliche Hüllen, die ihm eine Groteske seines alten Lebens vorführten. Aber die Szene gewann an Plastizität, als der eine Polizist dicht vor ihn trat und ihm mit seinem schwindelerregenden Zwiebelatem eine weitere Einsilbigkeit entgegen bellte. »Mitkommen, hab’ ich gesagt!«
Vioric rührte sich nicht. Der andere Polizist hob beschwichtigend die Hände. »Sie sind nicht verhaftet, Monsieur Vioric. Mehr dürfen wir Ihnen aber nicht sagen. Order von allerhöchster Stelle.« Er hob bedeutsam die Augenbrauen.
Mit der allerhöchsten Stelle konnte nur der Polizeipräfekt gemeint sein. Edouard Vioric. Juliens Bruder. Aber wie war das möglich? Er hatte außer Paul Tusson niemandem gesagt, dass er nach Paris zurückgekehrt war.
Schweigend zog er sich Schuhe und Mantel an. Unwillkürlich tastete er nach seinen Handschuhen, deren weiches Leder ihm tief in seiner Manteltasche selbst während der wärmeren Monate Trost spendete, wenn es zu heiß war, sie sich überzuziehen. Er ging den Polizisten voraus die Treppe hinunter. Vor dem Haus parkte ein schwarzer Kastenwagen, wie für den Transport eines Gefangenen. Es hatte geregnet und die Nacht hing wie ein frisch gewaschenes Laken zwischen den Häusern. Vioric stieg in den Wagen und verfluchte den Keim der Neugier, der in seinem Inneren die ersten Triebe entrollte. »Wohin geht die Reise?«, fragte er, bevor er einstieg.
»Père Lachaise.«
»Ist jemand gestorben?«
Als Antwort wurde die Tür hinter ihm zugeknallt.
Vioric stellte sich auf eine lange Fahrt ein. Er starrte durch das vergitterte Seitenfenster des Wagens hinaus in die Nacht, an deren Rändern bereits der Morgen leckte, und versuchte, sich einen Reim auf das Ganze zu machen.
Im zwanzigsten Arrondissement angekommen, bog der Wagen auf den Boulevard de Ménilmontant ein und hielt vor der Porte du Repos, einem kleinen Seitenzugang des Friedhofs, wo die beiden Polizisten Vioric schweigend aussteigen ließen. Er blieb kurz stehen und genoss den fragilen Zauber, der so nur über Paris liegen konnte. Das Dunkel verdämmerte bereits zu einem silbrigen Zwielicht, während die Straßenlaternen noch immer ihr rötliches Licht über die Wirklichkeit legten. Mit dieser Ungewissheit der letzten Stunde vor Tagesanbruch hier in der Stadt konnte Antibes schlicht nicht mithalten. Etwas schepperte. Vioric lächelte. Ihn hatte schon immer gewundert, dass in diesem frühen Morgengrauen stets irgendwo ein Mülltonnendeckel klapperte. Die Stille war greifbar, aber nie vollkommen. Seine beiden wortkargen Begleiter führten Vioric ein kleines Stück in das dicht mit Bäumen bewachsene Gelände hinein, ehe sie in eine westlich verlaufende Gasse einbogen. In den Ästen zwitscherten verschlafen die ersten Vögel und ein Fuchs huschte vor ihnen zwischen den Gräbern hindurch ins Gebüsch. Vioric fröstelte ein wenig in der Frische des Morgens. Die monumentalen Gräber am Rand des Weges lagen da wie stille, kleine Paläste. In der Luft hing der Geruch immergrüner Pflanzen und die ewigen Lichter, die vor den Grabstätten züngelten, ließen das Pflaster feucht schimmern. Von den Treppenstufen, die zwischen den Gräbern hindurchführten, blitzten ihn die Augen regloser Katzen an. Der Friedhof präsentierte sich den drei Männern wie eine verwunschen daliegende Welt, die sich unter den immer heller werdenden Himmel duckte, als wollte sie die Dunkelheit nicht loslassen.
Die beiden Polizisten bogen abrupt links auf einen schmaleren Weg ab und Vioric stolperte, während er noch in seinem letzten Gedanken festhing.
In einiger Entfernung standen mehrere Gardiens zusammen. Lichtkegel durchkreuzten das Dämmerlicht. Leises Murmeln war zu hören. Vioric strengte seine Augen gegen die Lichter der Taschenlampen an, die das eben noch so sanfte Zwielicht zerhackten. Und dann sah er, um welches Monument auf diesem an Monumenten so überreichen Friedhof das Taschenlampenlicht so hektisch zuckte. Im steinernen Wald der Grabstätten, von zwei schmalen Treppen von seinen Nachbarn getrennt, erhob sich der helle Stein einer letzten Ruhestätte, die wie kaum eine andere auf dem Père Lachaise für das große Erbe Frankreichs stand.
Frédéric Chopin.
Der Name war über einem Marmorrelief des Komponisten in den Stein gemeißelt, der nun fast silbrig leuchtete, und wurde von der Statue einer in ewiger Melancholie gebannten Frau bewacht. Eine steinerne Zeugin der Trauer, die größer zu sein schien als der Stolz, dass ein Genius wie Chopin unter den Menschen gelebt hatte. Das grelle Licht erfasste die seltsam entsättigten Farben von Blumengebinden und Sträußen, die rings um das Grab gegen das verschnörkelte Eisengitter gelehnt waren. Die grellen Taschenlampen ließen die welkenden Blumen frisch erscheinen und dieser befremdliche Kontrast beschäftigte Viorics Gedanken wie ein Hinauszögern des endgültigen Erkennens.
Denn zu eindeutig war die Form des kleinen Grauens, das unter dem Eisengitter den Blumen ein blutiges Rot beimischte.
Auf der Stufe vor dem Grabmal lag ein menschliches Herz.
Der Lichtstrahl einer weiteren Taschenlampe richtete sich nun auf das Grab.
Vioric griff in seine Manteltasche und hielt sich an seinen Handschuhen fest. Vor seinem inneren Auge tauchten die flachen Stufen zum Théâtre des Champs-Élysées auf. Auf einer der Stufen lag ein Herz, ohne eine zusätzliche Nachricht oder sonst etwas, das das Grauen hätte erklären können. Das musste vor rund zwölf Jahren gewesen sein, und Vioric war es damals nicht gelungen, den Fall zu lösen.
Nur widerwillig gab sein Verstand die Erinnerung an jenes andere Herz frei, aber schließlich überlagerte dieses alte Bild den Anblick des Herzens, das vor ihm lag. Vioric blinzelte und zwang die Erinnerung zurück. Vor dem Grabmal wirkte es wie eine Opfergabe. Doch beim näheren Betrachten erinnerte es Vioric eher an ein verstörendes Detail aus der Leichenhalle. Die großen Adern, die es einmal mit einem Körper verbunden hatten, waren teilweise nicht sauber durchtrennt worden, das konnte Vioric auch ohne Expertise aus der Pathologie erkennen. Er atmete tief aus.
Ein weiteres altes Bild zuckte durch sein Inneres, untrennbar verwoben mit seinem damaligen Fund. Ein Smaragdohrring in der Hand einer bleichen Frau, die ihm wüste Beschimpfungen an den Kopf warf.
Jemand berührte Vioric am Arm. Ein Polizist bedeutete ihm, ihm zu folgen. Er begleitete den Mann einige Minuten durch die steinernen Pfade des Friedhofs. Der Kies unter ihren Schuhen knirschte leise. In der Luft lag der Geruch von erwachenden Pflanzen. An einer Weggabelung entdeckte Vioric ein Stück entfernt auf einer der Zufahrtsstraßen die Umrisse eines Fahrzeugs im Zwielicht. Er ahnte, wer ihn dort erwartete. Er nahm erneut einen tiefen Atemzug, aber die kühle Mailuft konnte die schlagartige Müdigkeit nicht vertreiben. Im Gehen nestelte er seine Handschuhe aus den Manteltaschen und vertraute seine Finger dem beruhigenden Gefühl an, darin eingeschlossen zu sein. Augenblicklich fühlte er sich dem, was kommen mochte, gewachsen. Langsam ging er dem Automobil entgegen und korrigierte sich in Gedanken. Es war keine Müdigkeit, die plötzlich in seinen Adern schwamm, sondern Widerwillen. Es kam ihm vor, als würde sich eine unangenehme Geschichte, die er vier Monate lang beiseitegelegt hatte, nun wieder vor ihm öffnen und ihn zwingen, mit der Lektüre fortzufahren.
An der Avenue Principale, dem westlichen Zufahrtsweg zum Friedhof, parkte ein schwarzer Peugeot 174 unter den Bäumen. Vor der geöffneten Seitentür hatte jemand einen kleinen Tisch und einen Klappstuhl gestellt. Ein älterer Polizist, den Vioric als den langjährigen Assistenten seines Bruders erkannte, holte eben einen Korb aus dem Kofferraum des Wagens und stellte zwei Tassen auf das Tischchen. In diesem Moment entdeckte Vioric auch die markante Silhouette Edouards auf der Rückbank. Dieser winkte ihm durch die offene Tür zu.
»Lust auf ein Frühstück?«, fragte Edouard und schwang die Füße aus dem Wagen, bevor er sie mit einem zufriedenen Seufzen unter dem Klapptisch ausstreckte. Er griff nach einer blütenweißen Serviette und steckte sie sorgfältig in seinen Kragen. »Du hast ein ganz schönes Hungerleidergesicht bekommen, mein Lieber. Hat dir Nicolette nichts zu essen gegeben? Ach, ich vergaß, sie ist ja blind.« Er grinste breit, entzückt über seinen eigenen Scherz. Vioric erstarrte. Hatte er wirklich geglaubt, sein Bruder ließe ihn den Polizeidienst quittieren und mir nichts dir nichts von dannen ziehen? Die Dinge, die er wusste, machten ihn gefährlich für den Pariser Polizeipräfekten. Die Vorstellung, dass Edouard nun von der blinden jungen Frau und ihrer Geschichte wusste, war ihm unerträglich.
Edouard machte eine gönnerhafte, einladende Geste. »Willst du dich nicht setzen, Julien?«
»Findest du diesen Ort passend für ein Frühstück?« Vioric beobachtete den Assistenten beim Eingießen des Kaffees aus einer Isolierkanne, die in Vioric unangenehme Erinnerungen an die Frühstücke an der Front wachrief. Die unbewegte Miene des Assistenten ließ nicht darauf schließen, was er von dieser Situation hielt.
»Der Friedhof ist für die nächsten Stunden abgeriegelt«, sagte Edouard. »Weder wird irgendjemand dieses herausgerissene Herz sehen noch meinen Appetit.«
Er schnitt ein Stück Baguette auf und musterte Julien mit verhaltenem Grinsen.
»Ich hoffe, du hast dich in deinem Urlaub gut genug erholt, um nun gegen den Irren anzutreten, der sich diesen schlechten Scherz erlaubt hat.«
»Urlaub«, echote Julien perplex. »Edouard, ich habe gekündigt. Ich bin kein Lieutenant mehr und du bist nicht länger mein Vorgesetzter.«
Der Polizeipräfekt schüttelte nachsichtig den Kopf. »Du warst immer schon ein ausgezeichneter Polizist, Julien, daran habe ich nie gezweifelt. Dir fehlt nur das … Fingerspitzengefühl für gesellschaftliche Belange, das man für höhere Weihen benötigt.«
Edouard beugte sich vor und taxierte seinen Bruder mit einem Fuchslächeln. Seine Glatze glänzte wie frisch poliertes Holz und er strahlte trotz all der Schuld, die er sich am Ende des vergangenen Jahres auf sich geladen hatte, immer noch eine federnde Entschlossenheit aus, um die Julien seinen Bruder früher beneidet hatte. Jetzt machte ihm diese energische Kraft beinahe Angst. Er hatte erlebt, zu welcher Skrupellosigkeit Edouard im Stande war und er hatte es während der Zeit in Antibes nicht vergessen.
»Ich finde, du kannst mir dankbar sein, Julien. Vier Monate auf einer einsamen Bank am Hafen in diesem Fischerdorf waren genug. Es wird Zeit, dass du wieder deiner Berufung nachgehst. Und deinem Beruf.« Edouard zückte ein Taschentuch und näherte sich damit beiläufig einem Fleck in der Scheibe der Wagentür, was den Assistenten zu einem nervösen Hüsteln veranlasste.
Vioric grub die Fingernägel in seine Handflächen. »Ich komme nicht mehr zurück, Edouard.« Er begann trotz Morgenkühle zu schwitzen. Er dachte an Jean, und an die Menschen, die das Ideal der Freiheit völlig zu Unrecht genossen. Er ließ seine Hände in die Taschen seines Mantels wandern und bewegte die Finger in den Lederhandschuhen. Und diese Berührung verknüpfte etwas in ihm mit einem anderen Gefühl, dass er liebte und hasste.
Er hasste es, dass da draußen Menschen waren, die anderen Menschen das Herz heraustrennten und vor einem Denkmal ablegten. Er hasste die Mächte, die damit beschworen wurden. Aber er liebte das Wissen, dass er imstande war, diese Mächte zu unterwerfen. Vioric ließ seinen Blick in die Dämmerung zwischen den Gräbern gleiten. Er wünschte, er hätte nicht vier Monate gebraucht, um sich darüber klar zu werden, dass er nichts anderes sein wollte als ein guter Polizist und nicht mehr.
Edouards süffisantem Schmunzeln sah er an, dass sein Bruder seinen Triumph, ihn besser zu kennen, genüsslich auskostete.
Über ihnen lachte eine Amsel und Edouard stimmte mit ein. Er deutete in die Richtung, in der das Chopin-Grab lag.
»Wir wissen beide, wie sehr es dich drängt, den Fall zu lösen, Julien, und, um ehrlich zu sein, ich kennen keinen, der dafür besser geeignet wäre. Du stehst mit sofortiger Wirkung wieder im Dienst der Préfecture.« Er winkte ab und biss in sein Baguette. »Danken kannst du mir später«, sagte er kauend. »Womöglich gelingt es dir, das Schlamassel von 1913 gleich mit aufzulösen, wer weiß?«
Julien spürte, wie etwas nach ihm griff, gegen das er sich kaum wehren konnte. Er starrte auf Edouards Revers, an dem es schwach glitzerte. Julien kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können.
Erst jetzt erkannte er, dass sein Bruder den Offiziers-Orden der Ehrenlegion trug. Er hatte ihn für besondere Tapferkeit im Krieg von der Légion d’Honneur verliehen bekommen. Vioric versuchte mit aller Macht die altbekannte Scham zurückzudrängen, die in seinem Hals aufstieg. Er selbst war als gebrochenes Nichts von der Front zurückgekehrt, während sein Bruder geschliffen und gestählt ein halbes Jahr nach Kriegsende zum Präfekten befördert worden war. Diese kleine, silbrig schimmernde Kreuz mit der Rosette an dem roten Seidenband hatte Edouard für die von ihm so begehrten höheren Weihen geradezu prädestiniert. Dass er es heute Morgen mit der Beiläufigkeit eines eingesteckten Taschentuchs trug, kam Vioric seltsam vor. Sah Edouard sich genötigt, der Umwelt seine Verdienste im Krieg in Erinnerung zu rufen? War der desaströse Maldoror-Fall im vergangenen Winter doch nicht spurlos an seinem Bruder vorübergegangen?
«Julien?« Edouards Frage hatte einen scharfen Unterton bekommen. Er warf einen Blick auf seine Taschenuhr.
Julien sah ihn nicht an. »Du kennst meine Antwort«, knirschte es kaum hörbar zwischen seinen Lippen hervor.
Edouard nickte knapp, ohne eine Miene zu verziehen.
Die schlaflose Nacht, sein leerer Magen und der Sog, der ihn zurück in seine alte Welt riss, ließen Julien schwindeln. Er musste sich an der Wagentür abstützen.
»Offengestanden ging die gesamte Préfecture davon aus, dass du dich wieder zeigen würdest, Bruder«, fuhr Edouard fort. »Ich habe gehört, du hast dir eine kleine Wohnung am Montmartre gesucht. Wie viel Miete zahlt dir der Kerl für deine alte Wohnung in der Rue de l’Abbaye?«
Julien brachte kein Wort hervor. Edouards wasserheller Blick ruhte amüsiert auf ihm, während sein Assistent bereits wieder das Geschirr abräumte. »Davon wolltest du nicht ernsthaft dein zukünftiges Leben bestreiten, oder? In Antibes hätte das vielleicht noch gereicht, meinetwegen, aber für ein anständiges Leben in Paris …«
Julien Vioric beobachtete eine Maus, die aus dem Gebüsch bei den Gräbern hervorgehuscht war und direkt unter Edouards Füßen die Baguette-Krümel aufsammelte. Edouard hatte Recht. Seine Gedanken wanderten in die Vergangenheit. Die Erinnerung an den einzigen ungelösten Fall seiner Karriere vor zwölf Jahren war fest eingeschlossen unter dem Geröll der Dinge, die sich danach ereignet hatten. Aber der Anblick des Herzens vor dem Chopin-Grabmal hatte sie wieder aufsteigen lassen wie eine Wasserleiche in der Seine.
Edouard lehnte sich seitlich gegen die Wagenpolster und reinigte seine Zähne mit der Zunge. Ein zufriedenes Raubtier, dachte Julien. Zwischen den Bäumen bahnte sich das Licht der aufgehenden Sonne den Weg bis zu Edouards Orden der Ehrenlegion, der nun schwach silbrig aufblitzte.
»Du wirst mir wohl zustimmen, dass dieses Stück Muskelgewebe höchstwahrscheinlich deswegen auf Chopins Grab liegt, weil du damals nicht in der Lage gewesen bist, aufzuklären, was es mit dem Herz am Théâtre des Champs-Élysées auf sich hatte.«
Noch während Edouard die letzten Worte aussprach, blickte Julien auf. Seine Augen brannten vor Müdigkeit und er schluckte die Spitze, die Edouard ihm entgegengeschleudert hatte, wortlos hinunter. Nicht, weil er glaubte, dass sein Bruder recht hatte. Aber er wollte ihm keine weitere Angriffsfläche mehr bieten. Es war schlimm genug, dass er überhaupt dieses Hadern verspürte, wieder in den Polizeidienst einzutreten, weil er damit Edouard gleichzeitig etwas gab, was dieser von ihm wollte und siegesgewiss wusste, dass er es auch bekam.
Vioric unterdrückte ein Gähnen. »Wir waren uns damals einig, dass das Herz am Théâtre des Champs-Élysées mit dem Skandal um diese Ballett-Premiere zusammenhing.«
»Le sacre du printemps von Strawinsky«, flocht Edouard ein.
Vioric nickte. Ihm war der Name des Balletts tatsächlich entfallen.
»Wir haben den Fund des Herzens mit dem immensen Skandal in Verbindung gebracht, den diese Premiere ausgelöst hat. Die Leute sind damals ja regelrecht durchgedreht. Aber dieses Herz hier«, Vioric deutete hinter sich in die immer heller werdende Allee, »ist vielleicht nur irgendeine harmlose, wenn auch makabre Anspielung auf Frédéric Chopin.«
»Warum?«
»Das Herz Chopins liegt in Warschau.«
Edouard hob die Augenbrauen. »Ach, tatsächlich?«
»Chopin hatte Angst, dass er lebendig begraben werden könnte. Daher verfügte er in seinem Testament, dass sein Körper nach seinem Tod geöffnet werden sollte. Bei dieser Gelegenheit ließ seine Schwester das Herz entnehmen, in Cognac einlegen und in Chopins Geburtsland zurückbringen, wo es in der Krypta einer Kirche aufbewahrt wird.«
Edouard klatschte sich auf den Oberschenkel. »Ich wusste, dass du der Richtige für diesen Fall bist!«
Julien schwieg. Natürlich hatte er dieselbe Befürchtung wie sein Bruder.
»Julien, nun tu nicht so bescheiden. Du weißt so gut wie ich, dass damals, als dieses Herz auf der Theatertreppe gefunden wurde, auch eine junge Frau verschwunden ist.«
Julien kniff sich in die Nasenwurzel. Den Namen dieser Frau hatte er sofort präsent. »Eugénie Forgée.«
Edouard nickte. »Die meines Wissens auch nicht wiederaufgetaucht ist. Weder in persona noch als Leiche, ob nun mit oder ohne Herz. Die Chopin-Episode mag ein geschmackloser Streich gewesen sein, aber …«
»In Paris verschwinden jeden Tag Menschen.« Vioric stieß sich vom Wagen ab und schaute die Allee hinunter. Die hellen Grabsteine leuchteten nun aprikosenfarben in der aufgehenden Sonne. »Es muss nicht unbedingt sein, dass diese verschwundene Frau etwas damit zu tun hat. Wir konnten das nie beweisen.«
Edouard starrte ihn verständnislos an. »Das mag sein. Aber dir wird nicht entgangen sein, dass gerade die halbe Welt zu Gast in Paris ist. Die kleine Weltausstellung rund um den Grand Palais. Ich muss dir nicht sagen, wie schädigend es für das Ansehen der Stadt ist, wenn herauskommt …«
»Du meinst so schädigend wie die drei Morde im vergangenen Dezember, die du einem Unschuldigen in die Schuhe geschoben hast, um Schaden vom Ansehen der Stadt abzuwenden?« Vioric konnte sich diesen Seitenhieb nicht verkneifen.
Edouard rückte mit einem kaltgepressten Lächeln die Krawatte zurecht. »Die Leute werden Fragen stellen. Vor allem die Familie von Eugénie Forgée.«
Julien Vioric hob abwehrend die Hände. »Du musst mich nicht weiter überzeugen.«
Edouard machte seinem Assistenten ein Zeichen, der rasch das Tischchen, den Stuhl und das wenige Geschirr im Kofferraum verstaute. Dann sah er seinen Bruder mit einem aufgeräumten Blick an.
»Du siehst müde aus, Julien. Schlaf dich erstmal aus, ehe du dich der Sache annimmst. Bevor wir keine Leiche finden, der dieses Herz gehört, ist das Ganze nicht so brisant, und die Öffentlichkeit weiß ja auch noch nichts von der Sache. Die Gerichtsmediziner sollen sich das Herz erst einmal anschauen, und dann sehen wir weiter. Du hörst von uns.«
Damit schob Edouard sich in die Mitte des Rücksitzes und winkte Julien noch einmal zu, ehe er die Tür schloss. »Wir sehen uns in der Préfecture, Lieutenant.«
3
Sieben Wochen zuvor
16. März 1925, Rue Pinel, vormittags
In dem Durchgang zu einem schäbigen Hinterhof bewegte sich eine überschaubare aber eng gedrängte Menschenmenge unter dem rötlichen Licht der Pendelleuchte, die wie ein erschrockener Mond mitten am Tag über den Köpfen hing. Weder die neu ankommenden Polizisten, die eben einem schwarzen Kastenwagen entstiegen waren, noch ein leichenblasser Hausmeister schafften es, die Menge zu zerstreuen, die für die Männer keinen Blick übrighatte. Aber selbst die Polizisten und der Concierge starrten immer wieder in die hintere Ecke, wo sich, wie in allen anderen Hinterhöfen von Paris und vermutlich der gesamten Welt, der Unrat bei den Mülltonnen türmte. Und zwischen diesem Unrat steckte der Körper einer toten Frau.
Im Hof ertönte immer wieder das Klicken der Kamera des Polizeifotografen. Die Köpfe der Menge folgten den unmöglichsten Winkeln, die ihnen erlaubten, die Leiche auch dann noch zu sehen, wenn der Fotograf den Blick versperrte.
Lysanne Magloire senkte den Kopf und griff sich in den Nacken. Sie hatte lange genug den Hals gereckt und auf den Zehenspitzen balanciert, um etwas zu sehen, dass sie eigentlich nicht sehen wollte. Doch ihre Freundin Héloïse Girard war noch näher an dem grauenvollen und zugleich traurigen Anblick der Toten gewesen. Eben drückte sie sich, von einem Polizisten nachdrücklich dazu aufgefordert, zurück zwischen die Menschen und neben Lysanne.
Der mittlerweile vertraute Anblick der Kamera um Héloïses Hals erinnerte Lysanne daran, dass sie und ihre Freundin im Gegensatz zu den Leuten ringsum einen Grund hatten, hier zu sein.
Héloïse stieß sie an und warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Sieh ganz genau hin, Lysanne. Damit du dich später, wenn du darüber schreibst, an alles erinnerst!«
Lysanne zwang sich dazu, das Ganze mit den professionellen Augen einer Journalistin zu sehen. Sie hatte in den letzten Monaten, seit denen sie in Paris wohnte, reichlich Erschreckendes und Endgültiges gesehen, und davor hatte das Grauen sie im Krieg, als sie sich in der sprachlosen Agonie dieser vier Jahre über die roten Abgründe der verwundeten Soldaten hatte beugen müssen, auch nicht geschont.
Doch Lysanne hatte nun das Bedürfnis, die junge leblose Frau gegen das Starren ringsum eher abzuschirmen, als sie mit ihren Worten nur noch weiter in die Öffentlichkeit zu zerren. Aber sie ließ sich nichts anmerken und zwang sich, jedes Detail in sich aufzunehmen
Die Frau steckte halb aufrecht zwischen den drei Blechtonnen an der gegenüberliegenden Hofwand. Jemand hatte dort ein altes Polster mit aufgerissenem Bezug abgelegt. Der überstreckte Kopf der Toten lag wie auf ein Ruhekissen gebettet. Ihre in befremdlicher Sinnlichkeit erstarrte Pose gab der Szenerie etwas seltsam Kunstvolles. Als wäre es das Gemälde einer dieser klassischen Schlafenden, die dem Betrachter neben ihrer Nacktheit auch ein üppiges Perlencollier präsentieren. Nur, dass in diesem Fall das Collier aus violetten Blutergüssen bestand. Die Haut der Frau hatte einen wächsernen, stumpfen Ton angenommen. Keiner der Polizisten machte sich die Mühe, die Blöße der Toten mit einem Tuch vor den Blicken der Leute zu schützen, die durch den Zugang in den Hinterhof starrten.
Es war noch früh am Vormittag und die Leiche der Frau war eben erst von dem Concierge des schäbigen Hinterhauses entdeckt worden. Zwischen den Köpfen der Neugierigen blickte Lysanne erneut auf die Tote.
Als einer der Uniformierten beiläufig an dem hellgrünen Seidenhöschen, dem einzigen Kleidungsstück der Frau, zupfte, schloss Lysanne die Augen. Einer der Umstehenden ließ ein anzügliches Grunzen hören. Lysanne musterte den Mann angewidert und sah gleich wieder weg, als er mit funkelnden Augen ihren Blick erwiderte. Abscheu und Traurigkeit erfüllten sie und zogen wie ein Gewicht an ihr, das sie zu Fall bringen wollte.
Neben ihr stieß Héloïse Girard einen Laut der Empörung aus.
»Schreib das auf«, forderte sie Lysanne mit lauter Stimme auf. »Schreib auf, wie unwürdig sie mit der armen Frau umgehen.«
Der Mann, der eben das anzügliche Geräusch gemacht hatte, lachte leise und gehässig.
Lysanne notierte die Beobachtungen in ihren kleinen Block mit dem silbernen Deckel und der Halterung für den edlen Drehbleistift, den Héloïse ihr als Willkommensgruß zu ihrem Einstand bei der Paris-Soir vor drei Monaten geschenkt hatte. Dieser große Tag schien eine Ewigkeit zurückzuliegen. Beim Gedanken an ihren ersten Arbeitstag empfand sie immer noch ein ehrfürchtiges Staunen. Vor vier Monaten noch ein Mädchen aus einem Vierhundertseelendorf, das ahnungslos nach Paris gestolpert kam, war sie nun Journalistin einer angesehenen neuen Tageszeitung. Bislang war ihre Arbeit an der Seite von Héloïse Girard jedoch unspektakulär, ja fast ein wenig eintönig gewesen. Héloïse hatte sie in den letzten Monaten mit diversen Techniken der Berichterstattung vertraut gemacht, ihr Schreibübungen aufgegeben und ihre Ungeduld, endlich eigene Artikel zu schreiben, damit vertröstet, dass es eben noch ein wenig dauern würde, bis Lysanne das Handwerk der Journalistin genügend beherrschte.
Doch nun hatte der Zufall sie zu diesem Hinterhof in der Rue Pinel geführt. Unweit des Place d’Italie hatten sie eigentlich ein Treffen mit einer amerikanischen Exilantin vereinbart, die durch ihren literarischen Salon und ihre offene Liebe zu Frauen von sich reden machte. Doch der Anblick der Leiche vor ihr ließ diesen angeblichen Skandal zu reiner Bedeutungslosigkeit schrumpfen, als würde das Leben im Angesicht eines so stillen und schäbigen Todes müde mit den Schultern zucken.
Ein Ellbogen traf Lysanne und beinahe wäre ihr der Stift aus der Hand gerutscht. Neben ihr blähte sich die Sensationslust eines weiteren Mannes, die ihn offenbar aus der benachbarten Schlachterei gelockt hatte. Er trug eine Schürze mit deutlichen Blutflecken, die ein wenig auf den hellblauen Mantel der vor ihm stehenden Frau abfärbten. Es kümmerte den Mann nicht weiter, der sogar die Ruhe hatte, sich inmitten reckender Hälse und schiebender Schultern eine Zigarette anzuzünden. Zumindest drängte das den Eisengeruch des Tierblutes auf seiner Schürze, der Lysanne regelrecht einhüllte, wieder etwas zurück. Den penetranten Schweiß eines übermüdeten Arbeiters hinter Lysanne konnte der Tabakrauch allerdings nicht vertreiben. Sie sehnte sich nach einem Glas Pastis, um die Eindrücke ringsum auf Abstand zu halten. Lysanne packte den Bleistift fester. In ihren Beinen breitete sich eine plötzliche Schwäche aus. Die wogenden Leiber hatten die Märzkühle aus dem Hofdurchgang vertrieben und in eine fast fiebrige Hitze verwandelt.
Héloïse stieß sie erneut an. »Was ist mit dir? Du bist ganz grau im Gesicht.«
Lysanne wollte abwinken und etwas sagen, aber die Worte verflüssigten sich bereits in ihrem Mund. Héloïse griff nach ihrem Handgelenk und bugsierte sie durch die Menge zurück auf das Trottoir. An der Hofzufahrt drückten sie sich an einem Polizisten vorbei, der an seine Uniformmütze tippte, als er Héloïse sah.
»Ach, bonjour Maxim.«
»Héloïse. Wie immer die Erste am Tatort? Ist mit deiner Freundin alles in Ordnung?« Der Polizist bedachte Lysanne mit einem besorgten Blick.
»Sie braucht nur etwas frische Luft«, sagte Héloïse. »Ich komme heute Mittag bei dir vorbei und stelle dir ein paar Fragen zum Tatort und der Toten. Dann haben wir mehr Ruhe.« Sie zwinkerte dem Polizisten zu
»Alles, was du willst, Mademoiselle Girard.«
Damit ließ er die beiden Frauen stehen und drängte weitere Schaulustige ab.
Dankbar sog Lysanne die frische Luft ein und entfernte sich ein paar Schritte von dem Gedränge, das selbst hier draußen vor dem Hofdurchgang noch immer weiter anzuwachsen schien.
Héloïse legte ihr die Hand auf die Schulter.
»Ach, Liebes, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, das ist deine erste Leiche, nicht wahr?«
»Meine erste Leiche als Journalistin«, präzisierte Lysanne. Héloïse nickte finster. »Und dann ist es gleich Mord. Die arme Mary-Anne Rose wurde erwürgt und zwischen Mülltonnen entsorgt. Ein grausames Ende.«
Lysanne sah ihre Freundin überrascht an. »Du weißt, wer sie ist?«
»Schätzchen, du doch auch.« Héloïse musterte sie amüsiert. »Wir müssen wirklich noch ein wenig an deiner Beobachtungsgabe arbeiten, wenn aus dir eine gute Journalistin werden soll. Wir haben diese junge Frau vor zwei Wochen im Moulin Rouge gesehen, erinnerst du dich nicht mehr?«
Stirnrunzelnd versuchte Lysanne, sich zu erinnern. Bilder an diesen Abend im Moulin Rouge tauchten langsam vor ihrem inneren Auge auf. Sie hatten für die Paris-Soir der Darbietung einer Revuesängerin beigewohnt, die wie ein Mann sang. So tief, dass Lysanne den Vollbart in ihrem Gesicht fast schon sehen konnte. Begleitet worden war die Dame von einem zwanzigköpfigen Ensemble. Die jungen, bildhübschen Frauen kamen aus der ganzen Welt – Java, Marokko, Karibik, Schweden und Russland. Eine von ihnen hatte eine kleine Sondereinlage und war im Programmblatt als Mary-Anne Rose aus New Orleans angekündigt worden.
»Hast du sie denn nicht wiedererkannt?«, fragte Héloïse. »Solche Muskeln hat nur eine Tänzerin. Und der kleine Silberring in ihrer linken Brustwarze? Komm schon, darüber hat das Publikum doch beinahe den Verstand verloren!«
Lysanne nickte. In Wahrheit erinnerte sie sich eigentlich nur noch an die vielen Cocktails, die ihr die Einzelheiten dieses Abends in scharf-süße Splitter zerteilt hatten. Héloïse hängte sich bei ihr ein und lotste sie in Richtung Place d’Italie.
»Tja, jetzt ist sie tot, die Arme, und ich garantiere dir etwas: Der Mord an ihr wird mit der Schlampigkeit behandelt, die Polizisten vorzugsweise bei Revue-Mädchen anwenden. Ich fresse meine Kamera, wenn die Herren Gardiens nicht insgeheim denken, dass eine wie sie auch genau da hingehört, wo man sie gerade gefunden hat. Es ist zum aus der Haut fahren.«
»Aber dafür haben wir ja die Paris-Soir«, sagte Lysanne. »Um den Pariser Lesern einen Sinn für institutionalisierte Ungerechtigkeit zu geben und mit ihnen gemeinsam an einer besseren Welt zu arbeiten.«
Héloïse fasste sie fester am Arm. »Du sagst es, meine Liebe! Wenn schon nicht die Herren Polizisten diesem Mädchen ihre Würde zurückzugeben gedenken, indem sie ihrem Mörder nachstellen, dann erledigen eben wir das.«
Lysanne warf ihr einen Seitenblick zu. Héloïses Samthut leuchtete in dem grauen Vormittag, als wollte er sich ersatzweise als Sonne anbieten.
»Du willst in dieser Sache eigene Ermittlungen anstellen?«
Héloïse machte eine unbestimmte Geste. »Wenn sich herausstellt, dass die Polizei den Hintern nicht hochbekommt, werden wir eigene Nachforschungen betreiben. Wir könnten die anderen Tänzerinnen aus Mary-Anne Roses Ensemble befragen.«
Je weiter sie sich von dem Gedränge in der Rue Pinel entfernten, desto leichter fiel Lysanne das Atmen. Dennoch empfand sie eine eigenartige Beklemmung tief in ihrer Brust.
Héloïse hakte sich bei ihr unter. »Gib zu, du hast dich schon begonnen zu langweilen!«
Lysanne lächelte zaghaft. »Du denkst hoffentlich nicht, dass ich regelmäßig eine Leiche brauche, um meine Arbeit als Journalistin genießen zu können.«
Héloïse stieß eine ihrer vogelhaft klingenden Lachsalven aus. »Genießen musst du unsere Arbeit nicht, nur gut machen. Der Genuss ist heute Abend wieder dran.«
Sie verfiel nun ins Schwärmen über einen irischen Schriftsteller, der derzeit en vogue war und ihnen heute auf einer Feier am Montparnasse begegnen würde. Lysanne atmete auf. Die bedrückende Enge zwischen den Schaulustigen und der Anblick der toten Tänzerin ging allmählich in der Szenerie der Straße auf, als wäre das Grauenvolle nur ein Riss im Alltag gewesen, neben dem das gewöhnliche Leben einfach weiterging. Ein Automobil knatterte um die Ecke. Drei Kinder in kurzen Hosen am Straßenrand ließen ihre Murmeln aus den Augen und sahen dem Wagen hinterher. Selbst inmitten des Häusermeers machte der Frühling sich bemerkbar. An den Bäumen Knospengeschehen, und die Leute hatten Blumentöpfe in die Fenster gestellt, und unter der Wolkendecke lag etwas undefinierbar Sanftes, das die strenge Winterluft abgelöst hatte. Auf den Köpfen der Frauen zeigten sich die ersten Frühlingshüte in hellen, frischen Farben.
Lysanne schüttelte den letzten Eindruck des eben Gesehenen ab und beschloss, Héloïse später zu der Besprechung mit dem Polizisten zu begleiten. Und anschließend dann eine Feier mit einem begehrten irischen Schriftsteller. Eine plötzliche innere Zufriedenheit ließ sie den kleinen Schwächeanfall und den Anflug von Entsetzen beinahe vergessen.
4
9. Mai 1925, Montmartre, in der Früh
Nach der unverhofften Richtung, die dieser Morgen genommen hatte, steuerte Lieutenant Vioric am Fuß des Montmartre eine kleine Boulangerie Ecke Rue de Clichy an, stürzte einen Kaffee noch am Tresen im Stehen hinunter und kaufte zwei Pains au chocolat. Auf dem Heimweg verzehrte er eines davon, gierig und zufrieden, als hätte er einen Sieg davongetragen. Er beschloss, nicht mehr an Edouards Beitrag zu diesem Gefühl zu denken und spürte der entschlossenen Freude in seinem Innern nach, seiner Bestimmung folgen zu können. Zudem würde der Fall ihm dabei helfen, die unangenehmen Erinnerungen an Antibes auf Abstand zu halten.
Der Morgen war mild, und fast meinte Vioric schon die Vorboten des Sommers in der Luft zu spüren. Nach den kühlen Ausdünstungen der Grabsteine kam ihm die im Morgenlicht liegende Häuserschlucht wie ein warmes Bad vor, das ihn innerlich auftaute.
Doch plötzlich mischte sich etwas Bitteres in sein Hochgefühl. Ein Mann, der neben einer Litfaßsäule stand, erinnerte Vioric unvermittelt an jenen Arzt, den er in Antibes öfters an der Seite von Nicolette gesehen hatte. Als er sich nach dem Mann umdrehte, hatte der sich bereits abgewandt und lief mit zügigen Schritten um die nächste Straßenecke. Vioric konnte sich gerade noch davon abhalten, dem Mann hinterherzulaufen und in sein Gesicht zu sehen. Er schluckte und fühlte sich mit einem Mal unerträglich ernüchtert. Der nächste Bissen des süßen Gebäcks schmeckte schon nicht mehr so, wie er schmecken sollte.
Vor dem Haus mit der Nummer elf stand Jean im Zugang zum Hof an den Briefkästen und sah sich nach allen Seiten um, als wüsste er nicht, ob er sich auf die Straße wagen sollte. Als er Vioric entdeckte, erhellte ein Lächeln sein Gesicht. »Julien, mein Freund. Sie liegen ja gar nicht in Ihrem Bett!«
Vioric schluckte den letzten Bissen seines Pains herunter und musterte Jean. Der junge Mann lächelte, aber auf eine ganz andere Art als in der vergangenen Nacht. Es sah aus, als würden unsichtbare Haken seine Mundwinkel nach oben zwingen, während der Rest seines Gesichts wie versteinert wirkte. Im Tageslicht sah Vioric, dass die Gesichtsverletzungen des Trompeters gravierender waren, als er in der Nacht geglaubt hatte.
Eine plötzliche Sorge ergriff ihn.
»Ist schon wieder etwas passiert?«, fragte er.
Jean verschränkte die Arme vor der Brust, als wäre ihm kalt.
»Es hört einfach nicht auf«, murmelte er.
»Was hört nicht auf?«
»Ach, das … das muss Sie nicht interessieren, Julien. Sie haben sicher wichtigere Dinge zu tun.«
Vioric machte einen Schritt auf Jean zu. Der Anblick des jungen Musikers löste eine Alarmglocke in seinem Innern aus, die nun leise, aber durchdringend seine Gedanken durchschrillte. »Wichtigere Dinge als was?«
Jean drehte zwei Briefe in der Hand und wirkte auf einmal wie ein schuldbewusster Junge, der seinen Eltern ein schlecht benotetes Diktat präsentieren muss.
»Die Dinge, mit denen wir uns herumschlagen müssen«, sagte er leise. »Dinge, mit denen andere Franzosen nicht behelligt werden.«
»Weiße Franzosen?«
Jean seufzte gereizt und ließ sich gegen die Briefkästen sinken. Schließlich nickte er.
»Was ist denn passiert?«, bohrte Vioric weiter.
»Gerade eben kam mein Freund Henry vorbei. Henry Chuckson aus Boston, aber ursprünglich stammt er aus Guadeloupe. Er ist Pianist und ein verteufelt guter noch dazu. Er spielt jeden Abend im Bal Nègre, seinem Stammlokal in der Rue Blomet. Tja und was soll ich Ihnen sagen, Julien. Gestern ist dort etwas Schlimmes passiert und …« Er unterbrach sich und wich Viorics Blick aus. »Ich sollte Ihnen das nicht erzählen. Henry würde das nicht wollen.«
Vioric verlor langsam die Geduld. »Nun lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen, Jean. Was würde Ihr Freund Henry nicht wollen?«
»Dass ich überhaupt mit Ihnen rede. Sie sind immerhin Polizist. Und gelernt ist gelernt, oder etwa nicht?«
»Was soll das heißen?«
Ein entschuldigender Ausdruck huschte über Jeans angespannte Miene. »Das würde jedenfalls Henry zu Ihnen sagen. Ich denke ja, Sie sind kein Vertreter der üblichen Sorte, denn sonst hätten Sie mir gestern Nacht kurzerhand die Trompete auf dem Schädel verbogen.« Jean schüttelte unentschlossen den Kopf. »Henry und ein paar meiner Freunde wurden gestern Nacht in eine üble Sache verwickelt und die Polizei unternimmt nichts zum Schutz von ihresgleichen … von uns.« Jean senkte den Kopf und beschattete seine Augen mit der rechten Hand. Als er erneut aufsah, lag in seinem Blick etwas Wildes, Flehendes, das Vioric innerlich zurückweichen ließ. Der Mann erstickte fast an etwas Ungesagtem. Vioric wartete kurz ab, ob Jean fortfahren würde, er schien sich durch seinen Beruf als Vertrauensperson aber irgendwie disqualifiziert zu haben – was die Lage für Jean offenbar nur umso quälender machte.
Er hielt den Blick des Trompeters fest. »Hören Sie, Jean, wenn Sie oder Henry Hilfe brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie es mir erlauben. Pain au chocolat?« Er hielt Jean seine Tüte hin.
Jean nickte überrascht, nahm es sich und biss vorsichtig hinein. Kurz darauf seufzte er und murmelte ein zufriedenes Merci.
»Also, letzte Nacht gab’s im Bal drüben im Fünfzehnten eine Schlägerei und … tja, wenn mein Freund Henry hier wäre, dann würde er Ihnen sagen, dass die Polizei deswegen nichts unternimmt, weil es sie insgeheim freut, wenn die Burschen von den Camelots uns schikanieren.«
»Haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen doch gerade meine Hilfe angeboten, oder etwa nicht?« Leicht verärgert knüllte Vioric die Papiertüte zusammen, die er nun in seiner Linken zu einer immer festeren Kugel rollte.
Sein Nachbar zuckte missmutig mit den Schultern.
Natürlich verstand Vioric Leute wie Jean oder diesen ominösen Henry, deren Misstrauen der Polizei gegenüber fast schon einer Neurose glich. Die Camelots du Roi, die meist jugendliche Schlägertruppe der Action française, war überall dort, wo das konservative Frankreich meinte, avantgardistischen Impulsen Einhalt gebieten zu müssen. Ihr Idealismus, die Bewahrer des wahren Frankreichs zu sein, war ein schlechtes Feigenblatt für das, was Vioric in ihren Umtrieben eigentlich sah. Blutige Streitlust.
Seit so viele Amerikaner und Einwanderer aus den Kolonien in die Stadt kamen, rissen die Camelots an ihren Ketten wie Metzgershunde, denen man mit einem saftigen Kotelett vor der Schnauze herumwedelt. Ein Club mit Schwarzen Musikern? Das war ein Affront gegen ganz Frankreich, ein gefundenes Fressen. Eine willkommene Gelegenheit, Fäuste sprechen zu lassen.
Vioric wunderte es nicht, dass so mancher Polizist sich bei solchen Zwischenfällen nur wohlig gähnend auf die andere Seite jener Bettstatt aus Duldung und Blindheit drehte, die der Polizeipräfekt und seine Vorgänger errichtet hatten, und dessen Laken man nie zum Lüften aus dem Fenster hängte.
Ja, er konnte Jeans Misstrauen durchaus nachvollziehen, hatte aber auch keine Lust, sich selbst in das gängige Bild eines solchen gewalttätigen oder Unrecht tolerierenden Polizisten drängen zu lassen.
Tiefe Müdigkeit fuhr ihm jetzt in die Knochen. Der Kaffee in der Boulangerie hatte seine Wirkung verfehlt. Er klopfte Jean behutsam auf die Schulter und wandte sich der Treppe zu. Der Trompeter warf ihm einen bedauernden Blick zu.