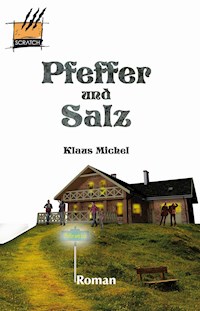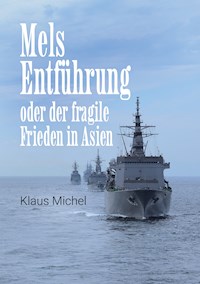
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mel, die geliebte Tochter des chinesischen Millionärs Jack Yang, wird entführt. Der Kidnapper verlangt als Lösegeldsumme eine Million Dollar. Da die Stimme des Anrufers einen deutschen Akzent aufzuweisen scheint, verpflichtet Jack Frank Tanner, einen deutschen Berater. Obgleich er das Lösegeld zahlt, bleibt Mel in der Gewalt des Entführers. Schließlich unterbreitet dieser Jack ein verwirrendes Angebot ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 1
Jeder, der zur Inaugenscheinnahme von Yang Qianlings Villa Gelegenheit erhielt, erblasste angesichts des luxuriösen Immobilienobjekts vor Neid. Das von einer hohen Ziegelmauer umfasste und mittels Kameras überwachte Herrenhaus lag im Norden Pekings in der Nähe des sogenannten Ming-Gräberfelds.
Zahlreiche vermögende Chinesen nannten inzwischen Villen ihr Eigen, bevorzugt in idyllischer Lage außerhalb der Stadt. Dedizierte, Developer genannte Unternehmen bemühten sich, den Bedarf nach gehobenem Wohnraum zu befriedigen, auch wenn der nur sporadisch, beispielsweise an Wochenenden, einer Nutzung unterlag.
In der Regel kooperierten die Firmen mit der lokalen Verwaltungsorganisation, deren verantwortliche Beamte sie in dem Bestreben bestachen, ihnen geeignetes Bauland zu übertragen. Die sahen sich hinfort vor die Aufgabe gestellt, die das Land bewirtschaftenden Bauern umzusiedeln. Zwar stand denen eine Entschädigung zu, die sie theoretisch in die Lage versetzte, andernorts Land zu erwerben oder sich in alternativen Berufen zu betätigen. Dass die Kompensation den Betroffenen nur in Ausnahmefällen in voller Höhe zugutekam, kaum noch landwirtschaftlich nutzbare Fläche zur Verfügung stand und die unternehmerische Tätigkeit der ehemaligen Bauern oft ein Desaster nach sich zog, stellte ein Faktum dar, welches die Regierung allenfalls am Rande zur Kenntnis nahm.
Hatten sich die früheren Besitzer – oft unter Gewaltanwendung – absentiert, rückten umgehend die Baumaschinen an und ebneten die Häuser der Vorbesitzer ein. Gleichzeitig wurde um das gesamte Gelände eine unüberwindbare Mauer erbaut, die den Bauern einen Blick auf ihr einstiges Eigentum verschloss. Danach entfaltete sich auf der ehemaligen Ackerkrume rege Bautätigkeit. Im Eiltempo schossen je nach Lage und Grundstückspreis entweder Wohnsilos ins Firmament oder man errichtete Villen jeder Größe und Ausstattungsqualität. Die fluteten lange vor dem Fertigstellungstermin den Immobilienmarkt und finanzierten auf diese Weise ein zukünftiges Bauprojekt.
Obgleich der Verkaufspreis einer ständigen Steigerungstendenz unterlag, fanden sämtliche Objekte reißenden Absatz und sei es auch nur als Kapitalinvestition. In wenigen Jahren erzielten die Immobilien einen Preis, der die Einstiegskosten um das Mehrfache überstieg. Ein Geldvermehrungseffekt, der die chinesische Immobilienblase beständig anschwellen ließ.
Die Yang’sche Villa, obgleich von derselben Baufirma errichtet, stellte gleichwohl eine Besonderheit dar. Außerhalb des als Garden bezeichneten Wohnareals fand sie hinter einer eigenen Mauer Schutz vor von Neugier erfüllter Nachbarschaft. Ausgefeilte Sicherheitstechnik gewährte dem Anwesen Diskretion. Insofern Herr Yang einen zehnprozentigen Anteil an dem Entwicklungsunternehmen hielt und auf allen Ebenen über Regierungskontakte verfügte, bereitete ihm der Erwerb des begehrten Baulands nur geringe Mühe.
Das Gelände, auf dem das Villenviertel entstanden war, erstreckte sich von der Straße, deren Ausbau ebenfalls dem Bauunternehmen oblag, in Richtung eines nahegelegenen Bergareals, einem beliebten Naherholungsgebiet. Ein Zipfel des monumentalen Grundstückareals reichte in ein sich nach oben verjüngendes Tal, das für einen ausgedehnten Gebäudekomplex ungeeignet erschien. Zumindest nach Meinung Herrn Yangs, dem es die an dem Projekt Beteiligten von dem Faktum zu überzeugen gelang, das Gelände stehe ihm zu. Mittels Geldgeschenken sowie des Versprechens, das ortsansässige Bauunternehmen mit dem Bau des Traumhauses zu betrauen, sicherte er sich aufgrund des Einflusses der Baubehörde, deren Unterstützung sich besonders kostspielig erwies, das Areal, das über den gewöhnlichen Villen zu thronen versprach. Gleichwohl verzichtete er auf die Dienste eines chinesischen Architektenteams. Stattdessen verpflichtete er ein kalifornisches Architekturbüro, dem es die anspruchsvollen Wünsche des Bauherrn besser zu vermitteln gelang. Nach reger Bautätigkeit – dem Bauprojekt im Tal allzeit um Monate voraus – entstand ein Gebäudekomplex, der in China seinesgleichen sucht. Indoor- und Outdoor-Pools, ein Tennisplatz, Gärten mit Fischteichen sowie einem eigens angelegten Forst entsprachen exakt der Vorstellung von einem angemessenen Domizil für sich und den Familienverband, inklusive Unterkünften fürs Dienstpersonal.
Nach dem Einzug geizte er allerdings mit Einladungen in sein neuerrichtetes Heim. Folglich fühlte sich jeder Geschäftsfreund oder Beamte geadelt, wenn er die Pforte des Yang’schen Imperiums durchschritt. In der Gewissheit, dem gemeinen Durchschnittsbürger bleibe eine solche Ehre verwehrt, sicherten sich die Auserwählten mittels Unterstützung der intendierten Projekte die Freundschaft des Familienoberhaupts. Dessen Interessen galten weit gestreut. Sie umfassten Fabriken im gesamten Land, Logistikunternehmen, Handelshäuser sowie einige tendenziell zwielichtige Unternehmen. Beteiligungen in Übersee rundeten das Portfolio ab.
Jedermann erachtete Herrn Yang als weltoffenen Geist. Dank seiner Weltläufigkeit ergriff er Chancen auf jedem Kontinent. Freunde und ausländische Geschäftspartner nannten ihn Jack. Ein Studium in den USA sowie ausgedehnte Aufenthalte vor Ort hatten ihn an die nonchalanten Umgangsformen der Amerikaner herangeführt. In China lautete die korrekte Anredeform Lao-ban oder Präsident Yang. Sein gesamtes Imperium erschuf er innerhalb eines Vierteljahrhunderts mit eigener Hand. Ein staatliches Stipendium, das ihm ein Universitätsstudium im Musterland des Kapitalismus finanzierte, legte die Basis für den beruflichen Werdegang. Zusätzlich zu einer mit Auszeichnung erworbenen Examensurkunde, kehrte er mit zahlreichen Geschäftskontakten sowie einem bescheidenen, in den USA neben dem Studium erwirtschafteten Grundkapital ins Heimatland zurück. Statt wie kleinmütige Geister die Dollars in die Landeswährung Renminbi zu konvertieren, fand das Kapital Verwendung, um im Land der Väter Beziehungen zu knüpfen und für die Zukunft zu bestärken. Den Rest legte er in ausgewählten Projekten an.
Wie durch ein Wunder verwandelte sich jedes Unterfangen, dem sich Yang zu widmen begann, in pures Gold, das er generös mit den Förderern in den Amtsstuben zu teilen pflegte. Zumindest empfanden die Beschenkten die Zuwendungen als Beweis der Yang’schen Großzügigkeit. In dem Maße, wie sich die Geschäfte entwickelten, wuchs sein Ruf als erfolgsverwöhnter Entrepreneur.
Der Vater, obgleich Parteimitglied, gehörte lebenslang dem anwachsenden subalternen chinesischen Beamtenstab an. Er hatte immerfort versucht, dem Sohn konfuzianische Tugenden anzuerziehen und in eigener Person das vermeintlich korrekte Leben vorgelebt, das in aufopferndem Dienst am Vaterland bestand. Dass ihm der Staat eine solche Einstellung nur unzureichend vergalt, über diesen bedauernswerten Umstand sah der alte Herr großmütig hinweg.
Auch Jack Yang predigte Großzügigkeit, nach oben wohlgemerkt, insofern von unten wenig zu erwarten stand, gleichwohl erwartete er für die Großherzigkeit ein Äquivalent, selbst wenn er erst in der Zukunft daraus Nutzen ziehen konnte. Gleichzeitig akzeptierte er die Allmacht der Partei als unabdingbare Notwendigkeit. Indessen widerstand er sämtlichen Anwerbungsversuchen der Staatspartei, indem er sich als der Ehre unwürdig zu bezeichnen pflegte. Unterdessen mehrte er sein Vermögen zum eigenen und dem Wohl des Staates. Leider verstarb der Vater, bevor es Jack sein Unternehmen unter die Top Ten des Landes zu torpedieren gelang, ein Umstand, der ihm die Erfüllung des Herzenswunsches versagte, dem alten Herrn vor Augen zu führen, in welchem Maß das Leben auf Gegenseitigkeit beruht.
Als der Grundstock zu einem Imperium geschaffen schien, widmete er sich der weltweiten Geschäftstätigkeit, die ihn bevorzugt den Blick nach Nord, Mittel- und Südamerika richten ließ. Landauf, landab knüpfte er Kontakte an, wobei er anders als in China den Beziehungen weniger durch finanzielle Zuwendungen eine Basis schuf. Stattdessen schilderte er Freunden und Geschäftspartnern die überdurchschnittlichen Anlagemöglichkeiten auf dem chinesischen Markt. Sofern sie seine Einschätzung eines lukrativen Investments im Reich der Mitte teilten, versprach er zusätzlich großzügige Unterstützung vor Ort. Gleichzeitig demonstrierte er, wie ein Bürger Asiens typischerweise zu Werke ging. In Miami sicherte er sich eine zwanzigprozentige Teilhaberschaft an einem Logistikunternehmen, das nicht nur Bananen und andere Früchte aus den südlichen Nachbarländern zu importieren begann. Im Erfolgsfall plante er, die Beteiligung zu erhöhen und die Partner aus dem Unternehmen zu drängen. In der Regel begnügte er sich jedoch mit einem Anteil von achtzig Prozent. Angesichts einer derartigen Quote bemühte sich der Miteigentümer schon aus Eigeninteresse um das Gedeihen des jeweiligen Betriebs.
Anlässlich eines geschäftsbedingten Aufenthalts in den USA verliebte er sich in seine zukünftige Ehegattin Jane. Obgleich er unter Freunden bereitwillig den eigenen Lebensweg beschrieb, blieb die Vergangenheit der Angetrauten stets ein wohlgehütetes Familiengeheimnis.
Als Janina Hagenholz hatte sie in einem winzigen Dorf im Harz in ärmlichen Verhältnissen das Licht der Welt erblickt. Im zarten Alter von achtzehn Jahren brannte sie mit ihrem damaligen Geliebten durch. Den Abschied von der Heimat befeuerte seitens des Freundes ein lebhaftes Interesse der Polizei an einer Unterhaltung mit ihm. Da eine solche Konversation hinter Gittern zu enden drohte, zogen sie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten dem Harz als zukünftige Wirkungsstätte vor. Die Romanze währte nur kurz. Als Janina, die sich seit der Ankunft in der Neuen Welt des Vornamens Jane bediente, einem vermögenden Fitnessapostel in Miami in die Arme lief, endete das Liebesverhältnis jäh.
Nach zwei Monaten führte Darren Armstrong das blonde Mädchen aus Germany vor den Traualtar und beging das Ereignis mit über fünfzig Freunden in einem Kasinokomplex. An die Strände Miamis zurückgekehrt, verlor Jane allerdings sowohl die sportliche Leidenschaft am Surfen als auch die Zuneigung des Frischvermählten. Die Scheidung, annähernd so zügig vollzogen wie der Eheschluss, ließ Jane Armstrong mittellos in der Millionenmetropole zurück. Weshalb der charmante Chinese mit dem uramerikanischen Vornamen Jack, unverzüglich ihr Interesse fand, zumal er über nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel zu verfügen schien. Einladungen in kostspielige Restaurants sowie in lauschige Clubs eröffneten ihr eine unbekannte Welt, die es umgehend zu erobern galt.
Blind vor Liebe und von Stolz erfüllt, mit einer blonden europäischen Schönheit den Bund der Ehe einzugehen, führte Jack sie vor den Traualtar. Da in China die Ehefrau den eigenen Familiennamen beibehält, hieß sie weiterhin Jane Armstrong. Jack kam dieser Umstand insofern entgegen, als der Name jedermann bewies, dass er eine Ausländerin seine Ehegattin nannte. Zwar stieg auch im Heimatland die Zahl der Mischehen an, allerdings wählten männliche Fremde meist ein attraktives Chinesenmädchen. Chinesen mit ausländischer Ehefrau stellten eine Seltenheit dar, ein Status, der Jack über die Masse der Mitbürger erhob.
Mit geschwellter Brust führte er die Angetraute in die Gesellschaft der Heimat ein. Sie dankte ihm die Zuneigung, indem sie ihm elf Monate nach der Vermählung eine Tochter gebar.
Im Allgemeinen ersehnen chinesische Familienväter, vor allem in ländlichen Regionen, bevorzugt männliche Nachkommenschaft, die sich in Ermangelung einer Altersversorgung später um das Elternpaar sorgt. Da die staatlich verordnete Einkindehe in der Regel einen zweiten Versuch verwehrt, versterben weibliche Babys meist schon im Säuglingsalter oder werden in Flüssen entsorgt.
Doch dank der internationalen Erziehung pflegte Jack einen differenzierteren Blick auf die Welt. Zudem stellte es für ihn zweifellos keine Schwierigkeit dar, die Beamtenschaft von der Notwendigkeit weiterer Nachkommen zu überzeugen. Kurzum, er liebte das kleine Wesen abgöttisch von der allerersten Stunde an.
Um seine Internationalität unter Beweis zu stellen, bat er Jane, einen westlichen Vornamen für das Kind zu wählen. Der lautete Melanie, verkürzte sich jedoch im Lauf der Jahre auf amerikanische Weise zu Mel. Da im Reich der Mitte auch ein chinesischer Name angeraten schien, nannte er das Baby Meilin, „schöner Wald“, und nahm dabei Bezug auf den eigenen Rufnamen Qianlin, wodurch sich die Verbundenheit zu dem kleinen Wesen weiter vertiefte.
In China pflegen Ehemänner, vornehmlich der gehobenen Stände, nach angemessenen Ehefreuden das Interesse an der Angetrauten zu verlieren und beweisen ihre Männlichkeit bei Kolleginnen, Sekretärinnen oder einer Gespielin, die in einer diskreten Wohnung den Sinnesfreuden dient. Hier bildete Jack, möglicherweise dank der konfuzianischen Erziehung eine lobenswerte Ausnahmeerscheinung, insofern er sich weitestgehend außerehelicher Freuden enthielt, die Ausnahme bestätigt bekanntlich die Regel. Stattdessen genoss er die beschränkte Freizeit am heimischen Tisch. Überdies forderte Jane, in steter Regelmäßigkeit extensiv den ehelichen Pflichten zu genügen. Einem solchen Diktat unterwarf er sich gern. Der Blick in die strahlenden Kinderaugen Mels entschädigte für manchen Verzicht.
Leider stellte sich, trotz fleißigen Bemühens, kein weiterer Nachwuchs ein, weshalb er das Töchterlein um so mehr zu verwöhnen begann. Zuweilen begleiteten ihn Gattin und Tochter auf ausgedehnten Reisen, wobei er praktischerweise geschäftliche Obliegenheiten mit privaten verwob. Während er Verhandlungen in den oberen Etagen der New Yorker Partnerfirmen führte, flanierten Jane und Mel im Central Park. Insofern er die neiderfüllten Blicke der Mitmenschen genoss, zeigte er seinen liebevoll Mädchen genannten Damen die Welt. Bei diesen Gelegenheiten nahm er sich der Allgemeinbildung sowohl der Tochter als auch der Gattin an – die Schule im Harz hatte ihr höhere Bildung zu vermitteln versäumt.
Bald sah sich Mel in der Lage, sämtliche Hauptstädte der Welt zu benennen, und ordnete sie Ländern zu. Ihr erschloss sich die exotische Pflanzenwelt, sie erwarb Kenntnisse der Rassen dieser Welt. Asiatische Küche schätzte sie ebenso wie französische oder italienische Kost.
Auch der Spracherziehung Mels wies Jack hohe Bedeutung zu. Zu Hause galt die amerikanische Form des Englischen als obligat, wobei er stets im Auge behielt, dass sich niemals New Yorker Gassenslang in die häusliche Unterhaltung schlich. Jane kommunizierte mit der Tochter ausschließlich im deutschen Idiom. Außerhalb des Anwesens sowie mit den Dienstboten bediente Letztere sich des Chinesischen, weshalb sie bei Einkäufen der Mama als Dolmetscherin zur Verfügung stand. Zuweilen nutzte sie die sprachliche Überlegenheit zum eigenen Wohl.
»Mama, ich frage die Tante gern, wie viel sie für das Kleid verlangt, doch nur, wenn du mir ein Eis spendierst«, pflegte sie die Mutter zu erpressen. Wenn Jane abends solche Erlebnisse wiedergab, strich Jack der Kleinen liebevoll übers Haar und konstatierte, sie entwickle schon früh den notwendigen Sinn fürs Geschäft.
Nur die besten Kindergärten erachtete er für Mel als geeignete Stätte, sich gehobene Umgangsformen anzueignen. Später besuchte sie die internationale Schule, wobei er stets auf der Forderung bestand, dass die chinesische Spracherziehung der Tochter nie Vernachlässigung fand. Während das Kind allmählich heranwuchs, wies sie hervorragende Zeugnisse vor, wurde allgemein von den Lehrern gelobt und entwickelte sich mit der Zeit zu einer Schönheit, die den Liebreiz der Mutter noch übertraf. Sowohl Jack als auch Jane achteten darüber hinaus, dass sich Mel aufgrund ihrer hervorgehobenen gesellschaftlichen Position nie über die Mitschüler erhob. Indem sie in der Villa Spielräume schufen, ermunterten sie das Kind, jederzeit mit Klassenkameraden Umgang zu pflegen. Das Ansinnen gestaltete sich infolge der abgeschiedenen Lage des Yang’schen Anwesens diffizil. Deshalb verpflichtete Jack eigens einen Chauffeur, der der jauchzenden Kinderschar in einem Kleinbus Fahrdienste angedeihen ließ.
Einzig als Mel das Alter erreichte, in dem Mädchen das andere Geschlecht nicht mehr als lästige Plage erleben, kühlte sich das Verhältnis zum Vater zwischenzeitlich ab. Obgleich Jack der Tochter gesteigerte Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ, vermochte er letztlich kaum mit den Jungen zu konkurrieren. Deshalb wählte er hinfort eine veränderte Strategie, die ihrem Interesse an Tanzveranstaltungen und Diskos Rechnung trug. Dass er zu solchen Gelegenheiten auch Fahrtdienste leistete, dankte sie ihm mit vermehrter Empathie. Das Angebot, sie auch in die Disco zu begleiten, wies sie gleichwohl zurück. Hinterher erging sie sich mit Freunden lachend über die Vorstellung, wie sich ihr alter Herr auf einer glitzernden Tanzfläche in Verrenkungen übte.
Dennoch zahlte sich die Offenheit gegenüber den Anliegen der Tochter aus. Eines Tages akzeptierte sie zögerlich das Angebot, auch Verehrern Zutritt in das Yang’sche Anwesen zu gewähren. Zudem forderte sie ihn ausdrücklich auf, ihr seine väterliche Meinung zu dem Jungen anzuvertrauen.
Fast brach er in erheitertes Lachen aus, als ihm der Angebetete, für den ihr Herz derzeit schlug, gegenüberstand. Dennoch übte er sich, auch wenn er bei Themen wie Popgruppen und Modefragen Unbewandertheit bewies, in artiger Konversation. In der Gewissheit, das Jüngelchen wisse die Ehre der Tochter zu wahren – kannte der überhaupt den Geschlechterunterschied? – überließ er geflissentlich die beiden im Wohnzimmer sich selbst. Am nächsten Tag vermittelte er dem Töchterlein auf diplomatische Art, Mädchen ihrer Altersgruppe interessierten sich seiner Ansicht nach für ältere Jungs.
Als sie allerdings einige Monate später ein weiteres Exemplar männlicher Ignoranz in die väterliche Villa lud, bereute er den voreiligen Rat. Der Lümmel wirkte, als könne er kaum erwarten, die Dessous der geliebten Tochter einer Inspektion zu unterziehen. In diesem Fall wachte er von Argwohn erfüllt über die Jungfräulichkeit des Töchterleins. Gleichzeitig bedrängte er den Jüngling mit Fragen nach schulischem Engagement. Die Zeugnisse demonstrierten einen ausgeprägten Hang zu außerschulischen Aktivitäten, die er bevorzugt in windigen Bars vollzog. Zu Hobbys befragt zählte er freimütig seine Lieblingsbeschäftigungen »Mädchen und mit Freunden rumhängen« auf.
Am Abend führte Jack ein dezidiertes Gespräch mit Jane über den Umgang ihres Töchterleins. Die entgegnete unbeherrscht: »Warum sprichst du, wenn du Kritik an ihr übst, statt von unserem stets von meinem Kind?«
Gleichzeitig wies sie ihn auf das Faktum hin, Mel habe bereits das Alter von achtzehn Jahren erreicht. Na und, hätte er fast repliziert, doch erschloss sich ihm der Aussage tieferer Sinn. Er fragte, ob sie ernsthaft die Möglichkeit erwog, dass sein Kind … Den Satz ließ er unvollendet im Raume stehen.
»In dem Alter brannte ich mit meinem damaligen Freund nach Amerika durch«, erwiderte Jane.
Zurückhaltend offenbarte sie ihm, dass sich der Lauf der Welt nicht verändern ließe. Er müsse sich eingestehen, dass Mel allmählich die Kontrolle über das eigene Leben übernahm.
Noch höchst unzureichend, wie er innerhalb kurzer Zeit konstatierte, als er eine schluchzende unter Liebeskummer leidende Mel in den Armen hielt. Immerhin erschloss sich ihm, sie habe dem Burschen mit den einseitigen Hobbys einen Griff in ihre Dessous verwehrt. Der hatte sich in der Folge an Mels Klassenkameradinnen delektiert. Jack enthielt sich der Frage, ob sie die Zurückhaltung auch gegenüber anderen Jungen beibehielt. Stattdessen hielt er sie in den Armen und genoss die Nähe, die sie ihm in letzter Zeit zuweilen vorenthielt.
Insofern Jane das Gespräch mit angehört hatte, lobte sie ihn hinterher, er finde stets den passenden Ton mit Mel.
Versöhnt umarmte er die Gattin und fragte, obgleich sich ihm die Antwort erschloss, höflich nach, ob das eheliche Pflichterfüllungsprogramm auch an einem Sonntagnachmittag Gültigkeit besaß.
Bevor Mel einen Abschluss der oberen Mittelschule, vergleichbar dem deutschen Abitur, erlangte, befragte er sie zu ihren Zukunftsplänen. In Andeutungen vermittelte sie ihm, sie strebe ein Studium in den Vereinigten Staaten an. Obgleich er das Lächeln beibehielt, erschrak er bei dem Gedanken, dass ihm eine Trennungsphase bevorzustehen schien. Angesichts der Vorstellung, wie die eigene Tochter ihr Leben in den USA auf sich selbst gestellt bestritt, setzte umgehend Bauchgrimmen ein. Vorerst verhehlte er die Beklommenheit und gab ihr stattdessen zu verstehen, ein Auslandsstudium stelle ihn zumindest vor kein finanzielles Problem.
Lächelnd drückte ihm Mel einen Kuss auf die Stirn. »Angesichts der Vorstellung, mich im Ausland zu wissen, befällt dich offensichtlich unsägliche Furcht.«
Indem er sie in die Arme schloss, vermittelte er ihr väterliche Sympathie. Zudem bat er um Verständnis, falls er sich als Vatergestalt möglicherweise zu beschützerisch verhielt. Einzig aus Vaterliebe lebe er in steter Sorge um ihr Wohlergehen.
Während sie ihm liebevoll in die Augen blickte, bekundete sie, die Zuneigung beruhe auf Gegenseitigkeit. Zugleich bestätigte sie, als Vater übe er Vorbildfunktion aus. Betrachte sie dagegen die Eltern der Klassenkameraden, vermittle sich ihr ein völlig abweichendes Bild.
Anschließend überraschte sie ihn mit einem unerwarteten Angebot. Sie fragte, wie er dem Vorschlag gegenüberstand, wenn sie nach erfolgreichem Schulabschluss noch ein Jahr bei ihm in China blieb und sich erst danach zu einem Studium ins Ausland begab. Das biete ihr Gelegenheit, die eigene Zukunft einer Analyse zu unterziehen. Aufgrund der Aussicht, das Töchterlein ein weiteres Jahr in seiner Nähe zu sehen, jauchzte er innerlich auf. Während er sie in die Arme schloss, versicherte er, der Vorschlag erwärme das väterliche Herz.
Kapitel 2
Mel Yang genoss ihr Dasein in vollen Zügen und völlig unbeschwert. Den Schulabschluss absolvierte sie mit einem Prädikatsexamen. Danach nutzte sie, wie mit Daddy besprochen, die Zeit, bezüglich der eigenen Zukunft Orientierung zu erstreben. Über das Faktum, dass sich das Bemühen um einen Platz im Leben vorwiegend auf Partys und in Diskotheken vollzog, sah er großmütig hinweg.
Zum zwanzigsten Geburtstag beglückte er sie mit einem flotten BMW-Coupé, mit dem sie die Straßen der Hauptstadt in eine Rennstrecke zu verwandeln begann. Strafmandate und Bußgelder beglich der alte Herr ohne tadelnden Kommentar. Mit dem Leiter der Distriktsverkehrsbehörde führte er ein ausgedehntes Gespräch, in dessen Verlauf er auf die Ungeduld der Jugend verwies. Der Beamte berichtete seufzend, dass ihn der eigene Sohn zuweilen in Ingrimm versinken ließ. Jack versprach umgehend und in glaubwürdiger Intonation, er nehme sich hinfort der Karriere des Jünglings an.
In Liebesdingen bewies Mel leider weniger Geschick. Seit der Abiturabschlussfeier verband sie eine Liaison mit Peter, dem Sohn eines Botschaftsattachés. Ebenso wie Mel verschob der den endgültigen Schritt ins Leben auf einen Zeitpunkt, zu dem das Auswärtige Amt den Vater in die Heimat zurückberief. Der Umstand gewährte dem Paar hinlänglich gemeinsame Zeit. Gleichwohl erschloss sich Mel, offensichtlich hatte sie ihn unter Alkoholeinfluss erwählt. Im Bett ermangelte es ihm an der notwendigen Kondition, befand Mel. Zwar verfügte sie, was Männer betraf, nur über einen beschränkten Erfahrungsschatz, doch brachten die Freundinnen völlig andere Geschichten zu Gehör.
Als er sie eines Tages in die verwaiste elterliche Wohnung lud und ihr – von Drogen berauscht – erstmals in der Beziehung zu befriedigendem Sex verhalf, ließ sie Peters Karriere als Liebhaber eine vorübergehende Gnadenfrist angedeihen. Hinterher fragte sie sich, hatte sie der Drogenrausch ins Paradies entführt oder seine verzweifelten Anstrengungen am weiblichen Unterleib.
Um der Liaison die notwendige Würze zu verleihen, ließ sie sich auf weitere Besuche ein, erteilte ihm allerdings zuvor einige grundlegende Lektionen in Lustbefriedigung. Bisher gipfelte die männliche Strategie in dem Bemühen, möglichst rasch die Ziellinie zu überqueren. Leider stellte er nur bedingt Lernbereitschaft unter Beweis, ein Umstand, der sich möglicherweise auf den Drogenkonsum zurückführen ließ. Als er eines Nachmittags nach einem zwar ungestümen, doch überaus kurzen Akt auf dem Wohnzimmerteppich in Morpheus Arme sank, fragte sie sich, während sie den verschwitzten Körper einer Betrachtung unterzog, was um alles in der Welt sie an dem Jüngling fand.
Aus dem Drogenrausch erwacht, eröffnete sie ihm zuvorkommend gleichwohl in der gebotenen Entschiedenheit, wie es ihrer Art entsprach, sie sehe die Beziehung als beendet an.
Peters Weltverständnis barst in Sekundenfrist. Er wimmerte, vergoss Krokodilstränen und versuchte sie gar mit Gewalt, zu einer Wiederholung zu bewegen. Als sie temporär dem Werben erlag, ersehnte sie eine abschließende Befriedigung. Als er jedoch abermals kläglich auf der Strecke blieb, beendete sie die Liaison zeitgleich mit dem ohnehin missglückten Liebesakt. Leider ließ sie sich hinreißen, auf sein schlaffes Glied zu verweisen und ihm ungehalten vorzuhalten: »Ich erachte dich nicht nur als Langweiler, sondern auch als Versagertyp.«
Sodann kleidete sie sich an und verließ ihn in dem Bestreben, die Wohnung nie wieder zu betreten.
Peter erlebte einen Zusammenbruch der Welt. Zornerfüllt brüllte er ihr verächtlich »Hure« hinterher und bediente sich der derbsten Tiraden aus einem Sprachschatz, den man in Botschaftskreisen mit Missbilligung zur Kenntnis nahm. Doch Mel hatte sich längst absentiert. Erzürnt betrachtete er das erschlaffte Glied, dem er mit der Hand Leben einzuhauchen trachtete. Doch auch das misslang. Der betrübliche Umstand beruhte in seinen Augen ausschließlich auf der Verweigerungshaltung des missratenen Weibs. Was fand er nur an ihr?
In den Folgetagen irrte er wie in Trance durch die Straßen der Stadt. Der Vater diente dem Heimatland in diplomatischer Mission, die Mutter suchte mit Diplomatenfrauen der Wohltätigkeit gewidmete Empfänge auf. Er schrieb ungestüme Liebesbriefe, die er jedoch noch vor der Fertigstellung dem Feuer übergab. In einem schwor er ewige Liebe, im nächsten glühenden Hass. Mel verwandelte sich in seinen Augen innerhalb Sekundenfrist von einem anbetungswürdigen, himmelsgleichen Wesen zu einer verabscheuungswürdigen Teufelin. Nur die Drogen verhalfen ihm vorübergehend zu einer entspannteren Betrachtungsweise zurück, wenngleich es ihm nie gelang, sie aus den drogeninduzierten Träumen zu verbannen.
Mel wiederum bereute bereits auf der Heimfahrt die allzu harschen Worte. Sie hatte Peter verletzt, ein Umstand, der keinesfalls in ihrer Absicht gelegen hatte. Sie wusste von seinem zartfühlenden Wesen. Was geschähe, wenn er sich von Hader erfüllt etwas zuleide tat?
In den nächsten Tagen versuchte sie sich an zahllosen Entschuldigungsbriefen, die sie letztlich alle dem Papierkorb übergab. Sie befürchtete, Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Verrenkungen auf dem Teppich zu wecken und verfehlte stets den passenden Ton. Doch schloss sie ein erneutes Ringen um Lust kategorisch aus. Sie wünschte, ihn nie wiederzusehen, niemals mehr die gierigen Hände auf dem eigenen Körper zu erspüren und seine überhasteten Bemühungen um Lust über sich ergehen zu lassen. Sie suchte nur ihr Gewissen zu beruhigen.
Um Peter eine Entschuldigung zu überbringen, sann sie über die Einschaltung einer Freundin nach, verwarf den Gedanken jedoch. Im Grunde wünschte sie nur, die Episode falle alsbald dem Vergessen anheim.
Als ihr Vater beim Abendmahl eine bevorstehende Dienstreise nach Hongkong erwähnte, bekundete sie hoffnungsfroh, sie begleite ihn. Sie suchte Distanz zum durchlittenen Liebesleid. Zudem fühlte sie sich von dem Wunsch beseelt, Dad mit ein wenig Vaterglück zu behelligen. Der nahm die Idee begeistert auf.
Die geschäftliche Agenda in der vormaligen britischen Enklave reduzierte er auf das absolute Minimum. Stattdessen fuhr er mit dem Töchterlein auf den Peak, führte sie in exklusive Restaurants, bereicherte ihre Garderobe mit extravaganten Dessous und genoss in vollen Zügen das Glück einer Tochter, die sich ihm verbunden fühlte.
Am letzten Abend in der ehemaligen Kronkolonie delektierten sie sich auf einem Boot an einem exquisiten Mahl. Die skeptischen Blicke des Deckpersonals, das Mel für seine Geliebte hielt, ertrug er mit stoischer Distanz. Wenn ein Kellner den Tisch passierte, legte er demonstrativ den Arm um sie.
Leider blieb ihm nach der Rückkehr in die Hauptstadt kaum Zeit zum Genuss des Familienglücks. Die Geschäfte riefen in einer Lautstärke, die umgehende Aufmerksamkeit anempfahl. Unglücklicherweise absorbierte ihn auch am Wochenende die Mehrung seines Kontostands. Stattdessen suchte er nach einer Möglichkeit, sich während der Woche um Mel zu bemühen.
Am Montag, dem sechsten August, traf Mel eine Verabredung mit ihrer Freundin Jenny, einer Australierin, die nach eigener Aussage soeben ein Tief in einer Liebesbeziehung durchlitt. Mel hoffte lediglich, sie ergehe sich nicht den gesamten Tag über die Niedertracht des männlichen Geschlechts. Das fehlgeschlagene Abenteuer mit Peter bereitete ihr weiterhin Seelenpein, rief ihr schmerzlich das Liebesdebakel in Erinnerung.
Als Mel gegen zehn Uhr den Schlüssel des BMW in der Hand das Haus verließ, fragte Jane, ob sie zur Abendtafel zurückzuerwarten sei. Mel bestätigte eine Heimkehr bis spätestens achtzehn Uhr.
Gleichwohl wartete Jenny vergeblich auf Mel. In einem Café übte sie sich mit Schulfreunden in trivialer Konversation. Zwar rief das Ausbleiben Mels Verwunderung hervor, denn sie galt allgemein als Pünktlichkeit in Person, indessen hielten sie die euphorischen Gespräche am Tisch von Rückfragen per Mobiltelefon ab.
Jane erinnerte sich des Versprechens der Tochter, sie kehre um achtzehn Uhr nach Hause zurück. Zudem rief sie sich in Erinnerung, in welchem Maß Jack die Stunden mit dem Töchterlein genoss, namentlich vor der bevorstehenden Ausreise in die USA. Deshalb wählte sie kurz nach neunzehn Uhr Mels Mobilfunknummer, um in Erfahrung zu bringen, wann mit ihrem Eintreffen zu rechnen sei. Gleichwohl konstatierte sie, dass die Tochter offenbar erneut die Speicherzelle des Mobiltelefons aufzuladen vergessen hatte. Eine Computerstimme informierte sie, das Gerät sei außer Betrieb. Sie maß dem Umstand jedoch nur untergeordnete Bedeutung bei. Zuweilen enthielt sich Mel jeglicher telefonischer Kommunikation und versäumte auch nicht zum ersten Mal das häusliche Abendmahl.
Da Jack ebenfalls verspätet das Haus betrat, thematisierte sie das Ausbleiben Mels erst um neun. Auch er unternahm Versuche, sie auf dem Mobiltelefon zu kontaktieren, erzielte jedoch das gleiche negative Resultat.
Erst um elf befiel ihn Sorge ums Töchterlein. Zwar kehrte Mel auch in der Vergangenheit zuweilen verspätet nach Hause zurück, doch hatte sie bisher jede längere Abwesenheit zuvor erwähnt. Im Falle einer Verspätung pflegte sie stets die Eltern zu informieren. Ohne Entschuldigung auszubleiben, widersprach ihrer zuvorkommenden Art.
In dem Wissen um Mels Verabredung unterbreitete Jane den Vorschlag, bei der Freundin nachzufragen, wo sich Mel befinden mochte. Sowie Jack den australischen Akzent in Jennys Stimme vernahm, trat auf seinem Antlitz ein zufriedenes Lächeln hervor. Als sie jedoch von dem geplatzten Treffen zu berichten begann, bildeten sich Sorgenfalten auf der väterlichen Stirn. Auch Jenny räumte ein, ohne Begründung einer Verabredung fernzubleiben, widerspreche Mels Wesensart.
Gemeinsam riefen sie sämtliche Freundinnen der Tochter an. Niemand hatte Mel an dem Tag erspäht.
Schließlich versuchte Jack sein Glück bei Peter Landwerk, Mels Ex-Freund. Jener wusste nur von dessen Rolle in Mels Liebesglück und zeigte nicht zum ersten Mal Verwunderung über Mels Geschmack, was Männer betraf. Gleichwohl hatte er sich klugerweise über Liebesdinge mit ihr auszutauschen versagt. Er hielt die Beziehung ohnehin für eine vorübergehende Liaison, die spätestens dann ein Ende fand, wenn sie sich zum Studium nach Amerika begab.
Peters Intonation klang diffus unartikuliert. Offensichtlich hatte er sich Alkohol zugeführt. Allerdings keimte Hoffnung in ihm auf, als er im Hörer Jack Yangs Stimme vernahm. Bediente sich Mel, um eine Versöhnung anzubahnen, der vermittelnden Vatergestalt? Als der jedoch zu erfahren begehrte, ob er Mel am selbigen Tag ansichtig geworden sei, verneinte er nur. Zudem erachtete er es unter seiner Würde, Jack die Trennung zu offenbaren. Er unterdrückte auch die Intention, ihm entgegenzuschleudern: »Woher soll ich wissen, in welchen Gassen die Hure herumvagabundiert?« Stattdessen versicherte er, er kontaktiere ihn, sobald sich ihm Mels Aufenthaltsort erschließe. Er erbot sich sogar, bei sämtlichen Freunden nachzufragen.
Nach dem erfolglosen Telefonat blickten sich Jack und Jane fragend an. Beiden stand die Sorge ins Antlitz geschrieben. Während sie sich noch das Gehirn zermarterten, wer über Mels Verbleib Auskunft zu erteilen vermochte, erscholl ein Klingeln des Telefons auf der Anrichte im Flur. Da nur wenige Menschen die Nummer kannten – Jack bemühte sich, der Familie einen Rest Privatsphäre zu bewahren – gingen beide von der Annahme aus, nach dem Abheben Mels Stimme zu vernehmen, die für ihre Verspätung um Entschuldigung bat. Jack trug sich bereits mit dem Gedanken, keinesfalls eine weitere lauwarme Rechtfertigung zu akzeptieren. Sie hatte die Eltern in Sorgen gestürzt, das sollte sie verstehen.
Er nahm den Hörer ab und meldete sich, wie in China üblich mit »Wei«.
Statt der Stimme des Töchterleins vernahm er aus dem Apparat den barschen Befehl, Jack möge schweigend lauschen. Ein Fremder informierte ihn, seine Tochter sei das Opfer einer Entführung geworden. Falls er die Polizei um Unterstützung ersuche, kehre sie niemals zurück.
Unvermittelt verspürte er einen eisigen Schauer auf der Haut, vernahm im Hörer ein Klicken und anschließend tatsächlich Mels Stimme: »Dad, ich bin wohlauf. Bitte komm umgehend seinem Begehren nach.«
Er wünschte soeben nachzufragen, wo sie sich befand, als erneut ein Klickgeräusch erklang, das ihm vermittelte, er hatte einer Tonbandaufnahme gelauscht. Schließlich vernahm er abermals den Anrufer: »Keine polizeiliche Ermittlungsarbeit. Um unsere Forderungen zu übermitteln, kontaktieren wir Sie in Tagesfrist.« Nach einem weiteren Klick senkte sich Stille über den Raum.
Während Jack sprachlos mit dem Hörer in der Hand verharrte, versuchte er, die überbordende Gedankenflut zu bezähmen. Die Vorstellung, dass sich die Tochter in Gefahr befand, drängte er zunächst zurück. Die fremde Stimme klang noch in den Ohren nach. Eine barsche, herrisch fordernde Intonation. Bis ihm ins Bewusstsein trat, sowohl der Anrufer als auch Mel hatten sich des Chinesischen bedient. Da die Familie im Allgemeinen Konversationen auf Englisch bestritt, nur mit der Mutter kommunizierte Mel im deutschen Idiom, wähnte Jack, der Entführer habe Mel zur Nutzung der Landessprache gedrängt. Möglicherweise blieb ihm eine Fremdsprachenkenntnisse vermittelnde Bildung versagt.
Erst nach Minuten der Kontemplation und einem kräftigenden Schluck eines alkoholischen Destillats erschloss sich ihm die Bedeutung des Telefonats. Die allesgeliebte Tochter befand sich in den Händen eines Missetäters. Sein Hirn wiederholte den Gedankengang wie in einer Endlosschleife. Er widerstand der Versuchung, das Glas an die Wand zu schmettern. In verzweifeltem Groll verspürte er den Wunsch, dem Geiselnehmer Schmerzen zuzufügen, fühlte den inneren Drang, dem Töchterlein zu Hilfe zu eilen. Ihn erfüllte das Verlangen, in den Wagen zu springen, um dem Entführer nachzusetzen, ihn mit eigenen Händen ins Jenseits zu befördern.
Stattdessen zwang er sich Ruhe und Gelassenheit auf. Er rief Liu Wei, seinen Assistenten, an. Ohne weitere Erklärung forderte er ihn zu umgehendem Erscheinen auf. Der kannte Jack zwar als friedfertiges Individuum, doch die angespannte Stimmungslage vermittelte ihm das Gefühl, dass er sich möglichst jeglicher Rückfrage enthielt.
Als Liu nach einer Stunde das Yang’sche Anwesen betrat, hatte Jack zwar zum einen die Contenance so weit wiedererlangt, um nüchterne Erklärungen abzugeben, doch innerlich kochte weiterhin der Zorn in ihm, drohte, jederzeit erneut hervorzubrechen.
Indem er die missliche Situation beschrieb, wartete er auf Vorschläge, wie sich dem Missetäter entgegentreten ließ, als ob Liu zu sagen wüsste, wen er der Entführung zieh und wie sich ihm das Mädchen entreißen ließ.
In dem intuitiven Wissen, welche Erwartungen Jack mit der Frage verband, seufzte Liu. Er riet, die Drohungen ernstzunehmen, zumindest vorläufig Verzicht auf den Einsatz der Polizei zu üben.
Nickend gab Jack zu verstehen, er schließe sich dessen Meinung an. Gleichwohl zeige er Bereitschaft, annähernd jeden Betrag für die Befreiung Mels aufzubringen.
Lius Vorschlag schien zwar bei Weitem prosaischer, doch vermochte ihn Jack nachzuvollziehen. Beim nächsten Telefonat gelte es, die Stimme auf Tonband zu bannen. Zudem empfahl er, ein Gerät zum Einsatz zu bringen, mit dessen Hilfe sich die Anrufernummer ermitteln ließ.
Jack fragte, ob eine Möglichkeit bestünde, auch den Standort des Anrufers herauszufinden. Liu schüttelte das Haupt. Dazu bedürfe es der Mithilfe der Polizei und China Telecom. Doch rate er nochmals vorerst zu Verzicht auf die Einbindung der Ordnungsmacht.
Jack wusste, auf welche Sorge sich der Assistent bezog. Bei früheren Entführungsfällen hatte die Staatsmacht ausschließlich auf das Begehren abgezielt, die Missetäter zu inhaftieren. Der Errettung eines Entführungsopfers wiesen sie eine mindere Prioritätsstufe zu.
Nach mehreren Anrufen Lius wurde im Morgengrauen die notwendige Technik installiert. Janes Nerven zeigten sich derart überspannt, dass sie nur noch schluchzende Laute von sich gab, der Aufforderung des Gatten, sich zur Ruhe zu begeben, jedoch widerstand. Der zwang sich – einen dritten Cognac in der Hand – zu äußerer Gelassenheit.
Jack beharrte auf dem Entschluss, das Telefon jederzeit im Auge zu behalten. Selbst zur Toilette begab er sich in der Furcht, den nächsten Anruf zu verpassen nur zögerlich. Schließlich ließ Herr Liu überall im Hause Klingeln installieren, wodurch ein Klingelgeräusch bis in den Garten vernehmbar blieb, falls er sich nicht zu weit von der Villa entfernt befand.
Überdies stellte er eine Armee von Vertrauten auf, die ausschwärmten, um Mels Bekannte zu befragen. Im Verlauf der Konversation erwähnten sie den Entführungsfall mit keinem Wort. Gleichwohl wusste in Kürze jedermann in der Stadt, dass Mel ein Schicksalsschlag traf. Indessen wurden die Diskussionen nur hinter vorgehaltener Hand geführt. Yangs hervorgehobene gesellschaftliche Position garantierte, dass niemand in der Öffentlichkeit mögliche Probleme in seinem Hause thematisierte.
In den nächsten Tagen durchlebten Jack und Jane ein gefühlsbedingtes Wechselbad. In einem Augenblick hingen sie der Überzeugung an, die Entführer hätten Mel bereits vom Leben zum Tode befördert. Dann sahen sie das Mädchen in Wachträumen durch die Wälder irren. Sie befreite sich aus den Händen der Peiniger und es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis sie wohlbehalten das Yang’sche Anwesen betrat. Bei sämtlichen Geräuschen schreckten die geplagten Eltern auf. Doch überfiel sie stets Entmutigung, wenn die Tochter nicht vor ihnen stand.
Beide schliefen nur noch stundenweise. Jack ernährte sich von Kaffee, Jane von überstarkem grünem Tee. Nur gelegentlich konsumierten sie ein wenig Obst. Trotzt der Klingeln im Haus, fühlte sich Jack gedrängt, niemals die Badezimmertür zu schließen, wenn er sich zu einer Dusche entschloss.
Wie ein dunkler Schleier legte sich eine bedrückende Atmosphäre über das Haus. Die Befragung der Freunde erbrachte außer Mels gelegentlicher Liebesabenteuer keine verwertbare Information. Beharrlich schwieg das Telefon. Jack hatte sämtliche Personen, welche die Nummer besaßen, gebeten, sich einen Anruf auf dem Anschluss zu versagen. Ihn plagte die Befürchtung, dass er mit einem Bekannten sprach, während ihn der Entführer vergeblich zu erreichen suchte.
Am Freitag gegen sieben Uhr abends ertönte endlich der langersehnte Klingelton. Allerdings statt am Festnetzanschluss am Mobiltelefon. Jack besaß mehrere Exemplare, deren Nummern wiederum der Geheimhaltung unterlagen.
Dieses Mal bediente sich der Anrufer des englischen Idioms, und zwar, wie Jack konstatierte, mit einer fremdländischen Intonation. Er vermeinte, einen deutschen Akzent zu identifizieren.
Zunächst zollte er Jack Lob für den Entschluss Verzicht auf den Einsatz der Polizei zu üben, stieß allerdings Drohungen aus, für den Fall, dass sich Jack umentschied. In einem solchen Fall müsse er den Verlust des Töchterleins beklagen. Als er Jack hinreichend terrorisiert erachtete, legte der Anrufer seine Forderung vor: eine Million US-Dollar, und zwar ausschließlich in gebrauchten Fünfziger- und Zwanziger-Scheinen. Die Details der Geldübergabe übermittle er zu gegebener Zeit.
Danach vernahm Jack erneut das bereits vertraute Klicken und schließlich Mels Stimme: »Daddy, die stoßen ernstzunehmende Drohungen aus. Ich glaube, du solltest die Forderungen erfüllen.« Insofern sie sich dieses Mal der englischen Sprache bediente, vermeinte er, eine angsterfüllte Intonation zu erspüren. Bevor er dem Entführer eine Warnung zukommen lassen konnte, seiner Tochter kein Leid zuzufügen, unterbrach der das Gespräch.
In Jack breitete sich eine innere Leere aus. Einerseits erfüllte ihn Hoffnung, endlich die Forderungen zu vernehmen, andererseits Enttäuschung, dass ihm das Töchterlein weiterhin vorenthalten blieb. Er hatte gehofft, umgehend eine Instruktion zu erhalten, die zu Mels Befreiung zu führen versprach. Gleichwohl zügelte er die eigenen Emotionen und rief erneut Liu Wei an. Ohne Details preiszugeben, berichtete er von dem zweiten Telefonat und befahl, sämtliche Telefone, Faxe, Computer, jegliche Kommunikationsmittel im Haus und in den zahlreichen Büros mit der modernsten Technik zu versehen.
»Kostenerwägungen stehen hinter Mels Unversehrheit zurück«, fügte er demonstrativ hinzu.
Den nächsten Anruf würde er auf Tonbandrollen bannen. Noch einmal düpierte ihn der Entführer keinesfalls.
Erst danach gestattete er sich eine von nervöser Ungeduld erfüllte Ruhephase. Während er eine weitere Tasse Kaffee trank, rekapitulierte er das Gespräch. Die Stimme mit dem vermeintlich deutschen Akzent sowie die Tatsache, dass Mel englisch gesprochen hatte, beförderten die Vermutung, dass ein Fremdländer hinter der Entführung stand. Das erfüllte den Vater insofern mit Zuversicht, als sich ihm erschloss, dass chinesische Geiselnehmer das Opfer erbarmungslos zu liquidieren tendierten, sofern sie eine Chance erkannten, an das Lösegeld zu gelangen. Bei Ausländern bestand Hoffnung auf berechnende Professionalität.
Gleichwohl zeigte er Bereitschaft, jeder Forderung nachzukommen, falls notwendig zahlte er auch mehr als eine Million. Für Mel übte er ohne zu zögern auf sein gesamtes Vermögen Verzicht. Koste es, was es wolle, er forderte die Tochter unversehrt zurück.
Allerdings mied er jede defensive Position. Wenn er sich schon die Mitarbeit der Polizei verbot, benötigte er Unterstützung von anderer Seite. Die Kontakte zur chinesischen Unterwelt verwarf er sogleich. Entweder beteiligte sich ein kriminelles Subjekt an der Entführung oder erkannte eine Chance, zusätzliches Kapital aus der Angelegenheit zu schlagen, wenn er von dem Verbrechen erfuhr. Ein geschwächter Jack böte zweifellos eine ausgezeichnete Gelegenheit, dessen Imperium Schaden zuzufügen. Mit derartigen Personen verhandelte man aus einer Position der Stärke heraus.
Zudem bekräftigte ihn die englische Intonation in der Überzeugung, dass die chinesische Unterwelt die Hände in Unschuld wusch. Einem Ausländer Vertrauen entgegenzubringen, erachtete man in solchen Kreisen als tabu.
Der deutsche Akzent beförderte eine Inspiration. Wenn überhaupt jemand die Fähigkeit besaß, ihm in der Angelegenheit Hilfe angedeihen zu lassen, dann Frank Tanner, ein bundesdeutscher Businessman. Der hatte in China bereits einige heikle Operationen erfolgreich zum Abschluss gebracht. Jack sann über die Frage nach, wie jener sich überzeugen ließ, ihm beizustehen. Anlässlich eines Treffens in der Vergangenheit hatte er verwundert registriert, mit welchem Geschick jener in diesem Land zu agieren verstand. Allerdings war er vor Jahren in seine Heimat zurückgekehrt.
Umgehend beauftragte er Liu Wei, essenzielle Auskünfte über Frank Tanner zu recherchieren. Insbesondere Telefonnummer, E-Mail-Adresse, möglichst jede ihm dienlich erscheinende Information. Und zwar bitte ohne Zeitverzug.
Nach dem Telefonat lehnte er sich in der Hoffnung Entspannung zu finden zurück. Endlich leistete er einen Beitrag zu Mels Befreiung. Hinfort kam es auf jede Stunde an.
Gleichwohl besann er sich und wählte erneut Liu Wei an. Als er im Hörer dessen Stimme vernahm, befahl er in grimmig entschlossener Intonation: »Die Telefonnummern sowie die E-Mail-Adresse brauche ich sofort. Das Dossier über Tanner zu erstellen, erfordert möglicherweise Zeit.«
Nach Beendigung des Telefonats rief er seinen Finanzchef an und erteilte ihm eine detaillierte Instruktion zur Beschaffung des Gelds. Er betonte explizit, er benötige gebrauchte Scheine. »Eine Mischung aus Fünfzig- und Zwanzigdollarnoten.«
Der verstand zwar das Begehren Yangs, die Beweggründe der befremdlichen Forderung regten allerdings zu Reflexionen an. Gleichwohl erschloss sich ihm, er wurde für Taten bezahlt. Einen Befehl des Chefs zu hinterfragen, war in seiner Stellenbeschreibung unerwähnt geblieben. Dennoch vermutete er ein dunkles Geschäft im Hintergrund.
Kapitel 3
Ich unterzog soeben die über Nacht eingegangenen E-Mail-Nachrichten einer kritischen Prüfung. Bei dieser Tätigkeit verfluchte ich zuweilen all jene Zeitgenossen, die der Angewohnheit huldigten, jedermann auf Kopie zu setzen, insofern mich das zwang, endlose Auslassungen zu irrelevanten Themen einer Überprüfung zu unterziehen; Vorgänge, die mich, falls überhaupt, nur am Rande tangierten. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass sich der Verfasser im letzten Abschnitt auf ein Projekt bezog, das möglicherweise in Zukunft meine Aufmerksamkeit zu erregen versprach.
Einige private Mitteilungen von Freunden und kaum geschäftliche Korrespondenz heute, registrierte ich hinlänglich mit dem Schicksal versöhnt. An einem Freitag übte ich mich ohnehin bereits in der mentalen Vorbereitung auf das bevorstehende Wochenende. Unter Umständen sollten wir ein Barbecue in Erwägung ziehen oder das Speisenangebot im neueröffneten Restaurant im Nachbarort einer persönlichen geschmacklichen Inspektion unterziehen. Von jedermann vernahm man nur Lobeshymnen über die dort praktizierte Küchenkunst.
Ich hob soeben an, mich an einer Tasse frischen Kaffee zu delektieren. Da sich das Büro im Souterrain des Hauses befand, musste ich für das Begehren die Kellertreppe erklimmen. Die Gattin beteuerte zwar, das unentwegte treppauf; treppab garantiere eine leistungsfähige Konstitution, empfahl jedoch gleichzeitig die Investition in einen Kaffeeautomaten fürs Kellergeschoss, wie sie meinen Arbeitsbereich zu bezeichnen pflegte. Eine widersprüchliche Forderung, wie so manches, das sie mir vorzuhalten geruhte. Als ich soeben die Treppe erklomm, rief mich das Klingeln des Telefons zurück. Ich stellte eiligst die leere Tasse ab, ergriff den Hörer und meldete mich.
»Good evening«, erscholl unvermittelt eine Stimme aus dem Apparat. Ein Ferngespräch aus Asien, folgerte ich.