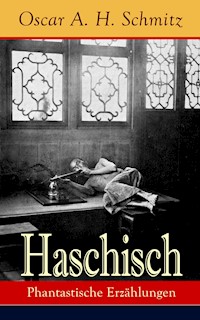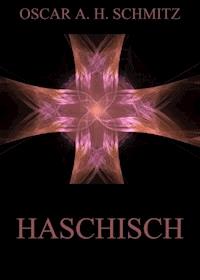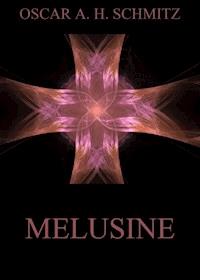
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk kann nicht anders als unvollkommen sein. Vollkommene Kunstwerke werden erst wieder möglich sein, wenn der Künstler von neuem in einer sicheren Weltanschauung wurzelt, deren Gehalt er nicht selbst zu entwickeln braucht, sondern bei dem Leser als bekannt und anerkannt voraussetzen darf. Davon ist heute in dieser größten Wendezeit seit der ausgehenden Antike nicht die Rede. Ein Werk zählt schon mit, wenn es sich bemüht, den Sinn bewußt zu machen, der durch all das Zeitchaos hindurch nach Ausdruck und Gestalt ringt. Falls man diesem Buch nichts anderes als solches Verdienst zuerkennen wollte, würde sich der Verfasser reichlich für seine Mühe belohnt fühlen. Der Roman eines Staatsmanns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Melusine
Oscar A. H. Schmitz
Inhalt:
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Melusine
An den Leser
Ancien régime
Im Elfenbeinturm
Restauration
Widerspiel
Zeitwende
MelusineA. H. Schmitz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635497
www.jazzybee-verlag.de
Oscar Adolf Hermann Schmitz – Biografie und Bibliografie
Deutscher Bohéme-Schriftsteller, auch bekannt als Oscar A. H. Schmitz, geboren am 16. April 1873 in Bad Homburg vor der Höhe, Hessen, verstorben am 17. Dezember 1931 in Frankfurt am Main. Schulische Ausbildung am Städtischen Gymnasium in Frankfurt, das Abitur legte er allerdings am Philippinum in Weilburg ab. Studierte anschließend u.a. Jura, Philosophie und Kunstgeschichte in Heidelberg, Leipzig, München und Berlin. Ab 1894 lebte er in München. Brach 1895 sein Studium ab und widmete sich, dank guter finanzieller Ausstattung durch den Tod seines Vaters, dem Reisen und Schreiben. In München geht er auf im Leben der Bohème in Schwabing und interessiert sich immer mehr für esoterische Themen, aber auch Satanismus und Sadismus. Auch kommt er in Kontakt mit Drogen. Immer wieder zieht es ihn auch auf Reisen durch ganz Europa, Teile von Afrika und Russland. Die letzten Jahre seines Lebens interessiert er sich auch zunehmend für Psychologie und Psychoanalyse. Er stirbt an einer Leberkrankheit.
Wichtige Werke:
Orpheus,1899Haschisch, 1902Der weiße Elefant, 1902Halbmaske, 1903Der Herr des Lebens, 1905Don Juanito, 1908Brevier für Weltleute, 191Wenn wir Frauen erwachen, 1912Der hysterische Mann, 1914Die Kunst der Politik, 1914Das wirkliche Deutschland: Die Wiedergeburt durch den Krieg, 1915Ein deutscher Don Juan, 1917Menschheitsdämmerung, 1918Das rätselhafte Deutschland,1920Melusine
Der Roman eines Staatsmannes
Widmung
Ich widme dieses Buch der Jugend, soweit sie bereit ist, zu erwägen, daß in die gewandelte Zeit die alten abendländischen Kulturwerte, wenn auch in veränderter Gestalt, gerettet werden müssen, sowie den Männern des tätigen Lebens, die nicht leicht Romane lesen, weil sie darin meist den Sinn ihres Daseins vermissen. Wenn ich die Frauen, meine treusten Leser, nicht besonders bedenke, so mögen sie mir verzeihen, aber, was in dem Werk über Frauen gesagt ist, wissen sie heimlich besser, als der Verfasser, und vielleicht ist es ihnen gar nicht recht, daß er aus der Schule plaudert.
O. A. H. S.
An den Leser
Dieses Werk kann nicht anders als unvollkommen sein. Vollkommene Kunstwerke werden erst wieder möglich sein, wenn der Künstler von neuem in einer sicheren Weltanschauung wurzelt, deren Gehalt er nicht selbst zu entwickeln braucht, sondern bei dem Leser als bekannt und anerkannt voraussetzen darf. Davon ist heute in dieser größten Wendezeit seit der ausgehenden Antike nicht die Rede. Ein Werk zählt schon mit, wenn es sich bemüht, den Sinn bewußt zu machen, der durch all das Zeitchaos hindurch nach Ausdruck und Gestalt ringt. Falls man diesem Buch nichts anderes als solches Verdienst zuerkennen wollte, würde sich der Verfasser reichlich für seine Mühe belohnt fühlen.
Vorbemerkung
Das Land Harringen wird der Leser vergeblich auf der Karte suchen. Trotzdem muß ich ihm zumuten, während des Verlaufs dieser Erzählung an die Wirklichkeit dieses Landes zu glauben. Mit Vergnügen wird er sagen, das ist offenbar eine phantastische Geschichte. Nein, das ist es nicht, und darin liegt die Zumutung an den Leser, daß die Handlung innerhalb unserer bekannten europäischen Welt spielt und doch zum großen Teil in einem erfundenen Lande.
Wer von dieser Einleitung noch nicht genug hat, der lasse sich über das Land Harringen folgendermaßen belehren: es ist zwischen Österreich und Bayern gelegen und hat ungefähr die Größe eines dieser beiden Länder. Wie diese ragt es im Süden in die Alpen hinein. Gen Norden dacht sich eine Hochebene ab, auf der die Hauptstadt Rolfsburg mit etwa einer halben Million Einwohner liegt. Die Bevölkerung ist wie in Österreich und Bayern bajuwarisch. Die Herzöge von Harringen, die Rolfinger, gehörten zur Zeit Napoleons dem Rheinbund an und wurden gleich den Wittelsbachern bei dieser Gelegenheit zu Königen gemacht. 1871 trat Harringen nicht dem Deutschen Reiche bei, sondern nahm eine ähnliche Stellung ein wie Luxemburg. Trotzdem teilte es die Schicksale seiner beide Nachbarvölker im Weltkriege und während der Revolution, durch die das Haus Rolfingen den Thron verlor. Der Anschluß an Deutschland, den nun manche Kreise wünschten, wurde dem Lande, ebenso wie Österreich, durch den Vertrag von Versailles fürs erste unmöglich gemacht.
Nun wird der Leser fragen, warum es nötig war, das Land Harringen zu erfinden, wo doch unser Herrgott dem Romanschriftsteller Osterreich und Bayern als frei verfügbare Schauplätze hingelegt hat. Der Grund ist der, daß nach 1918 Harringen seine eigenen Wege ging und eben diese schildert zum Teil dieser Roman, in dem, wie gesagt, im übrigen unsere deutsche, ja die europäische Welt so vorausgesetzt wird, wie sie heute ist.
Erstes Kapitel
Ancien régime
I.
Dies ist die Geschichte der beiden Brüder Erich und Ferdinand, der letzten Abkömmlinge der einst am Rhein berühmten Familie Holthoff.
Erst waren die Holthoffs Bauern gewesen, die ihren Stammbaum, wie nur wenige bürgerliche Familien Deutschlands, bis in den dreißigjährigen Krieg zurückführen konnten. Handwerker verschiedener Art, vom Schmied bis zum Schneider, sind unter den Vorfahren beglaubigt. Dann studierten sie und gaben dem Land manchen bekannten Juristen und Theologen. Später verdienten sie Geld, sandten Schiffe übers Meer, dienten Fürsten oder wurden städtische Senatoren. Auch an nichtsnutzigen Subjekten fehlte es nicht. Im 18. Jahrhundert wurde einer gehängt, weil er sich seinen Bedarf an Geld selber herzustellen pflegte; unter Napoleon III. gab es in Paris eine bekannte Tänzerin und berüchtigte Männerfresserin, eine geborene Holthoff. Noch der Bankier Fabian Holthoff, der Vater Erichs und Ferdinands, wurde einmal durch einen dem Spiel ergebenen Bruder, der schließlich durch Selbstmord endete, dicht an den Ruin gebracht, fand aber Hilfe und hat durch seine Zähigkeit die Krise beschworen.
Er war nach den Begriffen der siebziger und achtziger Jahre der Typus eines schönen Mannes mit fächerförmigem, schwarzem Vollbart, gewölbter, in eine blanke Glatze übergehender Stirn und humorvoll blitzenden grauen Augen, die zusammen mit den sinnlich geschwungenen, gern lachenden Lippen die Freude an heiterem Mahl verrieten. Jeden Morgen, im Sommer wie im Winter, zog der anständige Mann eine frische weiße Pikeeweste an.
Diese lebensfrohe, allem öffentlichen Treiben fremde Persönlichkeit geriet nun durch ihr unbefangenes Temperament eines Tages in eine Lage, die ihr über Nacht einen politischen Charakter gab. Es gehörte bekanntlich zu der Politik Wilhelms II., die alten Patriziergeschlechter der westlichen Städte durch Verleihung des Adels fester an den Thron zu knüpfen. Darüber pflegte Fabian Holthoff oft zu lächeln, und bekannt war der Ausspruch des weit herumgekommenen Rheinländers, dessen Auftreten und Lebensführung eines großen Stils nicht ermangelten, der Kaiser glaube wohl, die alten Bürgerfamilien seien weniger vornehm, als der ostelbische Kleinadel, und dem müsse rasch durch die Zufügung der Partikel an den Namen abgeholfen werden. Nach einem guten Mahl mit erlesenen Weinen fand man solche Bemerkungen köstlich, ohne sie allzu ernst zu nehmen; als aber eines Tages Holthoff nach einem ähnlichen Privatgespräch mit dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz das Gefühl hatte, seine wahre Ansicht in dieser Frage sei eben sondiert worden, da dauerte es nicht mehr lange, bis der Kaiser zu seinem hellen Ärger erfuhr, daß die eine und die andere rheinische Familie die geplante Auszeichnung nicht wünsche, da sie damit zugeben würden, sie seien früher weniger, als der preußische Adel gewesen. Obwohl sich der Widerstand in die loyalsten Formen kleidete – man versäumte keine Gelegenheit, zu versichern, daß die Hingabe an Kaiser und Reich auch ohne jene Auszeichnung über allen Zweifel erhaben sei –, war der Monarch unversöhnlich gekränkt, und er wußte wohl, daß der Urheber dieser Stimmung – denn mehr wahr es nicht, von einer »Bewegung« konnte füglich nicht gesprochen werden, – der Bankier Fabian Holthoff war, derselbe, der ihn so oft durch Erzählung rheinischer Witze, sogenannter »Krätzjer«, ergötzt hatte.
Freilich konnte in Fabian Holthoff nichts von der blutgebundenen Anhänglichkeit des preußischen Junkers an das angestammte Fürstenhaus sein, aber er nannte sich aufrichtig einen konstitutionellen Monarchisten, einmal aus vernünftiger Erwägung der verschiedenen Staatsformen, dann aber auch aus persönlicher Sympathie für den edlen Großvater Wilhelms II., mit dem er erst in geschäftlicher, dann in persönlicher Verbindung gestanden war. Die Beziehungen hatte der junge Kaiser gern übernommen, da er ja keine Eigenschaft an einem Mann mehr schätzte, als Munterkeit bei Tisch. Mit diesem zweifellosen Vorzug verband aber leider Fabian Holthoff gerade jene andere Eigenschaft, die dem Kaiser nun einmal in den Tod verhaßt war, nämlich persönliche Selbständigkeit, und so brach er die Beziehung schroff ab. Bei allen staatlichen Geschäften wurde das Bankhaus Holthoff künftig geflissentlich übergangen. Das hinderte freilich Fabian Holthoff nicht, sich weiter seinen Burgunder und seine Havanna wohl munden zu lassen; unangenehm war ihm nur, daß seine rein persönliche Haltung oft mit jenem engen partikularistischen Protestlertum verwechselt und eben darum gepriesen wurde, während seinem freien Kopf und seinem weiten Herzen nichts ferner lag. Diese Ereignisse sollten, wie wir gleich sehen werden, die Laufbahn seines ältesten Sohnes Erich entscheidend beeinflussen.
Obwohl Fabian Holthoff genau das darstellte, was die Allgemeinheit von einem vornehmen Bürger erwartete, so hatte er sich doch sein Leben lang nie nach allgemeinen Maßstäben gerichtet. War aus seinem Wesen schließlich ein gültiger und anerkannter Typus geworden, so sind doch seine Triebfedern immer ganz persönlich gewesen. Vor allem hatte er in ganz unkonventioneller Weise geheiratet. Seine Frau, Consuelo, war, ehe er sich mit ihr vermählte, Erzieherin seiner jüngeren Geschwister und auf nicht gewöhnliche Weise in das Haus Holthoff gekommen. Ihr Vater, ein noch mehr in der Lebensführung, als in seiner Kunst genialer Maler, der als Spätromantiker in der vorigen Jahrhundertmitte geblüht, hatte das Kind aus kurzer Ehe mit einer amerikanischen Pflanzerstochter in den Südstaaten von einem mehrjährigen Aufenthalt in deren Heimat als junger Witwer mit nach Hause gebracht. Später schleppte er das exotische Geschöpf, das von der Mutter einen spanischen, wenn nicht indianischen Bluteinschlag hatte, in halb Europa herum. Sie besuchte Schulen in Paris und Rom, führte dazwischen als halbes Kind den skizzenhaften Haushalt bald in abgelegenen bretonischen Fischerdörfern, bald am Rand der Sahara, wurde unversehens in Brokat- und Schleiergewänder gesteckt oder auch wohl halb entkleidet, um in den verschiedensten Stellungen gemalt zu werden. Schließlich nahmen sich angesehene Gönner des Künstlers in dessen süddeutscher Heimat des bezaubernden Kindes an, erzogen es auf dem Land mit den eigenen Töchtern, die es später auf ein Jahr in ein Sacrécœurkloster begleitete. Bald darauf starb Consuelos Vater, und nun wurde sie auf Grund ihrer ausgezeichneten Sprachkenntnisse als Erzieherin im Hause Holthoff untergebracht. Zu diesem Amt eignete sich freilich das gleich einem Eichhörnchen bewegliche, schwärmerische Geschöpf nicht, desto besser aber zur Lebensgefährtin des ältesten Sohnes, dessen mit Geschäften ausgefüllten Tagen ihr ewig zwischen flüchtigen Launen und tiefer Leidenschaftlichkeit wechselndes Temperament einen fantastischen Hintergrund gab. Bis zu seinem in den neunziger Jahren eintretenden Tod blieb sie ihm ein ewig frisches Naturereignis. Kaum aber war er gestorben, da verfiel die noch nicht Fünfundvierzigjährige schnell. Ihre elastische Spannung schien plötzlich aufgehoben. Da war auf einmal eine alternde, fett werdende Frau, die nicht mehr zu bewegen war, die still gewordene Holthoffsche Villa und den einsamen Garten für einen Spaziergang, geschweige denn eine Reise, zu verlassen. Sie lag im Dunkel wie eine alte Katze. Bis zu ihrem Tod besuchten sie von Zeit zu Zeit ihre beiden, nun erwachsenen Söhne Erich und Ferdinand, aber es war fraglich, wie viel die halb Taube noch von dem in sich aufnahm, was man ihr in ihr schwarzes Hörrohr schrie, das weniger wie ein Verbindungsmittel mit der Welt wirkte, als wie ein gegen sie gerichtetes Instrument der Abwehr. Eines Tages ging sie tonlos ein, wie ein Tier des Waldes, dessen Lebenskräfte aufgebraucht sind.
II
Als Erich Holthoff anfangs der neunziger Jahre, um die Rechte zu studieren, die Universität Bonn bezog, war er für seine Jahre schon recht umfassend gebildet. In den oberen Gymnasialklassen hatte ein Lesekränzchen bestanden, wo die Auslese der Schüler Literatur, Philosophie und besonders Geschichte trieb. Erich rühmte sich, kein Schöngeist zu sein, und seinem Einfluß war es hauptsächlich zuzuschreiben, daß jenes Kränzchen nicht ausschließlich literarischen und künstlerischen Interessen huldigte. Seine Helden waren die großen Staatsmänner der Geschichte, Solon, Perikles, Cäsar, Augustus, Constantin der Große; sogar mit Richelieu und Disraeli hatte er sich schon beschäftigt, und, wie in jener Zeit unvermeidlich, stand er stark unter der Wirkung Bismarcks. Freilich erfüllten ihn diesem gegenüber auch manche Zweifel, die der Vater in ihm nährte.
Die Holthoffs waren Katholiken, und zwar ohne jeden Fanatismus. Die ererbte Religion galt in der Familie als eine Selbstverständlichkeit, ihre Forderungen erfüllte man ruhig, aber gesprochen wurde darüber wenig. Was man den alten Holthoff an Bismarcks Kulturkampf gegen die Kirche besonders unangenehm berührte, war, daß dadurch das Ruhende plötzlich aufgerüttelt wurde. Sein weltliches Leben hatte sich immer ganz gut mit der katholischen Praxis vertragen, doch ein ausgesprochenes Betonen von Dingen, die man am besten mit sich allein abmacht, war ihm in der Seele verhaßt; nun aber wurde er durch seine Stellung gezwungen, Partei zu ergreifen, ja gelegentlich öffentlich für einen Glauben zu sprechen, den er zeitlebens gefühlsmäßig gehegt hatte, ohne sich viel um seine Argumente zu kümmern. In der Tat, eine widerwärtige Lage für einen heiter vertrauend dem Leben zugekehrten Mann, dem auch die Religion ein gern hingenommenes Stück Leben ist, nicht eine diskutierbare Lehre, für oder gegen die man auftreten kann.
Erichs Voraussetzungen waren anderer Art, wenngleich sie zu derselben Haltung führten. Im Gegensatz zu seinem Vater erfaßte er die Welt vorzugsweise mit dem Gedanken, aber er war von jenem, die helleren Köpfe seiner Generation auszeichnenden Skeptizismus erfüllt. Dieser wendete sich nicht gegen die Religion, sondern gegen die bereits die Massen ergreifende Freigeisterei, die für jede Erscheinung des natürlichen und seelisch-geistigen Lebens sofort eine platte Vernunfterklärung bereit hält, dagegen ließ er Religion als bedeutende Erscheinung des menschlichen Lebens wieder mit Toleranz gelten. Erich und seine Freunde warfen nun Bismarck vor, daß er gegen diese fehlte und sein gröbliches Vorgehen obendrein Kulturkampf nannte, und was gar das Sozialistengesetz betraf, so fühlte er als Glied der die Zukunft tragenden Generation deutlich den schweren Mißgriff.
Eine so ausgesprochene kritische Haltung bei einem so jungen Mann wirkte begreiflicherweise auf seine Umgebung als unausstehlicher Hochmut. Er verspottete zudem alles, was dadurch, daß es in die Hände einer Vielheit geraten war, notgedrungen mittelmäßig wurde, mochte es uranfänglich noch so vorzüglich gewesen sein. Er liebte die auf dem Gymnasium gelehrten Wissenschaften, aber der Schulbetrieb und seine pedantischen Vertreter schienen ihm lächerlich, nicht minder aber die Mühseligen und Beladenen, die darunter ächzten, weil sie ihn zu ernst nahmen. Darum hatte er nicht die geringste Anlage zum Revolutionär, wohl aber zum Frondeur, der rein individuell seine Rechte wahrt. Dies tat er sehr bald nicht mehr durch zur Schau getragenen kindischen Trotz, sondern durch eine früh in ihm zu Tage tretende eigentümliche Fähigkeit: er »behandelte« Lehrer und Angehörige, mit Ausnahme des Vaters, der bei derartigen Versuchen von Anfang an mit einem verständnisvollen Lächeln geantwortet hatte. So blieb er der einzige, den Erich als voll nahm. Dies alles vollzog sich so leicht und selbstverständlich, daß es eine frühe Menschenverachtung in dem Jüngling zeitigte, die aber, da sie nicht auf Enttäuschungen, sondern auf leichten Siegen beruhte, nicht Menschenhaß wurde. Nur wen er in seine vertraute Sphäre einließ, der entdeckte die Eigenschaften seines Herzens: vor allem neidlose, gern anerkennende Kameradschaft und Großmut gegen Geringere. Auf die meisten aber wirkte er anmaßend, kalt, ja berechnend.
In Bonn folgte er seinen zwei besten Freunden vom Gymnasium ohne eigentliches Widerstreben, aber auch ohne besondere Begeisterung in ein Korps. Dort kam er nun in einen Kreis ausgesprochener Bismarckverehrer, darunter Söhne und Enkel von solchen, die einst Bismarck heftig und oft aus kleinen Motiven bekämpft hatten. Bald merkte er, daß diese Bewunderung blind war, und daß jeder Versuch von Kritik einen sofort in den Verdacht eines hämischen Nörglers brachte. Ja das, was Erich, als einen Sohn alter westlicher Zivilisation, abstieß, und was er Bismarck allenfalls wegen seiner Größe verzeihen konnte, eben das gefiel gerade diesen jungen aristokratischen Anarchisten. In der Debatte mit ihnen gewann indessen sein inneres Wunschbild vom modernen Staatsmann, während er es verteidigen mußte, immer festeren Umriß.
Seine neuen Kommilitonen, in deren Treiben er die beiden Schulfreunde bald trotz ihrer besseren Tradition fröhlich aufgehen sah, waren meist Ostelbier, unter denen der Adel vorherrschte. Oh, sie verfügten über recht gute, wenn auch etwas steife und veraltete Formen, aber sie vermochten sie auch sehr leicht abzulegen, wie man ein Festgewand auszieht, und dann kam, besonders unter alkoholischem Einfluß, eine bisweilen erschütternde Primitivität des Denkens und Fühlens zum Vorschein. Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß glaubten sie sich künftig zur Herrschaft im Lande berufen, schienen auch wohl bereit, in späteren Jahren ernste Pflichterfüllung zu üben, aber von einem Verstehen und Erfühlen der lebendigen Kräfte des Landes war nicht nur keine Rede, sie wußten gar nicht, daß es so etwas gibt, und daß gerade dies eine Grundeigenschaft des Führers ist. An Eingehen auf Individualität und Psychologie des vergötterten Bismarck dachte keiner. Er war ein Mythos wie Siegfried und Barbarossa, und sie wußten im einzelnen nicht viel mehr von ihm, als von jenen Gestalten grauer Vorzeit.
Die aus gräflichen Häusern Stammenden waren stolz auf ihr Französisch und glaubten dadurch allein zum diplomatischen Dienst fähig zu sein. Notgedrungen war etwas von der geistigen Verfeinerung auf sie übergegangen, die bei einiger Beherrschung der gallischen Ausdrucksweise unvermeidlich ist, aber ihre französische Kultur blieb eine kleine Insel in ihrem Mikrokosmos und beeinflußte nicht im mindesten ihr deutsches Menschentum. Sie waren durchaus fähig, in das bisweilen rüde Gebahren der anderen mit einzustimmen. Diese schienen ihr hausbackenes, engstirniges Preußentum, das ohne höhere Instruktion keine Verantwortung im Handeln wie im Denken zu übernehmen wagte, überschreien zu wollen durch neudeutsche, rücksichtslose Herrenallüren und ein unerträgliches Besserwissertum. Solche völlig triebhafte Einstellung, die einigen ganz schablonenmäßigen Formen kollektiven Denkens folgte, machte es möglich, daß diese Jünglinge ebenso wie den »greisen Kanzler«, den »jungen Kaiser« verehrten. Ein fachliches Gespräch über das, was zwischen beiden Männern vorgegangen war, blieb dem Untertanenverstand dieser künftigen Führer tabu. Derartige Untersuchungen waren ihrem Geist, der sich stundenlang mit Stammbäumen und heraldischen Fragen unterhalten konnte, worin sie ein bewundernswürdiges Wissen und vor allem Gedächtnis zeigten, schon zu verwickelt. Erich wurde daher von ihnen lachend ein Bücherwurm gescholten, aber, da er kaltblütig blieb und seine Ansichten nicht zwecklos unterstrich, blieb der kameradschaftliche Ton ungestört.
Immerhin wurde er von ihnen als Fremdkörper empfunden. Schon sein Äußeres fiel auf. Zwar hinderte die kräftige, hohe, niederdeutsche Gestalt, daß ihn seine, von der Mutter geerbte brünette Gesichtsfarbe als Südländer erscheinen ließ, dagegen wirkte sein starker, fast schwarzer Haarwuchs befremdend, zumal er, wenn auch ohne Künstlerextravaganz, das Haar etwas länger trug, als diese meist Blonden, die das unentrinnbare Schicksal frühzeitiger Kahlheit vorwegnehmen zu wollen schienen, indem sie den noch vorhandenen, wenngleich dünnen Segen der Schere oder gar dem Rasiermesser opferten. Ferner hob sich von den meist hübschen rosa Knabengesichtern Erichs schon ausgesprochener Kopf ab, der nicht eigentlich jugendlich wirkte. Gegen die damalige Mode rasierte er sich den keimenden Schnurrbart, während die anderen dieses Zeichen der Manneswürde liebreich pflegten. Sie nannten ihn darum oft scherzend einen »ollen Römer«, was er sich nicht ungern gefallen ließ.
Seine Erfahrungen machten ihn recht nachdenklich. Bald erkannte er als die tiefste Ursache der deutschen Uneinheitlichkeit und Uneinigkeit den Umstand, daß die deutschen Landschaften nicht nur an der europäischen, sondern selbst an der deutschen Kultur in sehr ungleichem Maß Teil haben und sich daher in ganz verschiedenem historischem Alter befinden. An seinen Kameraden war die Antike spurlos vorübergegangen, das Mittelalter hatten sie noch nicht verdaut. Wenn sie auch die gleichen Worte wie er gebrauchten, so waren diese Worte von anderen Gefühlstönen getragen, ja war das überhaupt noch dieselbe Sprache? Konnte es ihm doch geschehen, daß er, nachdem er vor ihnen einen Gedankengang etwas eingehender als üblich entwickelt hatte, in Verlegenheit geriet, weil er fühlte, daß den plötzlich Verstummten seine durchdachte Ausdrucksweise fremd war und gesucht oder anmaßend erscheinen mußte.
Mit dem jungen Grafen Egon, der als Sohn eines Diplomaten oft im Ausland geweilt hatte, verstand er sich in dieser Hinsicht recht gut, nur schien ihm, daß dieser die Dinge doch etwas zu leicht und witzig nahm. So hatte er Erichs Betrachtung darüber, daß die anderen noch im Mittelalter lebten, etwas verbogen seiner verwitweten Mutter als ein köstliches »bonmot« nach Hause geschrieben, und die alte Dame äußerte den Wunsch, den geistreichen Freund ihres Sohnes kennen zu lernen. Erich folgte ihm über die Pfingstferien auf dessen Gut jenseits der Elbe.
Die alte Dame mit der weißen Löckchenperücke und den noch sprühenden, schwarzen Augen fand den jungen Rheinländer sehr charmant, verriet aber darüber schon beim Empfang eine solche Überraschung, daß es fast an Beleidigung grenzte. Sie zeigte sich geradezu übereifrig, um es Erich, dem ersten Bürgerlichen, den sie in ihrem Schloß als Gast beherbergte, behaglich zu machen, und als sie ihm beim Tee das Gebäck reichte, sagte sie:
»Bitte tunken Sie nur!«
Erich wehrte lächelnd ab, aber sie drang in ihn:
»Nein, Sie sollen sich zu Hause fühlen bei uns, ich weiß, daß Ihresgleichen gern tunken.«
Graf Egon litt Qualen, aber Erich fand das ihn erlösende Wort:
»Ich hoffe, Gräfin, daß mich Egon in den Sommerferien besucht, und dann kann er Ihnen von unseren Sitten am Rhein Bericht erstatten.«
Die alte Dame war etwas betreten, aber sie fand schnell einen Ausweg.
»Ach ja,« rief sie aus, »vom Rhein, erzählen Sie vom Rhein, ich kenne das Land dort nur wenig.«
Sie nahm übrigens Erich seine Antwort nicht übel, sondern fand ihn exzellent bis zum letzten Tag, ja sie fühlte etwas wie Dankbarkeit, weil er es ihr so leicht gemacht hatte, gleich den rechten Ton zu finden, den sie nun nicht wieder verfehlte.
Auf der Rückfahrt nach der Universität fragte sich Erich indessen, ob es ihm je möglich sein würde, in diesem Land seine Träume zu verwirklichen. Nicht an einer langwierigen Beamtenlaufbabn war ihm gelegen, in der man durch die von ihm subaltern genannten Tugenden des Fleißes, der Geduld und der Beliebtheit zum Ziel kam, sondern noch immer schwebte ihm das Bild des Staatsmannes vor. Zu dessen Verwirklichung war notwendig, daß man ihn oben bemerkte und der vorgeschriebenen Bahn entzog, um ihn an eigentlich politischer Tätigkeit teilnehmen zu lassen. Wie aber sollte er in Preußen anders, als unliebsam auffallen, zumal er als Sohn seines Vaters von vornherein bei der allerhöchsten Stelle auf die größten Vorurteile stoßen würde?
Diese Pfingstreise war die erste große Enttäuschung, die er erlebte, und sie hatte darum jene unverhältnismäßige Wirkung, die erste Blicke in den Hintergrund des Lebens stets auf junge Menschen haben, welche sich bisher vorgestellt hatten, die Welt sei eine Auster, die sie berufen seien, mit einem Schwert zu öffnen. Erich verfiel in tiefe Trübsal und Gleichgültigkeit für Gegenwart und Zukunft.
III
Ganz anders hatte sich Erich's um ein paar Jahre jüngerer Bruder Ferdinand entwickelt. Er war ein träumerischer blasser Knabe gewesen, der infolge seiner Kurzsichtigkeit schon früh eine Brille tragen mußte. Als der Jüngere und stets etwas Hilflose wurde er von der Mutter und den weiblichen Dienstboten sehr verhätschelt. Zu dem älteren Bruder blickte er voll Verehrung empor. Der war aber auch wirklich verehrenswert. Mit 15 Jahren gründete er ein »Ministerium«, in das er seine besten Freunde berief, von denen jeder sich aus den Umschlägen alter Wachstuchhefte ein »Portefeuille« herstellte. Die übrige Klasse galt als das beherrschte Volk, aber es ging damit, wie mit dem Erdkreis des Sultans: einige Grenzvölker erkannten die Herrschaft des Padischah nicht an, wußten sogar nicht einmal recht, daß sie verfügt war, und das führte zu dauernden Kriegen, auch etwa vertragsmäßigen Anerkennungen souveräner Gruppen. Eines Tages wurde Ferdinand eröffnet, er habe im Auftrag des »Ministeriums«, zu dessen geheimen Sitzungen er bisher nie zugelassen worden war, unter dem Titel eines Kardinals die geistliche Macht zu übernehmen. Ohne zu ahnen, was das wohl sein mochte, erklärte er sich sofort freudig dazu bereit, und er brauchte es nicht zu bereuen. Er hatte bei Beginn der Schlachten, von denen selbst ihn zu seiner Genugtuung die ihm verliehene geistliche Würde ausschloß, Messen zu lesen und nach erfolgtem Sieg auf dem Harmonium das Tedeum zu spielen. Zur Abschließung politischer Verträge wurden die früheren Feinde in die Holthoffsche Villa zu Schokolade und Kuchen geladen und mußten dann auf eine Oblate in Ferdinands blasser Hand Friede und Treue schwören. Die sich bewährten, erhielten später den Titel Sekretär, der ihnen sehr gefiel. Aus dem »Ministerium« entwickelte sich dann in reiferen Jahren das schon genannte Kränzchen, in dem Ferdinand mehr die literarischen und künstlerischen Interessen vertrat. So waren geistliche und weltliche Macht unter den Brüdern wohl verteilt.
Einer von den beiden Buben sollte auf jeden Fall einmal das väterliche Bankhaus übernehmen, und da Erich sehr entschieden erklärt hatte, sich dem Staatsdienst widmen zu wollen, während Ferdinands Neigungen nie recht ernst genommen wurden, verstand es sich von selbst, daß er nach bestandenem Abiturium in die Bank eintrat. Es zeigte sich aber sofort, daß er sich dafür ganz und gar nicht eignete, denn er addierte falsch, und wenn er sich dadurch helfen wollte, daß er die Rechnung dreimal wiederholte, wurde das Übel immer schlimmer, denn statt einer hatte er nun drei falsche Zahlen. Er wiederholte dann die Operation so lange, bis dieselbe Zahl mehrere Male erschienen war, und entschied sich dann dafür sozusagen durch Mehrheitsbeschluß. Er war natürlich höchst unglücklich.
Infolge eines Gesprächs, das Erich im vierten Semester mit dem nun ernstlich herzleidenden Vater hatte, den es tief schmerzte, sein Lebenswerk wohl in fremde Hände übergehen lassen zu müssen, nahm das Schicksal der Brüder eine entscheidende Wendung.
Erich war aus dem Korps ausgetreten, einmal weil es ihn maßlos gelangweilt hatte, dann aber auch, weil er sich nicht durch ein zerhacktes Gesicht etwaige Möglichkeiten im Ausland abschneiden wollte. Seine innere Verstimmung war nicht von ihm gewichen. Den Studien lag er lässig ob, las indessen viel und trieb sich unter Menschen aller Kreise herum, alles mit jener sogenannten »Wurschtigkeit«, die das Zeichen enttäuschter Jugend ist. Immer mehr hatte er sich überzeugt, daß seine Hoffnungen in dem Reich Wilhelms II. nicht zu verwirklichen waren. Schien es denn unter diesen Umständen nicht wie ein Schicksalswink, daß die väterliche Bank gewissermaßen auf ihn wartete? So aussichtslos ihm eine Beamtenlaufbahn schien, so viele Möglichkeiten boten sich gerade jetzt einem Großkaufmann von Initiative. Begeisternd waren sie freilich nicht für einen, der von Cäsar geträumt hatte, aber die Bummelei des letzten Jahres mußte ein Ende nehmen. Die Liebe zu dem Vater, dessen Schmerz er verstand, gab seinem Entschluß noch einen mächtigen Gefühlsantrieb, und jener umarmte den Sohn mit feuchten Augen, als er ihm die überraschende Mitteilung machte, er sei bereit, zum Bankfach umzusatteln. Das Ereignis wurde durch ein festliches Mahl mit den Verwandten und Freunden des Hauses gefeiert, bei dem Ferdinand der Glücklichste war, denn er durfte nun nach München ziehen und Kunstgeschichte studieren.
IV
Erich begab sich gleichzeitig nach Paris, von seinem Vater an das Haus Rothschild empfohlen, wo er als Volontär Einsicht in die Geschäfte nehmen sollte. Bei einem großen Abendempfang seines Chefs machte er die Bekanntschaft von Espérance Waldegg.
Espérance war eine jung verheiratete Frau. Ihr Gatte, Graf Arthur Waldegg, befand sich bei der Harringenschen Gesandtschaft in einer wenig unterhaltlichen Hauptstadt und hatte Espérance, mit der er die Sommermonate auf der Insel Wight verbringen wollte, gestattet, einige Wochen vorher den tötlichen Ort zu verlassen und ihn in Paris zu erwarten, wohin sie schon lange von einer weitläufigen Kusine eingeladen war. Sie wirkte eher wie ein großes, aber gerade durch seine unbeirrte Naivität sehr selbstsicheres junges Mädchen. Das rötlich blonde Haar und die klassischen, wenn auch eher großen Hände sollten später in der europäischen Gesellschaft eine gewisse Berühmtheit erlangen. Das reizvollste aber war der, genau genommen, nicht schöne Mund, dessen unregelmäßige und doch nicht formlose Lippen sich dauernd im Ausdruck ihrer bald heiteren, bald staunenden oder ablehnenden Gemütsbewegungen kräuselten und dabei ein bewunderungswürdiges Gebiß entblößten.
Espérance genoß ihren Pariser Aufenthalt in vollen Zügen. Es war zum erstenmal in ihrem Leben, daß sie sich ganz frei bewegen konnte, und so unternahm sie täglich Kreuz- und Querfahrten durch die Stadt; dabei bekundete sie bereits die selbständige Eigenart der Lebensführung, die sie später auszeichnen sollte. Die Geselligkeit der verschlafenen Paläste des Faubourg St. Germain fand sie nur wenig anregender, als den Hof daheim in Rolfsburg, während die Herzoginnen und Marquisen sie darum beneideten, daß in ihrer Heimat die Sonne des Königtums noch unbewölkt leuchtete. Hingegen bot ihr der Verkehr in den reichen Häusern des republikanischen Bürgertums des Neuen nicht wenig. Dort traf man Leute, die »wirklich interessant« waren, deren Welt für Frauen aus Espérancens Kreis mit nicht weniger Romantik verklärt war, als Hofgesellschaft für die Weiblichkeit der Mittelklassen. Nur kam dazu noch ein verrucht prickelnder Duft wie von eigentlich verbotenen Früchten. Espérance spürte den verwegenen Reiz der Atmosphäre, die Männer ausstrahlten, welche entweder unbegrenzt Geld verdienen oder die öffentliche Meinung beeinflussen. Fast täglich wurden sie in den Zeitungen genannt, zwar einer Erfindung des Teufels, aber doch nur von unheimlich gescheiten Menschen zu machen, die man Abends mit halbnackten Geliebten im Theater betrachten konnte. Nun, und gar diese Frauen, die bekanntlich nach ihrem eigenen Geschmack die Mode erfinden, welche man nur ein Jahr später auch in Rolfsburg und zwei Jahre später sogar in jener tötlichen Hauptstadt sah, wo Espérance zur Zeit mit Graf Arthur ihren Wohnsitz hatte. Kurz, in dieser Welt geschah gerade das, was man daheim für indiskret, geschmack-, takt-, wenn nicht schamlos hielt, mit einer so überlegenen Sicherheit, daß man sich allen Ernstes fragen konnte, ob die daheim nicht mit ihren Konventionen einfach am Leben vorbeilebten. Das alles mußte auf Espérance wirken, wie auf eine Frau aus der Provinz der unverhoffte Anblick einer großen Kurtisane, die gerade um der Dinge willen Verehrung genießt, die man ihr bisher als das Allerschändlichste nur schattenhaft angedeutet hat, und die doch ganz entschieden ihren Reiz besitzen. Trotzdem ließ sich Espérance in der ihr neuen Umgebung nicht einen Augenblick aus der Fassung bringen. Wie vergnüglich sie auch die aus mancherlei Düften zusammengesetzte Luft mit ihren beweglichen Nasenflügeln einatmete, über das Wesen der einzelnen Menschen, mit denen sie sprach, ließ sich ihr unbefangenes Herz hier so wenig durch Ruhm oder Reichtum täuschen, wie daheim durch große Namen und Titel.
Espérance bemühte sich, nach Tisch den Polypenarmen ihres Tischherrn im Palmenfrack der Académie Francaise zu entrinnen, der sie wie mit Saugnäpfen hatte festhalten wollen. Im Gedräng der nun erst zum Empfang erscheinenden Gäste begegnete sie dem jungen Holthoff, der ihr schon vor dem Essen kurz vorgestellt worden war. »Furchtbar arrogant« war er ihr im ersten Augenblick durch Gesichtsausdruck und Ton erschienen, aber dann hatte sie ihn bei Tisch ein wenig beobachtet und interessant gefunden. Infolge der Gleichheit des Alters und der Sprache schien er ihr jetzt gerade geeignet, sich bei ihm von einem langweiligen Tischgespräch zu erholen. Sie redete ihn deutsch an, und als sie bemerkte, wie sehr den hier noch Fremden das beglückte, gab sie einem Lakei ein Zeichen, daß er die Kaffeetassen auf ein Tischchen unter den Palmen des Wintergartens stellen solle.
Erich taute sehr schnell auf und war von dieser Sicherheit einer großen Dame jünglinghaft begeistert; er ahnte so wenig, daß das große Mädchen Espérance eben zum erstenmal etwas derartiges unternahm, wie sie erkannt hatte, daß seine »furchtbare Arroganz« die Haltung des noch Ungeübten auf Glatteis war. In Rolfsburg hätte sie als junge Frau ein solches »Aparté« mit einem unbekannten Herrn nicht wagen dürfen. Hier aber befand man sich in Paris. Diese Menschen waren doch frei, Klatsch gab es sicher nicht. Wie fühlte sie sich von der Pariser Luft getragen, in der es so leicht war, zu fliegen! Mehr als eine Stunde saß sie mit Erich lachend und deutsch sprechend unter der Palme, und während es ihr sehr pariserisch schien, daß dies anging, ahnte sie nicht, daß man es ihr nur als einer Fremden von Distinktion verzieh. Besonders erstaunte sie indessen, zu finden, wie harmlos, ja kindlich sich unter vier Augen dieser grimmige Löwe zeigte, der ihr nun immer mehr als ein Löwenjunges erschien, wie sie einmal in Rolfsburg im zoologischen Garten eines auf den Arm genommen hatte.
Sie fühlte sich von Erich bezaubert. So klug er für sein Alter schon war, noch trug er das Herz auf den Lippen und besaß die Naivität genialer Jünglinge, denen ihr eigenes originelles Wesen als etwas Selbstverständliches erscheint. Seine Enttäuschungen hatten daran nichts geändert. Das ließ ihn, wie hochmütig er den Durchschnitt auch verachtete, sofort bei einem Partner, der ihn einigermaßen anzog, eine Gemeinschaft voraussetzen, was wohl manchen Reiferen voreilig, manchem Unwürdigen lächerlich erscheinen mochte. Gerade Espérance aber schlug er damit sofort in seinen Bann. Sie hatte auch schon erfahren, daß sie sich durch ihr unmittelbares Erleben und Beurteilen der Dinge sehr wesentlich von allen anderen Menschen ihrer Umgebung unterschied, die, statt selber die Dinge anzuschauen, fertige Anschauungen übernahmen, bestenfalls zwischen mehreren eine heraussuchten und sich aneigneten. Dies erschien bereits als Originalität. So hatte sie z. B. schon öfters mit einem Anhänger der damals geplanten Weltsprache Volapük gesprochen und einmal sogar mit einem Freimaurer. Es war in Franzensbad. Wenn sie auch wohl schon wagte, oft und erheblich an der unbedingten Richtigkeit der Anschauungen ihres Kreises zu zweifeln, so war sie doch immer nur so weit gegangen, für möglich zu halten, daß vielleicht die Auffassungen anderer Gesellschaftsgruppen die richtigen sein konnten. Daß aber überhaupt keine geltende Meinung, sondern gerade sie, die jeden Menschen und jeden Vorgang unmittelbar von sich aus anzuschauen pflegte, damit vielleicht recht haben könnte, der Gedanke war ihr nie gekommen. Eine Frau muß ja so vieles unterdrücken; ein wahres Glück, daß es, wenn sie »horreurs« sagte, wie es ihre Gouvernannte genannt hatte, ohne ihr Zutun in einer Art geschah, welche die Leute liebenswürdig oder zum Wälzen komisch fanden. Sie aber hatte es oft gar nicht komisch gemeint, sondern ihre ernstesten Überzeugungen ausgesprochen, so, als sie mit 14 Jahren sich zu erklären erdreistete, daß sie einen kleinen Vetter nicht nur seelisch, sondern auch körperlich liebe. Freilich hatte sie es französisch gesagt: » et moralement et physiquement«.
Erich griff noch beherzt nach den Menschen, die ihn anzogen, und kümmerte sich nicht um die anderen. Auch ihn hatte sein Tischpartner, eine ältliche, angelsächsische Spinster spätviktorianischen Stils, gelangweilt, und das schilderte er sofort Espérance sehr anschaulich, während er bei ihr aufatmete.
Eine so voreilige Intimität war nun wirklich eine »horreur« aber sie gefiel Espérance außerordentlich, hatte sie sich doch in ganz ähnlicher Lage befunden, und so beging sie entzückt dieselbe »horreur«, indem sie sich bei Erich über ihren Tischherrn lustig machte, ja ihn sogar nachahmte.
»Wir benehmen uns wirklich skandalös« rief sie, hinter ihrem Spitzenfächer lachend, und freute sich über dieses »wir«, das Erich heimlich erbeben ließ. Das merkwürdigste aber war, daß dieser wildfremde Gesprächspartner, mit dem sie sich so weit vergaß, über anwesende Gäste zu spotten, ihr nicht eine Spur von jenem leisen Mißtrauen einflößte, wie diese ganze Pariser Welt, in deren Flut sie doch mit so viel Vergnügen umher plätscherte. Er hatte ihr gleich erzählt, warum er in Paris war und was er in Preußen für Erfahrungen gemacht. Ihr war zu Mut, als ob sie auch ihm wie einem Altbekannten alles erzählen könnte und ihr das ein großes Vergnügen bereiten würde.
Espérancens Mutter war ein Fräulein Gandolphine de Nesle aus altbretonischem Geschlecht gewesen. Das Französische hatte daher schon das Kind auch schriftlich beherrschen gelernt. Das Deutsche sprach sie nicht ganz korrekt und mit gerade so viel süddeutschem Anflug, als anmutig ist. An diesem Abend fühlte sie indessen zum erstenmal, wie innig die gemeinsame Sprache verbinden kann, und ihr kam vor, als ob das, was französisch ganz unbedingt eine »horreur«, gewesen wäre, auf Deutsch gar nicht so schlimm ist, war doch damit so viel vertrauliche Herzlichkeit verbunden, wie sie seit langem nicht mehr gefühlt hatte, auch wenn sie deutsch sprach. Dies tat sie als Kind gewöhnlich, wenn sie unartig war, und später, wenn sie sich gehen ließ. Heute abend fühlte sie sich wieder einmal köstlich unartig, und es war beglückend, sich gehen zu lassen.
Unbefangen fragte sie Erich, wie er seine freie Stunden verbringe. Nun, er führte das Leben der jungen Leute in Paris, hatte zwei nicht sehr wohnliche Zimmerchen in einem garni, war infolgedessen nie zu Haus, speiste im Gasthaus, besuchte Theater, ernste und heitere, dann und wann auch die Vergnügungslokale. »Beneidenswert«, rief sie aus und klatschte vor Vergnügen in die Hände. Ein Mensch, der wirklich tun und lassen konnte, was er wollte, dem niemand etwas zu sagen hatte! Nicht minder erstaunt war Erich zu erfahren, daß diese schöne Frau, die mehrmals die Woche in großen Häusern speiste, außer der Oper, der Comédie Française und natürlich den Geschäften der Rue de la Paix, sozusagen nichts von dem »wahren« Paris kannte, weder die kleinen Frühstücke en goguette in den Vororten an der Seine, noch die eleganten Restaurants mit Ausnahme des sehr vornehmen, aber gar zu langweiligen Café Anglaise, weder den damals noch in Blüte stehenden Montmartre mit seinen in jeder Beziehung, außer in Hinsicht auf Geist und Witz, bescheidenen Kabaretts, noch die lustigen kleinen Theater à côté; von Moulin Rouge und Bullier, die noch ihre einzigartige Atmosphäre hatten, ganz zu schweigen. Kurz, das Gespräch unter der Palme des Rothschildschen Wintergartens endigte damit, daß Erich sich als Begleiter durch alle diese Herrlichkeiten anbot und Espérance erwiderte, er möchte dieser Tage bei ihrer Kusine, wo sie wohnte, vorbei kommen und seinen Namen in das Buch der Besucher einschreiben. Als sich Erich später beim Hausherrn nach der Adresse erkundigte, erfuhr er, daß Espérancens Kusine die Exkönigin Marie Sophie von Neapel war, die zu jener Zeit in einer Villa in Saint-Mandé nahe dem Vincenner Wäldchen ziemlich zurückgezogen lebte. Er verbarg geschickt sein Erstaunen, schrieb am folgenden Tag dort seinen Namen ein und erhielt eine Einladung zum Frühstück. Ein wie ernster junger Mann er auch war, so versäumte er doch nicht, an diesem großen Tag eine Kravatte bei Charvet auf der Place Vendôme zu kaufen, ja mehrmals vor Geschäften mit Spiegelscheiben stehen zu bleiben, um sich zu überzeugen, daß sie ihn gut kleidete. Die Persönlichkeit der leise alternden, in ihren Bewegungen etwas unbeholfenen Königin Marie Sophie war wohl dazu angetan, dem »Vernunftmonarchismus« eines jungen Mannes, den dieser als geistiges Inventarstück von seinem Vater ererbt hatte, den Schwung eines begeisternden Gefühls zu geben, zumal, da die Begegnung stattfand in einem Augenblick, als das bisher noch unberührte Gefühlsleben des nachdenklichen Jünglings zum ersten Mal in tiefe Wallung geraten war. Manches über Marie-Sophie, so die heldenmütige Verteidigung von Gaëta, kannte er aus der Geschichte; Einzelheiten über das Martyrium ihrer Ehe mit einem Tropf erfuhr er von Espérance. Sie hatte für diese viel ältere Kusine, die sie als Kind oft in Tutzing besucht hatte, eine Mädchenschwärmerei gehegt, welche sich nun, da sie ihr als Erwachsene wieder begegnete, in Ehrfurcht vor dem tragischen Geschick dieser Frau verwandelte. Als sehr junges Mädchen war sie dem König Franz II. von Neapel in Stellvertretung angetraut worden, in der Meinung, in ihm einen ritterlichen jungen Gatten zu bekommen. Statt dessen fand sie einen unsauberen Fresser, feig und schlaff, den die Napolitaner wegen seines kleinlichen Gepolters im Gegensatz zu seinem temperamentvollen Vater, dem Ré Bomba, Ré Bombetta, d. i. König Bömbchen nannten. Beim Einmarsch der Truppen Garibaldis lief das Bömbchen davon und überließ die Verteidigung der Krone seiner Frau. Anfangs der neunziger Jahre ist er endlich gestorben. Erich fragte sich, ob denn in der ganzen Festung Gaëta nicht ein einziger Mann gewesen war, und in Tagträumen sah er sich selbst auf dem Wall für die verlorene Sache der kühnen Frau fechten. Marie-Sophie lebte in Saint-Mandé in Zurückgezogenheit und Einfachheit. Noch war die große Gestalt mit den nun ergrauenden, einst tiefschwarzen Haaren schön zu nennen. Trotzdem gefiel sie den Parisern nicht, die kaum bemerkten, daß diese Frau, welche die bayrische Schwerfälligkeit der Kleidung nie ganz überwand – » fagoté« nannten sie das – unvergleichlich viel mehr große Dame war, als die pikanten Löwinnen des Quartier de l'Etoile, wo die Eleganz in jenen Jahren bereits begann, ein Selbstzweck und damit das Gegenteil von Vornehmheit zu werden.
Die Königin, die nicht viel sprach, aber Espérancens Geplauder mit Erich gern lauschte, teilte deren Interesse an dem jungen Herrn, der trotz seiner ungewohnten Art durchaus » bien pensant« schien. Nach jener offiziellen Einladung wurde er meist zum Tee gebeten, wo er nicht selten die beiden Kusinen allein traf, ohne den winzigen Hofstaat an der Frühstückstafel, der wenigstens die eine Funktion mit Vollkommenheit erfüllte, lebendig werdende Gespräche im Keim zu ersticken. Der eisgraue fadendünne Monsieur de la Brillière mißbilligte jedes Wort Erichs, ehe er es noch ausgesprochen hatte, während man dem vertrockneten und knochigen Fräulein von Oberfuhr-Civetta die Gerechtigkeit widerfahren lassen muß, daß es mit seiner ablehnenden Miene doch erst abwartete, bis es gehört und wenn möglich verstanden hatte, was der Gast sagte. Sie auf seine Seite zu ziehen, wäre für Erich ein Leichtes gewesen, wenn er sich hie und da verbindlich an sie gewendet hätte, und dann wäre der freilich hoffnungslose Fall des Monsieur de la Brillière, der schon die Tafel des Königs Bömbchen tötlich gelangweilt hatte, wenigstens isoliert worden. Diese Kunst der gesellschaftlichen Kleingeldwirtschaft besaß aber Erich Holthoff noch nicht. Er war bis über die Ohren verliebt in Espérance und teilte sofort deren Verehrung für die Königin; was gingen ihn da diese zwei versteinerten Wesen an? Er betrachtete sie als Verkehrshemmnisse, nichts sonst, und behandelte sie demgemäß. Wieder eine » horreur« unglaublichen Grades, aber durchaus nach dem Herzen Espérancens, die darin Kühnheit sehen wollte; und selbst das menschenfreundliche Herz der Königin schien diesen beiden massiven Säulen ihres Alltags zu gönnen, daß sie einmal wie Luft behandelt wurden. Immerhin vermied sie häufige Wiederholung solcher moralischen Züchtigung.
Die Teeeinladungen erschienen allen Beteiligten als die beste Lösung. Es war leicht, einen kleinen Ritt zu zweit in das an den Garten angrenzende Vincenner Gehölz anzuschließen, oder Erich ruderte, wenn mit den Pferden etwas nicht in Ordnung war, Espérance auf dem Lac de Daumesnil, wo sich die Kleinbürger der nächsten Quartiere, ja offensichtlich ineinander verliebte Pärchen, auf die gleiche Art ergötzten.
Espérance war fern davon, Erich zu etwas mehr Rücksicht auf den »Hofstaat« anzuleiten – solchen sittigenden Einfluß übte sie auf ihn erst später – vielmehr forderte sie ihn geradezu heraus, wenn er bisweilen zu einem einfachen Diner blieb, bei Tisch von ihren gemeinsamen Beobachtungen zu erzählen. Dies tat er mit lebhafter Anschaulichkeit, von zwei bereits liebenden und zwei wohlwollend begönnernden Frauenaugen ermutigt. Espérance war stolz darauf, mit ihrem »Protégé«, wie die Königin Erich in seiner Abwesenheit zu nennen pflegte, bei dieser so viel Glück zu haben, und als sie deren Vertrauen und Sympathie zu dem nun fast täglichen Besucher hinreichend gefestigt fühlte, konnte sie es endlich wagen, für einen Abend um das Kupee zu bitten, da sie nach dem Diner mit Herrn Holthoff in's Theater fahren wolle. Dies wiederholte sich nun öfter. Espérance ließ bald den Kutscher vom Theater gleich wieder nach Hause fahren, damit man nach der Vorstellung in Ruhe soupieren konnte, und spät in der Nacht brachte Erich sie in einem Fiaker zurück. So wurden die Lücken in ihrer Kenntnis des »wahren« Paris, die beide an jenem Abend bei den Rothschilds so tief beklagt hatten, schnell ausgefüllt. Am anderen Tag pflegte Espérance das ihr geeignet Scheinende von dem, was sie, besonders in den Theatern, gesehen hatte, offen und ausgelassen bei Tisch zu erzählen. Die Königin lachte und dachte im Stillen, daß ja nun Graf Arthur bald kommen und sie abholen würde und daß es vielleicht höchste Zeit dazu sei. Herr de la Brillière aber und Fräulein von Oberfuhr-Civetta mußten auf ihre alten Tage Gespräche mit anhören, die in ihrer Jugend in der Umgebung einer Königin einfach unmöglich gewesen wären.
Es gab nun nichts mehr in Erichs Leben was er Espérance nicht mitgeteilt haben würde, und auch von ihr wußte er genug, um es zu wagen, ihr seine rückhaltlose Liebe zu gestehen, nämlich, daß Graf Arthur zwar ein sehr achtenswerter Charakter und rührender Vater ihres Buben sei, aber ihr als Gatte von den Eltern bestimmt worden war und in ihr nicht mehr als Gefühle der Freundschaft und der Pflicht erweckt hatte, die sie ihm ihr Leben lang immer zollen würde. Hätte Erich Espérance daheim kennen gelernt, so wäre er vielleicht jahrelang ihr stummer Bewunderer geblieben, ohne zu wagen, sie für etwas anderes als unnahbar zu halten. Die vertrauliche Gemeinschaft nicht nur im Ausland, sondern auch innerhalb einer für beide fremdartigen Gesellschaft, änderte die Lage indessen völlig und ermutigte zum Ungewöhnlichen, ja Abenteuerlichen. Erich überließ sich zum erstenmal ganz einem Gefühl; er wußte, daß die, welche es ihm einflößte, so schnell, wie sie in seinem Leben aufgetaucht, wieder verschwinden würde, und dies bewirkte, daß die ganze Leidenschaft, deren er fähig war, die aber sonst nicht auf der Gefühlsseite lag, plötzlich hierher übersprang und sein Wesen durchaus zu verändern schien. Er lernte nun die tiefen Melancholien und die plötzlichen Entzückungen der Liebenden kennen, die Blicke, die wie ein Sonnenstrahl die ganze Welt plötzlich verwandeln, und die Düfte, die Ewigkeitsschauer auszulösen scheinen. Er fühlte sich als die eine Hälfte der Welt und Espérance als die andere, und nur, wenn sie allein zusammen waren, schien ihm die Welt ganz. War er einsam, so mußte ihm ein entwendeter Handschuh, den er an das Gesicht drückte, die fehlende Hälfte seines Lebens ersetzen; hörte er in Gesellschaft den so ungemein persönlichen, dunklen Klang ihrer Stimme, dann erzitterte er oft bei dem Gedanken, mit wie dünnen Fäden er sie hielt. Was war das nur? Sein Leben, das er vor aller äußeren Beeinträchtigung hatte wahren wollen, um ihm eine besondere und große Gestalt zu geben, er hatte es nun rückhaltlos auf eine Karte gesetzt, und er dachte nicht daran, daß sie vielleicht verlor. War er sich ganz entfremdet worden, oder aber fand er in diesen Gefühlen jetzt erst seine wahres Selbst? Aber wozu fragen und grübeln? Eine Strömung trug ihn dahin, ebenso mächtig wie sanft, und er erkannte Schicksal und Erlebnis als Eines. Zum erstenmal fühlte er auch ganz nah und wirklich einen andern Menschen und schaute in dessen Inneres hinein, und die Tiefe, in die er da blickte, schien ihm dieselbe, in die er nun durch sein eigenes Inneres schaute: der Abgrund der Welt selber. Das Ich wurde dort hinuntergeworfen, aber doch ist es noch da, reicher und ganzer als bisher. War er wirklich so hochmütig, kalt, »egozentrisch«, wie die Menschen glaubten? Er lächelte.
Das einzige, was Espérance an ihrem jungen Freund mißbilligte, war, daß er seinen ursprünglichen Ehrgeiz aufgegeben hatte und nun ein Geschäftsmann werden wollte. Zwar war ihr noch nicht beigekommen, tief über das Wesen der Staatsmannschaft nachzusinnen, aber sie hatte doch schon oft Minister gesehen, bald in Hofuniform mit Stern und Ordensband, bald vor dem Parlament, das tun mußte, wie sie wollten. Sie ahnte auch dunkel, daß sie gescheiter waren, als der ganze Hof, ja vielleicht sogar gescheiter, als der König. Wie konnte nur Erich eine solche Zukunft aufgeben, wo er doch dazu wie geschaffen war mit seiner großen Gestalt und dem scharf geschnittenen, etwas fremdartig brünetten Gesicht? Wenn man sich sein dunkles Haar in späteren Jahren gar etwas grau meliert vorstellte, dann war er geradezu das Muster eines großen Staatsmannes. Ein großer Bankier dagegen ist dick und rundlich, hat eine Glatze und einen Vollbart, gebärdet sich zwar manchmal galant, aber seine Witze sind oft peinlich, kurz, nichts für eine richtige Frau; nein, so durfte Erich nicht werden. Man sieht, Espérance hatte nicht ohne Nutzen die Pariser Gesellschaft besucht, sie kannte nun die Welt.
Eines Nachts, während eines verschwiegenen Soupers, fragte sie ihn, ob er nicht versuchen könne, das, was ihm in Preußen unmöglich schien, in Harringen zu erreichen. Dieses Wort traf Erich wie einen im Dunkel ringenden Frommen die Stimme eines Engels. Er sprang auf, bedeckte Espérance mit Küssen, dann kniete er vor ihr, ihre beiden Hände an seine Stirn drückend. Espérancens Worte waren die Lösung eines Zwiespalts, den er, solange ihr Glück blühte, nicht recht ins Bewußtsein hatte kommen lassen, der ihn aber doch heimlich die ganze Zeit gequält. Er wußte, daß Graf Arthurs Ankunft täglich näher heranrückte und Espérance dann Paris für immer verließ. Wenn er aber in Harringen seine Rechtsstudien wieder aufnahm und dort in den Staatsdienst trat, dann konnte er ihr immer nahe sein und zugleich sein aufgegebenes Ideal wieder ergreifen. Oh, Espérance war sein guter Engel! Er sagte es ihr, und sie fand, daß er recht hatte. Sie besaß enge Beziehungen zum königlichen Haus und würde schon dafür sorgen, daß man Erich oben bemerkte.
»Aber nicht zu bald,« sagte er, lächelnd in ihre Kinderaugen blickend, während ihm vor Erregung über sein plötzlich erschautes Lebensschicksal fast das Herz zersprang, »erst will ich doch etwas leisten; wenn du mir dann die notwendigen Beziehungen vermitteln willst ... «
Das verstand Espérance nicht recht, aber die Männer haben offenbar ihre eigene, sonderbare Art. Alles fangen sie beim andern Ende an. Nun, sie würde da schon helfen, die gesellschaftlichen Verhältnisse kannte sie besser, als er mit all seiner Gescheitheit, und mit freudiger Überraschung merkte sie nun, wie wertvoll diese Kenntnis war. Oh, Erich mußte überhaupt noch manches lernen. So wie er sich in Saint-Mandé benahm, erwog sie plötzlich mit Ernst, durfte der künftige Staatsmann in Rolfsburg doch nicht auftreten, aber es war nicht nötig, hier in Paris davon zu reden.
Im schwermütigen Schein eines bläulichen Morgengrauens in den ersten Julitagen brachte Erich Espérance zum letzten Mal nach Saint-Mandé zurück. Von der Königin hatte er sich schon am Vorabend verabschiedet. Er und Espérance hatten vermeiden wollen, daß er jetzt mit Graf Arthur zusammentraf, der heute erwartet wurde und morgen mit seiner Frau und dem kleinen Herbert, den eine Kinderfrau in bunt gestickter Nationaltracht mitbrachte, den Kanal überfahren wollte.
V
Einige Tage später trat auch Erich seine Sommerferien an und begab sich in die rheinische Heimat zurück. Noch war er von dem jähen Abbruch dieses kurzen Glückes allzu sehr erschüttert, um gleich das Zusammenleben mit den Seinen aufnehmen zu wollen. So blieb er erst eine Woche allein in einem kleinen Städtchen am Rhein, um sich wieder selber zu finden. Zunächst schossen ihm allerlei wilde Gedanken durch den Kopf: nach der Insel Wight fahren ... im selben Hotel leben wie Espérance, ohne sich dem Gatten zu erkennen zu geben, nur ihr nahe sein und sie sehen ... indessen warum dies alles? Sie liebte ihn doch ... er mußte sie zur Scheidung überreden ... aber was dann? Sie waren beide Katholiken ... Durfte er daran denken, Espérance aus ihrem Erdreich zu reißen und ihr ein Abenteuerleben zuzumuten, vielleicht Austritt aus der Kirche und dann Ziviltrauung: Herr und Frau Holthoff ... und den kleinen Herbert, an dem sie vermutlich mehr hing, als sie in dem Trubel ihrer ersten freien Wochen zeigte, den sollte sie wohl zurücklassen? Nein, so kindisch war er nicht, dergleichen ernstlich zu erwägen. Übrigens hatte er ihr in der letzten Nacht aus redlichem Herzen versprochen, daß er ihre Kreise nicht stören wolle, und das auch ganz in der Ordnung gefunden, denn ihr Leben war bereits gestaltet, das seine noch nicht. Würde er etwa einem dummen Mädel erlauben, seine Lebenspläne zu zerstören, auch wenn er in sie verliebt wäre? Nein, er war ehrgeizig, das mußte er sich nun ganz offen zugestehen. Macht und ihre äußeren Zeichen lockten ihn, er war nicht fähig, das Leben aus der Froschperspektive eines Glücks im Winkel anzuschauen. War das vielleicht bei seinen großen historischen Vorbildern anders gewesen? Es erschien ihm als eine deutsche Einfältigkeit, daß ihm das überhaupt zum Problem werden konnte. Der Deutsche gibt ja lieber jede Leidenschaft zu, ja Trunksucht und Liederlichkeit, ehe er bekennt, daß er ehrgeizig ist; er verzeiht eher Mißgunst und gemeinen Neid, als die Leidenschaft des Ehrgeizes, vielleicht weil er dabei stets an subalterne Streberei denkt. Aber Espérance war eine großartige Frau, sie verstand ihn besser, als er sich selbst bisher verstanden. Sie hatte in allem Recht, was sie tat, so naiv und kindlich auch oft die Art war, wie sie erklärte. Vielleicht ist das weiblich, vielleicht hatte er sich gerade in diese innerlich so entschiedene und äußerlich so spielerische Art verliebt. Sie gab ihm Sicherheit, und zugleich fühlte er sich ihr doch oft überlegen. Er war bei ihr auf seiner Höhe, sie lockte seine Kräfte hervor, und doch verstand sie, die Reifere, mit unbeirrbarem Griff die Lenkung ihrer Beziehung in der Hand zu behalten. Ja, es war, wie sie sagte: der Frühling ihrer Liebe wich schon dem Sommer. Sie hatte versprochen, ihm zu schreiben, vielleicht ein bis zweimal im Monat. Dann sollte er ihr innerhalb einer Woche antworten, jedenfalls immer einen Brief von ihr als Wink abwarten. Sie würde beurteilen können, wie weit sich dieser Briefwechsel vor ihrem Mann vertreten ließe. Natürlich beabsichtigte sie nicht, diesen Erichs Briefe lesen zu lassen, und seine Art war nicht, dergleichen zu verlangen, aber die Briefe mußten jedenfalls so gehalten sein, daß sie zur Not einem Gatten unter die Augen kommen konnten. Vor allem durften sie nicht die geringsten Rückschlüsse auf Espérancens Briefe gestatten. Auf eine postlagernde oder durch eine dritte Person zu vermittelnde Geheimkorrespondenz hatte sie sich unter keinen Umständen einlassen wollen. Aber sie wollte alles wissen, was er tue und denke; was er fühle, das müsse sie sich in der Fantasie vorstellen, bis sie sich im Herbst in Rolfsburg wiedersähen. Dort würde es dann wieder Gelegenheiten zu Plauderstunden und kleinen Ausflügen geben. In der Hinsicht sei die dortige Gesellschaft nicht allzu streng. Das Schöne, was sie miteinander erlebten, war so einzig, daß es jenseits ihres Alltags bleiben müsse. So verklärte es ihn, ohne ihn zu stören.
Woher kam solche Weisheit auf so junge Lippen und in so unschuldige Mädchenaugen? Er hatte sie das gerade heraus gefragt, und ihre Antwort war, ihre Mutter sei doch Französin gewesen. Von ihr hatte sie nicht nur gelernt, wie sich ein junges Mädchen legitimen Bewerbern gegenüber zu benehmen hat, sondern auch wie eine junge Frau handeln muß, wenn der deplorable Fall eintritt, daß sie weiblicher Schwäche erlegen ist, hélas! Das war gewiß Sünde, aber es sei nicht nötig, hatte Gräfin Gandolphine Waldegg, née de Nesle, gemeint, daß man zur Sünde auch noch die Dummheit fügt. Tatsächlich ist eines von beiden genug. Alles das hatte Espérance einmal bei Erich in sehr vertraulicher Situation ohne jede Frivolität vorgebracht, sondern mit der kindlichen Verständigkeit eines schon ziemlich großen kleinen Mädchens, das nun ernstlich alle Kindereien aufgegeben hat und sich guten Willens bemüht, die Gesetze der Erwachsenen einzuhalten.