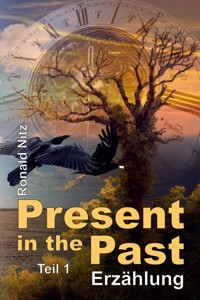Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herman Bargetz schildert in dieser Geschichte unter falschem Namen seine Lebensgeschichte, weil er befürchtet, dass sich Nazis für sein Werk an seiner Familie rächen könnten. Er wächst in Vorarlberg, Österreich, in einem ländlichen Tal auf und sympathisiert in seiner Jugend aufgrund seiner äußeren Ähnlichkeit mit dem arischen Idealbild zunächst mit den Nazis. Doch nach einem schweren Unfall und der Erfahrung von Nazi-Gewalt beginnt er, die Nazis zu verachten. Während des Zweiten Weltkriegs wird Herman aufgrund seiner Verletzung vorübergehend von der Wehrmacht freigestellt. Er gründet eine Familie, aber sein Glück wird durch den Verlust seiner Tochter und den Missbrauch seiner Frau durch die Gestapo überschattet. Dies führt dazu, dass er zu einem entschiedenen Gegner der Nazis wird und sogar Anschläge auf sie verübt. Herman wird schließlich zur Wehrmacht eingezogen und gerät in Stalingrad in Kämpfe und Gefangenschaft. Er überlebt brutale Prügel und schwere Zeiten, die ihn beinahe zur Aufgabe treiben, aber er findet Trost in einer unerwarteten Freundschaft. Nach Kriegsende wird Herman in die Freiheit entlassen und kehrt nach Österreich zurück. Er heiratet erneut und führt ein glückliches Leben mit seiner Familie, bis der Verlust seiner zweiten Frau ihn erneut in Depressionen stürzt. Doch seine Familie hilft ihm, sich zu erholen, und er verarbeitet seine traumatische Vergangenheit, indem er seine Memoiren aufzeichnet. Schließlich stirbt er im hohen Alter von 95 Jahren. Hermans Geschichte ist von persönlichem Leid, Überlebenskampf und der Suche nach Glück und Heilung geprägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ronald Nitz
Memoiren eines Nazikillers
Roman
Imprint
Memoiren eines Nazikillers
Ronald Nitz
Copyright: © 2023 Ronald Nitz
Umschlaggestaltung: Erik Kinting / buchlektorat.net
Druck: epubli
www.epubli.de
Ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über den Rahmen des Zitatrechtes bei korrekter vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.
Um meine Familie und mich vor Übergriffen von Nazis zu schützen, benutze ich in dieser Geschichte den Namen eines mutigen Mannes, der gegen die Nazis aufbegehrte, und einige Monate vor Kriegsausbruch von den Nazis umgebracht wurde. Sein Name war Herman Bargetz. Er bekam nie die öffentliche Anerkennung die er für seine Integrität und seinen Heldenmut verdient hätte.
Ich kann mich noch gut an den Tag im April 1938 erinnern, als wir zu Hause am Küchentisch saßen, und in einer Rundfunkansprache bekanntgegeben wurde, dass über 99 Prozent der österreichischen Bevölkerung für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gestimmt haben. Als ich tags darauf mit Bekannten in unserer Dorfwirtschaft saß, konnte ich hören, was einige Leute am hintersten Tisch miteinander redeten. Sie beschwerten sich darüber, dass nun für uns alle eine dunkle Zeit heranbrechen würde. Sie schimpften über das Nazipack und über alle die mit ihnen sympathisierten, und das waren zu dieser Zeit weitaus mehr Menschen als es Nazigegner gab. Es war schon damals gefährlich solche Gedanken öffentlich zu äußern, umso genauer lauschte ich den Worten dieser Leute. Die meisten kannte ich, doch vor allem an den Förster und an den hiesigen Dorfschullehrer kann ich mich noch gut erinnern, weil sie die Hauptakteure an diesem Abend waren. Die Gespräche an den Nebentischen sind langsam verstummt, weil fast alle wie gebannt den Worten des Försters und des Lehrers lauschten. Die beiden eröffneten mir eine Sichtweise der aktuellen politischen Ereignisse, die ich so noch nie gehört hatte. Ich habe den beiden geglaubt, als sie im Wirtshaus erzählten wie unschuldige, lang eingesessene Bürger nur aufgrund ihres Glaubens von Leuten schikaniert wurden, die zuvor in gutem Einverständnis mit ihnen im selben Dorf oder in der gleichen Stadt lebten. Vor allem in den nahegelegenen Städten wie Bregenz und Dornbirn seien körperliche Übergriffe vor allem gegen Juden inzwischen an der Tagesordnung. Der Lehrer schimpfte über die Dummheit der Menschen, die sich von der Ideologie der Nazis anstecken ließen, und ohne ihr Handeln zu hinterfragen böse Dinge taten, und sich gegen Gott versündigten. Solche klaren Worte waren mir bis dahin noch nie zu Ohren gekommen. Zuhause wenn meine Eltern, mein Bruder und ich eine Radiosendung angehört hatten, schwiegen wir uns danach gegenseitig an. Mein Vater schimpfte nur manchmal unverständliches Zeug vor sich hin, ohne dass er eine klare Meinung zu den politischen Ereignissen geäußert hätte. Meine Mutter vertiefte sich immer in eine Tätigkeit. Entweder strickte, häkelte oder putzte sie etwas.
Ich weiß noch wie ich einmal, als gerade eine Radiosendung zu Ende war, in die Runde fragte, „wieso reden die eigentlich von Wiedervereinigung mit Deutschland? War denn Österreich schon einmal mit Deutschland vereinigt?“
Mein Vater brummte nur, dass im vergangenen Jahrhundert Österreich und Deutschland schon einmal zu einem Deutschen Reich oder Bund vereinigt waren. Aber genau wisse er es auch nicht. An viel mehr Konversation innerhalb unserer Familie zum Thema Politik kann ich mich nicht erinnern. Mein jüngerer Bruder, der damals 15 war, hatte nur eines im Sinn. Er wollte unbedingt Soldat werden und in den Krieg ziehen, davon ließ er sich auch von den Beteuerungen meiner Eltern hierzubleiben und uns auf dem Hof zu helfen, nicht abhalten. Wie er darauf gekommen ist, dass es Krieg gibt, weiß ich bis heute nicht.
Im April 1938 redete niemand von Krieg, abgesehen vom Förster und vom Lehrer, und auch in ihrem Fall waren ihre Äußerungen mehr eine Vermutung als eine Gewissheit. Eines Tages werde er gehen, sagte mein Bruder selbstbewusst, und als guter Österreicher seinem Land dienen. Zwei Jahre später tat er das auch, obwohl er zu dieser Zeit noch keine 18 Jahre alt war. Was mich anbelangt, so hatte ich gar keine Meinung zu diesen vagen Kriegsäußerungen. Ich weiß nur, dass mich die ewige Arbeit auf unserem Hof und das ewig gleich bleibende Dorfleben anödete. Ich wollte weg von zuhause und irgendwo im Rheintal eine Lehre machen. Mein Vater meinte nur, dass ich zuhause auf dem Hof mehr lernen könne als in jeder Berufslehre. In gewisser Weise hatte er damit auch Recht, doch in Wahrheit hatte er mit mir und meinem Bruder zwei Arbeitskräfte die fast umsonst schwere Arbeit verrichteten, und das 6 manchmal auch 7 Tage in der Woche. Aber mein vordringlichster Wunsch war damals wieder gesund zu werden, und endlich wieder ohne Krücken gehen zu können, doch darauf werde ich später noch zurückkommen.
Wie schon gesagt, lauschten im Gasthaus die circa 40 Gäste gebannt den Worten des Lehrers und des Försters. Manche Gäste murrten über deren Äußerungen, doch ich konnte nicht verstehen was sie sagten. Mich wunderte es, dass niemand es wagte seine Meinung zu äußern und gegen die beiden Stellung zu beziehen, obwohl sogar ich wusste, dass einige Gäste glühende Anhänger des Nationalsozialismus waren. Im Wirtshaus saß zwar niemand der eine Uniform anhatte die ihn als Nazi ausgewiesen hätte, doch es war im Dorf allgemein bekannt, wer ein Nazianhänger war. Sie organisierten jede Woche Fahrgemeinschaften und fuhren zu irgendwelchen Kundgebungen nach Bregenz. Ein Jahr zuvor waren es zwei oder drei Leute aus dem größeren Nachbardorf die nach Bregenz fuhren, mittlerweile belief sich ihre Anzahl auf weit über hundert Anhänger. Der Begriff Nazi war schon damals die gängige Bezeichnung für einen Nationalsozialisten, oder Hitlerfreund und Judenhasser wie sie von einigen genannt wurden. Und die meisten, wenn nicht sogar alle, brüsteten sich damit Nazis und waschechte Arier zu sein. Immer mehr meiner Verwandten und Bekannten wurden Nazianhänger, doch es gab auch einige unter ihnen die den Mut hatten gegen die Gesinnung der Nazis aufzubegehren.
Ich selbst tendierte ganz eindeutig auch dazu ein Nazi zu werden. Vor allem die Tatsache, dass ich blond und blauäugig war, und somit den Ariern, einer besonderen Gattung Mensch, angehörte, erfüllte mich mit Stolz. Damals fühlte es sich einfach toll an ein Arier zu sein. Rückblickend kann ich zu meiner Verteidigung nur sagen, dass ich damals ein identitätsloser 17-jähriger Dummkopf war, mit wenig Selbstwertgefühl und einem erheblichen Mangel an Selbstvertrauen. Ich habe sehr unter der Enge meines Lebensalltags gelitten, und ich fühlte mich unzulänglich, weil ich damals lange Zeit mit Krücken gehen musste, und körperlich sehr eingeschränkt war.
Als ich damals in das Wirtshaus kam, verfolgten mich verächtliche Blicke von einigen der anwesenden Gäste. In ihren Augen war ich ein Krüppel, und ich wurde immer öfter als solcher beschimpft. Meine Kumpels, mit denen ich im Gasthaus am Tisch saß, akzeptierten mich zwar als vollwertiges Mitglied in ihrer Runde, dennoch verbarg ich meine sperrigen Krücken so gut es ging. An den Tischen verstummten allmählich die Gespräche, um den Ausführungen der beiden besser folgen zu können. Der Dorflehrer und der Förster waren Respektpersonen die im ganzen Tal einen guten Ruf genossen. Sie waren gebildet und waren in ihrem Leben schon viel herumgekommen. Ihre Äußerungen gegen die Nazis lösten in mir Zweifel aus, ob ich wirklich ungefragt all das glauben sollte, was über die Nazis gesagt wurde. Ganz ohne Zweifel brachten die Nazis Schwung in das mühsame und entbehrungsreiche Leben vieler Deutscher und Österreicher. Das war, zumindest was mich anbelangte, mehr ein Gefühl als eine Tatsache von der ich mich überzeugen konnte. Ich konnte weder sehen, dass es mehr Arbeit gab, noch dass die Menschen mehr zu Essen hatten. In unserer Familie hatten wir auch schon in der Zeit vor die Nazis an die Macht kamen immer genug zu essen, und die Arbeit ging uns ohnehin nie aus. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft, wir betrieben Viehhaltung und Ackerbau, und meine Mutter verstand sich ausgezeichnet auf Sticken, Nähen und darauf Lebensmittel haltbar zu machen, sodass wir auch im Winter nie Hunger leiden mussten. Mein Vater war, wie die meisten Bauern, handwerklich geschickt und verrichtete bei uns auf dem Hof und in der Umgebung Maurer-, Zimmermanns-, und auch Schlosserarbeiten. Als sein ältester Sohn musste ich schon als Kind nicht nur auf dem Hof, sondern auch bei den vielen Nebenbaustellen meines Vaters mithelfen.
Ich weiß noch wie ich mich freute als ich in die Hauptschule kam, die in den 1930er Jahren eine Pflichtschule für alle 10 bis 14-Jährigen war. Am Abend habe ich am Küchentisch oft so getan als würde ich Hausaufgaben machen oder für die Schule lernen, weil mich meine Eltern dann in Ruhe ließen und ich nicht irgendeine Arbeit verrichten musste. Ich war ein guter Schüler obwohl ich nicht gerne zur Schule ging, vor allem am Anfang. Ich musste 6 Tage in der Woche zweimal am Tag bei jedem Wetter einen mehrere Kilometer langen Marsch zurücklegen um in die Schule zu kommen. Schlimmer aber waren die Sticheleien und körperlichen Übergriffe der älteren Mitschüler. Als 10-Jähriger war ich zwar kräftig, und in meiner Nachbarschaft gab es nicht viele Gleichaltrige die mir in einem Kampf überlegen waren, doch gegen die älteren Schüler hatte ich keine Chance im Kampf. Die Schüler kamen aus 3 Gemeinden zusammen, und es gab einen Gesamtunterricht für alle Altersgruppen. Ich weiß noch wie mir einmal auf dem Nachhauseweg 3 Mitschüler auflauerten und mich nur so zum Spaß verprügelten. Als ich endlich zuhause ankam, schilderte ich meinem Vater den Vorfall, in der Hoffnung, dass er für Gerechtigkeit sorgen würde.
Das Einzige was er sagte war, „da bist du ja noch mit einem blauen Auge davongekommen. Das nächste Mal schlägst du zurück, oder rennst davon“.
Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet, und so blieb ich mit meinem Hass auf die Schüler die mich geschlagen hatten alleine. Erst als ich viel später aus einer Auseinandersetzung mit zwei älteren Schülern als Sieger hervorging, wurde ich von den anderen Schülern in Ruhe gelassen.
Eines Tages lauerten mir auf dem Rückweg von der Schule zwei ältere Mitschüler auf, die mir eine Abreibung verpassen wollten. Beinahe gleichzeitig sprangen sie etwa 10 Meter vor mir hinter den Bäumen hervor, und versperrten mir den Weg. Im Unterricht habe ich einen der beiden, den Köhler Hubert, ausgelacht, weil er auf die Frage des Lehrers, welches die Hauptstadt von Deutschland sei, steif und fest behauptete es sei Lindau. Es war nicht meine Absicht den Hubert bloßzustellen, aber ich musste einfach drauf loslachen, und dummerweise haben viele der Mitschüler in das Lachen miteingestimmt. Natürlich wusste ich schon damals, aus eigener Erfahrung, wie schrecklich man sich fühlt, wenn man von anderen ausgelacht wird, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Bis Hubert mit einem Gehilfen bedrohlich vor mir stand, und mich am Weitergehen hinderte. „Schlag zurück, oder renn davon.“ Mir kamen die Worte meines Vaters in den Sinn, als ich zum ersten Mal auf dem Schulweg von älteren Schülern verdroschen wurde. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Option dachte ich, und versuchte es mit einer Entschuldigung.
„Tut mir leid, dass ich dich ausgelacht habe“, sagte ich ihm mit aller Reue und Aufrichtigkeit die ich aufbringen konnte.
Davon wollte der gute Hubert aber nichts wissen, und kam immer näher und bedrohlicher auf mich zu. Vielleicht wäre ich den beiden entkommen, wenn ich davongelaufen wäre, aber der Weg nachhause war versperrt, und den Rückweg in die Schule wollte ich auf keinen Fall antreten. Beide Schüler waren mir an Körpergröße und Masse überlegen, dennoch gelang es mir meine Angst wie ein lästiges Insekt abzuschütteln. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, stellte den Schulranzen in der Nähe eines Baumes ab, wo ich einen schönen, handgroßen Stein gesehen hatte. Ich hob den Stein auf, und trat ohne zu zögern auf Hubert zu. In diesem Moment wusste ich ganz genau, dass ich aus dieser Konfrontation als Sieger hervorgehen würde. Wuchtig schmetterte ich Hubert den Stein an den Kopf, worauf er sich die Hand an den Kopf hielt, und anfing wie ein kleines Mädchen zu weinen. Sein Gehilfe musste die Entschlossenheit in meinem Gesicht gesehen haben und bekam es mit der Angst zu tun, da er mich für einen Moment ganz erschrocken mit großen Augen anstarrte, sich umdrehte, und wie ein geölter Blitz davonrannte.
„Einen tollen Freund hast du dir da ausgesucht. Sag dem Feigling, dass er mir besser aus dem Weg gehen soll, sonst wird Schlimmeres über ihn kommen als ein Stein am Kopf.“, sagte ich selbstbewusst zu Hubert, und ging nach Hause.
Während ich so dahinging, kamen widersprüchliche Gefühle in mir hoch. Einerseits fühlte ich mich stark und unbesiegbar, andererseits war ich verblüfft und besorgt, dass ich zu solch einer Brutalität fähig war. Am Abend kam Huberts Vater auf unseren Hof und tobte anfangs wie ein Wilder. Ich hätte bei einer harmlosen Auseinandersetzung zu unlauteren Mittel gegriffen, und seinem Sohn eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich sei nicht ganz normal, ich habe einen Teufel in mir, meinte er, und forderte meinen Vater auf angemessen darauf zu reagieren. Mein Vater rief mich, und forderte mich auf den Sachverhalt aus meiner Sicht zu schildern. Nachdem ich meine Version vorbrachte, ging mein Vater einen Schritt auf Huberts Vater zu, und forderte ihn in ruhigem aber entschlossenem Ton auf seinen Hof zu verlassen. Sollte sein Sohn noch einmal so einen feigen Hinterhalt aushecken und irgendwelche Vergeltungsaktionen gegen mich unternehmen, so werde er sich selbst darum kümmern. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, drehte sich mein Vater um, und ging in den Stall zurück um weiterzuarbeiten. Ich huschte schnell ins Haus zurück, und blätterte wieder in meinem Schulheft herum. Durch das Küchenfenster sah ich zu wie Huberts Vater mit hängendem Kopf davontrottete. Von meinem Vater bekam ich weder eine Schelte noch ein Lob, was für mich bedeutete, dass er meine Aktion guthieß. Der Vorwurf von Huberts Vater, dass ich vom Teufel besessen sei, lastete allerdings schwer auf mir. Vor allem am nächsten Tag, als ich in der Schule bemerkte wie mir manche Schüler aus dem Weg gingen, und mich seltsam anschauten als wäre ich nicht ganz normal. Das verunsicherte mich irgendwie, doch andererseits war ich auch stolz auf mich, weil mir an diesem Tag und an allen anderen Tagen die ich noch in der Schule war, niemand mehr blöde kam, auch nicht die älteren Schüler. Rückblickend wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich diese ganze Sache mit Hubert mit jemandem besprechen hätte können, doch in meiner Familie war es unüblich über Gefühle zu reden, und so hatte ich es auch nie gelernt. Vielleicht war dieser Umstand mit ein Grund dafür, wieso mir der Förster und der Lehrer mit ihren Äußerungen so imponierten, weil sie klar Stellung bezogen. Obwohl ich an jenem Abend im Wirtshaus betrunken war, gingen mir auf dem Nachhauseweg die Worte der beiden nicht mehr aus dem Kopf. Es kostete mich unglaublich viel Selbstbeherrschung mit meinen Krücken ohne zu stürzen nachhause zu humpeln. Trotz meines alkoholumnebelten Kopfes begann ich abzuwägen wohin ich eigentlich gehörte. Welchen Standpunkt sollte ich vertreten, den der Nazis oder denjenigen der Nazigegner. Schließlich kam ich jedoch zu der Überzeugung, dass ich es toll fand ein Arier zu sein, weil ich nichts dafür leisten musste, um dieser außergewöhnlichen Menschenrasse anzugehören. Alleine nur wegen meiner Herkunft und wegen meines Aussehens entsprach ich dem Idealbild eines Ariers. Ich glaubte zwar nicht wirklich daran anderen Menschen überlegen zu sein, dennoch war ich stolz und fühlte mich gut dabei ein Herrenmensch zu sein. Ich war im besten Alter, 1,80 Meter groß, kräftig gebaut, ich konnte lesen und schreiben, ich war handwerklich geschickt, die Frauen interessierten sich für mich, und ich hatte einige Kameraden und mindestens zwei gute Freunde. Was interessierte mich der Krieg, damit hatte ich nichts zu schaffen. Der Lehrer und der Förster meinten, dass mit Hitler an der Macht schlechte Zeiten auf uns zukommen würden, und er ein Kriegstreiber sei, der uns in den Abgrund führen werde. Die Menschen hätten offensichtlich das Elend das der 1.Weltkrieg über sie brachte schon vergessen. Mich interessierte weder der 1. Weltkrieg, noch interessierte mich ein möglicherweise bevorstehender Krieg. Warum sollte ich mir Gedanken über etwas machen, das vielleicht in einer ungewissen Zukunft passieren wird. Ich genoss meine Jugendzeit so gut es mit meiner Einschränkung möglich war, und scherte mich nicht um das Morgen. Sollten der Lehrer und der Förster doch sagen was sie wollten, mir gefiel der neue Schwung, die Abwechslung den die Nationalsozialisten in mein perspektivloses, ödes, von Arbeit geprägtes Dasein brachten.
Wenige Jahre später, als ich mit vielen anderen nach Stalingrad marschierte, kamen mir die beiden immer wieder in den Sinn. Ich habe den Förster und den Lehrer an diesem Abend zum letzten Mal gesehen. Die beiden wurden zwei Jahre später von den Nationalsozialisten umgebracht, und wenn ich gekonnt hätte, hätte ich um die beiden mutigen und weisen Männer geweint, als ich von ihrem Tod erfuhr. Sie konnten die damalige Situation recht gut einschätzen, und sie hatten mit jedem einzelnen ihrer Worte Recht behalten. Leider waren sie mit ihren Ansichten in der Minderheit, sonst hätte es nie so weit kommen können, dass dieser Hitler mit der Wehrmacht in Österreich einmarschiert, und von einem Großteil unseres Volkes begeistert empfangen wurde. Rückblickend könnte man sagen, dass es schon damals durchaus absehbar war, dass uns dieser drogensüchtige Tyrann für einen Krieg missbrauchte, den er mit diversen Großindustriellen die vom Krieg profitierten, ausgeheckt hatte.
Das Fundament des Krieges, so ließ man uns glauben, war der Antisemitismus, der Kampf gegen den Kommunismus, und die Etablierung der arischen Rasse. Doch ohne die Großindustriellen und Mäzenen die Hitler finanziell unterstützten, hätte es gar keinen Krieg gegeben. In Hitler hatten sie den perfekten Idioten gefunden, der sich gut vor ihren Karren spannen ließ, um ihre Gier nach Profit und Macht zu befriedigen. Zu diesem Schluss bin ich gekommen nachdem ich unzählige Gespräche belauscht und selbst mit den unterschiedlichsten Personen geführt hatte. Natürlich kamen diese Gespräche nicht alle auf diesen einfachen Schluss, doch der überwiegende Teil vertrat die Meinung, dass große Financiers, Industrielle oder andere Bonzen gemeinsam mit Hitler und seinem engsten Kreis den Krieg zu verantworten hatten. Die Nazis sind wie eine Lawine langsam aber stetig immer nähergekommen. Vorboten dieser Katastrophe waren die falsche Propaganda, die jeder irgendwie aufschnappte, ob er nun ein Rundfunkgerät zuhause hatte oder nicht. Den Leuten wurde eine Verbesserung ihrer entbehrungsreichen Lebensumstände und die Ausrottung des menschlichen Übels versprochen, obgleich nur die wenigsten wussten was genau an einem Kommunisten oder Juden so schlimm sein sollte, dass man ihn ausrotten muss. Die Menschen wurden manipuliert und aufgehetzt. Nur standhafte, integre und gebildete Menschen ließen sich nicht von dieser plumpen Propaganda infizieren, und begehrten gegen diesen monumentalen Propagandaschwachsinn auf. Genauso wie es der Förster und der Lehrer gemacht hatten. Doch ihr Mut und ihr Charakter wurden ihnen zum Verhängnis. Alle die sich gegen die Nazis stellten, wurden erbarmungslos vernichtet. Das habe ich selbst erlebt, als ich mittendrin in diesem verdammten Krieg steckte, und mehr als einmal glaubte, dass mein letztes Stündlein geschlagen hat.
Im September 1939 begann der 2. Weltkrieg. Zunächst sah es nicht so aus als würde ich an diesem Ereignis teilnehmen. Wie schon erwähnt brauchte ich Krücken um mich vorwärts zu bewegen, und das geschah in einem Moment der unmöglich ein Zufall sein konnte. Im Jahr 1938, noch bevor Hitler in Österreich einmarschierte, war ich wie schon oft bei Michael, meinem besten Freund, auf Besuch. Ich war 17 Jahre alt, hatte mich tags zuvor von der Lisl getrennt, weil sie mir mit ihren Wünschen Bäuerin zu werden und einen eigenen Hof aufzubauen auf die Nerven ging. Zu dieser Zeit hatte ich keine Ahnung was ich beruflich einmal machen sollte, aber zumindest wusste ich, was ich nicht werden wollte, und das war Bauer. Ein Leben das nur aus Arbeit besteht, wollte ich mir nicht aufhalsen, und überhaupt passte mir so ziemlich alles am Bauerndasein nicht. Die nie endende Arbeit, auch an den Wochenenden, das ewige Genörgel über die anderen Bauern, die kleinlichen Auseinandersetzungen mit den Grundstücksnachbarn wegen unklarer Grenzmarkierungen, die elend langen und langweiligen Sommer auf der Alpe, und viele andere Dinge mit denen ich in absehbarer Zukunft nichts mehr zu haben wollte. Die Lisl, die eigentlich Elisabeth hieß, versuchte mich ständig zu überreden mit ihr eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Sie sah vor allem das Positive am Bauerndasein, wohingegen ich nur die Nachteile darin sah. Unabhängig sein, der eigene Chef auf dem eigenen Hof sein, in Verbundenheit mit der Natur leben, eigene Lebensmittel herstellen, und viele andere Vorteile habe das Bauernleben, schwärmte sie mir vor, ohne sich um meine Ansichten zu scheren. Mit meinen 17 Jahren hatte ich noch nicht viel Erfahrung in Sachen Beziehung mit einer Frau, und schon gar nicht mit der Liebe. Ich mochte die Lisl wirklich gerne, und vielleicht hätten wir auch geheiratet, wenn sie mir nicht andauernd vom Dasein als Bäuerin in den Ohren gelegen wäre, und meine Abneigung dagegen nicht völlig ignoriert hätte. Wir hatten damals schon Pläne geschmiedet, wo wir die Hochzeit ausrichten, wen wir alles einladen, ja wir machten uns sogar Gedanken darüber was wir zur Hochzeit anziehen sollten. Vor allem Lisl machte sich Gedanken darüber, ich ließ mich nur auf dieses Thema ein, weil Lisl danach immer strahlte und sie es dann zuließ, dass wir Sex miteinander hatten. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich diese quälenden Diskussionen über das Heiraten und das Bauerndasein nur deshalb über mich ergehen ließ, um mich an ihrem Körper zu erfreuen. Na ja, ich war damals 17, und der Sex mit ihr war so ziemlich das Beste was mir in dem öden Leben in unserer Dorfgemeinde widerfahren ist.
Sie sagte immer, „du interessierst dich ja gar nicht für mich! Du willst nur Sex“, und damit hatte sie vollkommen Recht.
Bis mir ihre Vorwürfe und ihre kleinkarierten Zukunftsperspektiven dermaßen auf die Nerven gingen, dass ich mich von ihr trennte. Daraufhin brach sie in Tränen aus, und wünschte mich in die Untiefen der Hölle. Schon am nächsten Tag bereute ich meinen Entschluss, weil ich mich nach ihrem nackten Körper sehnte, und ich war drauf und dran mich bei ihr zu entschuldigen. Wer weiß was passiert wäre, wenn ich nicht vorher meinen Freund besucht hätte. Das Scheunentor war offen, und ich konnte Markus sehen wie er am Ende des Stalls eine Arbeit verrichtete. Auf der rechten Seite des langgezogenen Stalls waren etwa 5 Pferdeboxen nebeneinander, und auf der gegenüberliegenden Seite waren Rinder eingestellt. Im Mittelgang waren kleine Haufen mit Einstreue ausgebracht. Ich ging durch den Gang auf Michael zu, der dabei war den Mist mit einer Schubkarre auf den Miststock zu kippen. Als ich so dahin ging, rannte plötzlich der Hofhund von hinten auf mich zu. Davon habe ich nichts mitbekommen, ich habe den Hund erst gesehen als er auf gleicher Höhe neben mir war, genau zu dem Zeitpunkt als ich einem Streuehaufen auswich. Der Hund musste ebenso ausweichen, und kam dabei einem der eingestellten Pferde gefährlich nahe. Die Pferde waren angebunden, weil Michael zum Misten und einstreuen die Pferdeboxen offen ließ. Beim Vorbeirennen hat der Hund den Hinterfuß eines Pferdes berührt, das daraufhin erschrocken war, und zur Abwehr mit einem Fuß ausschlug. Das Pferd hatte mich voll mit seinem beschlagenen Hinterhuf erwischt. Ich kann immer noch das grausige Knirschen und Knacken in meinem Kopf hören. Wie vom Blitz getroffen, sackte ich zusammen und fiel auf den Stallboden. Ich kam unmittelbar hinter dem Pferd zu liegen, und ich weiß noch genau, wie ich damals Angst hatte, dass mich das Pferd noch einmal tritt oder auf mich draufsteht. Ich wollte mich gerade wegrollen, um Abstand zwischen mich und das Pferd zu bekommen, als Michael meine Hände nahm und mich wegzog. Bis dahin hatte ich keinerlei Schmerz gespürt, doch in dem Moment als mich Michael zu dem Streuehaufen zog, und meinen Kopf darauf bettete, spürte ich einen Schmerz wie ich ihn noch nie zuvor gespürt hatte. Da mir jede Bewegung meines rechten Beines unsägliche Schmerzen bereitete, blieb ich einfach liegen. Ich hörte wie Michael auf mich einredete, doch seine Worte kamen in meinem Gehirn nicht an, und ich registrierte auch sonst nichts mehr was in meiner Umgebung geschah. Erst später erfuhr ich, dass Michael ein Pferd sattelte, und zum Arzt ritt der ungefähr 12 Kilometer vom Hof entfernt war. In dieser Zeit lag ich mit schmerzverzerrtem Gesicht da, legte meine Hand an die Stirn und wiegte meinen Oberkörper stöhnend hin und her. Es dauerte eine schiere Unendlichkeit bis endlich wieder jemand zu mir kam. Ich spürte wie sich mehrere Hände unter meinen Körper schoben, die mich auf einen mit Decken ausgelegten Pferdekarren legten. Ich weiß noch wie mir das Anheben dermaßen weh tat, dass ich fast ohnmächtig wurde. Ich war so in meinem Schmerz gefangen, dass ich gar nicht mitbekam wer mich auf den Karren gehoben hat. Ich hörte nur wie jemand Anweisungen gab, das war das Letzte an das ich mich erinnern kann. Michael erzählte mir später ausführlich wie er Hilfe holte. Beim Erzählen fühlte er sich wie ein Held. Er habe zuerst seinen Vater und seine Mutter gesucht, doch die waren auf einem ihrer Felder, das weit vom Hof entfernt war. Also hat er eine Stute losgebunden, sie gesattelt und ist auf dem kürzesten Weg zum Dorfarzt geritten. Ich sehe Michael noch vor mir wie er lachte als er erwähnte, dass er durch Gärten ritt und im Galopp über mannshohe Zäune sprang. Das war natürlich gelogen, doch ich wollte ihm seine Freude nicht trüben, zumal ich es zu einem Großteil ihm zu verdanken habe, dass mein rechtes Bein noch funktionsfähig ist. Michael war heilfroh, dass der Doktor zuhause war, und er ihn nicht suchen musste. Obwohl der Doktor Patienten im Haus hatte, wurde Michael sofort von der Arzthelferin zum Doktor vorgelassen. Aufmerksam hörte sich der Arzt Michaels Geschichte an, und packte gleich darauf ein paar Sachen in eine schwarze Umhängetasche. Ab diesem Zeitpunkt habe der Doktor die Führung übernommen, und alles Weitere in die Wege geleitet. Im Wartezimmer forderte er die Patienten, die sich dazu im Stande fühlten, auf sie zu begleiten, weil es auf dem Hof von Michael einen Notfall gab. Zwei Männer standen sofort auf und ritten mit dem Arzt und Michael zu dessen Hof. Der Arzt schnitt mir mit einer Schere die Hose auf, untersuchte mein rechtes Bein, und gab mir eine Spritze. Kurz darauf sei ich eingeschlafen. Michael erzählte mir, dass er sich beinahe übergeben musste als er mein kaputtes Bein sah. Der gebrochene Knochen habe gegen die Außenhaut gedrückt die sich stark gewölbt hatte. Mein Bein war unnatürlich verdreht, und es war auf den ersten Blick zu sehen, dass ich schwer verletzt war. Noch heute bin ich dem Arzt dankbar, dass er mir diese Spritze gab. Wenn ich mir die Fahrt auf dem Pferdekarren vom Hof bis zum Kloster ohne Betäubung vorstelle, wird mir fast schlecht. Auf dieser holprigen Fahrt hätte ich gelitten wie ein Hund, das weiß ich, weil mir mein Bein bis zum heutigen Tag Schmerzen bereitet. Nicht jeden Tag, aber oft genug. Ich danke Gott dafür, dass mich der Arzt betäubt und ich von der holprigen Fahrt nichts mitbekommen habe. Nachdem sie mich auf den Karren gehoben hatten, ritten die zwei Helfer nachhause, und der Arzt begleitete Michael auf dem Kutschbock ins 7 Kilometer entfernte Kloster. Aus Mangel an Krankenhäuser wurden damals viele Patienten in Klöster behandelt. Als ich wieder zu mir kam, lag ich aufgereiht zwischen 8 anderen Patienten in einem Bett mit sauberen Laken. Eine Nonne die als Krankenschwester ausgebildet war, klärte mich auf was mit mir geschehen war. Durch den heftigen Tritt des Pferdes erlitt ich eine Tibiakopffraktur, ein Bruch des oberen Schienbeinknochens. Zudem waren einige Bänder gerissen und auch Muskeln und Blutgefäße wurden durch das Hufeisen schwer verletzt. Am Anfang standen meine Prognosen sehr schlecht. Die Krankenschwester sagte mir, dass sie mein Bein oberhalb des Knies wahrscheinlich amputieren müssen. Der Arzt hatte meinen gebrochenen Knochen so gut es ging wieder eingerichtet, und hat mir danach mein rechtes Bein vom Fuß bis zum Oberschenkel eingegipst. Damals gab es weit und breit kein Röntgengerät das zur Verfügung stand. Durch den Aufprall der Hufe auf meinem oberen rechten Schienbein, gab es Absplitterungen meines Schienbeinknochens die unerkannt blieben, und mir später noch viele Komplikationen und ständige Schmerzen bescherten. Wäre das Pferd nicht beschlagen gewesen, wären meine Verletzungen wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Die Krankenschwester die mir das mitgeteilt hatte, war sehr einfühlsam, und ich war froh, dass es mir nicht einer der anderen Hausdrachen erzählte. Einige der Krankenschwestern in ihren Nonnentrachten waren eiskalte, gefühlsarme Frauen denen es eindeutig an Mitgefühl mangelte. Vielleicht wurden sie aber nur deshalb so, weil sie stets von Leid umgeben waren. Die Nachricht, dass sie mir vielleicht mein Bein abnehmen müssen, hatte mich dermaßen schockiert, dass ich tagelang im Bett lag und mit niemandem reden wollte. Auch als meine Familie zu Besuch kam, redete ich kein Wort. Ich war dermaßen in dieser Schreckensvorstellung gefangen mein Bein zu verlieren, dass ich die Realität um mich herum nur schleierhaft wahrnahm. Als meine Eltern und mein Bruder endlich gegangen waren, sagte ich am nächsten Tag der netten Krankenschwester, dass ich keinen Besuch mehr haben möchte. Sie nickte nur mit dem Kopf, und richtete es so ein, dass ich die nächsten 2 Wochen keinen Besuch bekam. Erst als sich bei der ersten Gipsabnahme herausstellte, dass meine Genesung gut voranschritt und ich mein Bein behalten konnte, kehrte auch mein Lebenswille wieder zurück. Die Schleier hatten sich gelichtet, und so nahm ich alles um mich herum wieder mit all meinen Sinnen wahr, und das war weiß Gott mehr Unangenehmes als Angenehmes. Das viele Gestöhne, das Schnarchen, Furzen, unangebrachtes Gelächter und Witze von Patienten und Besucher, unzählige verschiedene üble Gerüche und Geräusche, das völlige Fehlen von Intimsphäre, stilles Weinen der Patienten und Besucher, Schmerzensschreie, unterdrücktes Lustgestöhne, schrullige, unfreundliche Krankenschwestern, fades Essen, und anderes Ungemach flutete auf mich ein, sodass mir der Aufenthalt im Patientensaal des Klosters zunehmend unerträglicher wurde. Sobald ich die positive Prognose bekommen hatte, wollte ich nur noch raus aus dem Kloster, doch der Arzt der zweimal in der Woche zur Visite kam, untersagte mir meinen Wunsch. Nur dass ich mein Bein nicht verliere, bedeute nicht dass alles gut sei, meinte er. Und so musste ich bis zur zweiten Gipsabnahme nach 5 Wochen in dem schrecklichen Lazarett bleiben, zur Untätigkeit verdammt und voll und ganz den angeführten Schikanen des Lebens ausgeliefert. Ich war nicht einmal fähig mich selbst zu waschen oder gar meine Notdurft zu verrichten. Das übernahmen die Nonnen die als Krankenschwestern fungierten, was mir am Anfang sehr unangenehm war. Nach einer Weile gewöhnte ich mich daran, dass die Nonnen mir helfen mussten auf dem Klostuhl, der in der Mitte ein Loch hatte, mein Geschäft vor allen anderen zu verrichten. Auch das Waschen, vor allem im Intimbereich, fand ich mit der Zeit nicht mehr so schlimm, und ich verlor zunehmend meine Scham. Da ich mich 4 Wochen lang nicht großartig körperlich bewegen konnte, versuchte ich diesen Stillstand mit meinem Gehirn zu kompensieren. Ich überlegte hin und her was ich mit meinem Leben anfangen sollte, welchen Beruf ich erlernen möchte, wo ich ein Haus bauen sollte, ob ich heiraten soll, und so weiter. All diese Gedanken schob ich in meinem Kopf hin und her, ohne dass sich dabei etwas Konkretes oder etwas nur ansatzweise Brauchbares herauskristallisierte. Dieses ständige, fruchtlose Nachdenken machte mich fast verrückt, bis ich endlich Krücken bekam, und ich mich im Klosterareal bewegen konnte. Zu Beginn war es für mich richtig schwer mit dem eingegibsten Bein mit den Krücken zu gehen. Doch die freundliche Krankenschwester lehrte mich geduldig die Krücken richtig zu benutzen, und begleitete mich oft auf meinen Streifzügen. Sie bot mir sogar an mich auf einem Rollstuhl durch die Gegend zu schieben. Dieses Angebot lehnte ich jedoch ab, weil für mich alle die im Rollstuhl saßen Krüppel waren, und als Krüppel sah ich mich keineswegs, obgleich ich genau wusste, dass ich diesem Schicksal nur um Haaresbreite entgangen war. Es war auch besser so, dass ich den Rollstuhl nicht benutzte, da mein Körper durch das ständige Rumgehüpfe mit den Krücken wieder zu Kräften kam. Schmerzen waren mein ständiger Begleiter. Es gab zwar Tage in denen ich stundenweise schmerzfrei war, doch die Schmerzen kamen immer wieder zurück, und nach einigen Tagen seit ich auf Krücken ging, schwoll mein Bein an, sodass die Schmerzen chronisch wurden, bis ich wieder bettlägerig wurde. Der Arzt der mich von Anfang an behandelte, verstand seinen Beruf. Bei der Visite erzählte ich ihm von meinen Beschwerden, woraufhin er mir sofort den Gips abnahm. Ich kann mich noch erinnern, dass sich ein übler Geruch ausbreitete, als der Arzt den Gips und die Bandagen abnahm. Mein rechtes Bein sah, im Gegensatz zu meinem linken Bein, aus wie ein verrunzelter, stinkender Zahnstocher, der in allen möglichen Farben richtig ungesund aussah. Unterhalb des Knies war eine Schwellung, und der Arzt meinte, dass beim Tritt gegen das Schienbein mit ziemlicher Sicherheit Knochenteile abgesplittert waren. Der Arzt veranlasste sofort, dass ich in die Klinik nach Innsbruck verlegt wurde. Dort waren sie mit einem Röntgengerät ausgestattet, und die dortigen Ärzte verstanden sich angeblich auf solche Eingriffe wie sie bei mir nötig waren. Ich bekam erneut einen Gips, allerdings achtete der Arzt darauf, dass er nicht zu eng war, für den Fall, dass sich die Schwellung weiter ausdehnen sollte. Als mein Vater davon erfuhr, dass ich nach Innsbruck musste, war seine erste Aussage, dass er sich diese Operation verbunden mit der langen Zugfahrt gar nicht leisten könne. Ich weiß noch, dass mich diese Aussage unfassbar wütend machte, weil ich mir sicher war, dass wir genug Vieh verkaufen hätten können, um die bevorstehenden Kosten zu decken. Außerdem habe ich jahrelang schwer gearbeitet ohne jemals einen anständigen Lohn dafür zu bekommen. Da hätte er doch ohne Weiteres sein gehortetes Geld herausrücken können, dachte ich verärgert, behielt meine Gedanken aber für mich. Der Arzt beschwichtigte meinen Vater indem er sagte, dass er die nötigen Gutachten in Bregenz auf dem Amt einreichen werde, und ein Großteil der Kosten von der öffentlichen Hand übernommen wird. Damals gab es noch keine Versicherungen. In den Gemeinden gab es zwar vereinzelt Geldrücklagen die für Notfälle herangezogen wurden, doch Einzelschicksale wie meines fielen nicht in diese Kategorie. Wohl oder übel musste mein Vater zustimmen, dass ich nach Innsbruck fuhr, und streckte mir einen ordentlichen Batzen Geld vor. Ich weiß, dass ihm das weh getan hat, zumal er nicht nur eine unentgeltliche Arbeitskraft auf lange Zeit verlor, sondern auch noch Ausgaben hatte für die er nichts zurückbekam. Meine Mutter war diejenige die es vorantrieb, dass ich so schnell wie möglich nach Innsbruck kam.
Mein Vater und mein Bruder brachten mich mit einem Pferdekarren nach Bregenz. Obwohl der Karren gut mit Decken gepolstert war, hatte ich unsägliche Schmerzen. Mein Bruder, der neben meinem Vater auf dem Kutschbock saß, schaute hin und wieder mitleidig zu mir zurück. Mehr als einmal dachte ich während Fahrt, wann immer wir eine Schlucht passierten, dass ich meine Kraft zusammennehme und in den Abgrund springe, doch dazu war ich zu feige. Als wir endlich In Bregenz ankamen, war ich schweißnass. Ich wollte jedoch keine Schwäche zeigen, und humpelte mit meinen Krücken tapfer über den Bahnsteig, der voll war mit Menschen. Vereinzelt sah ich auch Uniformierte mit den Hakenkreuzbinden am Arm. An eine traurig dreinblickende Menschentraube die am gegenüberliegenden Bahnsteig stand und von Soldaten schikaniert und angeschrien wurde, kann ich mich noch gut erinnern. Einige von ihnen trugen Koffer, und bei fast allen konnte man den Judenstern auf ihren Kleidern sehen. Auch kleine Kinder wurden von Erwachsenen an den Händen gehalten. Ich weiß noch wie mich dieser Anblick anwiderte, weil die Soldaten so rüpelhaft mit den Menschen umgingen.
„Lass die Leute in Ruhe“, schrie ich einen Soldaten an, ohne dass ich mir etwas dabei gedacht habe.
Mein Vater der inzwischen die Zugkarte besorgt hatte, sah mich entsetzt an, packte mich an der Jacke und zog mich hinter einen Eisenpfeiler. Dabei fiel mir eine Krücke aus der Hand, und ich wäre beinahe zu Boden gestürzt. Um einen Sturz zu vermeiden, musste ich mein Gewicht auf das eingegibste Bein verlagern. Der Schmerz den ich dabei empfand trieb mir die Tränen in die Augen. Ich wollte meinen Vater anschreien und ihn beschimpfen, doch ich brachte kein Wort heraus.
„Halt dein Maul“, blaffte er mich mit vor Entsetzen geweiteten Augen an.
„Glaubst du etwa, dass die Soldaten auf dich hören werden, du Idiot? Du wirst uns noch alle ins Gefängnis bringen, wenn du gegen die Nazis aufbegehrst! Den Juden kannst du nicht helfen, also halt verdammt noch mal die Klappe!“
Zum Glück fuhr gerade der Zug ein, wodurch die Soldaten uns aus den Augen verloren. Mein Vater drückte mir die Krücken in die Hand, und wir gingen so schnell wir konnten zum Wagon indem mir mein Vater einen Sitzplatz reserviert hatte. Mein Bruder trug mir den großen Rucksack den meine Mutter für mich gepackt hatte bis ins Abteil nach. Dann schauten sich mein Vater und mein Bruder noch einmal nach allen Seiten um ob kein Soldat in der Nähe war, und verabschiedeten sich von mir. Das Ereignis hatte mich schockiert, und die eindringlichen Worte meines Vaters schwebten wie ein Damoklesschwert über mir. Erst als sich der Zug pfeifend in Bewegung setzte, kam ich wieder zur Ruhe, und der Schmerz in meinem Bein ließ allmählich nach. Ich kann mich noch genau erinnern wie ich staunend am Fenster saß, und ich die Landschaft, die sich ständig änderte, wie einen Schwamm in mich aufsog. Ich fühlte mich als wäre ich aus einem Gefängnis entkommen, und durfte nun die große, weite Welt bestaunen, obgleich ich immer noch in Vorarlberg war. Ich bin bis zu jenem Tag noch nie aus meinem Tal hinausgekommen. Es musste ein Unglück geschehen, dass ich endlich meine Fesseln abstreifen konnte, und sich nicht nur im Außen sondern auch in meinem Inneren eine Weite auftat, die ich kaum beschreiben kann. Am ehesten trifft das Wort Glückseligkeit zu um diesen Zustand zu beschreiben. Das Einzige was meine gute Stimmung trübte, war der Lärm im Zugabteil. Es waren viele junge Männer im Abteil, die alle ungefähr in meinem Alter waren. Wie ich mitbekam, mussten sie nach Innsbruck zur Musterung, um ihre Tauglichkeit für den Militärdienst feststellen zu lassen. Auch ich hatte einen Musterungsbefehl bekommen als ich als Patient im Kloster war. Meine Mutter hatte mir das Schreiben mitgebracht, und ich wusste damals nicht so recht was ich davon halten sollte. Ich habe meiner Lieblingskrankenschwester, Schwester Anna, den Musterungsbefehl gezeigt, worauf sie nur meinte, dass sie das für mich erledigen würde. Im Zimmer der Äbtissin gab es ein Telefon von dem aus Schwester Anna bei der Landesverwaltung in Bregenz angerufen, und mich von der Musterung aufgrund meines Unfalls abmeldet hat. Ich weiß noch wie ich schmunzeln musste, als mir bewusst wurde, dass ich mit ziemlicher Sicherheit auch ohne meinen Unfall in diesem Zug gelandet wäre, nur unter anderen Umständen. Damals saß ich in dem Abteil und wünschte mir, ich würde nach Innsbruck zur Musterung und nicht in die Klinik fahren müssen. Als der Zug im großen Bahnhof quietschend und pfeifend zum Stehen kam, half mir ein aufmerksamer, freundlicher Herr beim Aussteigen. Der Bahnhof war um vieles größer als der Bregenzer Bahnhof, und es wimmelte geradezu vor Menschen. Der Mann der meinen Rucksack trug, begleitete mich geduldig zum richtigen Autobus, der in regelmäßigen Abständen zwischen dem Bahnhof und der Klinik verkehrte. Als der Mann mir den schweren Rucksack zum Tragen hinhielt und ich in die Tragegurte schlüpfte, wäre ich beinahe umgekippt. Der gute Samariter hielt mich gerade noch fest, und half mir in den Bus einzusteigen. Ich bedankte mich bei ihm, und genoss die Fahrt in die Klinik in vollen Zügen. Innsbruck war für mich eine Großstadt die mich faszinierte. Mit großen Augen bestaunte ich die großen Bauwerke, die vielen, unterschiedlichen Menschen und die unzähligen, verschiedenen Geräusche. Als der Autobus bei der Klinik anhielt, half mir der Buschauffeur beim Aussteigen, und setzte mir den Rucksack auf die Schultern. Unbeholfen schleppte ich mich mit den Krücken voran bis ich am richtigen Ort ankam, und eine freundliche Krankenschwester mich nach der Aufnahme auf ein kahles, schmuckloses Zimmer brachte, indem vier Betten standen, von denen nur eines belegt war. Hier in der Klinik konnte man zwischen den Betten einen Vorhang zuziehen, und sich so ein bisschen Intimsphäre schaffen. Ich sah diesen Vorhang als einen wahren Luxusgegenstand, den ich mir in der Zeit als ich im Kloster lag viele Male gewünscht habe. Ständig den Blicken anderer ausgeliefert zu sein, empfand ich als sehr unangenehm und störend. Kaum war ich im Zimmer angekommen, half mir eine freundliche Krankenschwester mich umzuziehen und mich zu waschen. Die vielen neuen Eindrücke während der Fahrt in die Klinik machten mich so müde, dass ich sofort nach dem Essen einschlief. Am nächsten Tag kam eine Schar Krankenhauspersonal zur Visite ins Zimmer, und kurz darauf wurde ich in einen Raum zum Röntgen gebracht. Ich weiß noch wie ich zum ersten Mal das Röntgenbild von meinem Bein sah. Der Knochenbruch war deutlich zu sehen, und der Arzt meinte, dass der Bruch recht gut eingerichtet wurde, und allem Anschein nach gut verheilt war. Das waren zwar etwas wacklige Aussagen, doch sah ich den Heilungsverlauf als recht positiv. Mein behandelnder Arzt in Vorarlberg hatte Recht, denn auf den Röntgenbildern waren mehrere kleine Splitter zu sehen, die bei der nachfolgenden Operation am nächsten Tag entfernt wurden. Von dieser Prozedur habe ich rein gar nichts mitbekommen. Ich war unter Vollnarkose, und kann mich nur noch daran erinnern wie ich auf einem Bett auf Rädern in den Operationssaal geschoben wurde. Als ich im Zimmer aufwachte, sah ich einen neuen Gips an meinem Bein. Der Arzt erklärte mir bei der Visite, dass sie 5 Knochensplitter entfernt hatten. Es könne aber gut möglich sein, dass noch irgendwo kleine Knochensplitter in meinem Bein vorhanden seien, die auf dem Röntgenbild nicht zu sehen waren. Das Gewebe rund um die Splitter war stark entzündet und eitrig, deshalb sei mein Knie so stark angeschwollen. Der Knochenbruch sei gut verheilt. Diese Nachricht nahm ich mit gemischten Gefühlen auf, weil ich mich einerseits darauf freute bald wieder nach Hause zu kommen, und andererseits weil ich befürchtete, dass dies noch lange nicht das Ende meines Invalidendaseins sein würde. Vorerst lief alles gut, die Schwellung unterhalb des Knies war nach einer guten Woche vollständig zurückgegangen, und die Entzündungen waren wohl auch abgeklungen. So sagte es mir zumindest der Arzt. Nach 2 Wochen konnte ich schon wieder auf Krücken gehen. Ich durfte auch die Klinik verlassen, wagte aber nicht mich allzu weit vom Klinikgelände zu entfernen. Die Schmerzen kamen sehr gewissenhaft, vor allem dann wenn ich zu übermütig war und ich mich überanstrengte. Ich bekam langsam ein Gefühl dafür, was ich mir zumuten konnte und was nicht. Je mehr ich auf meinen Körper hörte, desto weniger wurden die Schmerzen. Mittlerweile benutzte ich auch hin und wieder einen Rollstuhl, damit ich meine Erkundungstouren ausdehnen konnte. Auf diesen Touren habe ich viele Leute getroffen, die aus allen Teilen Österreichs kamen, ja sogar aus Deutschland und Italien. Hin und wieder verkehrte ich in den umliegenden Gasthäusern, um mich volllaufen zu lassen, vor allem an meinem achtzehnten Geburtstag, den ich mit Fremden feiern musste. Noch heute schätze ich die Innsbrucker, weil mich immer jemand zurück in die Klinik brachte, wenn ich zu betrunken war um alleine gehen zu können. Ich war begeistert und unternehmungslustig, was entscheidend dafür war, dass meine Genesung schnell voranschritt. Der Arzt meinte zwar immer, dass ich es nicht übertreiben solle, doch auch er war sehr zufrieden mit meinen Fortschritten. Irgendwann bekam ich dann einen Gehgips, was mich zwar nicht viel mobiler machte, aber dennoch eine Verbesserung war. Als sie mir den alten Gips und die Bandagen abnahmen, war ich zuerst erschrocken, weil mein Knie von mehreren hässlichen Narben entstellt war. Ich habe den Eingipser gefragt, ob an meinem Knie ein Arztlehrling zugange war, der bei mir seine erste Operation durchführte. Darauf meinte er schmunzelnd, dass die Schnitte notwendig waren, um so viele Splitter wie möglich zu entfernen. Damals war ich enttäuscht als ich die wulstigen, roten Narben sah, doch später, als ich in die Wehrmacht eingezogen wurde, sollten mir diese Narben noch gute Dienste erweisen. Obwohl das Gehen mit dem Gips sehr steif und holprig war, kam ich mit der Zeit immer besser zurecht. Ich wurde zunehmend selbstständiger und unabhängiger, konnte meine Notdurft schon bald ohne fremde Hilfe verrichten, und vor allem brauchte ich die sperrigen Krücken nicht mehr, die mich als Invaliden abstempelten. Langsam fühlte ich mich wieder als ganzer Mensch, der sich fast uneingeschränkt bewegen konnte.
Nach meiner Entlassung aus der Klinik, fuhr ich wieder nachhause, wo mir am darauffolgenden Tag beim Gemeindearzt der Gips entfernt wurde. Da ich mein Bein noch nicht voll belasten konnte, war ich wieder für lange Zeit auf die hässlichen Unterarmkrücken angewiesen. Es dauerte mindestens zwei Wochen bis ich mich sicher mit den Krücken fortbewegen konnte. Mein rechtes Bein nahm allmählich an Masse zu, sodass es wieder fast so aussah wie mein linkes Bein. Dann fing ich an mein Bein mit meinem vollen Gewicht zu belasten, und am Anfang ging auch alles gut, obwohl ich oft Schmerzen hatte. Aber an die Schmerzen hatte ich mich bereits gewöhnt, sofern man sich überhaupt jemals an Schmerzen gewöhnen kann. Der Arzt meinte, dass die Schmerzen vergehen würden, doch bei mir war das nicht der Fall. Natürlich musste ich zuhause wieder in der Landwirtschaft mithelfen, was meiner Genesung nicht sehr zuträglich war. Wenn ich einmal mit meinen Kumpels unterwegs war, ließ ich mich volllaufen. Der Alkohol war mein Freund, weil er mich für eine Zeit lang aus meinem tristen Alltag heraushob, und mich Freude, Spaß, Unbeschwertheit und Glück verspüren ließ. Zum Glück hatte ich kaum Geld in dieser Zeit, sonst wäre ich wahrscheinlich zum Alkoholiker geworden. Unter dem Knie schwoll mein Bein immer wieder an. Der Arzt meinte, dass eventuell noch irgendwo Knochensplitter in meinem Gewebe abgelagert waren. Es sei durchaus möglich, dass auf den Röntgenbildern nicht alle Splitter sichtbar waren, meinte er. So ging es fast ein Jahr lang dahin. Das Bein schwoll an, daraufhin war ich zur Untätigkeit verdammt, und die Schwellung ging wieder zurück. Für kurze Zeit ging es dann gut, und ich hatte kaum Schmerzen, bis schließlich alles wieder von vorne anfing. Irgendwann ging dann die Schwellung nicht mehr zurück, und ich musste wieder ins Kloster, wo sie rein gar nichts für mich tun konnten, außer mir Medikamente zu verabreichen. In dieser Zeit war ich furchtbar deprimiert. Mir kam sogar der Gedanke, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn sie mir mein Bein abnehmen würden, dann hätten diese Schmerzen endlich ein Ende. Diesen Gedanken behielt ich aber vorläufig für mich. Das einzig Positive was ich dem erneuten Aufenthalt im Kloster abgewinnen konnte, war, dass ich eine Berufsperspektive gefunden hatte. Eigentlich hätte ich schon viel früher darauf kommen sollen, dass es für mich besser wäre einen sitzenden Beruf zu erlernen. Mir war schon klar wieso ich diese Option bis jetzt noch nicht in Betracht gezogen hatte, weil ich mir schlichtweg nicht vorstellen konnte in einem Büro zu arbeiten. Ich war ein Handwerker, und das bedeutete in den meisten Fällen im Freien zu arbeiten. Ich hätte viele Berufe erlernen können die man nicht im Freien, sondern in einer Werkstatt verübt, wie zum Beispiel Tischler, Drechsler, Küfer oder Mechaniker. Dabei interessierte mich der Beruf des Auto- oder Landmaschinenmechanikers am meisten, obgleich wir so gut wie keine Maschinen auf unserem Hof hatten. Wir hatten nicht einmal einen Traktor. Alle Arbeiten auf dem Feld und die Transporte machten wir mit unseren 2 Pferden. Um wieder gesund zu werden, würde ich mich aber wohl oder übel damit abfinden müssen in Zukunft in einem Büro, in einem Verkaufsladen oder als Schuster zu arbeiten. Als meine Familie auf Besuch kam, erläuterte ich ihnen meine Absichten. Meine Mutter meinte nur, dass ich das am besten wisse, und ich das tun solle was für mich am besten ist. Als ich einen neuen Musterungsbefehl bekam, intervenierte Schwester Anna wieder mit der Landesstelle, worauf ich erneut einen Aufschub von der Musterung bekam. Dabei wäre ich liebend gerne zur Musterung gegangen, denn fast alles war besser als untätig im Patientensaal des Klosters zu liegen. Nachdem ich einige Tage übellaunig im Kloster vor mich hinvegetierte, kam der Arzt auf mich zu. Er schlug mir vor in die Klinik nach München zu gehen, die angeblich mit besseren Röntgengeräten ausgestattet war als die Klinik in Innsbruck. Natürlich willigte ich sofort ein, und ich verspürte endlich wieder Hoffnung, eines Tages wieder normal und beschwerdefrei gehen zu können. Der Arzt veranlasste die Überweisung, regelte beim Land die Finanzierung und machte für mich einen Termin in der Klinik München. Für alle Kosten kam das Land natürlich nicht auf, und mein Vater musste wieder erneut tief in die Tasche greifen um seinem Sohn die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Es war ihm anzusehen, dass er mit mir langsam die Geduld verlor, und wahrscheinlich hätte er mich verkauft, wenn er gekonnt hätte. Dennoch bin ich meinem Vater dankbar was er für mich getan hat. Mein Vater fragte den Gemeindesekretär ob er uns mit seinem Auto nach Bregenz fahren könne, worauf dieser sofort zusagte. Ich war heilfroh, dass ich nicht wie bei der ersten Fahrt auf dem holprigen Pferdewagen liegen musste, und einigermaßen schmerzfrei die Fahrt überstand. Am Vortag der Abreise betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel, und mit großem Frust stellte ich fest, dass ich überhaupt nicht wie ein 18-Jähriger aussah. Ich sah eher aus wie ein 30-Jähriger, der von vielen Schmerzen im Gesicht gezeichnet war. Ich hatte schon leichte Falten unter den Augen, und mein erster Eindruck war, dass ich ein verhärmtes, übellauniges Gesicht hatte. Plötzlich verstand ich, wieso immer mehr Leute auf Abstand gingen zu mir. Ich sah nichts mehr Freundliches in meinem Gesicht, und ich weiß noch wie ich mir während meiner Selbstbetrachtung im Spiegel dachte, dass ich dreinschaute als wollte ich jemanden umbringen. Meine Mutter war die Einzige die meine Veränderung mitbekam. Irgendwann während meiner langen Leidensphase sagte sie zu mir, dass ich auf mein Seelenheil achtgeben soll, sonst würden sich bald alle meine Bekannten von mir fernhalten. Mir selbst war diese Veränderung gar nicht richtig bewusst, obwohl ich natürlich mitbekam, dass sich meine Bekannten, ja sogar meine zwei besten Freunde, zunehmend von mir distanzierten. Ich wurde schnell aggressiv, ich wurde immer unfreundlicher, gereizter, und mehr als einmal verspürte ich den Drang in mir jemanden niederzuschlagen. Einzig mein Gebrechen und meine gute Erziehung hielten mich davon ab die Leute die mich nervten zu schlagen, und dazu zählte auch meine Familie. Etwas Gutes hatte es zumindest, dass ich wieder ins Spital musste, weil ich Gott sei Dank wieder von Zuhause wegkam.
Als wir auf dem Parkplatz beim Bregenzer Bahnhof ausgestiegen waren, kam mein Vater mit erhobenem Zeigefinger auf mich zu, und sagte mir in einem sehr ernsten Tonfall, „überleg dir dieses Mal was du zu wem sagst. Diese Nazis fackeln heutzutage nicht mehr lange herum, egal ob Juden oder Einheimische. Selbst Arier wie du sollten lieber ihre Zunge hüten, sonst sperren sie dich ein, oder erschießen dich gleich an Ort und Stelle!“
Erst dachte ich, dass mein Vater mir nur Angst machen wollte, doch nur zwei Wochen später habe ich selbst gesehen wie ein Soldat einen Einheimischen auf offener Straße erschossen hat, nur weil er sich gegen das schikanöse Verhalten eines Soldaten aufgelehnt hat. Ich war zu weit weg um zu erkennen wen dieser Soldat schikaniert hatte, doch er hat zweifelsfrei einen Einheimischen vor aller Augen erschossen. Doch ich greife den Ereignissen vor.
Ich nickte nur als mich mein Vater ermahnte mein Maul zu halten. Ich bedankte und verabschiedete mich beim Gemeindesekretär, und folgte meinem Vater der meinen Rucksack zum Bahnsteig trug. Wie bei meiner ersten Zugfahrt nach Innsbruck standen auch dieses Mal Juden in einer Gruppe von mindestens 50 Leuten auf dem Bahnsteig, nur dass sie dieses Mal kein Gepäck bei sich hatten. Um sie herum standen Soldaten die ein Maschinengewehr um den Hals gehängt hatten, und die Juden bewachten und manchmal auch anbrüllten. Mein Vater tat so als wäre nichts, und legte noch einmal verschwörerisch seinen Zeigefinger auf die Lippen, um mir zu signalisieren, dass ich mein Maul halten soll. Abermals nickte ich nur mit Kopf, und verabschiedete mich von ihm. Als mein Vater außer Sichtweite war, humpelte ich auf einen Soldaten zu der etwas abseits von seinen Soldatenkollegen stand, und den Fahrplan an der Wand studierte.
„Guten Morgen“, grüßte ich ihn freundlich. „Können sie mir bitte sagen was mit diesen Leuten passiert.“
„Die werden umgesiedelt“, antwortete er barsch ohne mich anzusehen.
„Wohin werden sie umgesiedelt“, fragte ich neugierig.
Urplötzlich drehte er sich zu mir um, betrachtete mich abschätzig von unten bis oben, und schrie mich an, „das geht dich einen Scheißdreck an du verdammter Krüppel. Verschwinde, aber sofort, sonst kannst du gleich mit umsiedeln“, und nickte mit dem Kopf zu den Juden, die etwa 20 Meter entfernt von uns standen.
Die Reaktion des Soldaten erschreckte mich, und machte mir auch ein bisschen Angst. Mein erster Impuls aber war, ihm das Ende meiner Krücke in den Bauch zu rammen und ihm dann mit meinem Gipsbein den Rest geben. Als ich aber sah wie zwei andere Soldaten auf das Gebrüll von dem Arschloch aufmerksam wurden und sich zu uns herbewegten, senkte ich meinen Kopf und entfernte mich von dem Scheißkerl ohne etwas zu sagen. Diese bedrohliche Präsenz der Soldaten machte mir Angst, und mir wurde klar, dass mein Vater Recht hatte, und ich besser mein Maul halten sollte. Allerdings war ich mir auch bewusst, dass ich nichts Unrechtes getan hatte. Ich habe dem Soldaten, der, wie ich an seinem Tonfall erkannte, ein Landsmann von mir war, lediglich eine simple Frage gestellt. Dass er so vehement darauf reagieren würde, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Zum Glück ließen mich die Soldaten in Ruhe, und ich konnte eine unbeschwerte Fahrt nach München antreten. Natürlich musste ich zuerst meine Neugier befriedigen, und fragte einige Mitreisende wo die Juden hingebracht werden. Doch ich bekam keine zufriedenstellende Antwort auf meine Frage. Entweder hatten die Leute Angst und reagierten nur mit einem ahnungslosen Schulterzucken auf meine Frage, oder sie antworteten lediglich, dass sie es nicht wüssten. Ob das der Wahrheit entsprach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schwang bei allen die ich gefragt hatte, ein spürbarer Hauch von Angst mit. Ich musste mich wohl oder übel damit abfinden, dass meine Neugier unbefriedigt blieb, und so widmete ich mich ausgiebig der Landschaft die an mir vorbei rauschte. Mit großen Augen bewunderte ich ihre Vielfalt und Schönheit. Der Zug fuhr an vielen unterschiedlichen Bahnhöfen vorbei, und blieb nur an den größeren Orten und in den Städten stehen. An den meisten Bahnsteigen standen Soldaten mit ihren unübersehbaren Hakenkreuzarmbinden, doch von diesem Geschmeiß wollte ich mir meine vielen Eindrücke nicht vermiesen lassen. Ich weiß noch wie herrlich und abenteuerlich es sich anfühlte, zum ersten Mal in meinem Leben im Ausland zu sein. Mein Dasein als Unfallgeschädigter brachte also durchaus auch seine Vorteile mit sich, dessen war ich mir schon auf der ersten Zugfahrt nach Innsbruck bewusst, nur hatte ich es vergessen. Es fällt mir schwer zu beschreiben welche Wohltat diese Reise für mich war, obwohl ich mit meinem Gips nicht immer bequem sitzen konnte. Um nachvollziehen zu können welch ein Genuss diese Reise für mich war, muss man vielleicht ein ähnliches Schicksal wie ich erlebt haben. Ich ertappe mich dabei wie ich mich ob dieser Gedanken schäme, denn in Wahrheit war das Schicksal vieler Menschen um einiges schlimmer als das meine. Die Juden und auch andere ethnische Bevölkerungsgruppen und Behinderte wurden von Nazis aus ihrem Zuhause verjagt, mussten alles zurücklassen und wurden umgesiedelt, und wie ich erst nach dem Krieg erfuhr, in Massen umgebracht. Egal ob Mann, Frau oder Kind.
Auf der Fahrt nach München war ich seit langer Zeit wieder einmal glücklich und zufrieden. Ich dankte Gott dafür, dass er mir diesen wohltuenden Ausflug ermöglichte, und entschuldigte mich bei ihm, weil ich ihn in letzter Zeit immer häufiger und heftiger beschimpfte. Bei irgendjemandem musste ich ja meinen aufgestauten Frust ablassen, und ich war mir sicher, dass Gott, falls es ihn gibt, meine Schimpftiraden bestimmt aushalten würde. Das Wetter war herrlich an diesem Tag im August 1939. Keine einzige Wolke war am Himmel zu sehen, die Menschen denen ich begegnete waren freundlich und gut gelaunt. Als wir am Hauptbahnhof in München ankamen, half mir eine junge, stämmige Frau meinen Rucksack zu tragen, während ich ihr mit meinen Krücken hinterher humpelte. Ich war begeistert von der großen Bahnhofhalle, wo sich eine Unmenge Leuten tummelten. Die nette Frau begleitete mich bis zum Busplatz, und erkundigte sich nach dem Bus der in die Klinik fuhr. Sie half mir beim Einsteigen, und da die Frau durchaus ansehnlich war, fragte ich sie ob und wann ich mich bei ihr revanchieren könne.
Sie blickte mich lange prüfend an, bis ich die Schultern hob und in meinem besten Hochdeutsch sagte, „keine Angst, ich will mich nur revanchieren für deine Hilfe. Sollte ich dir etwas Böses wollen, hättest du leichtes Spiel mit mir. Es würde mich sehr freuen, wenn du mich mal besuchen kommst in der Klinik. In der Nähe gibt es bestimmt ein Cafe‘, oder ein Gasthaus. Mein Name ist Herman, wie heißt du?“
„Anna. Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück“, antwortete sie verlegen, und ging mit einem Grinsen im Gesicht ihrer Wege.
Ich weiß noch wie ich mir dachte, dass ich als Krüppel ohnehin keine Chancen bei ihr haben würde, doch einen Versuch eine nette Damenbekanntschaft zu machen war es allemal wert. Die Fahrt mit dem Bus dauerte nicht lange, und die Anmeldung in der Klinik ging reibungslos vonstatten. Allerdings musste ich lange warten bis mich eine nette Krankenschwester im Wartesaal abholte, und mich auf mein Zimmer brachte, wo schon zwei andere Patienten lagen. Nachdem ich mich umgezogen und so gut es ging gewaschen hatte, schlief ich bis am frühen Morgen durch. Das Abendessen stand noch unberührt auf dem Nachttisch. Mit einem Bärenhunger machte ich mich über das fade Essen her, und döste anschließend wieder vor mich hin, bis die Visite kam. Ein Arzt fragte mich sehr detailliert über meinen Unfall aus, obwohl er bereits den Bericht von meinem behandelnden Arzt in Österreich gelesen hatte. Doch das legte ich ihm nicht als Schikane aus, sondern vielmehr als berufliches Interesse und Professionalität. Nach dem Verhör befahl er einem Pfleger mich im Rollstuhl ins Röntgenzimmer zu bringen. Ein kundiger Pfleger schnitt mit einer großen Schere mühsam meinen Gips auf, worauf sich sofort ein übler Geruch im Behandlungszimmer ausbreitete. Der Bereich beim angeschwollenen Knie war rot, und sah überhaupt nicht gut aus. Sorgfältig wusch mir der Pfleger das Bein, dann musste ich mein Bein in allen möglichen Positionen auf den Röntgentisch legen um mehrere Röntgenbilder zu machen. Die Schmerzen waren kaum aushaltbar, und ich stöhnte jedes Mal mit schmerzverzerrtem Gesicht auf, als er mein Bein anfasste und vorsichtig in die richtige Position brachte. Die Prozedur dauerte mehr als eine Stunde, und ich war fix und fertig als es endlich vorbei war. Der Pfleger der mich gebracht hatte, schob mich im Rollstuhl wieder zurück in mein Zimmer, wo ich den Rest des Tages apathisch im Bett lag. Auf die Versuche meiner Zimmergenossen Konversation zu machen, reagierte ich kurz angebunden und abweisend, bis sie mich schließlich ignorierten und in Ruhe ließen. Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, wurde ich in ein Behandlungszimmer gebracht, wo ein Arzt auf einer beleuchteten Glasscheibe die Röntgenbilder anbrachte, und mir geduldig zeigte was die Technik zum Vorschein brachte. Genau in der Mitte des Kniegelenks waren schemenhaft zwei weiße Knochensplitter zu sehen.
„Gut dass sie hier hergekommen sind Herr Bargetz. Wenn diese Knochensplitter, von denen wir zumindest davon ausgehen, dass es Knochensplitter sind, nicht entfernt werden, können sie in absehbarer Zeit überhaupt nicht mehr gehen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass man ihnen irgendwann das Bein amputieren muss. Der Eingriff wird nicht einfach werden, doch ich bin zuversichtlich, dass wir die zwei Eindringlinge erwischen. Allerdings werden sie sich für eine lange Zeit schonen müssen, damit alles gut verheilen kann.“, erklärte mir der Arzt, und blickte dabei ständig auf die Röntgenbilder.
Bei seiner Erklärung benutzte er viele Fremdworte, die ich nicht verstand, doch im Großen und Ganzen wusste ich worum es ging. Das Einzige was mir wichtig war, war seine Aussage, dass er eine Möglichkeit sah die Splitter zu entfernen, und ich irgendwann wieder normal würde gehen können, ohne auf eine Gehhilfe angewiesen zu sein.
„Wieso hat man das nicht schon beim ersten Mal Röntgen gesehen, und wie ist es überhaupt möglich, dass diese Knochensplitter in mein Kniegelenk gekommen sind, Herr Doktor? Der Knochenbruch war doch weiter unten“, fragte ich neugierig.