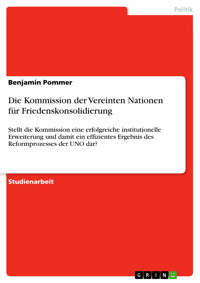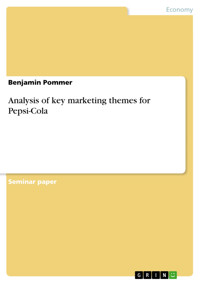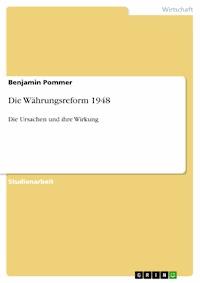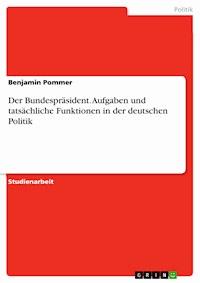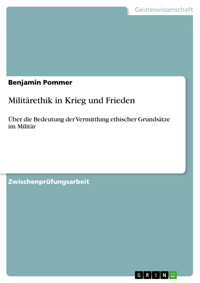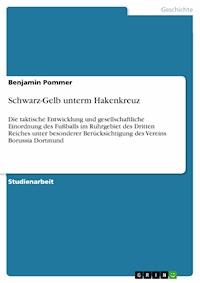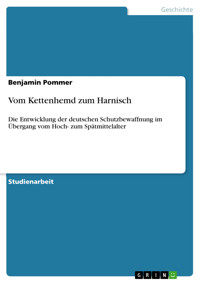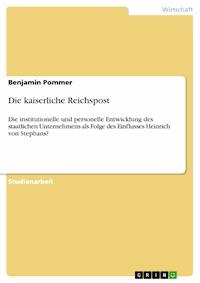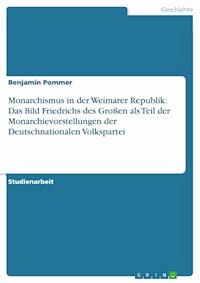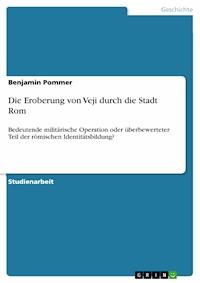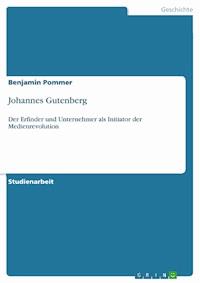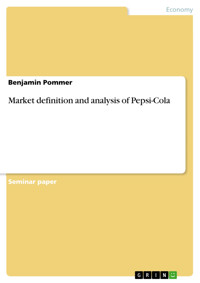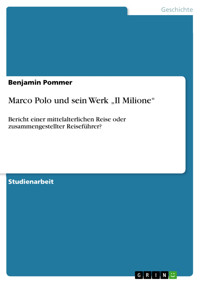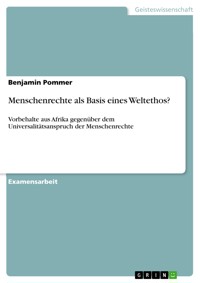
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Soziales System und Sozialstruktur, Note: 1,7, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt in großen Teilen der Kontinente Südamerika, Asien und vor allem Afrika aus der Wahrnehmung der dortigen Bevölkerungen heraus Vorbehalte gegenüber Einheitsbestrebungen, die einer westlichen Dominanz entsprangen und diese Dominanz auch behalten. Im Bereich der Menschenrechte gibt es grob gesagt zwei Strömungen, die sich der Universalisierung der Verbreitung und ihrer Bewahrung widmen. Es handelt sich zum einen auf geopolitische Ebene um die Vereinten Nationen und zum anderen auf religiöser Ebene um die Bestrebungen eines interreligiösen Austausches mit dem Ziel eines Weltethos. Jedoch tragen die Initiativen auf beiden Ebenen nicht zum gewünschten Ergebnis bei, weshalb der Bogen wieder zur Rezeption der am Prozess der Vereinheitlichung nur marginal beteiligten Gesellschaften der so genannten Dritten Welt zu spannen ist. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Vorbehalte aus der Dritten Welt aus welchen Gründen an die westlich dominierte Vereinheitlichung von Ethos und Menschenrechtsgedanken herangetragen werden und wie sie ethisch-theologisch zu lokalisieren und Lösungsansätze zu erarbeiten sind. Als These liegt dieser Arbeit die Annahme zu Grunde, dass theologische und kulturelle Differenzen das Ergebnis einer fehlerhaften Kommunikation sind, bestehend aus dem historischen Verhältnis zwischen Westen und Afrika mit dementsprechend gering ausgeprägter Empathie, und eine Lösungsmöglichkeit über die Form eines flexiblen Konsenses auf Basis der gegenseitigen Anerkennung von Differenzen und Gemeinsamkeiten zu erreichen ist. Um die These zu begründen wurde in dieser Arbeit ein vergleichender Ansatz gewählt, der mit der Betrachtung des historisch belasteten Verhältnisses zwischen Westen und Afrika beginnt. Danach werden die bereits erwähnten Konzepte auf politischer und theologischer Ebene ausführlicher betrachtet, um neben den historischen Voraussetzungen noch die universalistischen Bestrebungen einordnen zu können. Den Hauptteil bildet die Analyse von Differenzen und Gemeinsamkeiten in der Konzeption von Menschrechten und Ethik (Westen, Afrika) anhand ausgewählter theoretischer Grundlagen, die versucht werden, auf Ansatzpunkte für die Begründung der These zu untersuchen. Im letzten Teil erfolgt eine Gegenüberstellung der Arbeitsergebnisse aus der vergleichenden Analyse zum Zwecke der Erfassung und Konkretisierung von Möglichkeiten zur Problemlösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einführung
„Immer deutlicher wurde mir in den letzten Jahren, daß die eine Welt, in der wir leben, nur dann eine Chance zum Überleben hat, wenn in ihr nicht länger Räume unterschiedlicher, widersprüchlicher und gar sich bekämpfender Ethiken existieren. Die eine Welt brauch dies eine Grundethos; diese eine Weltgesellschaft braucht gewiß keine Einheitsreligion und Einheitsideologie, wohl aber einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele.“1
Die Ausführungen des schweizerischen Theologen Hans Küng symbolisieren, wenn auch nicht eine Notwendigkeit, so doch den Bedarf einer Beseitigung von religiösem Konfliktpotential, welches sich in europäischer und globaler Perspektive nicht selten in Form von bewaffneten Konflikten entlud. Der Wille zur Vereinheitlichung bestimmter einzelstaatlicher Vorgänge lässt sich nicht nur in religiösen und theologischen Fragen beobachten, er tauchte historisch bereits in Handelsverflechtungen von einzelnen Staaten oder des größten Teils der am Weltmarkt beteiligten Staaten auf. Ebenso findet ein politisch bestimmtes Zusammenwirken auf Basis gemeinsamer Werte und Interessen statt, wie regional in der Europäischen Union oder global in den Vereinten Nationen. Jedoch handelt es sich bei den verschiedenen Formen des Zusammenwirkens oftmals nicht um Verhandlungen, die auf Augenhöhe geführt werden.
Es gibt in großen Teilen der Kontinente Südamerika, Asien und vor allem Afrika aus der Wahrnehmung der dortigen Bevölkerungen heraus Vorbehalte gegenüber
Einheitsbestrebungen, die einer westlichen Dominanz entsprangen und diese Dominanz auch behalten. Im Bereich der Menschenrechte gibt es grob gesagt zwei Strömungen, die sich der Universalisierung der Verbreitung und ihrer Bewahrung widmen. Es handelt sich zum einen auf geopolitische Ebene um die Vereinten Nationen und zum anderen auf religiöser Ebene um die Bestrebungen eines interreligiösen Austausches mit dem Ziel eines Weltethos. Jedoch tragen die Initiativen auf beiden Ebenen nicht zum gewünschten Ergebnis bei, weshalb der Bogen wieder zur Rezeption der am Prozess der Vereinheitlichung nur marginal beteiligten Gesellschaften der so genannten Dritten Welt zu spannen ist.
Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Vorbehalte aus der Dritten Welt aus welchen Gründen an die westlich dominierte Vereinheitlichung von Ethos und Menschenrechtsgedanken herangetragen werden und wie sie ethisch-theologisch zu lokalisieren und Lösungsansätze zu erarbeiten sind. Als These liegt dieser Arbeit die Annahme zu Grunde, dass theologische und kulturelle
1KÜNG, Hans: Projekt Weltethos. 3. Aufl. München 1990, 14.
Page 2
Differenzen das Ergebnis einer fehlerhaften Kommunikation sind, bestehend aus dem historischen Verhältnis zwischen Westen und Afrika mit dementsprechend gering ausgeprägter Empathie, und eine Lösungsmöglichkeit über die Form eines flexiblen Konsenses auf Basis der gegenseitigen Anerkennung von Differenzen und Gemeinsamkeiten zu erreichen ist. Um die These zu begründen wurde in dieser Arbeit ein vergleichender Ansatz gewählt, der mit der Betrachtung des historisch belasteten Verhältnisses zwischen Westen und Afrika beginnt.
Danach werden die bereits erwähnten Konzepte auf politischer und theologischer Ebene ausführlicher betrachtet, um neben den historischen Voraussetzungen noch die universalistischen Bestrebungen einordnen zu können. Den Hauptteil bildet die Analyse von Differenzen und Gemeinsamkeiten in der Konzeption von Menschrechten und Ethik (Westen, Afrika) anhand ausgewählter theoretischer Grundlagen, die versucht werden, auf Ansatzpunkte für die Begründung der These zu untersuchen. Im letzten Teil erfolgt eine Gegenüberstellung der Arbeitsergebnisse aus der vergleichenden Analyse zum Zwecke der Erfassung und Konkretisierung von Möglichkeiten zur Problemlösung. Es wird während der Arbeit versucht werden den westlichen und afrikanischen Auffassungen ein argumentatives Gleichgewicht zu verschaffen, jedoch ohne das Ziel, soviel sei bereits vorweggenommen, ein Lösungsheft für das belastete Verhältnis der beiden kulturellen Sphären in den Händen zu halten.
Auf die Einbeziehung der islamisch geprägten nordafrikanischen Sicht wurde, obgleich einer aktuellen Relevanz, weitestgehend verzichtet, da die angesprochenen Probleme einer westlichen Bevormundung hauptsächlich im subsaharischen Afrika auftreten, und die Berücksichtigung gerade der islamischen Theologie Inhalt einer eigenen Arbeit sein muss. Für diese Arbeit war eine Fülle an Material vorhanden, die in einem entsprechenden Anteil an dieser Arbeit Berücksichtigung fand und im jeweiligen Kapitel nachvollzogen werden kann. Besonders auffällig und für den Wissenschaftler begrüßenswert ist die hohe Anzahl von afrikanisch initiierten Arbeiten über kulturelle und theologische Problemfelder, abseits von der ebenfalls relevanten Kolonial- und Entwicklungsliteratur. Hier sind vor allem die Arbeiten von Bénézet Bujo hervorzuheben, die dementsprechend Berücksichtigung fanden.
2. Problematik des interkulturellen Nord-Süd-Dialogs
2.1. Folgen des Kolonialismus
Die eigentliche Welle der Erschließung des afrikanischen Kontinents begann mit dem Ende des 15. Jahrhunderts durch die Ausbreitung europäischer Mächte außerhalb