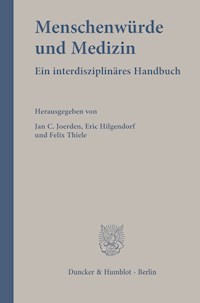
Menschenwürde und Medizin. E-Book
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Begriff »Menschenwürde« ist in den vergangenen Jahrzehnten weltweit zu einem Brennpunkt der bioethischen Debatte geworden. Angestoßen durch den rasanten Fortschritt der medizinischen Forschung und die sich daraus ergebenden Probleme hat sich eine umfangreiche gesellschaftliche Kontroverse über die moralische Akzeptabilität vieler neuartiger medizinischer Technologien entwickelt. Dieser Diskussion widmet sich das interdisziplinäre Handbuch, das im Rahmen einer interdisziplinär und international zusammengesetzten Forschungsgruppe am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZIF) in Bielefeld zu dem Thema »Herausforderungen für Menschenwürde und Menschenbild durch neuere Entwicklungen der Medizintechnik« erarbeitet worden ist. In Teil A. wird zunächst eine theoretische Grundlegung des Menschenwürdebegriffs aus den Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen entwickelt. Teil B. zeigt die Möglichkeiten der Anwendung des Menschenwürdebegriffs auf die gleichsam klassischen Fragen der Medizinethik und des Medizinrechts, einschließlich seiner Bezüge zur medizinischen Praxis. Teil C. erweitert die Perspektive um neuere Entwicklungen des medizintechnischen Fortschritts und die hiermit zusammenhängenden möglichen Anwendungsbereiche des Menschenwürdegedankens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
JAN C. JOERDEN / ERIC HILGENDORF / FELIX THIELE (Hrsg.)
Menschenwürde und Medizin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 2013 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Satz und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-13649-0 (Print) ISBN 978-3-428-53649-8 (E-Book) ISBN 978-3-428-83649-9 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort
Dieses Handbuch ist im Rahmen einer interdisziplinär und international zusammengesetzten Forschungsgruppe am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld zu dem Rahmenthema „Herausforderungen für Menschenwürde und Menschenbild durch neuere Entwicklungen der Medizintechnik“1 erarbeitet worden. Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Kapitel haben sich vorgenommen, zu zeigen, welche Bedeutung der Begriff der Menschenwürde im Bereich der Medizin (insbesondere für Medizinethik und -recht) hat bzw. haben könnte. In Teil A. des Handbuchs wird zunächst eine theoretische Grundlegung des Menschenwürdebegriffs aus den Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen entwickelt. Teil B. zeigt die Möglichkeiten der Anwendung des Menschenwürdebegriffs auf die gleichsam klassischen Fragen der Medizinethik und des Medizinrechts, einschließlich seiner Bezüge zur medizinischen Praxis, und der Teil C. erweitert die Perspektive auf neuere Entwicklungen des medizintechnischen Fortschritts und die hiermit zusammenhängenden möglichen Anwendungsbereiche des Menschenwürdegedankens.
Die Herausgeber danken dem ZiF zum einen für die Förderung der Forschungsgruppe und zum anderen für die großzügige Unterstützung der Drucklegung dieses Handbuchs herzlich. Dabei ist besonders die umsichtige Betreuung durch das Direktorium des ZiF, geleitet zunächst von Jörg R. Bergmann und dann von Ulrike Davy, sowie die Geschäftsführerin des ZiF Britta Padberg hervorzuheben. Unsere Dankbarkeit erstreckt sich aber auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ZiF für ihre Gastfreundschaft und die stets hilfreiche Förderung der Forschungsgruppe.
Für die Unterstützung bei der Realisierung dieses Handbuchs danken wir ganz herzlich Natalia Petrillo, der Koordinatorin der Forschungsgruppe im ZiF, sowie ihren Mitarbeiterinnen Rebecca Mertens und Kristina Panchyrz, jeweils Bielefeld. Außerdem gebührt Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Strafrecht und Rechtsphilosophie in Frankfurt (Oder) Johannes Bochmann, Chris[6]tiane Herzog, Dariia Ieremenko, Susen Pönitzsch, Stefan Seiterle, Maximilian Silm und Carola Uhlig für ihre Hilfe bei den vielfältigen Aufgaben im Rahmen des Drucklegungsprozesses. Zu besonderem Dank sind wir Carola Uhlig auch für die sorgsame Anfertigung der Register verpflichtet. Einige der Kapitel mussten aus der englischen Sprache ins Deutsche übertragen werden. Den Übersetzern sei hier auch ausdrücklich für ihre Arbeit gedankt; ihre Namen sind bei den jeweiligen Kapiteln vermerkt.
Dem Handbuch ist eine Bibliographie zu „Menschenwürde und Medizin“ angefügt, in der wichtige Buchpublikationen aus jüngerer Zeit im Schnittbereich der beiden Begriffe erfasst sind. Für die Zusammenstellung dieser Bibliographie danken wir in erster Linie wiederum Natalia Petrillo, Bielefeld, aber auch Christiane Herzog und Christian Lüdorf, Frankfurt (Oder). Schließlich geht unser Dank an Lars Hartmann im Verlag Duncker und Humblot, Berlin, für die umsichtige und geduldige Betreuung der verlagsmäßigen Herstellung des Bandes.
Würzburg/Frankfurt (Oder) /Bad Neuenahr-Ahrweiler,
Jan Joerden,
im Sommer 2012
Eric Hilgendorf,
Felix Thiele
1 Geleitet wurde die Forschungsgruppe von Jan C. Joerden, Frankfurt (Oder) (federführend), Eric Hilgendorf, Würzburg, und Felix Thiele, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Natalia Petrillo, Bielefeld, hat die Arbeit der Forschungsgruppe als wissenschaftliche Mitarbeiterin koordiniert. Als residente Fellows haben der Forschungsgruppe außerdem angehört: Frank Dietrich, Leipzig / Bielefeld; Dorothee Dörr, Köln; Marcus Düwell, Utrecht; Daniel S. Goldberg, Greenville; Altan Heper, Istanbul; Andrzej M. Kaniowski, Łodz; Ulrich Körtner, Wien; Gesa Lindemann, Oldenburg; Georg Lohmann, Magdeburg; Markus Rothhaar, Erlangen / Hagen; Peter Schaber, Zürich; Stefan Seiterle, Frankfurt (Oder), Ralf Stoecker, Potsdam und Guglielmo Tamburrini, Neapel. Die Autorinnen und Autoren der Kapitel dieses Handbuchs waren entweder Fellows der Forschungsgruppe oder der Forschungsgruppe als externe Mitglieder assoziiert.
Inhaltsverzeichnis
A. Grundlagen der Menschenwürde-Diskussion
Einführung in Teil A.
(Felix Thiele)
I. Menschenwürde aus philosophisch-ethischer Perspektive
1.
Kapitel:
Erläuterungen der Menschenwürde aus ihrem Würdecharakter
(Ralf Stoecker
und
Christian Neuhäuser)
2.
Kapitel:
Menschenwürde qua Autonomie und Anerkennung: Kant und Fichte (
Markus Rothhaar)
3.
Kapitel:
Fähigkeiten – Rechte – Menschenwürde. Ethische Begründung und anthropologische Dimensionen der Menschenwürde bei Martha Nussbaum und Alan Gewirth (
Marcus Düwell
)
4.
Kapitel:
Menschenwürde und Diskursethik (
Micha H. Werner
)
5.
Kapitel:
Phänomenologische Ansätze zur Menschenwürde
(Natalia Petrillo)
6.
Kapitel:
Menschenwürde-Skepsis
(Dieter Birnbacher)
II. Menschenwürde aus rechtsphilosophischer und juristischer Sicht
7.
Kapitel:
Menschenwürde als „Basis“ von Menschenrechten
(Georg Lohmann)
8.
Kapitel:
Konzeptionen des „Menschenbilds“ und das Recht
(Eric Hilgendorf)
9.
Kapitel:
Menschenwürde als juridischer Begriff
(Jan C. Joerden)
10.
Kapitel:
Menschenwürde in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
(Stephan Kirste)
11.
Kapitel:
Menschenwürde und Verfahren
(Frank Saliger)
12.
Kapitel:
Menschenwürde im internationalen Recht
(Brian Valerius)
III. Menschenwürde aus religiöser und interkultureller Perspektive
13.
Kapitel (1. Teil):
Menschenwürde im Christentum – aus evangelischer Sicht
(Ulrich H. J. Körtner)
13.
Kapitel (2. Teil):
Menschenwürde im Christentum – aus katholischer Sicht (
Dietmar Mieth
)
14.
Kapitel:
Menschenwürde, Islam und bioethische Fragen
(Altan Heper)
15.
Kapitel:
Grundbegriffe der interkulturellen Theorie und der Begriff der Menschenwürde (
Jan-Christoph Marschelke
)
IV. Menschenwürde aus gesellschaftsund kulturwissenschaftlicher Perspektive
16.
Kapitel:
Menschenwürde – ihre gesellschaftsstrukturellen Bedingungen (
Gesa Lindemann
)
17.
Kapitel:
Menschenwürde aus kulturwissenschaftlicher Sicht (
Jörn Ahrens
)
18.
Kapitel:
Der Menschenwürdebegriff in der Bioethik (
Roberto Andorno
und
Marcus Düwell
)
B. Menschenwürde und normative Grundfragen der Medizin
Einführung in Teil B. (
Jan C. Joerden
)
I. Menschenwürde vor und am Beginn des Lebens
19.
Kapitel:
Menschenwürde und vorgeburtliches Leben (
Frank Dietrich
und
Frank Czerner
)
20.
Kapitel:
Schwangerschaftsabbruch und Menschenwürde (
Jacek Holówka
)
II. Menschenwürde und medizinische Behandlung
21.
Kapitel:
Arzt-Patient Verhältnis und Menschenwürde (
Felix Thiele
)
22.
Kapitel:
Menschenwürde und Psychiatrie (
Ralf Stoecker
)
23.
Kapitel:
Menschenwürde und klinische Ethikberatung (
Uwe Fahr
)
24.
Kapitel:
Menschenwürde und Gesundheitsversorgungsgarantien (
Hartmut Kliemt
)
25.
Kapitel:
Menschenwürde und Behinderung (
Sigrid Graumann
)
26.
Kapitel:
Menschenwürde und Pflege: Sozial-, handlungs- und haltungsethische Dimensionen (
Heike Baranzke
)
27.
Kapitel:
Menschenwürde und Pflege: Schutz der Handlungsfähigkeit (
Monika Bobbert
)
III. Menschenwürde am und nach dem Lebensende
28.
Kapitel:
Menschenwürde am Lebensende (
Ulrich H. J. Körtner
)
29.
Kapitel:
Menschenwürde, Bewusstsein und menschliche Existenz (
William Winslade
)
30.
Kapitel:
„Menschenwürde“ und normative Grundfragen im Hinblick auf den Verstorbenen
(Dominik Groß, Brigitte Tag
und
Markus Thier
)
C. Menschenwürde und medizinisch-technischer Fortschritt
Einführung in Teil C. (
Eric Hilgendorf
)
I. Menschenwürde bei der Hervorbringung menschlichen Lebens
31.
Kapitel:
Menschenwürde und Ersatzmutterschaft (
Tatjana Hörnle
)
32.
Kapitel:
Menschenwürde und Präimplantationsdiagnostik (
Dieter Birnbacher
)
33.
Kapitel:
Menschenwürde und reproduktives Klonen (
Tatjana Hörnle
)
II. Menschenwürde und neue Medizintechniken
34.
Kapitel:
Menschenwürde und embryonale Stammzellforschung (
Klemens Störtkuhl
und
Markus Rothhaar
)
35.
Kapitel:
Menschenwürde und Intensivmedizin: Lebensqualitätsbewertung und die Funktion des Menschenwürdeprinzips (
Dorothee Dörr
)
36.
Kapitel:
Menschenwürde und Menschenrecht in der Transplantationsmedizin (
Hartmut Kliemt
)
37.
Kapitel:
Menschenwürde und Xenotransplantation (
Frank Dietrich
)
38.
Kapitel:
Menschenwürde, Neuroimaging und das „Menschenbild“ (
Daniel Goldberg
)
39.
Kapitel:
Menschenwürde und Neuromodulation (
Eric Hilgendorf
)
40.
Kapitel:
Menschenwürde und Hirntod (
Ralf Stoecker
)
41.
Kapitel:
Menschenwürde und Gehirnkommunikation und -steuerung (
Guglielmo Tamburrini
)
42.
Kapitel:
Menschenwürde und sexuelle Identität (
Florian Steger
)
43.
Kapitel:
Menschenwürde und Roboter (
Gregor Fitzi
und
Hironori Matsuzaki
)
III. Menschenwürde und der Umgang mit medizinischen Informationen
44.
Kapitel:
Menschenwürde und Biobanken
(Kris Dierickx
und
David Kirchhoffer
)
45.
Kapitel:
Zufallsbefunde – was gebietet die Menschenwürde? (
Reinold Schmücker
)
IV. Menschenwürde und die Veränderung des Menschen
46.
Kapitel:
Menschenwürde und Enhancement (
Holger Baumann
und
Nikola Biller-Andorno
)
47.
Kapitel:
Menschenwürde und Mensch-Maschine-Systeme (
Susanne Beck
)
48.
Kapitel:
Menschenwürde und Nanotechnologie: Zwei Perspektiven, zahlreiche Ethiken (
Roger Brownsword
)
49.
Kapitel:
Menschenwürde und Chimären- und Hybridbildung (
Jan C. Joerden
)
V. Ausblicke
50.
Kapitel:
Menschenwürde und die Idee des Posthumanen (
Eric Hilgendorf
)
Bibliografie
Abkürzungsverzeichnis
Personenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
A. Grundlagen der Menschenwürde-Diskussion
Einführung in Teil A.
Felix Thiele
I. Einleitung
Der Begriff ‚Menschenwürde‘ ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Brennpunkt der bioethischen Debatte geworden – und das nicht nur in Deutschland, wo die Menschenwürde das Fundament der verfassungsrechtlichen Grundordnung bildet, sondern weltweit.1
Angestoßen durch den rasanten Fortschritt der medizinischen Forschung und die sich daraus ergebenden Probleme hat sich eine umfangreiche, oft kontrovers geführte Debatte über die moralische Akzeptabilität vieler neuartiger medizinischer Technologien entwickelt. Beispielsweise bewerten viele Autoren die sich am Horizont abzeichnende Möglichkeit der gezielten Intervention in das menschliche Genom als Überschreitung moralisch schützenwerter „natürlicher“ Grenzen – aus einer bislang durch menschliche Intervention nicht beeinflussbaren, ‚gewordenen‘ genetischen Ausstattung wird, so die Argumentation, ein menschlichen Eingriffen nicht länger verschlossenes, ein ‚gemachtes‘ Genom. Auch andere mit dem medizinischen Fortschritt in enger Verbindung stehende Entwicklungen werfen neue Probleme auf: So nimmt die Lebenserwartung der Menschen immer weiter zu. Das hat unter anderem zur Folge, dass eine stetig steigende Zahl von Menschen unter Alterskrankheiten, vor allem Demenz, leidet. Moralisch relevant wird diese Entwicklung nicht nur wegen einer absehbaren Ressourcenknappheit mit unabsehbaren Folgen für die medizinische Versorgungslage. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Medizinethik mit den etablierten Konzepten, allen voran dem Prinzip der Autonomie, die geeigneten Mittel für die Bewältigung der anstehenden Debatten zur Verfügung stehen. So ist fraglich, ob sich der moralisch empfehlenswerte Umgang mit Demenz-Kranken unter Rückgriff auf das Prinzip der Autonomie bestimmen lässt. Ein im Endstadium Demenzkranker ist auf Grund fehlender Autonomie genauso wenig in der Lage, seinen Willen kund zu tun, wie ein Embryo. Nun gibt es für dieses Problem Hilfsargumentationen (z. B. die Feststellung des mutmaßlichen Willens etc.), doch verwundert nicht, dass angesichts der Limitierungen etablierter medizinethischer Begriffe auch nach Alternativen gesucht wird. Hier kommt insbesondere der Menschenwürde eine Schlüsselrolle zu.
[14] In Teil B. und C. dieses Handbuches werden eine Vielzahl medizinethischer Probleme, die sich direkt oder indirekt aus dem medizinischen Fortschritt ergeben, mit Blick auf ihr Verhältnis zur Menschenwürde diskutiert (s. dazu auch die Einleitung zu den Teilen B. und C.). In Teil A. des Handbuchs und in der vorliegenden Einleitung soll es zunächst um die philosophischen Ansätze, den Begriff der Menschenwürde zu explizieren und zu begründen, gehen.
Wollte man eine Ideengeschichte der praktischen Philosophie in den letzten 60 Jahren schreiben, ließe sich die These vertreten, dass wir Zeuge eines Paradigmenwechsels sind, bei dem die ‚Menschenwürde‘ zum neuen Leitmotiv, zur zentralen Begründungsinstanz der praktischen Philosophie und Bioethik wird und damit das Mantra ‚Autonomie‘ verdrängt. Und tatsächlich scheint es doch, wie schon angedeutet, überzeugender zu sein, über die Würde eines Demenzkranken, eines Menschenaffen oder eines Embryos zu sprechen, wo es wenig oder keinen Sinn macht, über deren Autonomie zu diskutieren.
Auch in den Grundtexten des internationalen Rechts ist eine ähnliche Bedeutungszunahme der Menschenwürde zu verzeichnen. Beginnend mit der politischen, juristischen und moralischen Aufarbeitung der Gräueltaten des Nationalsozialismus nach 1945 findet der Begriff Menschenwürde in zahlreiche internationale Rechtsdokumente und nationale Verfassungen Eingang. Noch bevor das Deutsche Grundgesetz 1949 in Kraft tritt, findet sich die Menschenwürde in der Charta der Vereinten Nationen von 1945. Auch in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 ist wiederholt von der Würde die Rede. Mittlerweile ist die Menschenwürde ein zentraler Bestandteil in vielen neu verabschiedeten Verfassungen und Deklarationen, so auch im Vertrag von Lissabon, dem gegenwärtig gültigen Grundlagenvertrag der Europäischen Union. Umstritten ist allerdings, welche praktische Bedeutung die Aufnahme der Menschenwürde in diese Rechtsdokumente hat. Während manche Autoren dies als den entscheidenden Schritt sehen, der die Menschenwürde praktisch wirksam werden lässt, meinen andere Autoren, dass diese Dokumente nur geringe juristische Bedeutung haben, Menschenwürde nach wie vor keine weitgehende juristische Wirksamkeit zukommt und besonders bei ethisch und juristisch umstrittenen biomedizinischen Problemen, die entsprechenden Dokumente den Vertragsstaaten große Ermessensspielräume belassen.2
Die Menschenwürde, obwohl kein biblischer Begriff, nimmt mittlerweile auch in der christlichen Theologie breiten Raum ein. Diskutiert wird unter anderem, ob sich die philosophischen Konzepte von Menschenwürde als neuzeitliche Interpretation biblischer Quellen interpretieren lassen – Menschenwürde wird dann etwa aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen und seinem Status als Geschöpf Gottes hergeleitet. Das Spektrum der christlichen Positionen zur Menschenwürde ist vielfältig mit z. T. erheblichen Unterschieden zwischen den Konfessionen.3 Auch in nicht[15]christlichen Religionen gibt es Bemühungen, den Begriff der Menschenwürde für die Bearbeitung moralischer Probleme nutzbar zu machen.4
Das Anschwellen der Literatur zur Menschenwürde darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass über beinahe alle Aspekte und Implikationen dieses Konzepts kontrovers diskutiert wird. Eine erste Frage ergibt sich mit Blick auf den philosophiegeschichtlichen Hintergrund des Menschenwürdebegriffs. In vielen Enzyklopädien und Handbüchern wird Cicero als Urheber der expliziten Verknüpfung von Mensch und Würde dargestellt. Von ihm und der römischen Antike ausgehend, über das Mittelalter, die Renaissance und die Aufklärung bis hin ins 20. Jahrhundert lässt sich die Geschichte der Verwendung des Wortes Menschenwürde nachzeichnen.5 Aber versteht Cicero eigentlich unter Würde das Gleiche wie Kant oder die Autoren der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948? Anders gesagt: Haben wir es überhaupt mit einem Begriff zu tun oder nicht vielmehr mit einem Wort und vielen Begriffen?6 Welche Bedeutung sollen wir der Philosophiegeschichte beimessen? Ist sie mehr als ein Steinbruch von Argumenten, in dem wir uns bedienen können, aber nicht müssen? Oder verleihen die historischen Ereignisse – besonders die des letzten Jahrhunderts – dem Menschenwürdebegriff eine Geltung, die wir möglicherweise missachten, wenn wir ihn für die Zwecke der Bioethik umdeuten?
Die tiefgreifende Kontroverse über die Menschenwürde sollte nun aber nicht zu einem radikalen Menschenwürde-Skeptizismus führen, dessen Vertreter diesen Begriff als „sinnlos“ oder als eine „Dummheit“ abtun wollen.7 Zwar ist angesichts der im folgenden näher zu beleuchtenden offenen Fragen in der Debatte über die Menschenwürde eine skeptische Grundhaltung sicher nicht zu verurteilen, nur sollte dieser Skeptizismus in kritischer Absicht bestehen, d. h. in gleicher Weise der Destruktion unbegründeter Argumente wie der Konstruktion begründeter Argumente dienen.
Die nachfolgenden Kapitel dieses Handbuchs bieten eine detaillierte Einführung und kritische Diskussion verschiedener Positionen zur Menschenwürde. Statt nun eine notwendig verkürzende Zusammenfassung dieser Kapitel zu versuchen, soll hier zum einen näher darauf eingegangen werden, mit welchen methodischen Mitteln Vertreter unterschiedlicher Menschenwürde-Konzepte ihren Untersuchungsgegenstand explizieren. Zum anderen soll dargestellt werden, welche Funktion der Begriff der Menschenwürde im bioethischen Diskurs übernehmen soll. Zuvor sollen kurz einige Vorläufer der modernen Menschenwürde-Debatte skizziert werden.
[16] II. Menschenwürde – Stationen der Begriffsgeschichte
In der praktischen Philosophie, insbesondere auch in der Medizinethik hat sich, wie bereits bemerkt, eine intensive, breit gefächerte Debatte über die Menschenwürde erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Dessen ungeachtet reicht die Begriffsgeschichte der Menschenwürde weit zurück. Aus diesem Grund sollen im Folgenden einige Stationen in der Entwicklung dieses Begriffs skizziert werden.8
In der Regel wird Cicero als derjenige Autor angesehen, mit dem der Begriff der Würde erstmals im Rahmen philosophischer Überlegungen eine tragende Rolle übernimmt. Cicero war zu seiner Zeit bekanntlich einer der einflussreichsten Staatsmänner der römischen Republik. Er hatte sich, wie man heute vielleicht sagen würde, aus (für die damalige Zeit) relativ kleinen Verhältnissen empor gearbeitet. Seine Familie gehörte nicht zu den Altadligen, und seinen Erfolg verdankte er daher ganz wesentlich seinen individuellen Gaben und Leistungen; ein Umstand, der sich auch in Ciceros Bild der Pflichten eines römischen Bürgers widerspiegelt. Cicero lebte in einer Zeit des Niedergangs der römischen Republik. Ein großer Teil der Führungsschicht wurde seinen Pflichten, so wie Cicero es sah, in der persönlichen Lebensführung und gegenüber dem Staat nicht gerecht. Vor diesem Hintergrund entwickelt Cicero sein Konzept von Würde als Teil einer Staatsbürgerkunde, die er als Beitrag zur geistigen Erneuerung der Republik betrachtete.
Für die stoische Ethik, auf die sich Cicero stützt, unterscheidet sich der Mensch von den Tieren vor allem durch sein Denkvermögen, das es ihm ermöglicht, die Weltordnung zu erkennen und sich einen Platz in ihr zu wählen. Mit Blick auf die persönliche Lebensführung ist das stoische Ideal die kontinuierliche und lebenslange Selbstformung, die auf eine starke Affektkontrolle hin ausgerichtet ist.
Vor diesem Hintergrund entfaltet Cicero sein Konzept der vier sozialen Rollen (personae), in denen sich jeder Mensch wiederfindet und die er relativ zu den dazugehörigen Anforderungen mehr oder weniger gut ausfüllt und sich damit als mehr oder eben weniger würdig erweist. Cicero unterscheidet vier Rollen, die der Herkunft, der körperlichen und geistigen Anlagen, des selbstgewählten Lebensplanes und die des Menschseins.9 Die Anforderungen, die sich aus den ersten drei sozialen Rollen ergeben, sind interindividuell unterschiedlich stark ausgeprägt: die Anforderungen etwa, die die Mitglieder vornehmer Familien erfüllen sollten, wenn es um den Einsatz für das Staatswesen geht, sind andere und höhere, als die Erwartungen, die man an einen gewöhnlichen römischen Plebejer richtet. Im Gegensatz dazu gibt es zwischen den Individuen mit Blick auf die vierte soziale Rolle – das Menschsein – keine unterschiedlichen Anforderungen daran, wie diese Rolle auszufüllen sein.
Allerdings ist die Würde, die sich aus dem Menschsein ergibt, bei Cicero nur mit sehr schwachen normativen Implikationen verbunden. Sein eigentliches Augenmerk [17] liegt auf den Leistungen, die ein Individuum aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund seiner körperlichen und vor allem geistigen Anlagen für das Gemeinwohl erbringen kann bzw. erbringen sollte. Zeitgenössische Konzepte der Menschenwürde sind mit wesentlich stärkeren normativen Gehalten versehen, so dass aus dieser Perspektive Ciceros Würde-Begriff als zu schwach erscheint. Allerdings sollte man nicht vergessen, für welches moralische Problem Cicero eine Antwort sucht: Es ging ihm um Kriterien, anhand derer sich die Verpflichtungen der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft bestimmen und sich deren Leistungen bewerten lassen. Der Einwand, dass damit die Gefahr entstehe, weniger leistungsfähige Menschen (z. B. geistig Behinderte), denen dann nur eine aus ihrem Menschsein resultierende Residualwürde zukommt, an den Rand zu drängen, ist zwar berechtigt, lässt aber wie gesagt außer Acht, dass Ciceros Würde-Konzept Antworten auf Fragen gibt, die sich von denen, die sich uns heute mit Blick auf die Bioethik stellen, grundverschieden sind.
In der Renaissance findet sich mit Pico della Mirandola ein Autor, der ebenfalls den Begriff der Menschenwürde für eine Standortbestimmung des Menschen verwendet. Aber anders als Cicero wendet sich Pico nicht nur der Stellung des Menschen in der Gesellschaft zu, sondern unternimmt den Versuch, den Menschen in der göttlichen Ordnung insgesamt zu verorten.
Pico lebt in einer Zeit des Übergangs, in der sich tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzungen vollziehen. Insbesondere die republikanisch organisierten Stadtstaaten Oberitaliens bieten gebildeten Individuen neue Entfaltungsspielräume außerhalb der kirchlichen Hierarchien. Die Spannungen zwischen dem verblassenden intellektuellen Führungsanspruch der Kirche und dem häufig in Diensten von Adligen stehenden neuen Typus des Intellektuellen bildet den Hintergrund für Picos Schrift „Über die Würde des Menschen“. Dieser vorausgegangen war eine Veröffentlichung Picos (Conclusiones), in der er in 900 Thesen eine umfassende, integrative Darstellung der bedeutenden christlichen und nicht-christlichen Systeme der Philosophie anstrebte. Die Kirche empfand diese Veröffentlichung als Angriff auf ihre Autorität, die Thesen wurden verboten und Pico für einige Jahre exkommuniziert. Der Text „Über die Würde des Menschen“ war von Pico als Grundlage für eine Verteidigung seiner 900 Thesen gedacht – weniger als Rechtfertigung ihres Inhalts, sondern mehr als eine Darlegung der Gründe, aus denen Pico das Recht ableitete, Gedanken zu publizieren, die von denen der Amtskirche abwichen. In moderner Terminologie gesagt: Es ging Pico um die Rechtfertigung der Meinungsfreiheit gegenüber der Kirche.
Das zentrale Argument bei Pico ist die These, dass jeder einzelne Mensch die Fähigkeit zur Selbstbestimmung besitzt. Der Mensch ist demnach das einzige Lebewesen, dessen Position in der Hierarchie des Kosmos, der scala naturae, nicht fixiert ist. Die Möglichkeit zum Selbstentwurf kann der Mensch dazu nutzen, sich dem Göttlichen anzunähern. Sie eröffnet dem Menschen zugleich aber auch die Möglichkeit, auf das Niveau von Tieren herabzusinken.10 Die Fähigkeit, über seine [18] Geschicke zu bestimmen, ist bei Pico der Grund dafür, dass dem Menschen Würde zukommt. Unklar bleibt dabei, ob Pico die Auffassung vertritt, dass die Würde ein Merkmal jedes einzelnen Menschen ist, und zwar unabhängig von seinen Taten, oder ob er meint, dass der Menschheit insgesamt und gegenüber den anderen Lebewesen Würde zukommt und der einzelne nur nach Maßgabe seiner individuellen Lebensführung mehr oder weniger Würde besitzt.
Vordergründig erörtert Pico in „Über die Würde des Menschen“ die anthropologische Frage nach der Natur des Menschen, und damit scheinbar nur die sich aus dieser Natur ergebenden Einsichten für die individuelle Lebensführung des Einzelnen. Allerdings leitet Pico diese Selbstverpflichtungen letztlich aus der göttlichen Ordnung her. Jemanden an dem Versuch zu hindern, seinen Verpflichtungen nachzukommen, ist also geradezu ein Verstoß gegen die Naturordnung, so dass die Menschenwürde gewisse Rechte des Einzelnen gegenüber Dritten mit sich bringt. Gerade mit Blick auf Picos Anliegen, seine Meinungsfreiheit gegenüber den kirchlichen Autoritäten zu rechtfertigen, spricht einiges dafür, dass er mit der Menschenwürde eine Schutzfunktion für den Würdeträger verbinden wollte.11
Mit Immanuel Kant wird die Menschenwürde endgültig zu einem zentralen Begriff der Moralphilosophie.12 Kants Ausführungen zur Menschenwürde gründen in seinem Konzept der Autonomie als dem Vermögen, sich selbst Zwecke zu setzen – oder anders formuliert, der Fähigkeit Handlungen zu vollziehen.13 Die Handlungsfähigkeit trennt die Gruppe der Vernunftwesen von anderen Wesen, die lediglich sinnlichen Impulsen folgen. Das Vermögen, sich selbst Zwecke zu setzen, ist nach Kant für jedes Vernunftwesen selbst unhintergehbar, so dass vernunftfähige Wesen als um ihrer selbst willen in der Welt seiend gedacht werden müssen. Diese als These der Selbstzweckhaftigkeit von Vernunftwesen bekannte Position begründet auch den von Kant eingeführten Unterschied von Würde und Preis:14 nur Vernunftwesen haben Würde, woraus Kant die normative Forderung ableitet, dass Würdeträger niemals bloß als Mittel, sondern immer zugleich als Zweck behandelt werden müssen.15 Ein mit Würde ausgestattetes Wesen hat moralische Rechte, denen moralische Pflichten der anderen korrespondieren. Die Einhaltung dieser Pflichten bringt die Achtung zum Ausdruck, die einem Würdeträger gebührt und deren Forderung Kant in der zweiten Formulierung des kategorischen Imperativs als Grund[19]prinzip der Moral darstellt.16 Im Gegensatz etwa zu Thomas Hobbes, der die Würde eines Menschen gleichsetzt mit dessen öffentlichem Wert (Leviathan, 10), ist nach Kant jeder Mensch Würdeträger, völlig unabhängig von seinen je individuellen Leistungen.
Entitäten ohne Vernunftfähigkeit genießen dagegen keinen Würdeschutz und dürfen vollständig instrumentalisiert werden. Kritiker des Kantschen Ansatzes sind der Meinung, dass es diesem nicht gelingt, deutlich zu machen, warum allein Vernunftfähigkeit – und nicht etwa Empfindungs- oder Leidensfähigkeit – umfassenden moralischen Schutz verleiht. Weiterhin ließe sich fragen, in welcher Weise der bei Kant formal bestimmte Begriff der Menschenwürde mit Inhalt gefüllt werden kann. Der Hinweis auf den kategorischen Imperativ als Prüfverfahren für Handlungen hilft nur bedingt weiter, denn es fehlen konkrete Angaben zur Anwendung. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass Kants Konzept bis heute die moralphilosophischen Debatten über die Menschenwürde prägt.
III. Zugänge zur Begriffsexplikation
Ein wesentliches Merkmal moralischer Debatten – besonders solcher, die im öffentlichen Raum stattfinden – ist es, dass mit Begriffen operiert wird, deren exakte Bedeutung oft unklar bleibt. Man denke nur an den oft bloß schlagwortartigen Gebrauch von z. B. Natur, Freiheit und Gerechtigkeit. In der Alltagssprache werden diese Ausdrücke in einer Vielzahl von nur oberflächlich ähnlichen Bedeutungen verwandt. Darüber hinaus haben diese Ausdrücke häufig eine lange und uneinheitliche Verwendungs-Geschichte. Auch der Begriff der Menschenwürde wird in öffentlichen Debatten in wechselnder und oft unklarer Weise gebraucht. Mit Blick auf diese unbefriedigende Situation wird gelegentlich verkürzend konstatiert, die Rede von Menschenwürde sei notwendig unklar und schwammig. Dagegen sollte man aber festhalten, dass es eine ganze Reihe meist philosophischer Ausarbeitungen des Menschenwürde-Begriffs gibt, die durchaus eine explizite Bedeutungsfestlegung bieten. Allerdings unterscheiden sich diese Ausarbeitungen zum Teil recht deutlich in der Art und Weise, wie und mit welchem Ergebnis sie den Begriff der Menschenwürde mit Bedeutung versehen. Dabei handelt es sich dann aber nicht um Unklarheiten innerhalb einer Position zur Menschenwürde, sondern um Widersprüche zwischen zwei oder mehreren Positionen – und solcherart Widersprüche sind ein Merkmal beinahe jeder wissenschaftlichen Kontroverse.
Im folgenden sollen einige der viel diskutierten zeitgenössischen Positionen zur Menschenwürde mit Blick auf ihren Ansatz zur Begriffsexplikation dargestellt werden. Damit soll ein erstes Verständnis für den methodischen Pluralismus der Menschenwürde-Debatte erreicht werden.
[20] 1. Alan Gewirth
Ein den Überlegungen Kants zur Menschenwürde verwandter Ansatz ist von Alan Gewirth entwickelt worden.17 Die Ausgangsfrage bei Gewirth lautet: Gibt es ein Moralprinzip, das für jeden Akteur verbindlich ist? Der Argumentationsgang lässt sich folgendermaßen nachzeichnen: Mit Handlungen verfolgen Akteure Zwecke. Die Realisierung von Zwecken setzt bestimmte Umstände voraus. Gewirth nennt in diesem Zusammenhang die Freiheit, zwischen Handlungszielen wählen zu können, und Wohlergehen im Sinne des Ausgestattetseins mit bestimmten basalen Gütern, die für jegliches Handeln notwendig sind. Diese Grundgüter nun muss jeder Akteur als für sich moralisch wünschenswert betrachten, eben weil er ohne sie seine Handlungszwecke nicht verfolgen könnte: „Wenn ich handeln will, dann muss ich im Besitz der genannten Grundgüter sein.“ Diese Argumentation gilt für jeden Akteur, d. h. jeder Akteur hält die genannten Grundgüter für sich für schützenswert. Gewirth argumentiert nun, dass, weil jeder Akteur für sich einen berechtigten Anspruch darauf habe, dass die für ihn notwendigen Bedingungen der Handlungsfähigkeit geschützt werden, er zugleich auch anerkennen müsse, dass jeder Akteur den gleichen berechtigten Schutzanspruch habe. Der Schutz der notwendigen Bedingungen der Handlungsfähigkeit wird somit zu einer moralischen Verpflichtung für alle handlungsfähigen Wesen. Gewirth nennt dies Moralprinzip das „Principle of Generic Consistency“. Der Wert, den jeder Akteur seinen grundlegenden Handlungsfähigkeiten beimisst, genauer beimessen muss, ist auch der Grund dafür, dass jeder Akteur sich als Würdeträger auffasst.18 Menschenwürde wird bei Gewirth also redehandlungstheoretisch rekonstruiert. Die Frage, wie sich diese Überlegungen auf konkrete bioethische Probleme anwenden lässt, kann hier ausgeklammert werden, wird von Gewirth und den Anhängern seiner Position aber bearbeitet.19 Kontrovers diskutiert bleiben jedoch zwei mögliche Defizite des Gewirthschen Ansatzes: zwar ist unbestreitbar, dass jeder Akteur den Anspruch erhebt bzw. erheben muss, dass die für ihn notwendigen Grundgüter geschützt werden sollen. Aber es herrscht kein Konsens, dass Gewirth genügend begründet hat, dass i) dieser von einem Akteur geäußerte Anspruch auch ein gerechtfertigter Anspruch ist, und dass ii) aus dem Umstand, dass ich einen gerechtfertigten Anspruch habe, notwendig folgt, dass gleichlautende Ansprüche anderer Akteure gleichermaßen gerechtfertigt sind.
2. Avishai Margalit
Im Anschluss an Avishai Margalits Buch The Decent Society lässt sich der Begriff der Menschenwürde aus einer Beschreibung derjenigen charakteristischen [21] Handlungs- und Verhaltensmuster eines Akteurs gewinnen, deren Behinderung oder Einschränkung dieser Akteur vernünftigerweise als Bedrohung für seine Selbstachtung empfindet. Selbstachtung wiederum lässt sich verstehen als das evaluative Selbstverhältnis, das Sich-um-sich-selbst-Kümmern, das den meisten Menschen eigen ist. Offenkundig gilt, dass nicht jede Bedrohung der Selbstachtung auch zu einer Verletzung derselben führt. Dass manche Individuen darüber hinaus nur eine schwach ausgeprägte oder gar keine Selbstachtung haben, schließt für Margalit aber nicht aus, dass sie vor Entwürdigung geschützt werden müssen. Selbstachtung und das Haben von Würde sind demnach nicht deckungsgleich. Eher ist der Zusammenhang so zu verstehen, dass die Missachtung derjenigen Handlungen und Verhaltensweisen, die für einen idealtypisch gedachten Akteur vernünftigerweise einen ernsten Angriff auf seine Selbstachtung bedeuten würden, als Demütigung und Entwürdigung qualifiziert werden müssen.
Im Gegensatz zur Gewirthschen Konzeption von Menschenwürde, orientiert sich der Margalitsche Ansatz sehr viel stärker an konkreten, man könnte sagen „gelebten“ Modellen des guten menschlichen Lebens. Damit wird die Diskussion um die Menschenwürde so erweitert, dass auch Überlegungen zu Demütigungen, Erniedrigungen, Ehr-Verletzungen und Stigmatisierungen in die Menschenwürde-Debatte einfließen können. Der daraus gewonnene Würde-Begriff wird von seinen Anhängern zuweilen auch als kontingente Würde bezeichnet, um dessen Kontextsensitivität herauszustreichen.20
Das Konzept von Menschenwürde als Gebot, Demütigungen zu vermeiden, wird von Margalit durch detaillierte Beschreibungen misslingender sozialer Kooperation mit Inhalt gefüllt. Diesem Vorbild folgend haben einige Autoren diesen Ansatz in die Medizinethik (insbesondere die Ethik der Psychiatrie) übertragen.21 Den Schutz vor Demütigungen in das Zentrum medizinethischer Überlegungen zu stellen, ist zunächst sehr plausibel, weil bei manchen Menschen, etwa Embryonen, Kindern oder psychisch Kranken, die Autonomie als zentrales normatives Kriterium nicht greift oder nur mit Hilfe selbst problematischer Hilfskonstrukte (mutmaßlicher und stellvertretender Wille, Vorausverfügungen) anwendbar ist.
Margalit und seine Anhänger verstehen ihren Ansatz als Rechtfertigungsverfahren für moralische Urteile, d. h. sie ziehen aus ihren praxisnahen Beschreibungen von typischerweise entwürdigenden Umständen normative Folgerungen. Es liegt nahe, diesen Ansatz mit Blick auf die Methodologie in die Nähe der hermeneutischen oder narrativen Ethik zu rücken.22 Für diese ist die Beschreibung von als moralisch oder unmoralisch empfundenen Situationen zugleich eine Quelle von Normativität. Kritiker weisen in diesem Zusammenhang auf die de facto vorfindliche interkulturelle und interindividuelle Varianz in der Beschreibung bzw. Bewertung bestimmter moralisch relevanter Vorkommnisse hin. Man denke in diesem Zu[22]sammenhang nur an die scharfen Diskussionen der vergangenen Jahre über die so genannten Ehrenmorde. Hier gibt es offensichtlich unvereinbare Vorstellungen darüber, ob bestimmte voreheliche Aktivitäten weiblicher Familienmitglieder eine Demütigung und damit Ehr- und Würde-Verletzung der männlichen Familienmitglieder darstellen. Allerdings ist dem aus Sicht der Margalitschen Position entgegenzuhalten, dass die normativen Schlussfolgerungen dieses Ansatzes sich keineswegs nur aus der Beschreibung real existierender sozialer Praktiken ableiten. Vielmehr versucht Margalit, die Allgemeingültigkeit seiner Überlegungen herauszuarbeiten. Dabei stützt er sich auf ethische Überlegungen, die über die narrative Rekonstruktion sozialer Praxen deutlich hinausgehen.23
3. Martha Nussbaum
Der von Nussbaum maßgeblich entwickelte Bedürfnis-Ansatz (capabilities approach) ist ein Versuch, im Rückgriff auf die ‚Natur des Menschen‘ bestimmte Grundgüter auszuzeichnen, die für ein gutes, menschliches Leben konstitutiv sind. In Abgrenzung von anderen Autoren (insbesondere John Rawls), die Grundgüter möglichst ohne Bezug auf die Natur des Menschen bestimmen wollen, bezieht sich Nussbaum im Anschluss an Aristoteles auf eben diese Natur. Wo Autoren wie Kant und Rawls die letztlich biologische Natur des Menschen als zwar unveränderlich, aber vor-moralisch halten, so dass sich an sie keine normativen Argumente knüpfen lassen, hält Nussbaum gerade dies für den einzig gangbaren Weg. So leitet sie umfangreiche „Listen“ von Grundgütern aus der Natur des Menschen ab und hält den Schutz dieser Güter für moralisch verpflichtend.24 Die Menschenwürde bezeichnet nach Nussbaum dann dasjenige Set von Bedürfnissen (Rationalität, Sozialität, körperliche Grundbedürfnisse), das für ein gutes menschliches Leben konstitutiv ist.25
Es ist Gegenstand anhaltender Debatten, in welcher Weise die von Nussbaum postulierte normative Relevanz bestimmter Bedürfnisse gerechtfertigt werden kann. Die Auszeichnung bestimmter Bedürfnisse als für die Natur des Menschen konstitutiv legt die Vermutung nahe, dass eine naturalistische Ethikbegründung vorliegt.26 Nussbaum lehnt aber explizit eine naturalistische Ethikbegründung ab, wenn diese sich, wie sie es formuliert, auf eine der Ethik „externe“ Biologie bezieht. Der Bezug auf die Biologie bei Aristoteles (und Nussbaum) sei dagegen „intern“, das heißt [23] immer schon durch moralische Überlegungen präformiert.27 Der Reiz naturalistischer Ethiken liegt darin, dass normative Überlegungen in einer als weitgehend konstant geltenden Natur verankert werden sollen, um jenseits historischer und kultureller Variabilität einen stabilen Kernbereich des Moralischen zu etablieren. Es wäre zu diskutieren, inwieweit der Nussbaumsche Ansatz gerade diese Attraktivität verliert, indem er die Natur des Menschen immer schon unter Einschluss moralischer Überlegungen rekonstruiert. Des Weiteren stellt sich auch die Frage, ob es mit Hilfe der investierten „Biologie“ gelingt, überzeugende und gehaltvolle normative Aussagen zu entwickeln.28
In einem neueren Text ist Martha Nussbaum explizit auf diese Problematik eingegangen.29 Sie präzisiert dort ihre ursprüngliche Position dahingehend, dass sie anerkennt, dass nicht alle (empirisch bestimmbaren) basalen Fähigkeiten gleichermaßen moralisch relevant sind. Als Verfahren der Evaluierung der basalen Fähigkeiten mit Blick auf ihre moralische Bedeutung empfiehlt sie nun im Anschluss an Rawls die Methode des Überlegungsgleichgewichts. Dieses Verfahren ist der Versuch, unter Bezugnahme und in Weiterentwicklung schon vorhandener moralischer Überzeugungen eine moralisch kohärente Moral herzustellen. Mit dieser Argumentation entgeht Nussbaum dem Naturalismusproblem. Fraglich bleibt aber, wie weiter oben schon angesprochen, inwiefern eine solcherart moralisch aufgeladene Biologie noch eine Anker-Funktion außerhalb historisch und kulturell veränderlicher Moralvorstellungen übernehmen kann.
4. Lehren aus der Geschichte
Nach Ansicht vieler Autoren in der politischen Philosophie haben uns die im 20. Jahrhundert von Nationalsozialisten, Stalinisten und anderen Totalitaristen verübten Gräueltaten unabweislich vor Augen geführt, dass die bis dahin gängigen Konzepte der Moral (etwa die ‚Menschenrechte‘) in der Praxis wenig wirksam waren. Das Völkerrecht nach 1945 brauchte, so die Schlussfolgerung, einen konzeptuellen Neuanfang. Unter anderem galt es als vordringliche Aufgabe, für alle Zukunft zu verhindern, dass große Bevölkerungsgruppen ohne jegliche Rechte und damit völlig schutzlos zum Spielball der Mächtigen werden, wie dies unter anderem den europäischen Juden im Nationalsozialismus geschah.
Auf der Grundlage solcher Überlegungen postulierte Hannah Arendt, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Nationalität oder Religion geschützt werden müsse. Für diese Idee entwarf sie die Formulierung vom ‚Recht, Rechte zu haben‘.30 Das Recht, Rechte zu haben, postuliert, dass alle Menschen Mitglied derselben mora[24]lischen Gemeinschaft sind und ihnen allen gleichermaßen Menschenwürde zukommt. Menschenwürde nach Arendt ist die Antwort auf die historischen Erfahrungen der Barbarei und Entwürdigungen von Menschen im Deutschland der Nazi-Zeit und in anderen totalitären Regimen. Menschenwürde ist keine bestimmte empirische Eigenschaft, die in der biologischen Natur des Menschen oder seiner sozialen Stellung vorgefunden werden kann, sondern ein historisch motiviertes und politisch gewolltes Konzept, das dem Würdeträger Schutz verleihen soll. Verbunden ist diese Position häufig mit der Auffassung, dass die Menschenwürde nun erstmals mit einer rechtsverbürgenden Kraft ausgestattet sei.31
Die, wie man zusammenfassend sagen könnte, politisch-historische Konzeption von Menschenwürde vermag sicher plausibel zu machen, warum die Diskussion über die Menschenwürde seit 1945 so rasant zugenommen hat. Die Betonung der Menschenwürde als ein auch politisches Konzept macht darüber hinaus auch deutlich, dass es eine bedeutende Aufgabe ist, moralphilosophischen Einsichten praktische Geltung zu verschaffen.
An der These, dass sich erst mit der politisch-historischen Konzeption die rechtsverbürgende Kraft der Menschenwürde angemessen begründen lasse, sind allerdings ideengeschichtliche Zweifel angebracht. So korrespondiert z. B. auch bei Kant das Haben von Würde mit bestimmten Rechten des Würdeträgers und Pflichten Dritter ihm gegenüber. Auch Nussbaum ist der Auffassung, dass aus ihrem Konzept von Menschenwürde bestimmte Rechte folgen.32 Es bleibt daher Gegenstand kontroverser Debatten, inwieweit die politisch-historische Konzeption der Menschenwürde mit Blick auf die normative Begründungsleistung über andere Konzepte hinausgeht. Wichtig bleibt jedoch die Erkenntnis, dass die Menschenwürde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Topos der internationalen Politik geworden ist.
5. Phänomenologische Annäherung an die Menschenwürde
Auch in der philosophischen Phänomenologie sind Verwendungsvorschläge für den Begriff der Menschenwürde entwickelt worden.33 Die Phänomenologie lässt sich in aller Kürze beschreiben als die Analyse der Struktur unserer Wahrnehmung; d. h. sowohl der Art und Weise, wie uns die Dinge (Phänomene) in der Wahrnehmung gegeben sind, als auch des Wahrnehmungsapparates selbst. Dabei steht die Wahrnehmung aus der 1.-Person-Perspektive im Vordergrund. Husserl, Heidegger, Merlau-Ponty, Sartre und andere sahen in der Phänomenologie nicht nur eine Teildisziplin der Philosophie, sondern ihre eigentliche Grundlegung, da die Wahrneh[25]mung der Welt den Anfangspunkt allen Philosophierens markiert. Damit ist schon angedeutet, dass eine phänomenologische Deutung der Menschenwürde dazu angetan sein könnte, in einer ebenfalls phänomenologisch inspirierten Ethik eine zentrale Stellung einzunehmen.
Die Phänomene, die wir wahrnehmen, sind nicht die Dinge selbst, sondern durch den Wahrnehmungsapparat aufbereitete Bilder, Ideen, Konzepte der Dinge. Diese Vermitteltheit der Phänomene ist für uns nicht hintergehbar. Bezogen auf unseren Körper sagt man in phänomenologischer Diktion dann auch: wir erfahren unsere körperlichen Regungen (Emotionen, Schmerzen, usw.), wie es dann heißt: unsere Leiblichkeit, aus der 1.–Person-Perspektive. Der Körper als von unserer Wahrnehmung getrennter Gegenstand ist uns somit nur sekundär gegeben als eine Abstraktion von unserer Erfahrung der Leiblichkeit. Hinzu kommt, dass in der phänomenologischen Tradition unsere Erfahrung des Anderen primär auch als eine Erfahrung von dessen Leiblichkeit gedacht wird. Wenn wir unser Gegenüber wahrnehmen, sehen wir demnach zunächst einen Menschen, der zum Beispiel aufgrund einer schweren Verletzung Schmerzen erleidet. Nur sekundär abstrahieren wir von der Leiblichkeit des Anderen und machen – etwa im Rahmen einer medizinischen Diagnose – Aussagen über den Körper des Verwundeten. Die Wahrnehmung der Leiblichkeit des Anderen ist phänomenologisch betrachtet konstitutiv für unser Verständnis anderer Menschen. Das heißt auch, dass dieser Vorgang präreflexiv und präverbal ist.
Die phänomenologische Grundfigur der Konstitution zwischenmenschlichen Kontakts durch die wechselseitige Erfahrung des Anderen in seiner Leiblichkeit hat auch im medizinischen Kontext Anwendung gefunden. Die sogenannte basale Stimulation ist der Versuch, bei Menschen mit schweren Behinderungen oder Verletzungen unter anderem über Berührungen durch den Therapeuten den Patienten wieder eine Erfahrung der eigenen Leiblichkeit zu ermöglichen. Auf diese Weise bekommt aber auch der Therapeut Zugang zum Erfahrungshorizont des Patienten, so dass sich in phänomenologischer Diktion gesprochen aus der wechselseitigen Erfahrung der Leiblichkeit ein Verständnis für den Anderen ergibt.
Der Begriff der Menschenwürde lässt sich aus phänomenologischer Perspektive an die Leiblichkeit knüpfen – wobei noch zu klären wäre, worin genau das Haben von Würde begründet liegt: in einer tatsächlich statthabenden Erfahrung der Leiblichkeit oder in dem Vermögen zu dieser Erfahrung. Für die Medizinethik bedeutet ein solcher Ansatz, dass der Respekt vor der Würde eines Kranken in der Erkenntnis begründet liegt, dass der Kranke auf Grund seiner Leiblichkeit Würde besitzt und zwar unabhängig davon, wie genau die Interaktion zwischen ihm und denjenigen, die ihn versorgen, abläuft – insbesondere spielen für die phänomenologische Würdekonzeption höhere mentale Fähigkeiten, etwa Autonomie und Handlungsfähigkeit, nur eine untergeordnete Rolle.
[26] IV. Die Funktion des Menschenwürdebegriffs im bioethischen und biopolitischen Diskurs
Nicht nur mit Blick auf die verwendeten Methoden der Begriffsexplikation unterscheiden sich die gängigen Menschenwürde-Positionen stark, auch bezüglich der Funktion, die die Konzepte im moralischen Diskurs übernehmen sollen, gibt es weitreichende Unterschiede.
1. Menschenwürde als Tabu
In öffentlichen Debatten wird die Rede von ‚Menschenwürde‘ häufig wie ein Tabu verwendet, d. h. mit der Äußerung, eine bestimmte Handlung oder ein bestimmter Welt-Zustand verletze das Würde-Tabu, ist eine normative Aussage verknüpft: Diese Handlung oder dieser Zustand sollte nicht realisiert werden – und zwar unabhängig davon, ob die Befürworter dieser Handlung oder dieses Zustandes meinen, gute Argumente auf ihrer Seite zu haben.34
Die Soziologie lehrt uns, dass es für die reibungsarme soziale Kooperation hilfreich sein kann, bestimmte Handlungen oder Welt-Zustände für tabu zu erklären und damit für jegliche moralische Kritik unzugänglich zu machen. Es lässt sich jedoch hinterfragen, ob es für aufgeklärte Gesellschaften akzeptabel ist, Tabus als unverrückbare Normen hinzunehmen. Sicherlich verletzt der Versuch, Tabus in gesellschaftlichen Konfliktbereichen zu installieren, die Idee einer liberalen Rechtsordnung. Jedenfalls sind für den Bioethiker Tabus als ethische Prinzipien dann nicht akzeptabel, wenn Ethik die Aufgabe hat, Konflikte argumentativ zu lösen und nicht eine bestimmte Moral – sei sie inhaltlich gerechtfertigt oder nicht – durchzusetzen.35 Allerdings ist das Verständnis von Würde als Tabu überwiegend ein Phänomen öffentlicher Debatten.36 Nur gelegentlich findet sich ein solches Argumentationsschema in akademischen Publikationen.37
2. Menschenwürde als anthropologische Grundlage der Zuschreibung von Rechten
Menschenwürde bezeichnet für manche Autoren den moralisch schützenwerten Bereich arttypischer Bedürfnisse, die zu den notwendigen Voraussetzungen für ein [27] gutes menschliches Leben gehören. So entwickelt etwa Martha Nussbaum unter Rückgriff auf die Natur des Menschen umfangreiche Aufstellungen von Grundfähigkeiten, die sie für ein gutes menschliches Leben für unverzichtbar hält. Dieses Set von Fähigkeiten lässt sich als anthropologische Charakterisierung des Menschen verstehen, aus der sich dann moralische Berechtigungen ableiten lassen.38
Kritiker anthropologischer Ansätze des skizzierten Typs merken an, dass es kaum zu vermeiden scheint, dass in irgendeiner Form auf naturalistische Begründungsstrukturen zurückgegriffen werden muss.39 Wenn man dieses Problem für lösbar hält, dann stellt sich verschärft die Frage, welche Begründungslast der Verweis auf die biologische Natur des Menschen tragen kann. Gerade mit Blick auf die angestrebte Fundierung spezifischer moralischer Rechte müsste es unbefriedigend bleiben, wenn mit dem Verweis auf die Biologie des Menschen lediglich gemeint wäre, dass der Mensch eben auch ein biologisches Wesen ist, dessen Verwurzelung in der Natur man nicht vergessen dürfe. Soll die Natur des Menschen als Grundlage von Rechten dienen, müsste man aus ihr gehaltvolle Folgerungen ziehen können. Nach Ansicht vieler Kritiker ist eine aristotelisch geprägte Biologie mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaften aber kaum vereinbar, so dass sich auch das Projekt einer neo-aristotelischen Ethik weiteren Zweifeln ausgesetzt sieht.40 Allerdings zeigt die jüngere Diskussion, dass das Projekt einer anthropologischen Fundierung der Ethik wieder vermehrt Aufmerksamkeit findet.
3. Menschenwürde als Prinzip, das Rechte fundiert
Ein (Moral-)Prinzip stellt die inhaltliche und/oder methodische Grundlage eines praktischen Begründungszusammenhangs dar. Aus Prinzipien können dann Rechte und Pflichten hergeleitet werden. So ist etwa das von Gewirth eingeführte ‚Principle of Generic Consistency‘ (PGC) ein Moralprinzip, aus dem sich Rechte und Pflichten für und gegenüber den Adressaten dieses Prinzips ableiten. Um konkrete Schutzansprüche aus dem PGC abzuleiten, muss dieses Moralprinzip konkretisiert und für den jeweiligen Anwendungskontext spezifiziert werden. Für das PGC beispielsweise haben verschiedene Autoren Hilfskonstruktionen vorgeschlagen, mit deren Hilfe die Anwendung auf den Einzelfall gelingen soll.41 Auch das bereits erwähnte Überlegungsgleichgewicht gehört zu den Verfahren, mit denen Prinzipien kontextualisiert werden können. Zwar wird Prinzipien-Ethiken häufig vorgehalten, dass sie zu wenig kontextsensitiv seien, doch dürfte dies recht verstanden nicht auf ein grundsätzliches Defizit einer solchen Ethik hinweisen, sondern allenfalls auf [28] ungeeignete Verfahren der Konkretisierung und Spezifizierung. Für ein Konzept von Menschenwürde als grundlegendem moralischem Prinzip ergeben sich daraus aber keine unüberwindbaren Hürden.
4. Menschenwürde als Recht
Rechte sind Ausdruck gerechtfertigter Ansprüche von Rechtsträgen. Bekanntlich werden verschiedenste Verfahren vorgeschlagen, um Rechte zu begründen – erinnert sei nur an die rechtsphilosophische Großkontroverse zwischen Naturrechtlern und Rechtspositivisten. Menschenwürde als Recht einzuführen bedeutet, bestimmte Ansprüche von Menschenwürde-Trägern als gerechtfertigt anzusehen. Das Recht ‚Menschenwürde‘ ist damit nicht selbst Begründungsinstanz für Rechte sondern Ergebnis eines Begründungsverfahrens. Aus einem Recht ‚Menschenwürde‘ lassen sich dann – je nach Theorie variierende – normative Konsequenzen ableiten.
Die Menschenwürde als Recht aufzufassen, ist insofern problematisch, als sie damit vermutlich ihre Stellung als zentrale Begründungsinstanz praktisch-moralischer Diskurse verlöre. So würde beispielsweise das Verhältnis eines Grundrechts Menschenwürde gemäß Art. 1 GG zu den in den nachfolgenden Artikeln formulierten Grundrechten unklar. Welchen „Mehrwert“ hätte die Menschenwürde noch, wenn sie gewissermaßen bloß den Oberbegriff, ein Etikett, für die Grundrechte bildete und ihnen keine zusätzliche Legitimation verschaffte?
5. Menschenwürde als Ensemble von Grundrechten
Menschenwürde kann auch als zusammenfassender Oberbegriff für fundamentale Grund- und/oder Menschenrechte verwendet werden. So interpretiert etwa die Ensemble-Theorie die Menschenwürde als einen verfassungsrechtlichen Grundwert, der durch philosophische und juristische Kritik bzgl. Inhalt und Reichweite systematisiert und ausdifferenziert wird. An diesem Ansatz ließe sich hinterfragen, ob in ihm das Wort Menschenwürde mehrdeutig verwendet wird: Zum einen scheint es als Sammelbegriff zu fungieren, unter dem ein Ensemble von Grundrechten zusammengefasst wird – genannt werden Rechte auf ein materielles Existenzminimum, auf autonome Selbstentfaltung, auf Schmerzfreiheit, auf Wahrung der Privatsphäre, auf geistig-seelische Integrität, auf grundsätzliche Rechtsgleichheit und auf minimale Achtung.42 Darüber hinaus soll die Menschenwürde aber offenbar selbst auch Begründungsinstanz sein. Lässt sich dieses Problem nicht auflösen, hätten wir es mit zumindest zwei Begriffen zu tun – M1 ‚Menschenwürde als Recht‘ und M2 ‚Menschenwürde als Begründungsinstanz‘ –, die sorgfältig auseinandergehalten werden sollten.
[29] 6. Menschenwürde als Ideal
Ein Einwand gegen das Konzept der Menschenwürde als zentrale Begründungsinstanz moralischer Argumentationen ist der folgende: Wird die Menschenwürde präzise definiert, dann verliert das Konzept möglicherweise seine Überzeugungskraft als ein für die Mehrzahl der Debatten-Teilnehmer akzeptables Konzept. Wird die Menschenwürde dagegen in eher unscharfer Weise expliziert, so dass die meisten Debatten-Teilnehmer ihr Verständnis von Würde wenigstens teilweise umgesetzt finden, so ist das Konzept Menschenwürde als eindeutiges Entscheidungskriterium für bioethische Konflikte weniger brauchbar.43
Folgt man dieser Kritik am Begriff der Menschenwürde, muss er deswegen aber noch nicht als unbrauchbar verworfen werden. Begriffe können nicht nur als Kriterien für die moralische Urteilsfindung eingesetzt werden, Begriffe können auch die Funktion einer Orientierungshilfe, eines Ideals übernehmen. In der Regel werden Ideale von einer großen Gruppe von Menschen geteilt. Dass ein Ideal geteilt wird, meint, dass es einen Bedeutungskern gibt, bezüglich dessen Bedeutung weitgehende inter-individuelle Übereinstimmung herrscht. Ein wichtiges Merkmal von Idealen ist aber, dass sie zu den Rändern hin unscharf werden. Begriffliche Unschärfe ist problematisch, wenn eine explizite Terminologie der Zweck philosophischer Bemühungen ist. Diese Unschärfe kann aber auch hilfreich sein, wenn der Bedeutungshof groß genug ist, um eine breite Akzeptabilität zu schaffen. Da Ideale nicht nur beschreiben, wie die Welt aussehen sollte, sondern immer auch die Aufforderung mit sich tragen, die Welt gemäß dem Ideal zu verändern, kann ein breit akzeptiertes Ideal als allgemeine Orientierungshilfe in einer moralischen Gemeinschaft dienen. Der Begriff der Menschenwürde lässt sich dann als ein Ideal interpretieren, das beschreibt, wie wir als moralische Entitäten gesehen, respektiert und behandelt werden wollen.
V. Menschenwürde in den Rechtswissenschaften
In der Menschenwürde-Debatte unter Rechtswissenschaftlern gibt es ebenso wie in der philosophischen Diskussion tiefgreifende Kontroversen über nahezu alle Facetten des Menschenwürdebegriffs. Diese Übereinstimmung ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass Rechtsphilosophie von Juristen und Philosophen vielfach mit den gleichen Methoden und Konzepten betrieben wird.44 Dennoch gibt es Be[30]sonderheiten der im engeren Sinne juristischen Diskussion. Insbesondere stellt sich dem Juristen die Aufgabe, die dem Augenschein nach mit Brüchen behaftete Geschichte der Rechtsprechung zur Menschenwürde zu interpretieren. Es lassen sich in diesem Zusammenhang unterschiedliche Strategien ausmachen: Einige Autoren versuchen, die Rechtsprechungsgeschichte so zu rekonstruieren, dass der Eindruck einer über die Jahrzehnte hinweg konsistenten Rechtsprechung entsteht.45 Die Menschenwürde erscheint dabei als weitgehend operables Konzept des positiven Rechts, das keiner tiefgreifenden Änderungen bedarf (Synkretismus). Andere Autoren betonen dagegen eher die Brüche in der Rechtsprechungspraxis und folgern daraus die Notwendigkeit einer kritischen Diskussion des argumentativen Fundaments dieses Begriffs mit möglichen Folgen für die zukünftige Rechtsprechung. Der Versuch, die Rechtsprechungspraxis zum Menschenwürdebegriff als weitgehend konsistent zu interpretieren, ist dabei keineswegs einfach nur unkritisch. Konsistenz in der Rechtsprechung ist ein Gut, ohne das ein wesentliches Kriterium des Rechtsstaates – Rechtssicherheit – kaum zu gewährleisten ist.
Auch der Blick auf das Völkerrecht, für das nach Ansicht vieler Autoren die Menschenwürde der zentrale Begriff ist, macht deutlich, dass eine gewisse Benevolenz bezüglich unterschiedlicher Rechtsauffassungen unvermeidlich ist, will man die Menschenwürde als einende moralische Instanz etablieren.46 Die offenkundige Pluralität der international vertretenen Auffassungen dazu, welche Handlungs- und Verhaltensmuster mit der Menschenwürde vereinbar sind, macht deutlich, dass das Beharren auf einer stringenten moralischen Fundierung des Menschenwürdebegriffs mit Sicherheit zum Aufbrechen der internationalen Zustimmung zur Menschenwürde als Grundbegriff des Völkerrechts führen würde.
Allerdings besteht hier die Gefahr, um übergeordneter Zwecke willen Konsistenz um den Preis „herzustellen“, dass offenkundige Brüche der Rechtsprechungspraxis nur übertüncht werden. Die Forderung, auch für einen fundamentalen Rechtsbegriff wie die Menschenwürde eine argumentativ überzeugende Fundierung zu entwickeln, hat auch in den Rechtswissenschaften zu einer vielfältigen Debatte über den Menschenwürdebegriff geführt.47
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die rechtswissenschaftliche Debatte über die Menschenwürde einerseits geprägt ist von dem Bedürfnis, ein für die Zwecke des nationalen und des Völkerrechts operables Konzept von Menschenwürde zu entwickeln, wodurch eine bestimmte Unschärfe der Begriffsverwendung unver[31]meidlich scheint. Andererseits wird auch in den Rechtswissenschaften eine stringente Fundierung normativ-rechtlicher Begriffe angestrebt. Es besteht hier ein Dilemma, das der praktischen Dimension des Rechts geschuldet ist und das sich hier nicht auflösen lässt.
VI. Menschenwürde und soziokultureller Kontext
In der philosophischen Debatte über die Menschenwürde gibt es, wie gezeigt, verschiedene Ansätze, die Bedeutung dieses Begriffs zu entfalten und ihm eine Funktion im bioethischen Diskurs zuzuweisen. Diskutiert wurden in dieser Einführung Versuche, die Bedeutung von ‚Menschenwürde‘ mit Hilfe von Überlegungen zur Natur des Menschen zu explizieren. Andere Ansätze streben eine transzendental- pragmatische Fundierung des Begriffs an oder versuchen, den Begriff mit Blick auf historisch-politische Ereignisse zu entwickeln. Gemeinsam ist diesen und anderen hier nicht erwähnten Ansätzen, dass sie den Begriff der Menschenwürde zu einem Grundbegriff der praktischen Philosophie machen, zur zentralen Begründungsinstanz für moralische Berechtigungen und Verpflichtungen. Praktische Philosophie, so zeigt sich auch am Beispiel der Menschenwürde, wird letztlich betrieben, um moralische Probleme der Lebenswelt zu klären und nach Möglichkeit zu bewältigen. Dies zieht die Forderung nach sich, dass die Grundbegriffe der praktischen Philosophie keine reinen „Kopfgeburten“ sein dürfen. Stattdessen sollten sich mit ihrer Hilfe lebensweltliche moralische Intuitionen auffangen und in reflektierter Form systematisch wiedergeben lassen.
Neben den Versuchen, die Menschenwürde als Grundbegriff der Ethik zu etablieren, finden sich Ansätze, die Menschenwürde im Rahmen der Gesellschaftstheorie zu charakterisieren. Im Gegensatz zum Ethiker, dessen Ziel es ist, unter Hinzuziehung der Menschenwürde bestimmte Handlungen oder Zustände zu bewerten, d. h. normativ auszuzeichnen, geht es in der Gesellschaftstheorie und Sozialforschung um die Beschreibung (nicht Rechtfertigung) der Bedeutung der Menschenwürde für das Funktionieren einer Gesellschaft. In den gesellschaftstheoretischen Entwürfen von z. B. Durkheim und Luhmann hat die Menschenwürde eine zentrale Funktion als Konstruktions- und Ordnungsprinzip moderner Gesellschaften.48 Letztere sind in verschiedene Teil-Systeme gegliedert. Der moderne Mensch ist in diese Teil-Systeme eingebunden und wird durch die in ihnen geltenden (moralischen) Regeln geprägt. Da diese Teil-Systeme ihren je eigenen Organisationsprinzipien folgen, ist der Zusammenhalt zwischen den Teilsystemen und damit der Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt brüchig. Die Menschenwürde hat, etwa bei Luh-mann und Durkheim entscheidende Bedeutung für den Zusammenhalt zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen: Luhmann etwa beschreibt die Menschenwürde als Merkmal eines jeden Individuums, unabhängig von seiner Prägung durch die [32] Regeln seiner gesellschaftlichen Einbindung. Die Menschenwürde wird damit praktisch zum entscheidenden Bindeglied zwischen allen Mitgliedern einer Gesellschaft und sichert auch dadurch den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Moralische Intuitionen sind bis zu einem gewissen Grad abhängig von kontingenten kulturellen und historischen Umständen. Wer also prüfen möchte, ob der von ihm favorisierte Menschenwürde-Begriff „den moralischen Nerv“ seiner Zuhörer und Leser trifft, kommt nicht umhin, sich mit deren moralischen Intuitionen zu befassen oder aber Gefahr zu laufen, einen sterilen Begriff zu drechseln, der von keinem praktischen Nutzen sein kann. Die Notwendigkeit der „empirischen Aufladung“ zeigt sich auch in rechtspolitischen Entwicklungen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 war ohne Frage entscheidend dafür, die Menschenwürde im Menschenrechtsdiskurs populär zu machen. Allerdings besteht international unter Rechtspolitikern wenig Einigkeit darüber, welchen normativen Gehalt die Menschenwürde in einer bestimmten Rechtsordnung und über verschiedene Rechtsordnungen hinweg eigentlich hat.49
Die vorstehenden Überlegungen sprechen nicht dagegen, die Suche nach einem universell gültigen Begriff von Menschenwürde fortzusetzen. Dieses Projekt behält seinen Wert als ewige Suche nach der philosophischen Wahrheit auch dann, wenn es absehbar scheitert. Die Vielfalt der Würde-Vorstellungen sollte allerdings Anlass sein, sich intensiver mit den kulturellen Aspekten von Menschenwürde zu befassen, als dies vielleicht bisher in Teilen der Fachdebatte der Fall ist. Beschäftigt man sich mit Würde-Konzepten über kulturelle Grenzen hinweg, so wird deutlich, dass es weitreichende begriffliche und methodische Differenzen gibt, die über die in dieser Einführung schon ausgeführten Differenzen hinausgehen. Weitgehende Einigkeit herrscht über Kulturgrenzen hinweg aber darüber, dass bei aller Klärungsbedürftigkeit der Begriff der Menschenwürde ein unverzichtbarer Grundbegriff sowohl für die moralphilosophische Fundierung als auch für die rechtspolitische Fortentwicklung der Menschenrechts-Debatte ist.
* * *
Der Leser mag sich am Ende dieser Einführung fragen, warum es denn überhaupt einer systematischen, letztlich auf Vereinheitlichung abzielenden Erforschung des Würdebegriffs bedarf. Schließlich ist die Gemeinschaft der Forschenden kein Parlament, das sich auf einen Gesetzestext einigen muss. Vielmehr ist eine Tugend der Wissenschaften, insbesondere der Philosophie, die Pluralität verschiedener Herangehensweisen zu respektieren und zu fördern. Das schließt Kritik natürlich nicht aus, lässt die Beilegung philosophischer Groß-Kontroversen aber eher unwahrscheinlich erscheinen.
[33] Nun steht bei aller Pluralität der Konzepte von Menschenwürde aber kaum in Frage, dass dieser Begriff für die moralisch wünschenswerte Weiterentwicklung unserer Gesellschaften eine bedeutende Rolle spielt und auch spielen soll. Somit sind Juristen, Philosophen und Angehörige anderer Disziplinen aufgefordert, an der Lösung gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken, sofern ihnen dazu die nötigen Instrumente und Methoden für die Entwicklung solcher Problemlösungen zur Verfügung stehen. Der vorliegende Band spiegelt daher auch das Interesse der Herausgeber und Autoren wieder, aktiv an der Bewältigung gesellschaftlicher Kontroversen mitzuwirken, die sich aus der rasanten Entwicklung der Medizin ergeben.
Literatur
Alexander, John M. (2005): Non-Reductionist Naturalism: Nussbaum between Aristotle and Hume. In: Res Publica 11, S. 157–183.
Anlauf, Lena (2007): Hannah Arendt und das Recht, Rechte zu haben. In: MenschenRechts-Magazin 3, S. 299–304.
Antony, Louise M. (2000): Nature and Norms. In: Ethics 111, S. 8–36.
Beyleveld, Derek/Brownsword, Roger (2001): Human Dignity in Bioethics and Biolaw, Oxford.
Birnbacher, Dieter (1995): Mehrdeutigkeiten im Begriff der Menschenwürde. In: Aufklärung und Kritik, Sonderheft 1, S. 4–13.
–
(Hrsg.) (2000): Bioethik als Tabu. Toleranz und ihre Grenzen, Münster.
Cicero, Marcus R. (1991): Von den Pflichten, Frankfurt am Main.
Düwell, Marcus (2008): Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche, Stuttgart.
Gewirth, Alan (1978): Reason and Morality, Chicago.
–
(1992): Human Dignity as Basis of Rights. In: Meyer, Michael J./Parent, William A. (Hrsg.): The Constitution of Rights. Human Dignity and American Values, Ithaca/London, S. 10–28.
–
(1996): Community of Rights, Chicago.
Hilgendorf, Eric (1999): Die missbrauchte Menschenwürde. Probleme des Menschenwürdetopos am Beispiel der bioethischen Diskussion. In: Jahrbuch für Recht und Ethik 7, S. 137–158.
Historisches Wörterbuch der Philosophie, 13 Bände, Basel, 1971–2007.
Hull, David L. (1998): On Human Nature. In: Hull, David L./Ruse, Michael (Hrsg.): The Philosophy of Biology, Oxford, S. 383–397.
Isensee, Josef (2003): Tabu im freiheitlichen Staat, Paderborn.
Kant, Immanuel (1785): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Werke, Akademie-Ausgabe, Band 4, Berlin (ab 1900).
–
(1797): Die Metaphysik der Sitten. In:Werke, Akademie-Ausgabe, Band 6, Berlin (ab 1900).
Kitcher
, Philip (1999): Essence and Perfection, Ethics, 100, S. 59–83.
[34] Leist, Anton (2010): Naturalismus bei Foot und Hursthouse. In: Hoffmann, Thomas/Reuter, Michael (Hrsg.): Natürlich gut. Aufsätze zur Philosophie Philippa Foots, Frankfurt am Main, S. 121–148.
Macklin, Ruth (2003): Dignity is a useless concept. In: British Medical Journal 327, S. 1419–1420.
Margalit, Avishai (1996): The decent society, Cambridge, MA.
–
(2011): Human Dignity Between Kitsch and Deification. In: Cordner, Christopher/Gaita, Raimond (Hrsg.): Philosophy, Ethics, and a Common Humanity: Essays in Honour of Rai-mond Gaita, London.
Müller, Anselm (2000): Toleranz als Tugend. In: Birnbacher, Dieter (Hrsg.): Bioethik als Tabu. Toleranz und ihre Grenzen, Münster, S. 23–40.
Neuhäuser, Christian (2011): Das narrative Begründungskonzept der Menschenwürde (mit einigen Bemerkungen zu seiner Relevanz für die Medizinethik). In: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Petrillo, Natalia / Thiele, Felix (Hrsg.): Menschenwürde und moderne Medizintechnik, Baden-Baden, S. 223–247.
Nussbaum, Martha C. (1995): Aristotle on Human Nature and the Foundations of Ethics. In: Altham, James Edward John/Harrison, Ross (Hrsg.): World, Mind, and Ethics: Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams, Cambridge, S. 86–131.
–
(1999): Gerechtigkeit oder das gute Leben, Frankfurt am Main.
–
(2006): Frontiers of Justice, Cambridge, MA.
–
(2008): Human Dignity and Political Entitlements. In: Schulman, Adam (Hrsg.): Human Dignity and Bioethics, Washington, S. 351–380.
Pinker, Stephen (2012): The Stupidity of dignity. Conservative bioethics’ most dangerous ploy. In: The New Republic, May 28, 2008 (http://www.tnr.com/article/the-stupidity-dignity,letzterZugriff12.März2012).
Quante, Michael (2010): Menschenwürde und personale Autonomie. Demokratische Werte im Kontext der Lebenswissenschaften, Hamburg.
Steigleder, Klaus (1999): Grundlegung der normativen Ethik: Der Ansatz von Alan Gewirth, Freiburg.
Stoecker, Ralf (2010a): Die Pflicht, dem Menschen seine Würde zu erhalten. In: Zfmr 1, S. 98–118.
–
(2010b): Die philosophischen Schwierigkeiten mit der Menschenwürde – und wie sie sich vielleicht auflösen lassen. In: ZiF-Mitteilungen 1, S. 19–30.
–
(2011): Wozu brauchen wir in der medizinischen Ethik die Menschenwürde? In: Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Petrillo, Natalia / Thiele, Felix (Hrsg.): Menschenwürde und moderne Medizintechnik, Baden-Baden, S. 197–2113.
I. Menschenwürde aus philosophisch-ethischer Perspektive
1. Kapitel
Erläuterungen der Menschenwürde aus ihrem Würdecharakter
Ralf Stoecker und Christian Neuhäuser
I. Einleitung
Obwohl der Begriff der Menschenwürde seit 1945 in nahezu allen wesentlichen Deklarationen, Codizes und neuen Verfassungen an zentraler Stelle vorkommt, hat er in der Moralphilosophie nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit nur vereinzeltes Interesse geweckt. Erst seit etwa 10 Jahren gibt es systematische Versuche, sich philosophisch Klarheit über die Menschenwürde zu verschaffen, hauptsächlich in Deutschland, in letzter Zeit aber auch in anderen Ländern, insbesondere den USA.
Es ist nicht ganz zufällig, dass sich die Philosophen lange Zeit gescheut haben, sich mit der Menschenwürde auseinanderzusetzen, denn es handelt sich in mehrerlei Hinsicht um einen problematischen Begriff:
die Art seines Gebrauchs legt die Vermutung nahe, dass es sich um eine beliebig und polemisch einsetzbare
Leerformel
handelt,
zudem scheint der Begriff
religiöse Konnotationen
zu haben, die ihn für eine säkulare Ethik untauglich machen,
die fundamentale Rolle, die der Menschenwürde üblicherweise zugedacht wird, nehmen nach Überzeugung vieler Ethiker bereits die Menschenrechte ein, so dass der Anschein einer
Rivalität zwischen Menschenwürde und Menschenrechten
entsteht,
schließlich kommt noch hinzu, dass die große Bedeutung, die der Menschenwürde heute in rechtlichen Kontexten zugeschrieben wird, möglicherweise auf einer Reihe von
Zufällen
beruht, die dafür gesorgt haben, dass in den einschlägigen Dokumenten nach dem Zweiten Weltkrieg von der „Würde des Menschen“ die Rede war anstelle von anderen, ebenfalls erwogenen Formulierungen. Offenbar hat es in den Augen der Autorinnen und Autoren dieser Texte keine zwingenden Gründe gegeben, hier der ‚Menschenwürde‘ den Vorrang zu geben, es hat sich wohl nur so ergeben.
Es gibt allerdings auch eine Reihe von Gründen, die für eine philosophische Beschäftigung mit der Menschenwürde sprechen:
[38] die Menschenwürde könnte eine
anthropologische Fundierung der Menschenrechte
versprechen,
sie bietet vielleicht eine Aussicht auf ein tragfähiges gemeinsames Fundament in einer
pluralen, multikulturellen Welt
,
auch wenn die Philosophie und teilweise die Rechtswissenschaften große Schwierigkeiten mit dem Menschenwürde-Begriff haben, so scheint er in
vielen anderen Bereichen der Moral
eine selbstverständliche und vielleicht sogar unverzichtbare Beurteilungsgrundlage zu bieten.
Diese Gründe sind hinreichend, um zumindest zu versuchen, nach einem philosophisch attraktiven Menschenwürdeverständnis zu suchen. Es gibt eine Reihe derartiger Ansätze, die in verschiedenen Artikeln im ersten Teil dieses Handbuchs vorgestellt werden. Gegenstand des folgenden Beitrags sind Versuche, die Menschenwürde aus ihrem Verhältnis zur Würde überhaupt zu verstehen.1
Der Rekurs auf die Würde ist uns aus unseren alltäglichen moralischen Bewertungen vertraut. Wir reden davon, jemand habe seine Würde aufs Spiel gesetzt, eine bestimmte Handlungsweise sei unter seiner Würde, er habe seine Würde bewahrt oder erkämpft usw. Vor allem kennen wir aber einen ganzen Strauß moralischer Bewertungen, die mit diesem alltäglichen Begriff der Würde verwandt sind: Entwürdigung, Demütigung, Beleidigung, Respekt, Ehre, Selbstachtung, Scham u. a. Man kann deshalb von einer Begriffsfamilie der Würde sprechen.
Die Urform der Würde ist die soziale Würde in stratifizierten Gesellschaften. Eine soziale Würde ist ein mit einem Amt oder sozialen Rang verbundener Komplex an normativen Verhaltenserwartungen an den Würdenträger selbst und an andere Personen ihm gegenüber. Diese Erwartungen werden aus dem besonderen Wert dieses Amts oder Rangs hergeleitet sowie eventuell auch aus dem besonderen Wert des Würdenträgers selbst. Verstöße gegen die Erwartungen durch andere werden als Beleidigungen, Demütigungen, Entwürdigungen verstanden, Verstöße des Würdenträgers selbst als würdelos, als Zeichen mangelnder Selbstachtung.
Trotz der alltäglichen Vertrautheit des Würdebegriffs und seiner Verwandten ist es auf den ersten Blick wenig naheliegend, die Menschenwürde auf der Basis der uns geläufigen, alltäglichen Würde zu explizieren. Es gibt mindestens drei Gründe, die dagegen sprechen, einen moralphilosophisch attraktiven Menschenwürdebegriff mithilfe dieser Würde zu suchen:
Der Begriff der Würde scheint
veraltet
zu sein und unter Umständen in Widerspruch zu anderen, wohl etablierten moralischen Grundsätzen zu geraten. „Benimm dich würdig!“ ist nicht unbedingt ein akzeptiertes Gebot. Das Recht auf freie Selbstbestimmung und Lebensgestaltung zählt moralisch jedenfalls mehr als [39] die Zwänge gesellschaftlicher Konventionen. Die Menschenwürde interessiert uns hingegen nur als zeitgemäßes Konzept.
Auch wenn wir es möglichst vermeiden wollen, in unwürdige und erniedrigende Situationen zu kommen, gibt es für uns in der Regel
viel wichtigere Gesichtspunkte für unser Handeln.
Steven Pinker hat beispielsweise darauf verwiesen, dass viele medizinische Behandlungen den Patienten in eine entwürdigende Position zwingen, ohne dass man bei schwerer Krankheit auf sie verzichten würde.
2
Die Menschenwürde hingegen soll den unverrückbaren Kern unseres moralischen Status ausmachen.
Hinzu kommt, dass es gerade ein Kennzeichen der mit der Würde verbundenen menschlichen Eigenschaften ist,
fragil
zu sein, während die Menschenwürde unveräußerlich und unverlierbar sein soll. Außerdem scheint es zur Würde zu gehören, dass sie
ungleich verteilt
ist, während die Menschenwürde universell allen Menschen gleichermaßen zukommen soll.
Viele philosophische Auseinandersetzungen mit der Menschenwürde beginnen deshalb damit, sie deutlich von unserer alltäglichen Würde abzuheben.3 Trotzdem sind in den letzten Jahren von verschiedenen Autoren Versuche unternommen worden, die Menschenwürde gerade aus ihrer Beziehung zur Würde generell zu erläutern.
Für diese Versuche spricht:
Es gibt eine lange
philosophische Tradition
der Beschäftigung mit der Würde, die diese mit dem Menschsein verbindet und die letztlich auch die steile Karriere der Menschenwürde nach dem zweiten Weltkrieg erklärt.
Wenn man sich nicht auf das Wort „Würde“ kapriziert, sondern das
ganze Begriffsfeld
berücksichtigt, verschwindet der Eindruck, dass es sich um ein veraltetes Konzept handelt.
Auch wenn nicht alle Erniedrigungen Menschenwürdeverletzungen sind, so sind doch umgekehrt
Menschenwürdeverletzungen stets erniedrigend
.
Da sich die moralphilosophischen Versuche, die Menschenwürde auf der Basis ihres Würdecharakters zu explizieren, noch nicht zu einem umfassenden Argumentationsfeld ausdifferenziert haben, werden wir in unseren Beitrag zunächst die historischen Hintergründe erläutern, die diese Versuche aussichtsreich erscheinen lassen, bevor wir dann untersuchen, inwieweit sie trotz der oben erwähnten Vorbehalte erfolgversprechend sein können.
[40] II. Der Ursprung der Idee einer allen Menschen gemeinsamen Würde in der Antike
Eine umfassende Begriffsgeschichte der Menschenwürde wie auch des Würdebegriffs insgesamt steht leider noch aus. Es herrscht aber weitgehendes Einvernehmen, dass sie spätestens bei der Stoa und Ciceros Verbindung stoischer mit aristotelischen Überlegungen einsetzen muss. Da die entsprechenden stoischen Texte verloren sind, kann man Ciceros erzieherischen Mahnbrief an seinen Sohn Tullius, De Officiis, als erste philosophische Abhandlung ansehen, in der von der Würde des Menschen die Rede ist.
Das Grundanliegen Ciceros lag darin, eine Beschreibung des sittlich guten (honestus)





























