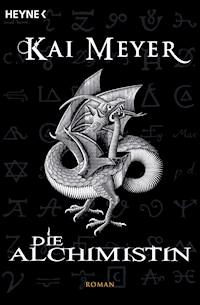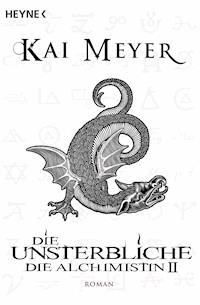10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Merle-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Merle ist zurück... Merles Venedig ist voller Magie. Doch die Fließende Königin, die mächtige Beschützerin der Stadt, wurde vertrieben. Venedig ist in großer Gefahr und alle magischen Wesen ahnen, dass nur Merle die Stadt vor dem Untergang bewahren kann. Während ihr Freund, der Meisterdieb Serafin, an Land und auf dem Wasser für die Freiheit kämpft, fliegt Merle auf dem Rücken des Obsidianlöwen Vermithrax in das Reich des Steinernen Lichts – geradewegs in die Unterwelt. Zweites Buch des Merle-Zyklus Der Klassiker der deutschen Phantastik in opulenter Neuausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kai Meyer
Merle
Das steinerne Licht
Inhalt
Sohn des Horus
Der Meisterdieb
Liliths Kinder
Die Enklave
Im Ohr des Herolds
Junipas Schicksal
Der Pharao
Winter
Achse der Welt
Der Anschlag
Herzhaus
Lord Licht
Die Kämpfer erwachen
Treibgut
Freundinnen
Sohn des Horus
Tief unter den Schwingen des Obsidianlöwen zog die Landschaft dahin wie ein Meer aus Asche. Vermithrax’ Körper aus pechschwarzem Stein glitt scheinbar schwerelos unter der dichten Wolkendecke dahin. Das Mädchen auf seinem Rücken hatte das Gefühl, als könnte es die wattige Unterseite der Wolken berühren, wenn es nur den Arm danach ausstreckte.
Merle krallte sich mit beiden Händen in die Mähne des geflügelten Löwen. Vermithrax’ langer Pelz war aus Stein wie sein ganzer Körper, doch aus Gründen, die Merle nicht kannte, fühlte sich sein Haar weich und biegsam an – nur eines der zahlreichen Wunder, die der Steinlöwe in seinem tonnenschweren Obsidiankörper barg.
Der Wind war in dieser Höhe empfindlich kühl und schneidend. Er drang ebenso mühelos durch Merles rotes Cape wie durch das grobe, wadenlange Kleid, das sie darunter trug. Der Saum war hochgerutscht und entblößte ihre Knie; die Gänsehaut auf ihren Schenkeln schien ihr mittlerweile ebenso selbstverständlich wie ihr knurrender Magen und die Ohrenschmerzen, die sie von der Höhe und der kalten Luft bekam. Immerhin schützten die klobigen Lederschuhe ihre Füße vor der Kälte, ein schwacher Trost angesichts ihrer verzweifelten Lage und des menschenleeren Landes, das hundert Schritt unter ihnen dahinzog.
Vor zwei Tagen war Merle auf Vermithrax’ Rücken aus ihrer Heimatstadt Venedig entkommen. Gemeinsam hatten sie den Belagerungsring des Imperiums durchbrochen und flogen nun nach Norden. Seitdem hatten sie unter sich nichts als verwüstete Einöde gesehen. Leere Ruinenstädte aus gezahnten, ausgeglühten Mauerreihen; verlassene Gehöfte, niedergebrannt oder unter den Sohlen der ägyptischen Armeen zu Staub zermahlen; Dörfer, in denen nur noch streunende Katzen und Hunde lebten; und natürlich jene Stellen, an denen das Erdreich aussah wie umgekrempelt, aufgewühlt und von Kräften verheert, die tausendmal stärker waren als jeder Ochsenpflug.
Allein die Natur widersetzte sich der brachialen Macht des Imperiums, und so kam es, dass viele Wiesen in frühlingshaftem Grün erstrahlten, dass sich blühende Fliederbüsche über verödeten Mauern erhoben und die Bäume dichtes, saftiges Laub trugen. Die Kraft und das Leben all dieser Pflanzen standen in einem höhnischen Gegensatz zu den verlassenen Höfen und Ansiedlungen.
»Wie lange noch?«, fragte Merle mürrisch.
Vermithrax’ Stimme war tief wie ein Brunnenschacht. »Einen halben Tag weniger als heute Mittag.«
Sie erwiderte nichts, sondern wartete, dass sich die geisterhafte Stimme in ihrem Inneren meldete, wie meist, wenn Merle Trost oder ein paar aufmunternde Worte brauchte.
Aber die Fließende Königin schwieg.
»Königin?«, fragte sie zaghaft.
Vermithrax hatte sich längst damit abgefunden, dass Merle gelegentlich mit jemandem sprach, den er weder sehen noch hören konnte. Er erkannte rasch, wenn ihre Worte nicht an ihn gerichtet waren.
»Gibt sie keine Antwort?«, fragte er nach einer Weile.
»Sie denkt nach«, kam es über Merles Lippen, aber es war nicht sie selbst, die diese Worte aussprach. Die Fließende Königin hatte sich einmal mehr ihrer Stimme bemächtigt. Mittlerweile tolerierte Merle diese Unart, auch wenn sie sich im Stillen darüber ärgerte. Im Augenblick war sie froh, dass die Königin überhaupt ein Lebenszeichen von sich gab.
»Worüber denkst du nach?«, fragte Merle.
»Über euch Menschen«, sagte die Königin und wechselte wieder in ihre Gedankenstimme, die nur Merle hörte. »Wie es so weit kommen konnte. Und was einen Mann wie den Pharao zu … so etwas bringt.« Sie hatte keine eigene Hand, um auf die Ödnis am Boden zu zeigen, aber Merle wusste sehr gut, was sie meinte.
»Ist er das denn? Ein Mensch, meine ich? Immerhin war er tot, bis ihn die Priester wieder zum Leben erweckt haben.«
»Allein die Tatsache, dass ein Mann von den Toten aufersteht, muss doch nicht bedeuten, dass er alle Länder mit einem Krieg überzieht, wie ihn die Welt seit langem nicht gesehen hat.«
»Seit langem?« Merle wunderte sich. »Gab es denn schon einmal einen Krieg, bei dem es gelungen ist, fast die ganze Welt zu erobern?« Mit Ausnahme von Venedig, dessen Stunden gezählt waren, widerstand nur das Zarenreich seit drei Jahrzehnten den Angriffen des Imperiums. Alle anderen Länder waren schon vor langer Zeit von Mumienheeren und Skarabäenschwärmen überrannt worden.
»Man hat es versucht. Aber das war vor Tausenden von Jahren, im Zeitalter der Subozeanischen Kulturen.«
Die Subozeanischen Kulturen. Die Worte klangen nach in Merle, auch als die Stimme der Königin verstummt war. Nachdem sie die Fließende Königin aus den Händen eines ägyptischen Spions befreit hatte, hatte sie erst angenommen, das sonderbare Wesen sei eine Überlebende der Subozeanischen Reiche, von denen es hieß, dass sie einst unfassbar mächtig gewesen waren. Doch die Königin hatte das abgestritten, und Merle glaubte ihr. Es wäre zu einfach gewesen.
Niemand vermochte eine Wesenheit wie sie völlig zu durchschauen, nicht einmal Merle, die der Königin seit ihrer gemeinsamen Flucht aus Venedig näher war als jede andere.
Merle riss sich aus ihren Gedanken. An Venedig zu denken hieß auch an Serafin denken, und das tat einfach zu weh.
Angestrengt spähte sie über Vermithrax’ schwarze Mähne hinweg. Vor ihnen erhoben sich die Felsnasen hoher Berge. Das Land wurde seit geraumer Zeit hügelig und stieg jetzt immer steiler an. Sie würden das Gebirge bald erreichen. Angeblich befand sich ihr Ziel nur ein Stück weit dahinter.
»Da liegt ja Schnee!«
»Was hast du denn gedacht?«, fragte der Obsidianlöwe amüsiert. »Sieh mal, wie hoch wir hier sind. Es wird noch ziemlich kalt werden, ehe wir auf der anderen Seite ankommen.«
»Ich hab noch nie Schnee gesehen«, sagte Merle. »Die Leute behaupten, es habe seit Jahrzehnten keinen echten Winter mehr gegeben. Und keinen Sommer. Frühling und Herbst gehen einfach ineinander über, irgendwie.«
»Während meiner Gefangenschaft im Campanile hat sich anscheinend nichts verändert.« Vermithrax lachte. »Die Menschen beschweren sich noch immer von morgens bis abends über das Wetter. Warum machen sich so viele Köpfe so viele Gedanken über etwas, das sie ohnehin nicht beeinflussen können?«
Merle fiel keine Antwort ein.
Erneut benutzte die Königin ihre Stimme: »Vermithrax! Dahinten, am Fuß dieses Berges … Was ist das?«
Merle schluckte, als könnte sie den unliebsamen Einfluss, der ihre Zunge kontrollierte, einfach hinunterwürgen. Sofort spürte sie, wie sich die Königin aus ihrem Mund zurückzog, ein Gefühl, als entwiche für die Dauer eines Lidschlags alles Blut aus ihrer Zunge und den Wangen.
»Ich seh’s auch«, sagte sie. »Ein Vogelschwarm?«
Der Löwe knurrte. »Ziemlich groß für einen Vogelschwarm. Und zu massiv.«
Der dunkle Schatten, der wie eine Wolke über einem Teil der Bergflanke schwebte, war scharf umrissen. Die Entfernung mochte noch einige tausend Schritt betragen, und im Vergleich zu den riesenhaften Felsgiganten im Hintergrund wirkte das Ding, das sich dunkel von den Hängen abhob, nicht besonders beeindruckend. Aber schon jetzt ließ sich erahnen, dass sich dieser Eindruck ändern würde, wenn sie erst näher heran waren. Oder das Ding auf sie zukam.
»Achtung!«, rief Vermithrax.
Er verlor so abrupt an Höhe, dass Merle das Gefühl hatte, ihre Eingeweide würden durch die Ohren nach außen gepresst. Einen Moment lang war ihr speiübel. Sie wollte den Obsidianlöwen gerade anfauchen, als sie sah, was ihn zu dem Manöver veranlasst hatte.
Eine Handvoll winziger Punkte umschwirrte den großen Umriss, helle Tupfen, die im Licht der untergehenden Sonne glühten, als hätte jemand Goldstaub über einem Landschaftsgemälde ausgestreut.
»Sonnenbarken«, sagte die Königin in Merles Gedanken.
Jetzt haben sie uns, dachte Merle. Sie haben uns den Weg abgeschnitten. Wer hätte ahnen können, dass wir immer noch so wichtig für sie sind? Gewiss, sie war die Trägerin der Fließenden Königin, des Schutzgeistes, der in den Gewässern der Lagune gelebt und Venedig vor den ägyptischen Eroberern bewahrt hatte. Aber das war vorbei. Die Stadt war unwiderruflich in der Gewalt der Tyrannen.
»Es muss Zufall sein, dass wir ihnen begegnen«, sagte die Gedankenstimme der Fließenden Königin. »Sieht nicht so aus, als hätten sie uns bemerkt.«
Merle gab ihr recht. Die Ägypter hätten sie nicht so schnell überholen können. Und selbst wenn es ihnen gelungen wäre, einen Teil ihrer Streitkräfte in dieser Region zu alarmieren, hätten sie die Flüchtigen gewiss nicht weithin sichtbar vor dem Schneefeld eines Gletschers erwartet.
»Was tun sie hier?«, fragte Merle.
»Das Große muss ein Sammler sein. Eine ihrer fliegenden Mumienfabriken«, antwortete die Königin.
Vermithrax schoss über die Wipfel eines dichten Waldes hinweg. Gelegentlich musste er hochgewachsenen Tannen und Fichten ausweichen, ansonsten aber hielt er geradewegs auf ihre Gegner zu.
»Vielleicht sollten wir ausweichen«, sagte Merle und versuchte, nicht allzu ängstlich zu klingen. Ihr Herzschlag raste. Ihre Beine fühlten sich an, als gehörten sie zu einer Lumpenpuppe.
Ein Sammler also. Ein echter, wahrhaftiger Sammler. Noch nie hatte sie eines der ägyptischen Luftschiffe mit eigenen Augen gesehen, und sie hätte weiterhin gut und gern auf diese Erfahrung verzichten können. Sie wusste, was die Sammler taten, sogar, wie sie es taten, und ebenso war ihr schmerzlich bewusst, dass jeder Sammler von einem der gefürchteten Sphinx-Kommandanten des Pharaos befehligt wurde.
Ziemlich finstere Aussichten. Und doch kam es schlimmer.
»Das sind wirklich eine Menge Sonnenbarken, die da um ihn rumfliegen«, sagte Vermithrax tonlos.
Auch Merle konnte jetzt erkennen, dass es sich bei den goldenen Punkten um die kleinsten fliegenden Einheiten der imperialen Flotte handelte. In jeder der sichelförmigen Sonnenbarken war Platz für einen Trupp Mumienkrieger, außerdem für den Hohepriester, dessen Magie die Barke in der Luft und in Bewegung hielt. Falls die Ägypter auf Vermithrax und seine Reiterin aufmerksam wurden, war der Sonnenuntergang ihre einzige Chance: Je dunkler es wurde, desto schwerfälliger wurden die Barken, bis sie nachts schließlich vollkommen stillstanden.
Aber noch ergoss sich blutige Röte über die Hänge des Gebirges, die Sonne war erst zur Hälfte hinter den Kuppen im Westen versunken.
»Ausweichen«, sagte Merle noch einmal, diesmal drängender. »Warum machen wir nicht einen weiten Bogen um sie?«
»Wenn mich nicht alles täuscht«, sagte die Königin durch Merles Mund, denn die Worte waren auch an den Löwen gerichtet, »ist dieser Sammler auf dem Weg nach Venedig, um an der großen Schlacht teilzunehmen.«
»Vorausgesetzt, es gibt eine«, entgegnete Merle.
»Sie werden kapitulieren«, sagte Vermithrax. »Die Venezianer waren noch nie besonders mutig. Anwesende ausgeschlossen.«
»Besten Dank.«
»Vermithrax hat recht. Wahrscheinlich wird es gar keinen Kampf geben. Aber wer weiß, wie die Armeen des Imperiums mit der Stadt und ihren Bewohnern umspringen werden. Venedig hat den Pharao immerhin über dreißig Jahre lang an der Nase herumgeführt.«
»Aber das warst du!«
»Um euch zu retten.«
Sie waren jetzt bis auf wenige hundert Meter an den Sammler herangekommen. Die Sonnenbarken patrouillierten in großer Höhe über ihnen. Das Licht der sinkenden Sonne brach sich auf der goldenen Panzerung, die Barken glühten rot im Licht der Abendsonne. Merles einzige Hoffnung war, dass der Obsidianlöwe in den Schatten zwischen den Baumwipfeln von oben aus unsichtbar war.
Der Sammler war gewaltig. Er hatte die Form einer dreiseitigen Pyramide, deren obere Spitze abgetragen worden war. Umrahmt von einem Zinnenkranz, befand sich dort eine weitläufige Aussichtsplattform mit mehreren Aufbauten, die wiederum so angeordnet waren, dass sie zur Mitte hin höher wurden und somit selbst eine Art Spitze bildeten. Merle erkannte winzige Gestalten hinter den Zinnen.
Der Wald wurde lichter, als das Gelände leicht anstieg. Deutlich waren jetzt tiefe Furchen im Waldboden zu erkennen, ein Labyrinth aus Schützengräben, die selbst nach all den Jahren noch nicht völlig überwuchert waren. An diesem Ort hatten einst erbitterte Kämpfe getobt.
»Hier sind Menschen begraben«, sagte die Königin unvermittelt.
»Was?«
»Das Gelände, über dem der Sammler schwebt – dort muss während des Krieges eine große Zahl Toter verscharrt worden sein. Sonst würde er nicht so still an einer Stelle schweben.«
Tatsächlich hing der gewaltige Rumpf der Mumienfabrik vollkommen reglos über einer Wiese, auf der sich hohes Gras im Abendwind bog. Zu einer anderen Zeit hätte dies ein idyllisches Bild sein können, ein Ort der Ruhe und des Friedens. Doch heute warf der Sammler seinen bedrohlichen Schatten darüber. Er schwebte gerade hoch genug über der Wiese, dass ein venezianischer Palazzo darunter Platz gefunden hätte.
»Ich lande«, sagte Vermithrax. »Ohne den Schutz der Bäume sehen sie uns.«
Niemand widersprach. Der Obsidianlöwe ließ sich am Rand des Waldes nieder. Ein harter Ruck fuhr durch Merle, als seine Pranken den Boden berührten. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr ihr Hinterteil von dem langen Ritt auf dem steinernen Löwenrücken schmerzte. Sie versuchte sich zu bewegen, aber das war so gut wie unmöglich.
»Nicht absteigen«, sagte die Königin. »Kann sein, dass wir ziemlich überstürzt wieder abheben müssen.«
Tolle Aussichten, dachte Merle.
»Es geht los.«
»Ja … das sehe ich.«
Vermithrax, der nicht mehr über das Imperium und seine Methoden wusste als das, was Merle und die Königin ihm erzählt hatten, nachdem sie ihn aus seinem Turmgefängnis mitten auf der Piazza San Marco befreit hatten, stieß ein tiefes Fauchen aus. Seine Mähne versteifte sich. Seine Barthaare standen mit einem Mal so gerade ab, als hätte man sie mit einem Lineal gezogen.
Es begann damit, dass um sie herum die Blätter an den Bäumen welkten, so schnell, als habe der Herbst beschlossen, seine Arbeit ein paar Monate zu früh und innerhalb von Minuten zu erledigen. Das Laub färbte sich braun, wellte sich und rieselte von den Ästen herab. Die Fichte, unter der sie Schutz gesucht hatten, verlor all ihre Nadeln, und von einem Moment zum nächsten waren Vermithrax und Merle mit einem braunen Mantel bedeckt.
Merle schüttelte sich und blickte zum Sammler empor. Sie befanden sich nicht direkt darunter, Gott bewahre, aber sie waren nahe genug, dass sie seine gesamte Unterseite im Blick hatten.
Die riesenhafte Fläche überzog sich mit einem Netzwerk dunkelgelb leuchtender Streifen, kreuz und quer, vielfach verwinkelt und keinem erkennbaren Muster folgend. Nur in der Mitte blieb eine runde Fläche dunkel, halb so groß wie der Markusplatz. Merle klammerte sich an Vermithrax’ Obsidianmähne, als urplötzlich der Boden erzitterte wie bei einem starken Erdbeben. Ganz in der Nähe wurden mehrere Bäume entwurzelt und kippten zur Seite, rissen andere mit sich und krachten inmitten dichter Wolken aus aufstiebendem Laub und Nadeln zu Boden. Einen Moment lang fiel es Merle schwer zu atmen, so gesättigt war die Luft von trockenen Splittern und Bröseln des ausgedörrten Blattwerks. Als ihre Augen aufhörten zu tränen, sah sie, was geschehen war.
Die Wiese, über der die Mumienfabrik schwebte, war verschwunden. Das Erdreich war aufgerissen, als habe sich eine Armee unsichtbarer Riesenmaulwürfe darüber hergemacht. Das glühende Netz haftete jetzt nicht länger an der Unterseite des Sammlers, sondern war in eine Unzahl gleißender Lichtstränge und Haken zerfasert, keiner geformt wie der andere. Sie alle wiesen abwärts, näherten sich dem verwüsteten Boden und zerrten etwas daraus hervor.
Körper. Graue, eingefallene Leichen.
»So kommen sie also an ihre Mumienkrieger«, flüsterte Vermithrax und seine Stimme klang, als würde sie jeden Augenblick vor Grauen versagen.
Merle riss an seiner Mähne. Sie konnte nicht mehr mitansehen, was sich vor ihren Augen abspielte. »Lass uns abhauen!«
»Nein!«, sagte die Fließende Königin.
Aber Vermithrax erging es genauso wie Merle. Nur weg von hier. Fort aus dem Sog des Sammlers, bevor sie selbst an einem der flirrenden Haken endeten und hinaufgezogen wurden ins Innere der Mumienfabrik, wo Sklaven und Maschinen etwas aus ihnen machen würden, das von einer anderen Art von Leben erfüllt war, von Demut und Gehorsam und dem Willen zu töten.
»Festhalten!«, brüllte er.
Die Königin widersprach lautstark mit Merles Stimme, doch der Obsidianlöwe beachtete sie nicht. In Windeseile trugen seine Schwingen sie empor in die Lüfte. Mit einem gewagten Manöver wandte er sich nach Osten, der näher rückenden Dunkelheit entgegen. Zugleich stieß er vorwärts, ungeachtet aller Sonnenbarken und Hohepriester, die in diesem Moment auf sie aufmerksam wurden.
Merles Arme verschwanden bis zu den Ellbogen in Vermithrax’ Mähne, so fest krallte sie sich in seinen Pelz. Sie beugte sich tief über seinen Hals, um weniger Luftwiderstand zu bieten, aber auch um den Geschossen der Ägypter auszuweichen. Sie wagte kaum aufzublicken, aber schließlich tat sie es doch, und da sah sie, dass ein halbes Dutzend Sonnenbarken aus ihrer Formation rund um den Sammler ausgeschert waren und die Verfolgung aufgenommen hatten.
Vermithrax’ Plan war so simpel wie selbstmörderisch. Er ahnte wohl, dass sich in dem mächtigen Rumpf des Sammlers Waffen befanden, mit denen es ein Leichtes war, einen fliegenden Löwen vom Himmel zu schießen. Wenn er aber die Nähe der Sonnenbarken suchte, würden sich die Befehlshaber an Bord des Sammlers vielleicht zweimal überlegen, ob sie Schüsse auf ein Ziel inmitten ihrer eigenen Leute abgaben.
Es wird nicht funktionieren, dachte Merle. Vermithrax’ Plan wäre gut gewesen, wenn sie es mit gewöhnlichen Gegnern zu tun gehabt hätten, solchen, die der geflügelte Löwe aus jenen Zeiten kannte, als er noch kein Gefangener der venezianischen Stadtgarde gewesen war. Doch die Sonnenbarken waren mit Mumienkriegern besetzt, jeder von ihnen leicht ersetzbar, und selbst den ein oder anderen Priester würden sie opfern.
Vermithrax fluchte, als ihm dieselbe Erkenntnis kam. Nur ein kleines Stück vor ihnen zischte ein mannslanger Bolzen aus Holz durch die Luft, abgefeuert aus einer der Luken im Rumpf des Sammlers. Die Mumienfabrik selbst war zu schwerfällig für eine Verfolgung, doch ihre Waffen waren tückisch und weitreichend.
Merle war übel, schlimmer denn je, als Vermithrax immer neue Haken schlug und wendige Manöver flog, die sie seinem schweren Steinleib nicht zugetraut hätte. Auf und ab ging es, oft in so raschem Wechsel, dass Merle bald jedes Gefühl für oben und unten verlor. Sogar die Königin schwieg betroffen.
Einmal blickte Merle zurück. Sie befanden sich jetzt beinahe auf Höhe der Aussichtsplattform am oberen Ende der Pyramide. Mehrere Gestalten standen hinter den Zinnen, Merle konnte ihre Gewänder und verbissenen Mienen erkennen. Hohepriester, vermutete sie.
Unter ihnen war einer, der ihr besonders ins Auge fiel. Er war einen guten Kopf größer als die Übrigen und trug einen aufgebauschten Mantel, der aussah, als wäre er aus purem Gold gewebt. Sein haarloser Schädel war mit einem Netzwerk aus goldfarbenen Fäden überzogen, wie Gravuren eines Kunstschmieds auf einer Brosche. Seine Hände umklammerten verbissen die Zinnen.
»Der Wesir des Pharaos«, flüsterte die Königin in ihrem Kopf. »Sein Name ist Seth. Er ist der höchste Priester des Horuskultes.«
»Seth? Ist das nicht auch der Name eines ägyptischen Gottes?«
»Die Horuspriester waren noch nie für ihre Bescheidenheit bekannt.«
Merle hatte das Gefühl, als bohrten sich die Blicke des Mannes über die Distanz hinweg in ihr Hirn. Einen Herzschlag lang kam es ihr vor, als stöhnte die Königin in ihrem Inneren schmerzerfüllt auf.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Schau weg! Bitte … Nicht in seine Augen.«
Im selben Moment raste ein ganzer Schwarm Bolzen über sie hinweg. Zwei davon schlugen in Sonnenbarken ein, die sich in unmittelbarer Nähe des Löwen befanden. Aus einer quoll Rauch, während sie in einer holprigen Spirale abwärtstrudelte. Die andere fiel wie ein Stein und zerbrach am Boden in einem Feuerwerk aus Eisensplittern. Die übrigen Sonnenbarken zogen sich sofort zurück, um nicht ebenfalls in den Geschosshagel des Sammlers zu geraten.
Das war die Chance, auf die Vermithrax gewartet hatte.
Mit einem wilden Aufschrei stürzte er sich in die Tiefe. Merle kreischte auf seinem Rücken, als der Boden blitzschnell näher kam. Schon sah sie sich zerschmettert neben den Trümmern der Barke liegen.
Doch wenige Meter über den Felsen fing Vermithrax den Sturz ab, fegte über den Boden und die Kante einer Steilwand hinweg, um dann erneut in die Tiefe zu sacken, die Wand hinunter und aus dem direkten Schussfeld des Sammlers. Jetzt hatten sie es nur noch mit den vier Barken zu tun, die ihnen jeden Augenblick über die Felskante folgen würden.
Die Fließende Königin hatte sich vom durchdringenden Blick des Wesirs erholt. »Ich wusste schon, warum ich Vermithrax für unsere Flucht ausgewählt habe.«
»Weil du keine andere Wahl hattest.« Merle hörte kaum ihre eigenen Worte, der Gegenwind riss sie von ihren Lippen wie Papierschnipsel.
Die Königin lachte in ihren Gedanken, was ein sonderbares Gefühl war, denn Merle kam es vor, als lachte sie selbst, ganz ohne ihr Zutun.
Der Löwe legte sich wieder in die Waagerechte und überquerte einen Irrgarten aus Felsspalten, ehe er eine entdeckte, die breit genug war, um darin abzutauchen. Rechts und links von ihnen schlugen Geschosse ein, Stahlkugeln diesmal, abgefeuert aus Läufen an den Spitzen der Sonnenbarken. Keine kam ihnen nahe genug, um gefährlich zu werden. Steinsplitter regneten von allen Seiten auf sie herab. Funken sprühten, wenn Querschläger über die Felswände schlitterten und Furchen in das Gestein fraßen.
Die Schlucht war nicht tief, kaum mehr als sechs oder sieben Schritt. Nach unten hin wurde sie enger, die Wände standen gerade weit genug auseinander, dass Vermithrax in niedriger Höhe hindurchjagen konnte. Zwei Sonnenbarken waren ihnen in das Felslabyrinth gefolgt; die beiden anderen glitten über das Gewirr der Spalten hinweg und lauerten darauf, dass der Obsidianlöwe wieder auftauchte. Vermithrax fiel es nicht schwer, scharfe Kurven zu fliegen, während die langgestreckten Sonnenbarken vor jeder Biegung verlangsamen mussten, um nicht gegen die Felsen zu prallen.
Unter ihnen füllte sich die Schlucht mit Wasser. Der tote Arm eines Bachs oder Bergsees. Vermithrax folgte dem Verlauf, und bald rasten sie über die Oberfläche eines Flusses hinweg. Die Felswände standen jetzt weiter auseinander und boten den Sonnenbarken ausreichend Platz zum Manövrieren. Doch noch war Vermithrax’ Vorsprung zu groß, und auch die beiden Barken oberhalb der Spalten hatten ihn noch nicht entdeckt.
»Wir können nicht ewig so tief fliegen, wenn wir auf die andere Seite des Gebirges wollen«, sagte die Königin.
»Erst mal müssen wir überleben, oder?«
»Ich versuche nur, die Dinge zu planen, Merle. Sonst nichts.«
Es fiel Merle schwer, sich zu konzentrieren. Nicht bei dieser Geschwindigkeit, nicht mit dem Tod im Nacken. Dem Sammler mochten sie entkommen sein, aber die Sonnenbarken befanden sich immer noch hinter ihnen.
»Vermithrax!« Sie beugte sich zum Ohr des Löwen und versuchte, den Lärm des Windes zu übertönen. »Was hast du vor?«
»Sonnenuntergang«, erwiderte er knapp.
An seinem Tonfall bemerkte sie, dass er erschöpfter war, als sie angenommen hatte. Tatsächlich war es ihr noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass auch einem Geschöpf wie Vermithrax schlichtweg die Puste ausgehen konnte.
Die Strömung unter ihnen wurde schneller. Merle sah, dass das Wasser nicht mehr rot leuchtete, wie noch vor wenigen Minuten, sondern die schattigen Felswände widerspiegelte. Auch der Himmel hatte an Glut verloren und verfärbte sich zu einem violetten Blau.
Am liebsten hätte sie geschrien vor Erleichterung. Vermithrax’ Plan ging auf. Er hatte die Ägypter ausgetrickst. Die Sonnenbarken blieben zurück. Merle stellte sich vor, wie die sichelförmigen Flugschiffe im Kriechtempo zum Sammler zurückkehrten, lahmgelegt vom fehlenden Tageslicht, so nutzlos wie ein Stück Eisenschrott.
Der Fluss wurde reißender, tobender, vor allem aber lauter, und bald tauchte vor ihnen eine weiße Schaumkrone auf, die sich quer über die gesamte Breite des Gewässers zog. Dahinter war nichts als Dunkelheit.
Vermithrax raste mit einem jubelnden Ausruf über den Wasserfall hinweg, der Boden sackte auf einen Schlag um hundert Meter ab. Der Obsidianlöwe hielt seine Höhe, so dass Merle weit über das Land am Fuß der Berge blicken konnte, über Wälder und Wiesen, schlummernd in der anbrechenden Nacht. Der Löwe verlangsamte seinen Flügelschlag, aber setzte unbeirrt seinen Flug fort. Merle starrte lange auf die dahinziehende Landschaft, bevor sie das Wort an die Königin richtete.
»Was weißt du über diesen Seth?«, fragte sie die Stimme in ihrem Inneren.
»Nicht viel. Anhänger des Horuskultes haben den Pharao vor über dreißig Jahren zurück ins Leben gerufen. Seitdem stellen sie die Hohepriester des Imperiums. Es heißt, Seth sei schon damals ihr Oberhaupt gewesen.«
»So alt hat er gar nicht ausgesehen.«
»Nein. Aber welchen Unterschied macht das?«
Merle überlegte, wie sie einem zeitlosen Wesen wie der Fließenden Königin klarmachen konnte, dass das Äußere eines Menschen Aufschluss über sein Alter geben sollte. Tat es das nicht, zeigte derjenige entweder nicht sein wahres Gesicht, oder er sah aus wie ein Mensch, war aber keiner. Zumindest kein Sterblicher.
Als Merle keine Anstalten machte, die Frage zu beantworten, fuhr die Königin fort: »Die Horuspriester haben viel Macht. In Wahrheit sind sie es, die die Geschicke des Imperiums lenken. Der Pharao ist nur ihre Puppe.«
»Das würde ja bedeuten, dass Seth, wenn er der oberste Horuspriester und noch dazu der Wesir des Pharaos ist, dass also er –«
»Der wahre Herrscher Ägyptens ist. Allerdings.«
»Und der Welt.«
»Unglücklicherweise.«
»Glaubst du, wir werden ihm noch einmal begegnen?«
»Du solltest beten, dass das nicht geschieht.«
»Zur Fließenden Königin? Wie ganz Venedig es wahrscheinlich gerade tut?« Die Worte taten ihr gleich darauf leid, doch es war zu spät.
Während der nächsten Stunden schwieg die Königin und zog sich in den hintersten Winkel von Merles Bewusstsein zurück, eingesponnen in einen Kokon ihrer kühlen, fremden, göttlichen Gedanken.
Sie überquerten das Gebirge ein Stück weiter östlich, ohne erneut auf Gegner zu stoßen.
Irgendwann, es musste nach Mitternacht sein, sahen sie im grauen Eislicht der Sterne die andere Seite vor sich, und jetzt endlich gönnte sich Vermithrax eine Ruhepause. Er landete auf der Spitze einer unzugänglichen Felsnadel, gerade breit genug, dass er sich hinlegen und Merle von seinem Rücken klettern konnte.
Ihr tat alles weh. Eine Zeitlang bezweifelte sie, je wieder laufen zu können, ohne dass bei jedem Schritt jeder Knochen, jeder Muskel schmerzte.
Im Dunkeln hielt sie Ausschau nach Verfolgern, konnte aber nirgends etwas Verdächtiges entdecken. Nur ein Raubvogel kreiste in der Ferne, ein Falke oder Habicht.
Aus dem weiten Land am Fuß des Gebirges drangen keine Laute herauf, nicht einmal der Schrei eines Tiers oder das Flattern von Vogelschwingen. Ihr Herz zog sich zusammen, und Beklommenheit überkam sie. Ihr wurde klar, dass dort unten nichts mehr lebte. Keine Menschen, keine Tiere. Sogar die Toten hatten die Ägypter geraubt, um damit ihre Galeeren, Sonnenbarken und Kriegsmaschinen zu bemannen.
Sie ließ sich am Rand des winzigen Plateaus nieder und starrte gedankenverloren in die Nacht. »Glaubst du, Lord Licht wird uns helfen?« Es war das erste Mal seit Stunden, dass sie das Wort an die Königin richtete. Sie rechnete nicht mit einer Antwort.
»Ich weiß es nicht. Die Venezianer haben seinem Boten böse mitgespielt.«
»Aber sie wussten ja nicht, was sie da taten.«
»Meinst du, dass das einen Unterschied macht?«
»Nein«, sagte Merle niedergeschlagen. »Nicht wirklich.«
»Eben.«
»Immerhin hat Lord Licht angeboten, Venedig im Kampf gegen das Imperium zu unterstützen.«
»Das war, bevor die Leibgarde seinen Boten getötet hat. Außerdem liegt es nicht in der Natur des Menschen, einen Pakt mit der Hölle einzugehen.«
Merle grinste humorlos. »Da hab ich ganz andere Geschichten gehört. Du weißt wirklich nicht viel über uns Menschen.«
Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Im Jahr 1833 hatte der englische Forscher Professor Burbridge entdeckt, dass die Hölle alles andere als ein Ammenmärchen war. Sie existierte als realer, unterirdischer Ort im Inneren der Erde, und Burbridge hatte eine Reihe von Expeditionen dorthin geleitet. Von der letzten war er allein zurückgekehrt. Vieles von dem, was er gesehen und erlebt hatte, war dokumentiert und bis zu Beginn des großen Krieges an den Schulen gelehrt worden. Aber es bestand kein Zweifel, dass dies nur ein Bruchteil seiner tatsächlichen Erkenntnisse war. Den Gerüchten zufolge war der Rest zu grauenvoll, zu entsetzlich, um ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies hatte dazu geführt, dass in den Jahren nach Burbridges letzter Expedition niemand mehr den Abstieg gewagt hatte. Erst seit Ausbruch des Krieges waren neue Lebenszeichen von unten heraufgedrungen, die darin gipfelten, dass Lord Licht, der sagenumwobene Herrscher der Hölle, den Venezianern seine Unterstützung im Kampf gegen den Pharao anbot. Doch der Stadtrat hatte in seiner Arroganz und Selbstzufriedenheit jede Hilfe abgelehnt. Merle selbst war Zeuge geworden, wie der letzte Bote Lord Lichts auf der Piazza San Marco ermordet worden war.
Und nun waren Merle, die Fließende Königin und Vermithrax unterwegs, um Lord Licht persönlich um Hilfe zu bitten, im Namen des Volkes von Venedig, nicht seiner Ratsherren. Dabei war es fraglich, ob sie – selbst wenn sie Erfolg bei ihrer Mission hatten – noch rechtzeitig kommen würden. Und wer sagte, dass Lord Licht mit ihnen nicht genauso verfahren würde, wie man mit seinem Boten in Venedig umgegangen war? Das Schlimmste aber war, dass ihnen nichts anderes übrigblieb, als auf Burbridges Spuren in den Abgrund zu steigen. Und keiner von ihnen, nicht einmal die Königin, ahnte, was sie dort unten finden würden.
Merle öffnete die Augen und blickte zum schlafenden Vermithrax. Sie war selbst hundemüde, aber zu aufgeregt, um Ruhe zu finden.
»Warum hilft er uns?«, flüsterte sie nachdenklich. »Ich meine, du bist die Fließende Königin und irgendwie ein Teil von Venedig – oder umgekehrt. Du willst beschützen, was zu dir gehört. Aber warum Vermithrax? Er könnte einfach zurück zu seinen Verwandten nach Afrika fliegen.«
»Falls er sie dort noch finden würde. Das Imperium hat sich nicht nur nach Norden ausgedehnt.«
»Du glaubst, die anderen sprechenden Löwen sind tot?«
»Ich weiß es nicht«, sagte die Königin traurig. »Vielleicht. Möglicherweise sind sie auch weitergezogen, so weit fort, dass die Ägypter sie vorerst nicht finden werden.«
»Und Vermithrax weiß das?«
»Vielleicht ahnt er es.«
»Dann sind wir alles, was er noch hat, nicht wahr? Seine einzigen Freunde.« Merle streckte eine Hand aus und streichelte sanft über eine steinerne Pranke des Löwen. Vermithrax stieß ein sanftes Schnurren aus, drehte sich auf die Seite und schob ihr alle vier Pfoten entgegen. Seine Lefzen flatterten bei jedem Atemzug, und seine Augen zuckten unter den Lidern. Er träumte.
Merle zog das Cape enger um ihren Körper, um sich vor dem kühlen Wind zu schützen, dann kuschelte sie sich ganz nah an Vermithrax. Wieder schnurrte er wohlig und begann leise zu schnarchen.
Die Königin ist hier, dachte sie, weil sie und Venedig auf irgendeine Art zueinandergehören. Eines kann nicht ohne das andere existieren. Aber was ist mit mir? Was tue ich eigentlich hier?
Ihre engsten Vertrauten, Junipa und Serafin, ihr Lehrmeister Arcimboldo und natürlich Unke, sie alle waren noch in Venedig und dort den Gefahren der ägyptischen Invasion ausgeliefert. Merle selbst war Waise, sie war als kleines Kind in einem Korb auf den Kanälen gefunden worden und im Waisenhaus aufgewachsen; der Gedanke, dass sie keine Eltern hatte, um die sie sich hätte Sorgen machen müssen, war heute ausnahmsweise einmal beruhigend.
Doch irgendwann würde sie erfahren, was für Menschen ihre Mutter und ihr Vater gewesen waren. Irgendwann, ganz bestimmt.
Gedankenverloren zog sie den magischen Handspiegel unter ihrem Cape hervor. Die Oberfläche bestand aus Wasser, das nicht aus dem Spiegel entweichen konnte, egal wie herum man ihn auch hielt. Wenn Merle ihren Arm hineinschob, spürte sie manchmal, wie ihre Finger von einer sanften, warmen Hand umschlossen wurden, auf der anderen Seite des Spiegels, in seinem Inneren. Der Wasserspiegel hatte neben ihr im Korb gelegen, als man sie damals gefunden hatte. Er war das Einzige, was sie mit ihren Eltern verband. Die einzige Spur.
Noch etwas befand sich in dem Spiegel: ein milchiger Hauch, der unablässig über die Oberfläche geisterte. Der Schemen war aus einem von Arcimboldos Zauberspiegeln entwichen und hatte sich in dem kleinen Handspiegel festgesetzt. Merle wollte nur zu gern Kontakt mit ihm aufnehmen. Fragte sich nur, wie. Serafin hatte ihr erzählt, dass die Schemen in Arcimboldos Spiegeln Menschen aus einer anderen Welt waren, denen es gelungen war, in diese hier überzuwechseln – ohne allerdings zu ahnen, dass sie hier als Schemen ankamen, formlose Schleier, die im Inneren von Spiegeln gefangen waren.
Serafin … Merle seufzte unhörbar.
Sie hatte ihn kaum richtig kennengelernt, da waren sie auch schon von der Leibgarde der Ratsherren getrennt worden. Nur wenige Stunden hatten sie miteinander verbracht, aufreibende, gefährliche Stunden, in denen sie dem ägyptischen Spion die Kristallkaraffe mit der Essenz der Fließenden Königin entrissen hatten. Und obwohl sie nur so wenig voneinander wussten, vermisste sie ihn.
Mit dem Gedanken an sein Lächeln, an den Schalk in seinen Augen schlief sie ein.
Im Traum war ihr, als höre sie den Schrei eines Falken. Sie erwachte kurz von einem sanften Luftzug auf ihrem Gesicht, vom Geruch von Federn, aber da war nichts in ihrer Nähe, und falls doch, so verbarg es sich wieder im Dunkeln.
Der Meisterdieb
Vor einer ganzen Weile hatten Venedigs Turmuhren Mitternacht geschlagen. Tiefe Dunkelheit lag über der Stadt und den Gewässern der Lagune. Die Gassen waren menschenleer, nichts rührte sich außer den streunenden Katzen, die unbeeindruckt von der Bedrohung durch das Imperium auf die Jagd gingen.
Am Ufer des schmalen Kanals war es still, beängstigend still. Serafin saß auf der Steinkante und ließ die Füße baumeln. Seine Sohlen schwebten nur eine Handbreit über dem Wasser. Die Häuserschneise war eng und düster; sie endete als Sackgasse vor der Wasserkante.
Vor gar nicht langer Zeit war er mit Merle hergekommen und hatte ihr die Spiegelungen auf der Oberfläche gezeigt. Spiegelungen, die es eigentlich nicht geben durfte und die nur zwischen zwölf und ein Uhr nachts zu sehen waren. Sie zeigten die Häuser am Ufer des Kanals, und doch waren sie kein Abbild der Wirklichkeit. Manche der gespiegelten Fenster im Wasser waren erleuchtet, obwohl die Gebäude in Wahrheit verlassen und dunkel waren. Hin und wieder bewegte sich etwas, wie die Reflexion von Fußgängern, die gar nicht existierten – nicht in diesem Venedig, der Stadt, in der Serafin und Merle aufgewachsen waren. So gab es Gerüchte, dass in einer anderen Welt ein zweites Venedig existierte, vielleicht sogar ein Dutzend oder Hunderte davon.
Serafin bröselte trübsinnig Krümel von einem kleinen Laib Brot ins Wasser, aber es kamen keine Fische, um die unverhofften Leckerbissen in Empfang zu nehmen. Seit die Fließende Königin vom Gift der ägyptischen Hohepriester aus dem Wasser der Lagune vertrieben worden war, sah man nur noch selten Fische durch die Kanäle ziehen. Statt ihrer gediehen jetzt Algen in den Gewässern, und nicht allein Serafin hatte das Gefühl, dass es mit jedem Tag mehr wurden. Dunkelgrüne Stränge, formlos und verdreht wie nass gewordene Spinnweben. Blieb nur zu hoffen, dass sie nicht wirklich von einem der großen Meeresarachniden stammten, die noch niemand gesehen hatte, von denen man aber munkelte, dass es sie im Mittelmeer gab, dort, wo das Wasser am tiefsten war, in den Ruinen der Subozeanischen Reiche.
Serafin fühlte sich hundeelend. Er wusste, dass Merle auf dem Rücken eines steinernen Löwen aus Venedig entkommen war, und trotz all seiner Verwirrung war er dankbar dafür. Zumindest drohte ihr im Augenblick keine Gefahr durch die Ägypter – vorausgesetzt, sie hatte den Belagerungsring des Imperiums passieren können, ohne von den Sonnenbarken abgefangen zu werden.
Es war nicht allein die bevorstehende Invasion, die ihm Sorgen bereitete. Die Angst vor den Ägyptern saß tief, gewiss, doch auf eine eigenartige Weise, die ihn selbst erschreckte, hatte er sich damit abgefunden. Die Eroberung Venedigs war unausweichlich.
Nein, etwas anderes nagte an ihm, ließ ihn kaum schlafen und machte ihn tagsüber ruhelos. Sein Magen fühlte sich an wie eine verhärtete Kugel, die nicht zuließ, dass er Nahrung zu sich nahm. Er musste sich zu jedem Bissen zwingen, aber selbst das gelang nicht immer. Die Brotkrumen unter ihm auf dem Wasser waren sein Abendessen.
Er sorgte sich um Junipa, das Mädchen mit den Spiegelaugen. Und natürlich um Arcimboldo, den alten Zauberspiegelmacher am Kanal der Ausgestoßenen. Arcimboldo war es gewesen, der Junipa und Merle aus dem Waisenhaus geholt und zu Lehrlingen in seiner Werkstatt gemacht hatte. Arcimboldo, der – wie Serafin vor kurzem erfahren hatte – eine Vereinbarung getroffen hatte, Junipa schon bald an Lord Licht, den Herrn der Hölle, auszuliefern.
Serafin hatte Arcimboldo zur Rede gestellt und der Zauberspiegelmacher hatte die meisten seiner Fragen beantwortet.
Arcimboldo machte den Eindruck eines geschlagenen Mannes. Seit Jahren belieferte er im Geheimen Lord Licht mit seinen Zauberspiegeln. Ein ums andere Mal hatte er sich mit Talamar, dem Gesandten Lord Lichts, getroffen, um neue Spiegel zu übergeben. Und als Talamar ihm eines Tages ein besonderes Angebot gemacht hatte, hatte Arcimboldo nach langem Zögern zugestimmt. Er sollte der blinden Junipa das Augenlicht zurückgeben, und zwar mit Hilfe seiner Zauberspiegel. An sich eine noble Geste, und seither lernte Junipa jeden Tag ein wenig schneller, mit ihrer neuen Sehkraft umzugehen.
Doch das war nicht alles.
Lord Licht hatte Arcimboldos Augenmerk nicht aus Nächstenliebe auf die zierliche Junipa gelenkt. Serafin hatte eine Weile nachbohren müssen, bis der Spiegelmacher ihm endlich alles erzählt hatte.
»Junipa kann mit ihren neuen Augen auch im Dunkeln sehen«, hatte Arcimboldo bei einem Glas Tee erklärt, während der Mond durch ein Dachfenster in die Werkstatt schien. »Das hat Merle dir vielleicht schon erzählt. Aber damit endet es nicht.«
»Endet?«, fragte Serafin irritiert.
»Das magische Spiegelglas, mit dem ich ihre Augäpfel ersetzt habe, wird ihr irgendwann die Macht geben, in andere Welten zu blicken. Oder besser: durch die Spiegel anderer Welten.«
Nach langem Schweigen fand Serafin wieder Worte. »In solche Welten wie die, die sich um Mitternacht auf einigen Kanälen spiegeln?«
»Du weißt Bescheid darüber? Ja, in diese und auch in andere Welten. Junipa wird denen, die dort wohnen, aus ihren Spiegeln entgegenblicken, und sie werden es nicht einmal bemerken. Sie wird Könige und Kaiser beobachten, die in ihren Spiegelsälen wichtige Entscheidungen treffen, und sie wird sehen, wenn sich vollbeladene Schiffe im Wasser ferner Ozeane spiegeln. Das ist die wahre Macht, die ihr die Spiegelaugen verleihen. Und sie ist es, auf die Lord Licht es abgesehen hat.«
»Kontrolle, nicht wahr? Darum geht es ihm. Er will nicht nur wissen, was in dieser Welt vor sich geht. Er wird erst zufrieden sein, wenn er alles weiß. Über alle Welten.«
»Lord Licht ist neugierig. Vielleicht sollten wir sagen: wissbegierig? Oder interessiert?«
»Skrupellos und bösartig«, sagte Serafin zornig. »Er nutzt Junipa aus. Sie ist so glücklich, dass sie sehen kann – und sie hat keine Ahnung, was wirklich dahintersteckt.«
»Doch«, widersprach Arcimboldo. »Ich habe mit ihr gesprochen. Sie weiß jetzt, über welche Kraft sie einmal verfügen wird. Und ich glaube, sie hat es akzeptiert.«
»Hat sie denn eine Wahl?«
»Lord Licht lässt keinem von uns eine Wahl. Auch mir nicht. Hätte ich sein Gold nicht angenommen, wäre die Werkstatt längst geschlossen. Er kauft mehr Zauberspiegel als jeder andere, seit mich die Gilde ausgestoßen hat. Ohne ihn hätte ich alle meine Lehrlinge zurück in die Waisenhäuser schicken müssen. Merle und Junipa wären gar nicht erst hierhergekommen.« Der kleine alte Mann schüttelte traurig den Kopf. »Serafin, glaub mir, mein eigenes Schicksal spielt keine Rolle. Aber das der Kinder … Ich durfte das nicht zulassen.«
»Weiß Junipa, wohin sie gehen wird?«
»Sie ahnt sicher, dass sie nicht für immer hier bei uns bleiben wird. Aber sie weiß nichts von Talamar und Lord Licht. Noch nicht.«
»Aber das darf nicht passieren!«, rief Serafin aus und stieß beinahe seinen Tee um. »Ich meine, wir können nicht einfach zulassen, dass sie … dass sie zur Hölle fährt. Im wahrsten Sinne des Wortes.«
Darauf hatte Arcimboldo nichts mehr erwidert, und nun saß Serafin hier am Kanal und suchte nach einer Lösung, nach Antworten, nach irgendeinem Ausweg.
Wäre Venedig eine freie Stadt gewesen und hätte es keine Ägypter gegeben, die sie bedrohten, so hätte er vielleicht mit Junipa fliehen können. Er war früher einer der geschicktesten Meisterdiebe Venedigs gewesen – er kannte Orte und Wege, von denen die meisten Bürger der Stadt noch nicht einmal etwas ahnten. Doch der Belagerungsring des Imperiums hatte sich von allen Seiten bis auf einige hundert Meter zugezogen, eine Henkersschlinge aus Galeeren, Sonnenbarken und zigtausend Kriegern. Es gab keinen Weg aus der Stadt, und sich mit Junipa irgendwo in den Gassen zu verstecken, vor der Hölle und den Ägyptern, wäre ein sinnloses Unterfangen. Früher oder später würde man sie finden.
Wenn Merle noch in Venedig wäre, vielleicht hätten sie gemeinsam eine Lösung gefunden. Aber er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie sie auf dem Rücken des steinernen Löwen über die Piazza San Marco geflogen war – über die Lagune aus der Stadt hinaus. Und aus Gründen, die er selbst nicht kannte, bezweifelte er, dass Merle schnell genug zurück sein würde – von wo auch immer –, um Junipa vor ihrem Schicksal zu bewahren. Wo steckte Merle? Wo hatte der Löwe sie hingetragen? Und was war aus der Fließenden Königin geworden?
Die Spiegelung aus der anderen Welt verblasste, als in der Nähe eine Turmuhr schlug, gefolgt von etlichen anderen. Die Stunde nach Mitternacht war verstrichen, mit ihr verschwanden abrupt die hellen Fenster auf dem Wasser. Nur ganz vage spiegelten sich jetzt noch die finsteren Fassaden auf den Wellen, unbeleuchtet, ein Abbild der Wirklichkeit.
Serafin seufzte leise, stand auf – und beugte sich blitzschnell wieder vor. Da war etwas im Wasser gewesen, eine Bewegung. Er hatte es genau gesehen. Keine Spiegelung, weder aus dieser noch der anderen Welt. Vielleicht eine Meerjungfrau? Oder ein großer Fisch?
Serafin sah eine zweite Bewegung, und diesmal fiel es ihm leichter, ihr mit den Augen zu folgen. Ein schwarzer Umriss glitt durch den Kanal, und jetzt entdeckte er noch einen dritten. Jeder war etwa fünf Meter lang. Nein, Fische waren das ganz bestimmt nicht, auch wenn sie in etwa die Form von Haien hatten. Erst recht keine Meerjungfrauen. Vorn liefen sie spitz zu, hatten aber auf ihrer übrigen Länge eine gleichbleibende Breite, wie ein dicker Baumstamm. Auch hatten sie keine Flossen, soweit er das im dunklen Wasser ausmachen konnte.
Der letzte Umriss glitt knapp unter der Oberfläche dahin, nicht so tief wie die anderen, und nun brach sich das Mondlicht auf ihm. Kein Zweifel – Metall! Damit gab es, was seine Herkunft anging, keinen Zweifel mehr. Nur Magie war in der Lage, Gegenstände aus Eisen oder Stahl federleicht durch das Wasser zu bewegen. Ägyptische Magie.
Serafin rannte los. Die umliegenden Häuser reichten bis ans Wasser, deshalb konnte er nicht direkt am Kanal entlanglaufen. Er musste einen Umweg nehmen, um den drei Gefährten zu folgen. Hastig lief er zurück durch die Sackgasse, bog um mehrere Ecken und kam schließlich auf eine Piazza, die er nur zu gut kannte. Vierzig Schritt vor ihm führte eine kleine Brücke über den Kanal, in den er eben noch sein Abendessen entsorgt hatte. In einem schmalen Haus zur Linken waren Merle und er den drei Verrätern vom Stadtrat und dem ägyptischen Spion begegnet. Hier hatten sie die Übergabe der Fließenden Königin vereitelt.
Jetzt lag das Haus verlassen und unscheinbar da. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet hier die Invasion des Imperiums ihren Anfang genommen hatte, hinter vernagelten Fenstern und einer grauen, brüchigen Fassade.
Auf der Brücke stand eine Gestalt in einem langen, dunklen Mantel. Ihr Gesicht war unter einer weiten Kapuze verborgen.
Einen Augenblick lang hatte Serafin das Gefühl, durch eine unsichtbare Tür in die Vergangenheit zu treten. Denselben Mann hatte er schon einmal gesehen, um die gleiche Nachtstunde am selben Ort: den ägyptischen Gesandten, den Spion, dem sie die Karaffe mit der Königin entrissen hatten. Merle hatte ihm mit Hilfe ihres magischen Spiegels die Hand verätzt, während Serafin ihm eine Horde zorniger Straßenkatzen auf den Hals gehetzt hatte.
Nun war der Mann abermals hier, und wieder versteckte er sich unter seinem Kapuzenmantel wie ein Gassenräuber.
Serafin überwand sein Erschrecken rasch genug, um nicht bemerkt zu werden. Geschwind drückte er sich dichter an eine Fassade. Der Mond beschien die gegenüberliegende Seite und einen Großteil der schmalen Piazza; jener Teil aber, durch den Serafin sich bewegte, lag in tiefem Schatten.
Durch die Dunkelheit geschützt, näherte er sich der Brücke. Der Gesandte wartete auf etwas, und nach Serafins Entdeckung von vorhin bestand wenig Zweifel, was das war. Tatsächlich ertönte jetzt ein hohler, metallischer Laut, der sich unregelmäßig wiederholte. Etwas schlug unter der Brücke gegen die Ufermauer.
Etwas legte an.
Der Gesandte eilte zum Fuß der Brücke und blickte von dort aus ins Wasser. Serafin war noch zehn Meter von ihm entfernt, verbarg sich hinter einem schmalen Marienaltar, den jemand vor langer Zeit an die Hauswand gemauert hatte. Opfergaben hatten hier vermutlich lange nicht gelegen. In den vergangenen Jahren hatten die meisten Menschen zur Fließenden Königin gebetet; an die Macht der Kirche glaubte keiner mehr, auch wenn es immer noch Unermüdliche gab, die der Form halber die Gottesdienste besuchten.
Serafin beobachtete, wie der Gesandte einige Schritte rückwärtsging, fort von der Uferkante. Er machte Platz für sechs Männer, die über eine schmale Treppe vom Wasser heraufstiegen.
Männer? Serafin biss sich auf die Unterlippe. Die sechs Gestalten waren einmal Männer gewesen. Heute hatten sie kaum noch Ähnlichkeit mit ihrem früheren Selbst.
Mumien.
Sechs Mumienkrieger des Imperiums, mit ausgetrockneten, eingefallenen Gesichtern, so dass sie alle einander ähnelten wie Zwillingsbrüder. Merkmale, die sie einmal unterschieden hatten, waren verschwunden. Ihre Mienen waren die von Totenschädeln, bespannt mit grauer Haut.
Alle sechs trugen dunkles Rüstzeug, das im Mondlicht ab und an metallisch aufblitzte. Jeder hielt ein Schwert, wie Serafin noch keines gesehen hatte: Die langen Klingen waren gebogen, beinahe halbmondförmig, aber die Schneide befand sich – anders als bei einem Krummsäbel – an der Innenseite der Biegung, was zu einer völlig anderen Handhabung führte. Ägyptische Sichelschwerter, die gefürchteten Klingen der imperialen Mumienkrieger.
In den seltsamen Fahrzeugen im Wasser musste Platz für je zwei von ihnen gewesen sein. Hintereinander hatten sie darin gelegen wie in einem hohlen Baum, unfähig, sich zu bewegen. Aber Mumien, vermutete Serafin, müssen sich wohl kaum kratzen; sie würden sich dabei nur die ausgedorrte Haut von den Knochen schaben.