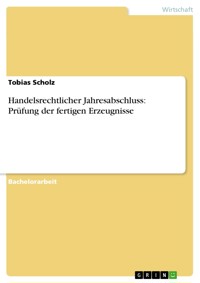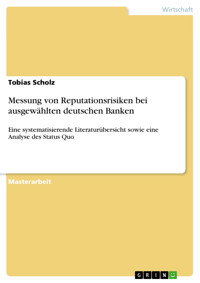
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Ruhr-Universität Bochum (Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Triebkräfte der Globalisierung und einem veränderten Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf das moralisch korrekte Verhalten von Unternehmen steht die Unternehmensreputation seit einiger Zeit im Fokus wie selten zuvor. Nicht zuletzt der Abgasskandal um Volkswagen offenbarte die gravierenden Folgen, die falsches Handeln für die Reputation haben kann. Wie sich die öffentliche Wahrnehmung von VW genau geändert hat und welche finanziellen Konsequenzen das Unternehmen in Zukunft erleiden wird, scheint, sofern keine Reputationsmessverfahren vorhanden sind, ungewiss. Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei zentrale Forschungsziele. Einerseits soll ein Verständnis für den Begriff Reputation, die in der Literatur vorhandenen Messverfahren und die damit verbundenen Schwierigkeiten gegeben werden. Andererseits soll der Status Quo der Reputationsmessung in der Unternehmenspraxis empirisch untersucht werden. Die geschieht anhand der 22 von der EZB beaufsichtigten Banken in Deutschland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
2. Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Unternehmensreputation
2.1.1 Definitionen
2.1.2 Unternehmensreputation als Erfolgsfaktor
2.2 Messverfahren
2.2.1 Qualitative Messverfahren
2.2.2 Quantitative Messverfahren
2.2.3 Zwischenfazit
3. Empirische Untersuchung: Status Quo – Reputationsmessung bei ausgewählten deutschen Banken
3.1 Analyse der Geschäftsberichte
3.1.1 Forschungsdesign
3.1.2 Ergebnisse und Hypothesenbildung
3.2 Analyse mittels Interview
3.2.1 Forschungsdesign
3.2.2 Ergebnisse
3.3 Diskussion
4. Zusammenfassung und Fazit
Anhang
A Statements Geschäftsberichte
B Interview Transkript
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Eigene Darstellung reflektiver und formativer Messmodelle nach Klode (2013).
Abbildung 2: RepTrak® Modell, aus: Reputation Institute online (2016).
Abbildung 3: RepTrak® Modell inkl. „Supportive Behaviors“ aus: 2016 Global RepTrak®100 Studie (2016).
1. Einleitung
“The top priority – trumping everything else, including profits – is that all of us continue to zealously guard Berkshire's reputation. We can't be perfect but we can try to be. As I've said in these memos for more than 25 years: ‘We can afford to lose money – even a lot of money. But we can't afford to lose reputation – even a shred of reputation.’”[1]
Star-Investor Warren Buffett betont die Wichtigkeit der Unternehmensreputation nach eigener Aussage bereits seit mehr als 25 Jahren.
Durch die Triebkräfte der Globalisierung und einem veränderten Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf das moralisch korrekte Verhalten von Unternehmen steht die Unternehmensreputation seit einiger Zeit im Fokus wie selten zuvor. Nicht zuletzt der Abgasskandal um Volkswagen offenbarte die gravierenden Folgen, die falsches Handeln für die Reputation haben kann. Wie sich die öffentliche Wahrnehmung von VW genau geändert hat und welche finanziellen Konsequenzen das Unternehmen in Zukunft erleiden wird, scheint, sofern keine Reputationsmessverfahren vorhanden sind, ungewiss.
1.1 Problemstellung
Der Leitsatz: „If you can't measure it, you can't manage it“[2] verdeutlicht zugleich die Schwierigkeit als auch den Stellenwert, die der Messung von Reputationsrisiken im Rahmen eines ganzheitlichen Reputationsmanagements zukommen. Die Unternehmensreputation ist ein abstraktes Wahrnehmungskonstrukt, das nicht direkt greifbar ist, sondern erst über Modelle indirekt erfasst werden kann. Diese Modelle bringen jedoch auch einige generelle Messprobleme mit sich, die in dieser Arbeit diskutiert werden und dazu führen, dass sie in der Unternehmenspraxis nicht einwandfrei angewandt werden können.
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei zentrale Forschungsziele.
Einerseits soll ein Verständnis für den Begriff Reputation, die in der Literatur vorhandenen Messverfahren und die damit verbundenen Schwierigkeiten gegeben werden. Andererseits soll der Status Quo der Reputationsmessung in der Unternehmenspraxis empirisch untersucht werden. Die geschieht anhand der 22 von der EZB beaufsichtigten Banken in Deutschland.
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Nachdem der Begriff Reputation definitorisch abgegrenzt wurde, erfolgt eine Darstellung der anerkanntesten Reputationsmessverfahren. Eine Einteilung erfolgt in qualitative und quantitative Verfahren. Die wichtigsten werden zudem kritisch gewürdigt. Anschließend soll, aufbauend auf dem Theorieteil, der Status Quo der Reputationsmessung bei den 22 von der EZB beaufsichtigten Banken in Deutschland analysiert werden. Hierzu werden zu Beginn die Geschäftsberichte der entsprechenden Institute durchleuchtet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Hypothesen extrahiert, die anschließend mithilfe eines Interviews überprüft werden. Die Ergebnisse werden schlussendlich sowohl diskutiert als auch strukturiert zusammengefasst.
2. Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Unternehmensreputation
Im Folgenden werden die Begriffe Reputation, Unternehmensreputation, Image und Reputationsrisiko definiert bzw. voneinander abgegrenzt. Eine definitorische Abgrenzung ist als Grundstein für ein tieferes Verständnis in Bezug auf die Messung von Reputationsrisiken unabdingbar. Die Notwendigkeit einer definitorischen Einordnung wird sich auch im Empirie-Teil der Arbeit als erforderlich herausstellen. Darüber hinaus wird der Einfluss, den die Ressource Reputation auf verschiedene Stakeholder ausüben kann, anhand ausgewählter Studien belegt.
2.1.1 Definitionen
Reputation
In der Literatur existiert keine allgemeingültige Definition für den Begriff Reputation. Der Duden beschreibt Reputation kurz als „[guten]Ruf“[3] und nennt Synonyme wie Achtung, Anerkennung, hohes Ansehen oder auch Wertschätzung.[4] Im Gabler Wirtschaftslexikon stellt sich Reputation dar als „das auf Erfahrungen gestützte Ansehen und ggf. auch Vertrauen, das ein Individuum oder eine Organisation bei anderen Akteuren hat. Reputation spielt eine wesentliche Rolle bei der Einschätzung künftiger Verhaltensweisen von A als potenziellem Interaktionspartner von B, v. a. in solchen Situationen, die vertraglich nur unvollständig bzw. gar nicht erfasst werden (können), vgl. Agency-Theorie. Reputation stellt heute ein Äquivalent für die traditionellen Begriffe Ehre oder Tugend dar.“[5]
Unternehmensreputation
Spezifisch auf Unternehmen bezogen, definieren Fombrun und Wiedemann (2001) Reputation wie folgt: „Unternehmensreputation läßt [sic] sich zunächst etwa als die Summe der Wahrnehmungen aller relevanter [sic] Stakeholder hinsichtlich der Leistungen, Produkte, Services, Organisation etc. eines Unternehmens und der sich hieraus jeweils ergebenden Achtung vor diesem Unternehmen interpretieren.“[6] Wie in vielen weiteren Definitionen in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird hier der stakeholderorientierte Charakter der Reputation deutlich. Schwaiger (2004) gibt zusätzlich zu bedenken, dass sich die Reputation niemals nur aus dem objektiven Wissen eines Stakeholders über ein Unternehmen zusammensetzt, sondern auch immer eine subjektive, emotionale Komponente eine Rolle spielt.[7] Im Reputationsportfolio von Schwaiger (siehe 2.2.2.5) wird diese Definition erneut aufgegriffen.
Reputation und Image
Zwei Begriffe, die häufig fälschlicherweise als Synonyme gebraucht werden, sind Reputation und Image. Das Image eines Unternehmens stellt sich, im Gegensatz zu der oben beschriebenen Reputation, nicht als wahrgenommenes Ansehen, sondern als Selbstverständnis und Identität eines Unternehmens dar. Es beinhaltet beispielsweise Attribute wie Tradition, Kultur und den Markennamen. Die Reputation kann somit als öffentliche Rückmeldung auf ein vorhandenes oder angestrebtes Image angesehen werden.[8] Das Gabler Wirtschaftslexikon beschreibt Image als ein „Konzept aus der Markt- und Werbepsychologie, das als die Quintessenz der Einstellungen verstanden werden kann, die Konsumenten einem Produkt, einer Dienstleistung oder einer Idee entgegenbringen.“[9] Das Unternehmensimage wird häufig mit dem Unternehmenslogo verbunden, wohingegen die Reputation mit Unternehmenseigenschaften, Vertrauen oder Glaubwürdigkeit gleichgesetzt wird. Ein weiterer Unterschied ist, dass das Image schnell mit Kommunikationsmaßnahmen verbessert werden kann, wohingegen eine gute Reputation ein langfristig angelegtes Konstrukt ist, das häufig auf jahrelanges Handeln zurückzuführen ist.[10]
Reputationsrisiko
Das „Reputationsrisiko kann als das Risiko eines unerwarteten Verlusts aufgrund von Reaktionen von Stakeholdern durch veränderte Wahrnehmung des Unternehmens definiert werden.“[11] Reputationsrisiken werden in einem Großteil der einschlägigen Literatur als Folgerisiken bzw. nachgelagerte Risiken klassifiziert, also als Risikoart, die wiederum aus anderen Risiken entsteht. Hier lassen sich vor allem operationelle Risiken nennen. Es sollte jedoch nicht vernachlässigt werden, dass Reputationsrisiken auch als originäre Risiken oder sogar als Ursache von weiteren Risikoarten auftreten können.[12] Hier lassen sich zum Beispiel unbedachte Äußerungen oder Gesten von Führungskräften aufführen. Diese unterschiedlichen Klassifizierungen werden in 3.1.2 und 3.2.2 erneut Gegenstand der Betrachtung.
2.1.2 Unternehmensreputation als Erfolgsfaktor