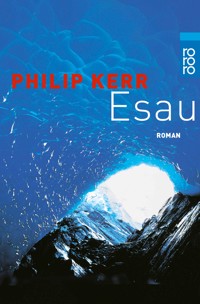9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt im Rausch zwischen Dunkelheit und Dekadenz Das Prequel und der 14. Fall der Bernie-Gunther-Serie von Bestseller-Autor Philipp Kerr. Berlin, 1928. Der junge Polizist Bernie Gunther wird von der Mordkommission engagiert. Innerhalb von vier Wochen sind vier Prostituierte in derselben Nachbarschaft massakriert worden. Gunther hat kaum Zeit, sich mit seinem ersten Fall vertraut zu machen, da wird die nächste Leiche gefunden – wieder eine Frau, erschlagen und skalpiert. Während diese Morde die Bevölkerung eher gleichgültig lassen, ist der Vater des letzten Opfers, ein sehr einflussreicher Anführer der Berliner Unterwelt, bereit, alles zu tun, um sich an dem Mörder zu rächen. Dann beginnt eine zweite Mordserie – an versehrten Kriegsveteranen, die auf den Straßen betteln. Vieles deutet auf ein und denselben Täter hin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Philip Kerr
Metropolis
Roman
Über dieses Buch
Eine Stadt im Rausch, aber das Böse ruht nicht
Berlin, 1928. Der junge Polizist Bernie Gunther wird von der Mordkommission engagiert. Innerhalb von vier Wochen sind vier Prostituierte in derselben Nachbarschaft massakriert worden. Gunther hat kaum Zeit, sich mit seinem ersten Fall vertraut zu machen, da wird die nächste Leiche gefunden – wieder eine Frau, erschlagen und skalpiert. Während diese Morde die Bevölkerung eher gleichgültig lassen, ist der Vater des letzten Opfers, ein sehr einflussreicher Anführer der Berliner Unterwelt, bereit alles zu tun, um sich an dem Mörder zu rächen. Dann beginnt eine zweite Mordserie – an versehrten Kriegsveteranen, die auf den Straßen betteln. Vieles deutet auf ein- und denselben Täter hin. Im Hintergrund wird die Stimme des Nationalsozialismus zu einem Dröhnen, das alle anderen zu übertönen droht. Aber nicht Bernie Gunther …
«Wieder einmal führt uns Kerr durch die Tatsachen der Geschichte und die Launen der menschlichen Natur. Sein Bernie Gunther glaubt, alles gesehen zu haben. Aber das hat er nicht, und wir haben es zum Glück auch nicht.» Tom Hanks
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich als Übersetzerteam. Zu den von ihnen übersetzten Autor:innen zählen Michael Crichton, Zadie Smith, Scott Turow, Dave Eggers und Tana French. 2012 wurden sie mit dem Albatros-Literaturpreis ausgezeichnet. Sie leben in Düsseldorf.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Metropolis» bei Quercus, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Metropolis» Copyright © 2019 by Thynker, Ltd.
Redaktion Elisabeth Mahler
Abbildungen auf Seite 10/11, 18, 142, 264: «Großstadt» (Triptychon), Gemälde von Otto Dix, 1927/28, Stuttgart, Kunstmuseum (akg-images/© VG Bild-Kunst, Bonn 2021)
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung General Photographic Agency/Getty Images; Yolande de Kort/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-20075-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. Zum Glück (für mich) entschied er sich, seine wunderbaren Romane woanders spielen zu lassen, obwohl er irgendwann eine frivole Kurzgeschichte über die Stadt schrieb. Die Geschichte hat den Titel «The Unnatural History Museum». Darüber und über Philips ambivalente Gefühle gegenüber seinem Geburtsort unterhielten wir uns an einem Abend im September 2015. Wir waren gemeinsam zurück nach Edinburgh gefahren, nachdem wir das Krimi-Festival «Bloody Scotland» in Stirling besucht hatten. Dort hatte mein Bühneninterview mit dem Schöpfer der Kultfigur Bernie Gunther das Abschlussevent gebildet.
Es machte großen Spaß, mit Philip zu plaudern, denn er verstand es, Klatsch und Tratsch mit tieferen Einblicken in politische Themen (zeitgenössische und historische) zu verbinden. Zu der Zeit schrieb er Thriller, die in der Welt des Fußballs spielten, und er erzählte mit fast kindlicher Begeisterung davon, dass die Bücher ihm international neue Fans einbrachten und ihm diese Arbeit einen Blick hinter die Kulissen der bekanntesten Fußballklubs gewährte.
Als wir auf seine in Edinburgh angesiedelte Kurzgeschichte zu sprechen kamen, wurde uns beiden klar, dass seine Bernie-Gunther-Bücher ein weiteres Beispiel für ein «Unnatural History Museum» darstellten, dokumentieren sie doch den Aufstieg des Faschismus im Deutschland der 1930er Jahre und die langen, oftmals grauenvollen Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. Philip hatte die Reihe 1989 mit Feuer in Berlin. Ein Fall für Bernhard Gunther begonnen. Ich hatte damals in London gelebt und zwei Jahre zuvor meinen ersten Kriminalroman veröffentlicht – der weder Anerkennung noch Käufer gefunden hatte. Ich versprach mir mehr Glück von Spionageromanen und spielte mit dem Gedanken, einen Hightech-Thriller zu schreiben. Egal was, Hauptsache, es bewahrte mich davor, weiter hauptberuflich als Zeitschriftenjournalist arbeiten zu müssen. Während ich also schriftstellerisch herumkrebste, ging Philips Erfolg durch die Decke. Seine ersten drei Bernie-Gunther-Bücher wurden nicht nur von der Kritik gefeiert, sondern waren auch eine Offenbarung für mich. Er schrieb ungemein flüssig und selbstsicher und präsentierte dem Leser einen voll ausgereiften Bernie in Geschichten, die detailreich und gründlich recherchiert sind und gleichzeitig einen genialen Plot haben. Der Protagonist ist ein Ermittler à la Chandler und Hammett, doch sein Schöpfer haucht dem überkommenen literarischen Topos neues Leben ein, indem er als Schauplatz Deutschland vor und im Krieg wählt. Wir waren damals ein kleiner Haufen recht junger, überwiegend in London ansässiger Autoren, die allesamt ihre ersten Gehversuche im Krimi- und Thriller-Genre wagten, und wir trafen uns regelmäßig in Bars in der Umgebung von Soho und Oxford Street, um uns zu betrinken und die Welt zu verbessern. Wir nannten uns Fresh Blood und druckten Flugblätter und Lesezeichen, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir wollten den klassischen Kriminalroman spannungsgeladener, radikaler und «realer» machen. Philip Kerr war ebenso mit von der Partie wie Michael Dibdin. Ich hatte beide gelesen und wusste, dass ich wesentlich besser werden musste oder es gleich bleiben lassen sollte. Es wäre sinnlos gewesen, mit dem historischen Hintergrundwissen des einen und dem Stilgefühl des anderen konkurrieren zu wollen. Aber ich machte mich an die Arbeit, entschlossen, es wenigstens zu versuchen.
Ich glaube kaum, dass ich das damals einem von ihnen erzählt habe, doch an jenem Abend, während wir in einem nahezu leeren Hotelrestaurant in Edinburgh beim Abendessen saßen, erwähnte ich es Philip gegenüber, daran erinnere ich mich genau. Nachdem die ersten drei Bernie-Gunther-Romane zusammen in einer Taschenbuch-Sonderausgabe erschienen waren, hatte Philip begonnen, an einem ungewöhnlichen Zukunfts-Roman-noir (Das Wittgensteinprogramm) und Hightech-Thrillern zu arbeiten. Später sollten eigenständige Titel wie seine Fußballkrimis und eine Reihe von Abenteuerbüchern für Kinder folgen. Alles, was er schrieb, war von Erfolg gekrönt, und doch kehrte er immer wieder zu seiner ersten Schöpfung zurück, zu Bernie Gunther.
Wir Leserinnen und Leser sahen zu, wie Bernie das Deutschland der Kriegsjahre überlebte, häufig, indem er für hochrangige Nazis Fälle übernahm. Auch Einblicke in sein Leben nach dem Krieg wurden uns gewährt. Und jetzt, in Metropolis, werden wir tiefer in die Vergangenheit zurückgeführt. Wir schreiben das Jahr 1928, und Bernie ist ein frischgebackener Ermittler bei der Mordinspektion. Ein Serienmörder, der Prostituierte nach vollbrachter Tat skalpiert, treibt in Berlin sein Unwesen. Außerdem hat es ein weiterer Mörder anscheinend auf die kriegsversehrten Veteranen der Stadt abgesehen. Bernie Gunther kann die Finger nicht vom Alkohol lassen, schafft es aber dennoch irgendwie, seinem Beruf nachzugehen. Er bleibt ein angenehmer Erzähler und scharfsinniger Polizist. Nachdem er als Soldat im Ersten Weltkrieg Grauenvolles erlebt hat, ist er fest entschlossen, den Veteranenmörder zu stoppen, während er gleichzeitig alles daran setzt, auch den anderen Täter zu fassen.
Das alles spielt in einem wunderbar beschriebenen Berlin mit seinen lasterhaften Nachtlokalen und zügellosen Sitten, wo die Reichen ausschweifend feiern und die Mittellosen auf den Straßen betteln. Die Dreigroschenoper von Brecht und Weill steht kurz vor der Premiere, und Bernie genießt einige erbauliche Begegnungen mit der Maskenbildnerin des Stücks. Er führt außerdem ein langes und aufschlussreiches Gespräch mit dem «entarteten» Künstler George Grosz (eines jener Details, die ich an Philip Kerrs Werken so liebe, verrät uns, dass Grosz gern in Cowboykleidung durch die Straßen lief). In einer Szene sitzt Bernie unfreiwillig Modell für einen anderen berühmten Künstler, Otto Dix, und selbst Fritz Lang taucht auf, wenn auch nur indirekt (Bernie lernt dessen Frau kennen, die Autorin und Drehbuchautorin Thea von Harbou). Langs Film M klingt im Buch immer wieder an, während sein früherer Stummfilm Metropolis (Drehbuch von Thea von Harbou) dem Roman seinen Titel gibt.
Doch es ist George Grosz, der zu Bernie sagt, dass das Berlin von 1928 eine «Höllenmetropole» sei, und dem lässt sich wohl kaum widersprechen. Der Nationalsozialismus ist auf dem Vormarsch, und Hitlers Name liegt in der Luft (auch wenn Bernie den Mann selbst noch nicht zu sehen bekommt). Juden werden zwar noch nicht systematisch vom Staat verfolgt, aber von Teilen der Bevölkerung offen beschimpft, und sie müssen stets auf der Hut sein. Populismus ist allgegenwärtig, so scheint es, und Philip Kerr sorgt dafür, dass Parallelen zur heutigen Zeit nicht zu übersehen sind.
Inmitten all dessen steht der Polizist Bernie Gunther, ein unerschütterlicher Überlebenskünstler. Er ist nie ganz apolitisch oder völlig amoralisch. Trotz der grotesken Realität um ihn herum schafft er es, einer jener von Raymond Chandler so geliebten «glanzlosen Ritter» zu sein, und wie Chandlers berühmteste Schöpfung Philip Marlowe schüttelt er stets einen trockenen Spruch aus dem Ärmel. Besonders köstlich finde ich seine Bemerkung zu einem Kollegen: «Sie sind so eiskalt, dass man auf Ihnen Schlittschuh laufen könnte.»
Philip Kerr zu lesen ist immer ein ganz besonderes Vergnügen, aber diesmal ist die Lektüre auch bittersüß. Als wir an jenem Abend im September 2015 zusammensaßen, ahnte ich nicht, dass er nur noch zweieinhalb Jahre leben würde. Er starb im März 2018 im Alter von zweiundsechzig Jahren. Wir hatten keine weitere Gelegenheit mehr zu einem gemeinsamen Essen, aber wir blieben in E-Mail-Kontakt. Er sprühte vor Energie und vor Ideen für neue Vorhaben. Er meinte, wir sollten zusammen ein Filmprojekt planen, und wir wollten uns auf jeden Fall wieder für weitere gemeinsame Bühnenauftritte auf Literaturfestivals engagieren lassen. Auf einem der Bühnenfotos, die während des Festivals «Bloody Scotland» von uns entstanden, ist zu sehen, wie wir uns vor Lachen biegen – an den Grund kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber sein Augenzwinkern war immer da, ließ seine scharfe Intelligenz durchscheinen, eine Intelligenz, die so viele wunderbare, tiefgründige Romane hervorbrachte, Romane, die ebenso von Humor und Menschlichkeit durchdrungen sind wie von einer existenziellen Angst und dem lähmenden Gefühl, dass sich Geschichte selbst in ihren schlimmsten Ausprägungen sehr häufig wiederholt. Wir alle leben noch immer in einem «Unnatural History Museum». Ich bin unendlich dankbar, dass Philip Kerr für viele von uns der kenntnisreiche Fremdenführer durch dessen dunkle labyrinthische Räume und Korridore war.
Ian Rankin, 2019
Für Jane
Jetzt und für immer
Prolog
Wie für jeden, der die Bibel gelesen hat, war Babylon für mich der Inbegriff einer Stadt der Verderbtheit und aller nur denkbaren Abgründe auf der Welt. Und wie jedem, der während der Weimarer Republik in Berlin lebte, war mir ebenfalls der Vergleich bekannt, der häufig zwischen den beiden Städten gezogen wurde. In der lutherischen Nikolaikirche Berlins, in die ich als kleiner Junge mit meinen Eltern ging, schien unser rotgesichtiger lauter Pastor Dr. Rotpfad so vertraut mit Babylon und dessen Topographie zu sein, dass ich glaubte, er müsse mal dort gelebt haben. Was meine Faszination für den Ort nur befeuerte und mich veranlasste, den Begriff im Konversationslexikon nachzuschlagen, das bei uns zu Hause im Bücherschrank ein ganzes Regalbrett füllte. Aber das Lexikon war nicht sonderlich aufschlussreich, was die Abgründe betraf. Und obwohl es in Berlin an Huren und liederlichen Frauen und Sünden wahrhaftig nicht mangelte, glaube ich kaum, das die Stadt schlimmer war als irgendeine andere Metropole wie beispielsweise London, New York oder Schanghai.
Bernhard Weiß sagte mir, der Vergleich sei schon immer blanker Unsinn gewesen, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Er glaubte nicht an das Böse und wies mich darauf hin, dass es gegen das Böse nirgendwo Gesetze gab, nicht mal in England, wo es gegen nahezu alles Gesetze gab. Im Mai 1928 war das berühmte Ischtartor, das nördliche Stadttor Babylons, im Berliner Pergamonmuseum noch nicht rekonstruiert worden, weshalb der Ruf der preußischen Hauptstadt als der sündhafteste Ort der Welt von den städtischen Moralwächtern noch deutlich betont werden musste, was bedeutete, dass es durchaus noch Anlass für Zweifel gab. Vielleicht waren wir einfach ehrlicher, was unsere Verderbtheit anging, und toleranter gegenüber den Lastern anderer Menschen. Und ich sollte das wissen, denn 1928 war ich im Sittendezernat des Polizeipräsidiums am Berliner Alexanderplatz beruflich mit der Lasterhaftigkeit in all ihren endlosen Abwandlungen betraut. Als Kriminalist – dank Weiß ein neues Wort für uns Polizisten – verstand ich vom Thema Lasterhaftigkeit fast genauso viel wie Gilles de Rais. Aber nach dem Ersten Weltkrieg mit den unzähligen Toten und der gleich darauf folgenden Grippe, die wie eine alttestamentarische Plage Millionen von Opfer gefordert hatte, schien es nicht mehr so wichtig, was Leute sich in die Nase zogen oder was sie so trieben, wenn sie sich in ihren dunklen Biedermeierschlafzimmern entkleideten. Und nicht nur in ihren Schlafzimmern. In Sommernächten ging es im Tiergarten manchmal zu wie in einem Freiluftbordell, so viele Huren kopulierten mit ihren Freiern im Gras. Ich schätze, es ist eigentlich kein Wunder, dass die Deutschen nach einem Krieg, in dem so viele von ihnen gezwungen waren, für ihr Vaterland zu töten, jetzt lieber vögelten.
Nach allem, was davor geschehen war, und allem, was danach kam, ist es schwierig, richtig und angemessen über Berlin zu sprechen. In vielerlei Hinsicht war es nie ein angenehmer Ort, und mitunter war es ein grotesker, hässlicher Ort. Im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß, zu dreckig, zu verqualmt, zu übelriechend, zu laut und natürlich furchtbar übervölkert, wie Babel, was ein anderer Name für Babylon ist. Sämtliche öffentlichen Gebäude der Stadt waren zum Ruhme eines deutschen Reiches errichtet worden, das kaum je existiert hatte, und genau wie die schlimmsten Elendsviertel und Mietskasernen der Stadt gaben sie praktisch jedem, der sie sah, das Gefühl, entmenscht und unbedeutend zu sein. Nicht dass sich je einer groß Gedanken machte über die Bewohner Berlins (seine Herrscher ganz bestimmt nicht), denn sie waren nicht besonders umgänglich oder freundlich oder kultiviert – viele von ihnen waren dumm, träge, stumpfsinnig und unglaublich vulgär; und alle waren sie grausam und aggressiv. Brutale Morde waren an der Tagesordnung. Meistens waren die Täter betrunkene Männer, die aus der Kneipe nach Hause kamen und ihre Frauen erwürgten, weil sie im Bier- und Schnapsrausch nicht mehr wussten, was sie taten. Aber dann gab es auch noch Typen wie Fritz Haarmann oder Karl Denke, diese absonderlichen, gottlosen Deutschen, die anscheinend aus reiner Lust am Töten mordeten. Selbst das war irgendwie nicht mehr überraschend. Im Deutschland der Weimarer Republik herrschte mitunter eine Gleichgültigkeit gegenüber plötzlichen Todesfällen und menschlichem Leid, die auch ein zwangsläufiges Vermächtnis des Ersten Weltkriegs war. Mit unseren zwei Millionen Toten hatten wir so viele Opfer zu beklagen wie Großbritannien und Frankreich zusammen. In manchen Felder in Flandern liegen die Knochen so vieler unserer jungen Männer begraben, dass sie deutscher sind als Unter den Linden. Und noch heute, zehn Jahre nach dem Krieg, sieht man überall in der Stadt Verstümmelte und Lahme, viele von ihnen noch in Uniform, die vor Bahnhöfen und Banken um ein bisschen Kleingeld betteln. Es kommt eher selten vor, dass einen die Plätze und Straßen Berlins nicht an ein Gemälde von Pieter Brueghel erinnern.
Doch trotz allem war Berlin auch ein wunderbarer, inspirierender Ort. Ungeachtet der zuvor genannten Gründe, die Stadt nicht zu mögen, war sie ein großer strahlender Spiegel der Welt und somit für alle, die in dieser Welt leben wollten, ein großartiges Abbild des menschlichen Lebens in seiner ganzen phantastischen Vielfalt. Ich hätte selbst gegen Bezahlung nirgendwo anders als in Berlin leben wollen, gerade jetzt, da Deutschland das Schlimmste überstanden hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Grippe und der Inflation ging es wieder aufwärts, wenn auch nur langsam. Für viele Menschen, vor allem im Osten der Stadt, war das Leben nach wie vor hart. Trotzdem war es nur schwer vorstellbar, dass Berlin je das gleiche Schicksal ereilen würde wie Babylon, das laut dem Konversationslexikon von den Chaldäern zerstört wurde, die seine Mauern, Tempel und Paläste dem Erdboden gleichmachten und den Schutt ins Meer warfen. So etwas würde uns nie widerfahren. Was auch immer als Nächstes kam, eine biblische Zerstörung drohte uns gewiss nicht. Es lag in niemandes Interesse – nicht in dem der Franzosen oder Briten und schon gar nicht in dem der Russen –, Berlin und damit Deutschland zum Ziel einer göttlichen apokalyptischen Rache werden zu lassen.
Teil einsFrauen
Überall das Mysterium der Leiche.
Max Beckmann, Self-Portrait in Words
Fünf Tage nach der Reichstagswahl ließ mich Bernhard Weiß, der Chef der Berliner Kriminalpolizei, zu einer Besprechung in sein Büro im sechsten Stock am Alex kommen. Umwabert vom Qualm seiner Lieblingszigarrenmarke Schwarze Weisheit saß er neben Ernst Gennat, einem seiner besten Polizisten bei der Mordinspektion, am Konferenztisch und forderte mich auf, Platz zu nehmen. Der gebürtige Berliner Weiß war achtundvierzig Jahre alt, klein, schlank und adrett, promovierter Akademiker, mit einer runden Brille und einem akkurat gestutzten Schnurrbart. Er war außerdem Jurist und Jude, was ihn bei vielen unserer Kollegen unbeliebt machte, und er hatte allerhand Vorurteile überwinden müssen, um dahin zu kommen, wo er war: In Friedenszeiten war es Juden untersagt gewesen, Offizier in der preußischen Armee zu werden, doch als der Krieg ausbrach, trat Weiß der Königlich Bayrischen Armee bei, wo er rasch zum Rittmeister aufstieg und das Eiserne Kreuz verliehen bekam. Nach dem Krieg hatte er auf Wunsch des preußischen Innenministeriums die Berliner Polizei reformiert und sie zu einer der modernsten Strafverfolgungsbehörden in Europa gemacht. Dennoch gab er zugegebenermaßen rein äußerlich einen ungewöhnlichen Polizisten ab. Er erinnerte mich immer ein wenig an Toulouse-Lautrec.
Vor ihm lag eine aufgeschlagene Akte, bei der es sich offensichtlich um meine handelte.
«Sie leisten gute Arbeit bei der Sitte», sagte er mit seiner sonoren, fast schauspielerhaften Stimme. «Obwohl ich fürchte, dass Sie einen aussichtslosen Kampf gegen die Prostitution in dieser Stadt führen. Die vielen Kriegerwitwen und russischen Flüchtlinge schlagen sich nun mal durch, so gut sie können. Ich sage unseren Politikern ständig, dass wir das Problem mit der Prostitution in Berlin über Nacht lösen könnten, wenn wir uns stärker für gleiche Bezahlung für Frauen einsetzen würden. Aber deshalb habe ich Sie nicht hergebeten. Ich nehme an, Sie haben es schon gehört: Heinrich Lindner hat die Polizei verlassen, um am Flughafen Tempelhof für den Sicherheitsdienst zu arbeiten, wodurch ein Platz im Mordauto frei geworden ist.»
«Ich hab’s gehört.»
«Wissen Sie, warum er gekündigt hat?»
Ich wusste es, wollte es aber lieber nicht sagen und verzog stattdessen das Gesicht.
«Sagen Sie es ruhig. Ich werde nicht im Geringsten gekränkt sein.»
«Offenbar wollte er sich von einem Juden keine Anweisungen erteilen lassen.»
«Richtig, Gunther. Er wollte sich von einem Juden keine Anweisungen erteilen lassen.» Weiß zog an seiner Zigarre. «Was ist mit Ihnen? Haben Sie ein Problem damit, sich von einem Juden Anweisungen erteilen zu lassen?»
«Nein, Herr Weiß.»
«Oder sich generell Anweisungen erteilen zu lassen?»
«Nein. Ich habe kein Problem mit Autoritätspersonen.»
«Freut mich zu hören. Wir überlegen nämlich, Ihnen dauerhaft einen Platz im Mordauto anzubieten. Lindners Platz.»
«Mir?»
«Sie klingen überrascht.»
«Weil am Alex gemunkelt wird, dass Inspektor Reichenbach den Platz bekommen soll.»
«Nur falls Sie ablehnen. Und selbst dann habe ich Bedenken, was den Mann betrifft. Natürlich wird man sagen, ich würde mich nicht trauen, den Platz einem weiteren Juden anzubieten. Aber das ist nicht der Grund. Unserer Meinung nach haben Sie das Zeug zu einem ausgezeichneten Kripobeamten, Gunther. Sie sind tüchtig, und Sie wissen, wann Sie besser den Mund halten. Das ist gut bei einem Kriminalisten. Sehr gut. Auch Kurt Reichenbach ist ein guter Kripobeamter, aber er lässt schon mal die Fäuste fliegen. Als er noch in Uniform war, haben ein paar von seinen Kollegen ihm den Spitznamen Siegfried verpasst, weil er so gern seinen Säbel geschwungen und einige unserer Kunden mit dem Griff oder der flachen Klinge geschlagen hat. Mir ist egal, was ein Beamter in Notwehr macht, aber ich dulde es nicht, wenn ein Polizist zum Vergnügen Leuten die Köpfe einschlägt. Egal, um wessen Kopf es sich handelt.»
«Und er hat auch nicht damit aufgehört, als er keinen Säbel mehr hatte», sagte Gennat. «Vor kurzem wurde gemunkelt, er habe einen SA-Mann verprügelt, den er in Lichtenrade festgenommen hatte, einen Nazi, der einen Kommunisten erstochen hat. Aber es gibt keine Beweise. Er mag ja am Alex beliebt sein – sogar ein paar Antisemiten scheinen ihn zu mögen –, aber er ist ein Hitzkopf.»
«Genau. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Polizist ist. Nur dass wir lieber Sie hätten.» Weiß senkte den Blick auf eine Seite in meiner Akte. «Wie ich sehe, haben Sie Abitur gemacht. Aber nicht studiert.»
«Der Krieg. Ich hab mich freiwillig gemeldet.»
«Natürlich. Also dann. Wollen Sie die Stelle? Falls ja, gehört sie Ihnen.»
«Ja. Sehr gern.»
«Sie haben ja schon einmal in einem Mordfall ermittelt, nicht wahr? Letztes Jahr. In Schöneberg, wenn ich nicht irre. Wie Sie wissen, ist es mir sehr recht, wenn meine Leute an der Seite eines Spitzenmannes wie Gennat hier Erfahrungen in einem Mordfall gesammelt haben.»
«Weshalb ich mich frage, warum Sie mich für den Posten in Betracht gezogen haben», sagte ich. «Dieser Fall, von dem Sie sprechen – der Frieda-Ahrendt-Fall –, ist ungelöst geblieben.»
«In vielen Fällen verlaufen Spuren im Sande», sagte Gennat. «Die ermittelnden Beamten treten einfach auf der Stelle. Vor allem hier in Berlin. Vergessen Sie das nie. Das liegt nun mal in der Natur unserer Arbeit. Neues Denken ist der Schlüssel, wenn man einen alten Fall lösen will. Ich habe übrigens einige andere Fälle, die Sie sich mal ansehen sollten, falls Sie je eine ruhige Minute haben. Mit der Aufklärung eines alten Falls kann sich ein Kripobeamter Ansehen verschaffen.»
«Frieda Ahrendt», sagte Weiß. «Helfen Sie mir auf die Sprünge.»
«Ein Hund fand im Grunewald Leichenteile, in Packpapier eingewickelt und vergraben», sagte ich. «Hans Schneickert und die Jungs von der Inspektion I konnten die Tote identifizieren. Und zwar weil der Mörder uns freundlicherweise ihre Hände hinterlassen hatte. Die Fingerabdrücke der Toten ergaben, dass sie wegen Bagatelldiebstahls vorbestraft war. Man sollte meinen, das hätte jede Menge Türen geöffnet. Aber wir haben keine Angehörigen, keine Arbeitsstelle, nicht einmal eine letzte gültige Adresse ausfindig machen können. Und weil eine Zeitung so blöd war, eine fürstliche Belohnung für Hinweise auszusetzen, haben wir viel Zeit damit vergeudet, Leute zu befragen, denen es eher darum ging, tausend Reichsmark zu kassieren, als der Polizei zu helfen. Mindestens vier Frauen sagten aus, ihr Ehemann sei der Täter. Eine von ihnen behauptete sogar, ihr Mann habe die Leichenteile kochen wollen. Daher der Beiname, den die Zeitung dem Mörder verpasste: der Grunewald-Schlächter.»
«So kann man seinen ungeliebten Gatten auch loswerden» sagte Gennat. «Ihm einen Mord in die Schuhe schieben. Billiger als Scheidung.»
Nach Bernhard Weiß war Ernst Gennat der ranghöchste Kriminalbeamte am Alex. Er war auch der dickste, was ihm den Spitznamen «Buddha» eingehandelt hatte. Es wurde richtig eng im Mordauto, wenn er mit an Bord war. Gennat selbst hatte das Fahrzeug entworfen. Es war ausgestattet mit einem Funkgerät, einem kleinen klappbaren Schreibtisch mit einer Schreibmaschine, einem Erste-Hilfe-Kasten, einer umfangreichen Fotoausrüstung und mit nahezu allem, was nötig war, um einen Mord zu untersuchen, außer einem Gebetbuch und einer Kristallkugel. Gennat hatte einen trockenen Berliner Humor, der, wie er sagte, daher rührte, dass er in den Personalunterkünften des Gefängnisses Plötzensee geboren und aufgewachsen war, als sein Vater dort stellvertretender Direktor war. Es ging sogar das Gerücht, Gennat habe an Hinrichtungstagen mit dem Henker gefrühstückt. In meiner Anfangszeit am Alex hatte ich mir vorgenommen, den Mann zu studieren und ihn mir zum Vorbild zu machen.
Das Telefon klingelte, und Weiß nahm den Hörer ab.
«Sie sind in der SPD, richtig, Gunther?», fragte Gennat.
«Das stimmt.»
«Wir können im Mordauto nämlich keine Politik gebrauchen. Kommunisten, Nazis, davon krieg ich zu Hause schon genug zu hören. Und Sie sind alleinstehend, nicht wahr?»
Ich nickte.
«Gut. Weil dieser Beruf eine Ehe zerstört. Sie gucken mich vielleicht an und denken durchaus zu Recht, dass ich bei den Damen sehr beliebt bin. Aber nur, bis ich einen Fall bekomme, der mich Tag und Nacht hier am Alex festhält. Ich muss mir eine nette Polizistin suchen, wenn ich je heiraten will. Und wo wohnen Sie?»
«Ich habe ein Zimmer in einer Pension am Nollendorfplatz.»
«Der neue Posten bedeutet ein bisschen mehr Geld, eine Beförderung und vielleicht ein besseres Zimmer. In dieser Reihenfolge. Und ihre Probezeit beträgt ein bis zwei Monate. Hat die Pension, in der Sie wohnen, Telefon?»
«Ja.»
«Nehmen Sie Drogen?»
«Nein.»
«Je welche ausprobiert?»
«Einmal ein bisschen Kokain. Wollte sehen, was die Leute daran finden. Ist nichts für mich. Könnte ich mir auch gar nicht leisten.»
«Ist auch nichts dabei», sagte Gennat. «Unser Land hat nach dem Krieg noch immer ein großes Bedürfnis, den Schmerz zu betäuben.»
«Viele Leute nehmen das Zeug aber nicht, um Schmerzen zu betäuben», sagte ich. «Und manchmal löst es eine ganze andere Krise aus.»
«Manche Leute glauben, die Berliner Polizei steckt in einer Krise», sagte Gennat. «Die glauben, die ganze Stadt steckt in einer Krise. Was glauben Sie, Gunther?»
«Je größer die Stadt, desto eher ist mit Krisen zu rechnen. Ich glaube, wir werden es immer mit irgendeiner Krise zu tun haben. Am besten gewöhnt man sich dran. Vor allem Unentschlossenheit verursacht Krisen. Regierungen, die nichts durchsetzen können. Ohne eine klare Mehrheit wird das bei der neuen wohl kaum anders. Zurzeit scheint unser größtes Problem die Demokratie selbst zu sein. Was nützt sie, wenn sie keine brauchbare Regierung zustande bringt? Das ist das Paradoxe an unserer Zeit, und manchmal fürchte ich, wir werden es satthaben, ehe es sich von selbst löst.»
Er nickte, stimmte mir offenbar zu und wechselte das Thema: «Einige Politiker sind nicht zufrieden mit unserer Aufklärungsrate. Was sagen Sie dazu, Gunther?»
«Die sollten mal herkommen und ein paar von unseren Kunden persönlich kennenlernen. Vielleicht hätten sie recht, wenn die Toten etwas redseliger wären.»
«Unsere Aufgabe ist es, sie trotzdem zu hören», sagte Gennat. Er wippte mit seiner Körpermasse einen Moment vor und zurück und stand dann auf. Es war, als würde man zusehen, wie sich ein Zeppelin in die Luft erhebt. Der Fußboden knarrte, als er zum Fenster des Eckturms ging. «Wenn Sie ganz genau hinhören, können Sie sie noch flüstern hören. Wie diese Winnetou-Morde. Ich stelle mir vor, seine Opfer reden mit uns, aber in einer Sprache, die wir einfach nicht verstehen.» Er deutete aus dem Fenster auf die Stadt. «Aber irgendjemand versteht sie. Jemand, der vielleicht gerade da unten aus dem Kaufhaus Tietz kommt. Vielleicht Winnetou selbst.»
Weiß beendete das Telefonat, und Gennat kam zurück zum Konferenztisch, wo er sich ebenfalls eine streng riechende Zigarre anzündete. Inzwischen hing eine breite Qualmwolke über dem Tisch. Sie erinnerte mich an Gas, das über Niemandsland treibt. Ich war zu nervös, um mir selbst eine Zigarette anzuzünden. Zu nervös und zu respektvoll gegenüber meinen Vorgesetzten. Ich hatte noch immer Ehrfurcht vor ihnen und war erstaunt, dass sie mich in ihr Team holen wollten.
«Das war unser Chef», sagte Weiß. Er meinte den Berliner Polizeipräsidenten Karl Zörgiebel. «Er sagt, das Glühlampenwerk Wolfmium in Stralau ist in die Luft geflogen. Nach ersten Berichten gibt es viele Todesopfer. Um die dreißig. Er hält uns auf dem Laufenden. Ich möchte Sie übrigens daran erinnern, dass wir vereinbart haben, nicht den Namen Winnetou zu benutzen, wenn wir über die Skalpier-Morde sprechen. Ich denke, solche reißerischen Bezeichnungen erweisen den armen toten Frauen keinen guten Dienst. Bleiben wir doch bitte beim Aktennamen, Ernst, in Ordnung? Schlesischer Bahnhof. Das ist sicherer.»
«Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor.»
«Also dann, willkommen bei der Mordinspektion, Gunther. Der Rest Ihres Lebens hat sich soeben für immer verändert. Sie werden andere Menschen nie wieder so sehen wie bisher. Von nun an werden Sie jeden Mann, neben dem Sie zufällig an einer Bushaltstelle oder im Zug stehen, dahingehend taxieren, ob er ein Mörder sein könnte. Und das ist auch richtig so. Der Statistik nach werden die meisten Morde in Berlin von normalen, gesetzestreuen Bürgern verübt. Kurzum von Leuten wie Sie und ich. Hab ich recht, Ernst?»
«Unbedingt. Mir ist selten ein Mörder untergekommen, der auch wie einer aussah.»
«Sie werden genauso schlimme Dinge sehen wie das, was sie im Krieg gesehen haben», fügte er hinzu. «Mit dem Unterschied, dass einige Opfer Frauen und Kinder sind. Aber wir müssen hart sein. Und Sie werden merken, dass wir dazu neigen, Witze zu machen, die andere nicht lustig finden.»
«Verstehe.»
«Was wissen Sie über die Mordserie Schlesischer Bahnhof, Gunther?»
«Vier Prostituierte wurden im Laufe von vier Wochen überfallen, drei von ihnen ermordet. Immer nachts. Die Erste unweit vom Schlesischen Bahnhof. Alle vier mit einem Hammer erschlagen und dann mit einem sehr scharfen Messer skalpiert. Wie von dem berühmten Indianer in den Karl-May-Büchern.»
«Die Sie hoffentlich gelesen haben.»
«Wer die nicht gelesen hat, kann wahrscheinlich gar nicht lesen.»
«Haben sie Ihnen gefallen?»
«Na ja, ist schon ein paar Jahre her – aber ja.»
«Gut. Ein Mann, der Karl May nicht mag, wäre mir unsympathisch. Was wissen Sie sonst noch? Über die Morde, meine ich.»
«Nicht viel.» Ich schüttelte den Kopf. «Wahrscheinlich kannte der Mörder die Opfer nicht, was es erschwert, ihn zu fassen. Gut möglich, dass er spontan zuschlägt.»
«Ja, ja», sagte Weiß, als hätte er das alles schon öfter gehört.
«Die Morde wirken sich offenbar auf die Anzahl von Straßenmädchen aus», sagte ich. «Es sind weniger Prostituierte unterwegs als sonst. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie hätten Angst, ihrer Arbeit nachzugehen.»
«Sonst noch was?»
«Nun ja …»
Weiß warf mir einen fragenden Blick zu. «Raus mit der Sprache, Mann. Egal, was Sie sagen wollen. Ich erwarte von meinen Leuten, dass sie offen reden.»
«Bloß dass die Strichmädchen einen anderen Namen für die Opfer haben. Weil sie skalpiert wurden. Nach dem Mord an der letzten Frau hörte ich, dass manche sie als Pixavon-Königin bezeichnen.» Ich zögerte. «Wie das Haarshampoo.»
«Ja, Pixavon ist mir durchaus ein Begriff. Wie es in der Werbung heißt, ein Shampoo, beliebt bei ‹guten Ehefrauen und Müttern›. Auf der Straße herrscht manchmal ziemlich schwarzer Humor. Sonst noch was?»
«Eigentlich nicht. Nur was in den Zeitungen steht. Meine Zimmerwirtin, Frau Weitendorf, verfolgt den Fall mit großem Interesse. Kein Wunder bei so einer Horrorgeschichte. Brutale Morde faszinieren sie. Wir müssen ihr alle notgedrungen zuhören, wenn sie uns das Frühstück serviert. Kein besonders appetitliches Thema, aber so ist es nun mal.»
«Interessant. Was hat sie denn über den Fall zu sagen?»
Ich stockte, stellte mir Frau Weitendorfs üblichen, vor nicht so ganz redlicher Empörung triefenden Redefluss vor, mit dem sie ihre Pensionsgäste beschallte, ohne sich großartig darum zu scheren, ob ihr überhaupt einer Aufmerksamkeit schenkte. Korpulent, mit schlecht sitzenden dritten Zähnen und zwei Bulldoggen, die ihr nicht von der Seite wichen, gehörte sie zu den Frauen, die gern redeten, ob mit oder ohne Zuhörerschaft. In dem langärmeligen gesteppten Morgenrock, den sie beim Frühstück trug, sah sie aus wie ein schmuddeliger chinesischer Kaiser – eine Wirkung, die durch ihr Doppelkinn noch verstärkt wurde. Außer mir gab es noch drei weitere Pensionsgäste: einen Engländer namens Robert Rankin, der behauptete, Schriftsteller zu sein; einen bayrischen Juden namens Fischer, der sich als Handelsreisender ausgab, aber vermutlich ein Betrüger war, und eine junge Frau namens Rosa Braun, die in einer Tanzkapelle Saxophon spielte, sich aber höchstwahrscheinlich nebenbei prostituierte. Zusammen mit Frau Weitendorf bildeten wir ein merkwürdiges Quintett, aber vielleicht einen perfekten Querschnitt des modernen Berlins.
«Frau Weitendorf würde in etwa Folgendes sagen: Für diese Frauen ist es ein Berufsrisiko, abgemurkst zu werden. Eigentlich haben sie das Schicksal doch herausgefordert. Und ist das Leben nicht schwer genug, ohne es unnötig aufs Spiel zu setzen? Das war nicht immer so. Berlin war mal eine anständige Stadt, vor dem Krieg. Aber nach 1914 war das Leben eines Menschen nicht mehr viel wert. Das war schon schlimm genug, aber dann kam 1923 die Inflation und machte unser Geld wertlos. Das Leben ist nicht mehr ganz so wichtig, wenn man alles verloren hat. Außerdem ist diese Stadt zu groß geworden, das sieht doch jeder. Vier Millionen Menschen leben dicht an dicht. Das ist ungesund. Manche hausen wie die Tiere. Vor allem östlich vom Alexanderplatz. Da dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sie sich wie Tiere verhalten. Es gibt keinen Anstand mehr. Und bei den vielen Polen und Juden und Russen, die seit der Revolution der Bolschewiken hier leben, ist es da ein Wunder, dass diese jungen Frauen umgebracht werden? Ich garantier Ihnen, es wird sich herausstellen, dass einer von denen die Frauen ermordet hat. Ein Jude. Oder ein Russe. Oder ein jüdischer Russe. Wenn Sie mich fragen, sind diese Leute nicht ohne Grund vom Zaren oder von den Bolschewiken aus Russland verjagt worden. Aber der wahre Grund, warum diese Frauen umgebracht werden, ist folgender: Die Männer, die aus den Schützengräben zurückgekommen sind, haben da die Lust am Töten gelernt. Wie Vampire, die Blut trinken müssen, um zu überleben, müssen diese Männer jemanden töten, egal wen. Ein Mann, der Soldat an der Front war und behauptet, er hätte seit seiner Heimkehr niemanden töten wollen, ist ein Lügner. Das ist wie mit dieser Jazzmusik, die die Neger in den Nachtklubs spielen. Das bringt ihr Blut in Wallung, wenn Sie mich fragen.»
«Diese Frau hört sich ja wirklich schrecklich an», sagte Weiß. «Mich wundert, dass Sie in der Pension frühstücken.»
«Ist im Zimmerpreis inbegriffen.»
«Verstehe. Und was sagt dieses furchtbare Weib, warum der Mörder die Frauen skalpiert?»
«Weil er Frauen hasst. Sie meint, während des Krieges sind die Frauen den Männern in den Rücken gefallen, weil sie deren Arbeit für die Hälfte des Geldes gemacht haben, und als die Männer zurückkamen, haben sie nur noch Arbeit gefunden, für die ein Hungerlohn gezahlt wird, oder gar keine, weil die Frauen weiter arbeiten. Deshalb bringt er sie um, und deshalb skalpiert er sie. Aus purem Hass.»
«Und was denken Sie? Warum skalpiert der Irre seine Opfer?»
«Ich denke, ich sollte mehr über die Fakten wissen, bevor ich Spekulationen anstelle.»
«Trotzdem würde ich gern Ihre Meinung hören. Aber so viel vorab: Bislang wurde keiner der Skalps gefunden. Wir vermuten daher, dass er sie behält. Er scheint keine Vorliebe für eine bestimmte Haarfarbe zu haben. Es wäre also naheliegend, dass er mordet, um an die Skalps zu kommen. Was die Frage aufwirft: Warum? Was hat er davon? Warum sollte ein Mann eine Prostituierte skalpieren?»
«Vielleicht hat er eine bizarre Perversion und möchte eine Frau sein», sagte ich. «Berlin ist voll von Transvestiten. Vielleicht ist unser Täter ein Mann, der die Haare braucht, um sich eine Perücke zu machen.» Ich schüttelte den Kopf. «Ich weiß, das klingt lächerlich.»
«Nicht lächerlicher als ein Fritz Haarmann, der die Organe seiner Opfer kocht und verspeist», sagte Gennat. «Oder ein Erich Kreuzberg, der auf den Gräbern der von ihm ermordeten Frauen masturbiert. Dabei haben wir ihn geschnappt.»
«Wenn Sie es so ausdrücken, muss ich Ihnen recht geben.»
«Wir haben unsere eigenen Theorien, warum der Täter seine Opfer skalpiert», sagte Weiß. «Oder zumindest hat Dr. Hirschfeld eine. Er berät uns in diesem Fall. Dennoch würde ich gern Ihre Meinung hören. Alles, was Ihnen dazu einfällt. Egal wie haarsträubend.»
«Es läuft auf simplen Frauenhass hinaus. Oder auf Sadismus. Den Wunsch, nicht nur zu vernichten, sondern auch zu demütigen und zu entwürdigen. In Berlin ist es sehr einfach, ein Mordopfer zu entwürdigen. Ich finde es schlicht unsäglich, dass die Stadt nach wie vor die Leichen von Mordopfern in der städtischen Leichenhalle öffentlich zur Schau stellt. Ein Mörder, der seine Opfer entwürdigen und demütigen will, kann das einfach der Stadt überlassen. Es wird Zeit, dass das aufhört.»
«Ich bin ganz Ihrer Meinung», sagte Weiß. «Und ich habe dem preußischen Innenminister das auch schon mehrfach nahegelegt. Aber immer wenn es danach aussieht, dass etwas dagegen unternommen werden soll, bekommen wir schon wieder einen neuen Innenminister. Zuletzt Albert Grzesinski, unser früherer Polizeipräsident.»
«Das war doch mal ein Schritt in die richtige Richtung», sagte Gennat.
«Sein Vorgänger, Carl Severing war ein guter Mann», sagte Weiß, «aber er hatte zu viele Gegner, zum Beispiel diese Mistkerle in der Armee, die schon heimlich den nächsten Krieg vorbereiten. Aber freuen wir uns mal nicht zu früh über Grzesinski. Da er Jude ist, wird seine Ernennung wohl kaum auf allgemeine Begeisterung stoßen. Grzesinski ist der Name seines Stiefvaters. Sein richtiger Name ist Lehmann.»
«Wieso hab ich davon nichts gewusst?», fragte Gennat.
«Keine Ahnung, Ernst, wo Sie doch angeblich Kripobeamter sind. Nein, es würde mich überraschen, wenn Grzesinski sich lange hält. Außerdem hat er ein Geheimnis, aus dem seine Feinde garantiert irgendwann Kapital schlagen. Er lebt nämlich nicht mit seiner Frau zusammen, sondern mit seiner Geliebten, einer amerikanischen Schauspielerin. Sie zucken mit den Achseln, Bernie, aber unmoralisch darf nur die Berliner Bevölkerung sein. Unseren gewählten Repräsentanten ist es nicht gestattet, wirklich repräsentativ zu sein. Nein, sie sollen gefälligst ohne Fehl und Tadel sein. Vor allem wenn sie Juden sind. Schauen Sie mich an. Ich bin praktisch ein Heiliger. Diese Zigarren sind mein einziges Laster.»
«Wenn Sie das sagen.»
Weiß lächelte. «So ist’s recht, Bernie. Glauben Sie nie, was jemand von sich selbst behauptet. Es sei denn, es wurde bereits hinlänglich bewiesen.» Er schrieb etwas auf ein Blatt Papier und trocknete die Tinte mit einer Löschwiege. «Gehen Sie damit zur Kasse. Dort bekommen Sie ein neues Soldbuch und eine neue Dienstmarke.»
«Wann fange ich offiziell an?»
Weiß zog an seiner Uhrenkette, bis eine goldene Savonnette auf seinem Handteller lag.
«Das haben Sie bereits. Laut Ihrer Akte haben Sie nächste Woche fünf Tage Urlaub, richtig?»
«Ja, ab Dienstag.»
«Na, dann haben Sie bis dahin Wochenenddienst. Nehmen Sie den Nachmittag frei und machen Sie sich mit der Akte Schlesischer Bahnhof vertraut. Das wird Sie wach halten. Wenn nämlich zwischen jetzt und Dienstag in Berlin ein Mord passiert, werden Sie als Erster vor Ort sein. Hoffen wir also in Ihrem Interesse, dass das Wochenende ruhig bleibt.»
Ich löste bei der Darmstädter und Nationalbank einen Scheck ein, um übers Wochenende bei Kasse zu sein, und ging dann hinüber zum Herkulesbrunnen, auf dem die riesige Skulptur des Heros thronte. Der war muskulös und grimmig, trug einen nützlich aussehenden Knüppel über der rechten Schulter, und bis auf die Tatsache, dass er nackt war, erinnerte er mich stark an einen Schupo, der gerade in einer billigen Spelunke für Ordnung gesorgt hatte. Egal, was Bernhard Weiß gesagt hatte, ein Polizist brauchte mehr als nur einen Dienstausweis und starke Worte, um eine Kneipe zu vorgerückter Stunde zu schließen. Wenn Deutsche den ganzen Tag und die halbe Nacht gezecht haben, bedarf es überzeugender und vor allem sichtbarer Argumente, um ihre Aufmerksamkeit mit einem Schlag auf die Biertheke einzufordern.
Die Kinder, die sich über den Rand des Brunnens beugten, achteten nicht groß auf Herkules. Sie interessierten sich mehr für die Münzen, die im Laufe der Jahre ins Wasser geworfen worden waren, und dafür, dass immense Vermögen zu kalkulieren, das dort lag. Ich eilte weiter in Richtung eines Eckhauses auf der Maaßenstraße, das mit mehr Schnörkeleien verziert war als eine fünfstöckige Hochzeitstorte und mit seiner kopflastigen Balkonfassade an Frau Weitendorf persönlich erinnerte.
Ich bewohnte zwei Zimmer in der dritten Etage – ein sehr enges Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer mit einem Kachelofen, der einer pistaziengrünen Kathedrale ähnelte, und einem Waschtisch mit Marmorplatte, vor dem ich mir immer vorkam wie ein Priester, wenn ich mich rasierte oder wusch. Das Arbeitszimmer war außerdem mit einem kleinen Schreibtisch und einem Stuhl möbliert sowie einem wuchtigen Ledersessel, der lauter ächzte und furzte als ein Ostseekapitän. Alles in meinen Zimmern war alt und solide und wahrscheinlich unzerstörbar – die Art von Möbeln, die wilhelminische Tischler so gebaut hatten, dass sie mindestens so lange halten sollten wie unser Reich, wie lange das auch immer sein mochte. Mein Lieblingsstück war ein großer gerahmter Mezzotintodruck mit einem Porträt von Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Hegel hatte dünnes Haar, Säcke unter den Augen und schien unter schlimmen Blähungen zu leiden. Mir gefiel das Bild, denn wenn ich verkatert war und es anschaute, beglückwünschte ich mich stets dafür, dass ich mich unmöglich so schlecht fühlen konnte, wie Hegel sich gefühlt haben musste, als er für den Mann posierte, der sich einen Künstler schimpfte. Frau Weitendorf hatte mir erzählt, sie sei mütterlicherseits mit Hegel verwandt, und das hätte durchaus wahr sein können, wenn sie nicht noch nachgeschoben hätte, dass Hegel ein berühmter Komponist gewesen sei, wodurch mir klarwurde, dass sie Georg Friedrich Händel meinte, was ihre Geschichte ein bisschen unwahrscheinlich machte. Um ihre Mieteinnahmen zu maximieren, wohnte sie selbst in einem Zimmer im obersten Stock, wo sie hinter einem großen Paravent auf einem übelriechenden Bett schlief, das sie sich mit ihren zwei Französischen Bulldoggen teilte. Praktische Gesichtspunkte und das Bedürfnis nach Geld wogen schwerer als Status. Obwohl sie in ihrem Haus die Herrin war, betrachtete sie ihre Mieter nie als ihrem Willen sklavisch unterworfen, was wohl durchaus hegelianisch von ihr war.
Die anderen Bewohner blieben jeder für sich – außer zu den Mahlzeiten. So machte ich die Bekanntschaft von Robert Rankin, dem gutaussehenden hageren Engländer, dessen Zimmer unter meinen lagen. Wie ich hatte er an der Westfront gedient, allerdings bei den Royal Welch Fusiliers, und nach mehreren Gesprächen hatten wir festgestellt, dass wir einander 1915 in der Schlacht bei Loos zu beiden Seiten eines Niemandslandes gegenübergestanden hatten. Er sprach ein fast fehlerfreies Deutsch, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass sein richtiger Name von Ranke lautete. Er hatte ihn während des Krieges aus offensichtlichen Gründen ändern müssen. Über seine Erlebnisse hatte er einen Roman mit dem Titel Pack Up Your Troubles geschrieben, der jedoch in England wenig erfolgreich gewesen war, und er hoffte nun, ihn an einen deutschen Verlag verkaufen zu können, sobald er ihn übersetzt hatte. Wie bei den meisten Veteranen, mich eingeschlossen, waren Rankins Narben größtenteils unsichtbar: Er hatte eine schwache Lunge von einer Granatexplosion an der Somme, aber ungewöhnlicher war, dass er von einem Feldtelefon, in das der Blitz eingeschlagen war, einen Stromschlag bekommen hatte, wodurch er noch immer pathologische Angst hatte, irgendein Telefon zu benutzen. Frau Weitendorf mochte ihn, weil er tadellose Manieren hatte und sie zusätzlich dafür bezahlte, dass sie seine Zimmer putzte. Trotzdem nannte sie ihn hinter seinem Rücken den «Spion». Frau Weitendorf war selbst ein Nazi und traute keinem Ausländer über den Weg.
Sowie ich mit meiner Tasche voller Polizeiakten das Haus betrat, schlich ich rasch die Treppe hinauf zu meinem Zimmer, um möglichst niemandem über den Weg zu laufen. Ich konnte Frau Weitendorf und Rosa in der Küche plaudern hören. Seit kurzem spielte Rosa ihr Tenorsaxophon in einer anspruchsvollen Haller-Revue im Admiralspalast auf der Friedrichstraße, einem klassischen Varieté mit Oben-ohne-Tänzerinnen, einem Kasino und VIP-Bereichen und einem sehr guten Restaurant. Aber es gab reichlich Gründe, das Theater nicht zu mögen – vor allem die schiere Menge an Zuschauern, die sich hineindrängten, darunter viele Ausländer –, und als ich das letzte Mal dort war, hatte ich mir und meinem Portemonnaie geschworen, nie wieder hinzugehen. Ich war mir sicher, dass Rosa, wenn sie mit Saxophonspielen fertig war, sich nicht scheute, nebenbei etwas Geld hinzuzuverdienen. Ein- oder zweimal war ich sehr spät vom Alex nach Hause gekommen und hatte gesehen, wie sie einen Freier nach oben geschmuggelt hatte. Es ging mich nichts an, und ich hätte es selbstverständlich niemals dem «Golem» verraten – wie Frau Weitendorf von uns Mietern genannt wurde, weil sie eine große steife gelbe Perücke trug, die an einen großen Laib Brot erinnerte und genauso aussah wie die des Ungeheuers in dem gleichnamigen Gruselfilm.
Nein, die Wahrheit war: Ich hatte eine Schwäche für Rosa, und es stand mir nicht zu, sie dafür zu verurteilen, dass sie ihre Einkünfte ein bisschen aufbesserte. Vielleicht täuschte ich mich ja, aber als ich einmal auf der Treppe lauschte, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass Frau Weitendorf versuchte, Rosa mit einem ihrer Freunde am Theater am Nollendorfplatz zu verkuppeln, wo sie, wie sie nie müde wurde zu erzählen, früher Schauspielerin gewesen war – was hieß, dass der Golem vermutlich nebenbei ein bisschen Zuhälterei betrieb.
Nach der Inflation von 1923 war in der Tat jeder, auch viele Polizisten, auf ein paar Nebengeschäfte angewiesen, und meine Wirtin und Rosa bildeten da keine Ausnahme. Die meisten Leute versuchten, genug zu verdienen, um sich über Wasser zu halten, aber es reichte nie, um sich etwas anzusparen. Ich kannte eine ganze Reihe Kollegen, die Drogen verkauften – Kokain war streng genommen nicht verboten –, Schwarzgebrannten, selbstgemachte Wurst, Devisen, seltene Bücher, zotige Postkarten oder Uhren, die sie Toten und Stockbetrunkenen auf der Straße abgenommen hatten. Eine Zeitlang besserte auch ich mein Gehalt auf, indem ich die eine oder andere Geschichte an Rudolf Olden verkaufte, einen Freund beim Berliner Tageblatt. Olden war Journalist und Anwalt, aber vor allem war er ein Liberaler, dem die Redefreiheit über alles ging. Ich hörte auf, ihn zu beliefern, als Ernst Gennat mich einmal in einer Kneipe mit Olden im Gespräch sah und die Gefahr bestand, dass er zwei und zwei zusammenzählte. Ich hatte Olden nie vertrauliche Informationen zugespielt, meistens bloß Tipps über Nazis und Kommunisten in der Abteilung 1A, der politischen Polizei, deren Personal eigentlich keiner Partei angehören sollte. So gab ich Olden beispielsweise mal ein paar Notizen, die ich mir auf einer Veranstaltung des Verbandes Preußischer Polizeibeamter, des Schrader-Verbandes, zu einer Rede von Kommissar Arthur Nebe gemacht hatte. Olden nannte Nebe zwar nicht namentlich, aber alle am Alex wussten, wer in der Zeitung zitiert wurde.
Ein angeblich parteiunabhängiger Kommissar der politischen Polizei Berlins hielt gestern Abend auf einer privaten Veranstaltung des Schrader-Verbandes im Hotel Eden eine Rede, in der er folgende Bemerkungen machte: «Unsere Nation ist nicht mehr gesund. Wir haben aufgehört, nach Höherem zu streben. Wir sind scheinbar ganz zufrieden damit, uns im Schlamm zu suhlen, in neue Tiefen zu versinken. Offen gesagt, mich erinnert diese Republik an Südamerika oder Afrika, nicht an ein Land im Herzen Europas. Und wegen Berlin schäme ich mich fast, Deutscher zu sein. Es ist schwer zu glauben, dass wir noch vor vierzehn Jahren eine Macht des moralisch Guten und eines der mächtigsten Länder der Welt waren. Die Menschen haben uns gefürchtet, jetzt verachten sie uns und machen sich über uns lustig. Ausländer strömen mit ihren Dollars und Pfund Sterling in die Stadt, um nicht nur Vorteile aus unserer geschwächten Reichsmark zu ziehen, sondern auch unsere Frauen und unsere liberalen Gesetze in Sachen Sittlichkeit auszunutzen. Vor allem Berlin ist das neue Sodom und Gomorrha geworden. Alle rechtschaffenen Deutschen sollten das Gleiche empfinden wie ich, und dennoch macht diese Regierung aus Juden und Freunden des Bolschewismus keinen einzigen ihrer goldberingten Finger krumm und überschüttet die Menschen mit Lügen, wie wunderbar doch alles ist. Eine abscheuliche Bande ist das! Sie lügen unaufhörlich. Doch Gott sei Dank gibt es einen Mann, der verspricht, die Wahrheit zu sagen und diese Stadt zu säubern, den Dreck aus Berlins Straßen zu spülen, den Abschaum, den Sie jede Nacht sehen: die Drogenhändler, Prostituierten, Zuhälter, Transvestiten, Schwuchteln, Juden und Kommunisten. Dieser Mann ist Adolf Hitler. An dieser Stadt ist etwas krank, und nur ein starker Mann wie Hitler mit seiner NSDAP hat das Heilmittel. Ich bin selbst kein Nazi, bloß ein konservativer Nationalist, der sehen kann, was mit diesem Land geschieht, der sehen kann, wie die finstere Hand der Kommunisten die Werte unserer Nation aushöhlt. Ihr Ziel ist es, das moralische Herz unserer Gesellschaft zu schwächen, damit es zu einer weiteren Revolution kommt wie der, die Russland zerstört hat. Sie stecken hinter all dem. Sie wissen, dass ich recht habe. Jeder Polizist in Berlin weiß, dass ich recht habe. Jeder Polizist in Berlin weiß, dass die amtierende Regierung nicht beabsichtigt, irgendwas an den Zuständen zu ändern. Wenn ich nicht recht hätte, dann könnte ich vielleicht auf einige Gerichtsurteile verweisen, die Sie davon überzeugen würden, dass das Gesetz in Berlin geachtet wird. Aber das kann ich nicht, weil unsere Justiz voll mit Juden ist. Beantworten Sie mir folgende Frage: Was ist das für eine Abschreckung, wenn nur ein Fünftel aller Todesurteile vollstreckt wird? Ich sage Ihnen, meine Herren, ein Sturm zieht auf – ein mächtiger Sturm, und all diese Entarteten werden hinweggefegt werden. Denn genau das sind sie: Entartete. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, wenn Abtreibungen auf Verlangen zu haben sind, wenn Mütter ihre Töchter verkaufen, Schwangere sich prostituieren und Jungen in dunklen Seitengassen an erwachsenen Männern unaussprechliche Handlungen vornehmen. Ich war kürzlich im Leichenschauhaus und habe gesehen, wie ein Künstler den Leichnam einer Frau zeichnete, die von ihrem Mann ermordet worden war. Ja, das geht heutzutage als Kunst durch. Wenn Sie mich fragen, ist der Mörder, den die Presse Winnetou getauft hat, bloß ein weiterer Bürger, der genug hat von der ganzen Prostitution, die diese Stadt beherrscht. Die preußische Polizei muss endlich begreifen, dass Verbrechen wie die von diesem Winnetou vielleicht die unvermeidliche Folge einer trägen, rückgratlosen Regierung sind, die das Gefüge der deutschen Gesellschaft bedroht.»
Gennat musste sich gedacht haben, dass wahrscheinlich ich es war, der Arthur Nebe ans Tageblatt verpfiffen hatte, und obwohl er damals nichts sagte, erinnerte er mich später daran, dass nicht nur Polizisten der Abteilung 1A ihre politischen Ansichten besser zu Hause ließen, sondern auch Kripobeamte. Vor allem Kripobeamte, die Arthur Nebe genauso wenig leiden könnten wie er und ich. Von Leuten wie uns werde ein höherer Standard erwartet, meinte Gennat, und es gebe schon genug Spaltung in der preußischen Polizei, auch ohne dass wir selbst dazu beitrugen. Ich fand, dass er recht hatte, und rief Olden nicht mehr an.
Allein in meinem Zimmer drehte ich mir eine Zigarette, befeuchtete das Ende mit ein wenig Rum und rauchte sie am offenen Fenster, damit der Rauch abziehen konnte. Dann packte ich meine Aktentasche aus und begann, die Akte Schlesischer Bahnhof zu lesen. Sie war selbst für mich schwer verdaulich, vor allem die Schwarz-Weiß-Fotos, die der Polizeifotograf Hans Gross aufgenommen hatte.
Seine Arbeit an Tatorten ging einem irgendwie unter die Haut. Es heißt, jedes Bild erzählt eine Geschichte, aber Hans Gross war ein Fotograf, der durch seine Arbeit zur Scheherazade der modernen Kriminalistik geworden war. Er arbeitete vorzugsweise mit der Graflex, einer großformatigen Fotokamera des Herstellers Folmer & Schwing, die auf ein Untergestell mit Rollen montiert war, und mit einer mobilen Version von Kohlebogenlampen, wie sie am Flughafen Tempelhof verwendet wurden. Kamera und Lampe beanspruchten zusammen mindestens die Hälfte des Platzes im Mordauto. Noch wichtiger als die Fotoausrüstung war jedoch meiner Meinung nach, dass Hans ein geradezu cineastisches Gefühl für einen Tatort hatte: Fritz Lang hätte keine besseren Bilder machen können, und manchmal waren die Fotos, die Gross für die Mordinspektion schoss, so gestochen scharf, dass es wirkte, als sei das bedauernswerte Opfer möglicherweise gar nicht tot, sondern tue nur so. Aber nicht nur Bildeinstellung und Schärfe machten die Fotos so effektvoll, auch die Hintergrunddetails trugen maßgeblich zu ihrem plastischen Eindruck bei. Auf seinen Bildern sahen Kriminalbeamte oft Dinge, die ihnen am Tatort selbst entgangen waren. Deshalb hatte Hans Gross am Alex den Spitznamen Cecil B. DeMord verpasst bekommen.
In der ersten Ermittlungsakte ging es um den Fall Mathilde Luz, die auf dem Andreasplatz ermordet aufgefunden worden war. Das Foto der Toten war dermaßen scharf, dass jede Linie der Rotfront-Schmierereien an der verfallenen Hauswand, vor der sie lag, deutlich zu erkennen war. Eine Brille mit dickem Gestell lag rechts von ihrem Kopf, als hätte sie sie nur kurz abgenommen. Man konnte sogar den Markennamen in einem ihrer Hellstern-Schuhe lesen, der ihr vom Fuß gerutscht war. Bis auf die Tatsache, dass ein Streifen ihrer Kopfhaut fehlte, sah Mathilde Luz so aus, als hätte sie sich bloß hingelegt, um ein kurzes Nickerchen zu machen.
Ich las die Notizen und diversen Aussagen und versuchte dann, mir das Gespräch vorzustellen, das ich mit ihr geführt hätte, wenn sie in der Lage gewesen wäre, mir zu erzählen, was passiert war. Das war eine neue Methode, zu der uns Bernhard Weiß ermunterte, nachdem er einen Aufsatz von einem Kriminologen namens Robert Heindl gelesen hatte. «Lassen Sie das Opfer sprechen», hatte Heindl geschrieben. «Versuchen Sie, sich vorzustellen, was es Ihnen erzählen würde, wenn Sie eine Zeitlang mit ihm verbringen könnten.» Und das tat ich jetzt.
Mathilde Luz war eine ziemlich attraktive Frau, und sie trug noch immer die Kleidung, in der sie ermordet worden war: den Hut, den Mantel und das Kleid, alles von C&A, aber dennoch geschmackvoll. Manche Frauen verstehen es einfach, auch billige Mode gut aussehen zu lassen, und Mathilde Luz war eine von ihnen. Laut Polizeibericht trug sie eine solche Menge Parfüm 4711, dass der Gedanke nahelag, sie wollte eher etwas übertünchen, als verführerisch duften. Der Bericht stellte außerdem fest, dass sie dunkelhaarig war, große braune Augen hatte und ihr Lippenstift denselben Rotton hatte wie ihr Nagellack. Ihr Gesicht war totenbleich gepudert, zumindest dachte ich, es sei Puder. Vielleicht sah sie auch nur so aus, weil sie tot war.
«Ich habe zwei Jahre lang im Deutschen Glühlampenwerk Glühstrümpfe hergestellt», hörte ich sie sagen. «Hat mir gefallen. Ich hatte ein paar gute Freundinnen da. Viel verdient hab ich nicht, aber mit dem Lohn meines Mannes – er baut bei Julius Pintsch in der Fabrik Gasmesser – sind wir einigermaßen über die Runden gekommen. Wenn auch mehr schlecht als recht. Wir haben auf der Koppenstraße gewohnt, in einer Einzimmerwohnung, wenn man das überhaupt so nennen kann – es war eher eine Bruchbude. Es ist ein armes Viertel, wie Sie wahrscheinlich wissen. 1915 haben dort zwei Butteraufstände stattgefunden. Können Sie sich Berlin ohne Butter vorstellen? Undenkbar. Ich erinnere mich noch gut an die Aufstände. Da muss ich knapp vierzehn gewesen sein.»
«Dann waren Sie zum Zeitpunkt ihres bedauerlichen Todes also siebenundzwanzig.»
«Das ist richtig. Jedenfalls, unser Vermieter, Lansky, war Jude wie wir, aber das zählte für ihn nicht, nur der Profit. Wenn wir die Miete nicht pünktlich bezahlt hätten, hätte er uns in null Komma nix vor die Tür gesetzt. Er hat ständig gesagt, was für ein Glück wir hätten, überhaupt so eine Bleibe zu haben, aber er musste ja nicht da wohnen. Ich weiß zufällig, dass er eine hübsche Wohnung in der Nähe der Tauentzienstraße hat. Ein richtiger Ganeff ist das. Jedenfalls, letztes Jahr kurz nach Weihnachten bin ich entlassen worden, hab dann natürlich nach einer anderen Arbeit gesucht, aber das macht ja zurzeit die Hälfte der Frauen in Berlin, deshalb war schon klar, dass ich nichts finden würde. Wäre ich nicht entlassen worden, hätte ich nie auf den Strich gehen müssen. Franz hat das vorgeschlagen, als die Miete fällig wurde, und ich hab mich drauf eingelassen, weil es besser war, als Prügel zu kassieren.»
«Die Schuhe, die Sie getragen haben. Modell Salomé, von Hellstern. Teuer.»
«Frauen müssen so gut wie möglich aussehen.»
«Wo hatten Sie die her?»
«Eine Freundin hat sie extra für mich bei Wertheim gestohlen.»
«Und die Brille?»
«Manche Männer mögen den Sekretärinnentyp. Vor allem in der Gegend nördlich vom Schlesischen Bahnhof. Dann können Sie sich einbilden, du wärst das Mädchen von nebenan, und das gibt ihnen Selbstvertrauen.»
«Das ist nur ein Katzensprung von der Julius-Pintsch-Fabrik entfernt, nicht wahr?»
«Richtig. Manchmal hat mein lieber Gatte in der Spätschicht gearbeitet und ist danach zu mir gekommen, nur um mir alles abzunehmen, was ich verdient hatte, damit er sich ein paar Bier genehmigen konnte. Er hat gesagt, er würde auf mich aufpassen, wie ein richtiger Zuhälter, aber das war Quatsch. Natürlich war es gefährlich. Und das wusste ich auch. Das wussten wir alle. Jeder erinnert sich an Carl Großmann. Der hat Gott weiß wie viele Frauen in demselben Bezirk ermordet. Wann war das?»
«Zwischen 1918 und 1921.»
«Der soll seine Opfer gegessen haben.»
«Nein, das war Haarmann. Großmann hat seine Opfer lediglich zerstückelt, nachdem er sie ermordet hatte. Normalerweise in seiner Wohnung auf der Lange Straße. Aber Sie haben recht. Das ist nicht weit von der Stelle, wo Sie ermordet wurden.»
«Dreckskerle. Alle Männer sind Dreckskerle, wenn Sie mich fragen.»
«Da haben Sie wahrscheinlich recht.»
«Sie sind bestimmt auch einer. Ihr Bullen seid genauso schlimm wie alle anderen. Schlimmer. Ihr lasst euch bestechen oder verscherbelt Koks, und dabei tut ihr so, als würdet ihr das Gesetz achten. Aber manchmal seid ihr die Allerschlimmsten. Wie hieß noch gleich das Bullenschwein, der Dreckskerl vom Alex, der vor ein paar Jahren Frauen umgebracht hat? Der, den sie mit einer milden Strafe haben davonkommen lassen?»
«Bruno Gerth.»
«Kannten Sie ihn?»
«Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass er eine milde Strafe bekommen hat.»
«Nein? Er hat seinen Kopf doch behalten, oder?»
«Das ja, aber er wurde in einer Irrenanstalt untergebracht. Und da wird er wahrscheinlich bis an sein Lebensende bleiben. Ich hab ihn übrigens vor zwei Monaten besucht.»
«Das muss für euch beide ja richtig nett gewesen sein. Es heißt, er hat dem Richter bloß was vorgemacht. Den Irren gespielt. Er hat gewusst, wie man das System austrickst, und das Gericht hat es ihm abgekauft.»
«Da mag was dran sein. Keine Ahnung. Ich war nicht beim Prozess dabei. Aber kommen wir noch mal darauf zurück, was Ihnen zugestoßen ist, Mathilde. Erzählen Sie mir von dem Abend, an dem Sie ermordet wurden. Was mir übrigens sehr leidtut.»
«Ich hab den frühen Abend im Hackebär verbracht. Wie üblich. Viele Chonten wie ich trinken sich ein paar Gläser Mut an, bevor sie sich auf die Suche nach einem Freier machen.»
«In Ihrem Körper konnte auch Kokain nachgewiesen werden.»
«Klar, wieso nicht? Das macht dich ein bisschen beschwingter. Hilft dir, einen Freier an Land zu ziehen. Hilft dir sogar, es zu genießen. Wenn sie dich vögeln. Und der Stoff ist ja nun nicht gerade schwer zu besorgen oder besonders teuer. Der Wurstverkäufer vor dem Schlesischen Bahnhof hat meist was da.»
«Wir haben ihn befragt. Aber er bestreitet es.»
«Wahrscheinlich habt ihr ihn zur falschen Zeit gefragt. Als er nur noch Salz und Pfeffer hatte.»
«Was ist dann passiert?»
«Ein paar von uns sind Richtung Rose-Theater losgezogen oder Zur Möwe.»
«Sie meinen das Tanzlokal auf der Frankfurter Allee.»
«Genau. Ist ein bisschen altmodisch, aber da sind meist jede Menge Männer auf der Suche. Leider überwiegend Männer wie Franz. Irgendwer hat mich mit einem Mann verschwinden sehen, aber aus naheliegenden Gründen kann ich Ihnen rein gar nichts über den sagen. Dann verschwimmt alles ein bisschen in meinem Kopf. Irgendwo auf dem Andreasplatz ist ein Brunnen mit einer Skulptur von einem Mann, der einen Hammer in der Hand hält.»
«Ein Zeuge sagt, er hat gesehen, wie ein Mann sich in dem Brunnen die Hände gewaschen hat, rund zehn oder fünfzehn Minuten nach dem mutmaßlichen Zeitpunkt Ihrer Ermordung.»
«Gut möglich. Jedenfalls, ich schätze, das war die Mordwaffe. So ein Hammer wie der an der Skulptur. Ich hab einen heftigen Schlag im Nacken gespürt.»
«Der hat sie getötet, Mathilde. Ihr Mörder hat Ihnen mit einem einzigen Schlag das Genick gebrochen.»
«Danach. Nichts. Die große Leere. Jetzt sind Sie an der Reihe, Herr Kommissar.»
«Und dann hat er Sie skalpiert.»
«So ein Jammer. Ich hatte immer schönes Haar. Fragen Sie Franz. Der hat es mir immer gebürstet, wenn er mal in zärtlicher Stimmung war. Ich fand das sehr entspannend nach einer Nacht auf dem Rücken. Das Gefühl, dass sich jemand für mich als Mensch interessiert und nicht bloß für meine Möse.»
«Das hat er uns erzählt. Aber meinen Vorgesetzten erschien das ein bisschen seltsam. Nicht viele Männer würden ihren Frauen das Haar bürsten. Man könnte meinen, er wäre vielleicht abartig fasziniert von Frauenhaar.»
«Da war nichts Abartiges dabei. Er konnte sehen, dass ich müde war, und wollte irgendwas für mich tun. Irgendwas Nettes. Irgendwas, das mich entspannt.»
«Reden wir über Franz. Wir haben ihn mehrmals vernommen. Meistens, nachdem jemand die Polizei gerufen hatte, weil Sie beide sich heftig stritten.»
«Das war auf der Koppenstraße, stimmt’s? Keine Suite im Adlon. In so einem Drecksloch von Mietskaserne streiten sich alle. Das Paar möchte ich sehen, das da haust und sich nicht zofft.»
«Er hat mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzung. Und er besitzt eine ganze Reihe scharfer Messer. Messer, die scharf genug sind, um einen Menschen mit Leichtigkeit zu skalpieren.»
«Er hat gern mit Holz gearbeitet. Spielzeug gebastelt, das er auf Weihnachtsmärkten verkauft hat. Um die Haushaltskasse aufzubessern. Hatte auch ein Händchen dafür. Aber für die Nacht, in der ich ermordet wurde, hat er ein Alibi. Da hatte er Nachtschicht bei Julius Pintsch.»
«Meine Aufgabe ist es, Alibis zu entkräften. Die Fabrik liegt ganz in der Nähe vom Tatort, er hätte sich also für zehn Minuten rausschleichen, Sie umbringen und wieder zurückkehren können.»