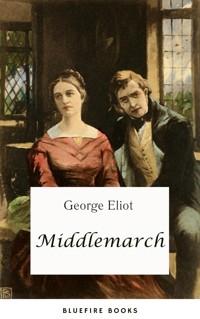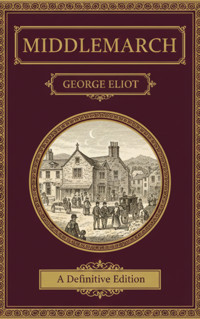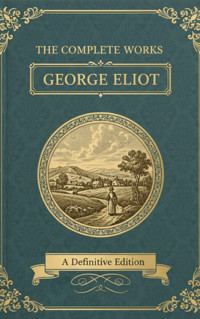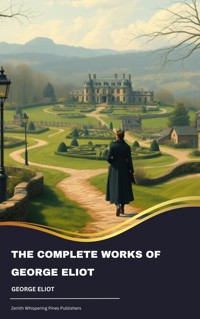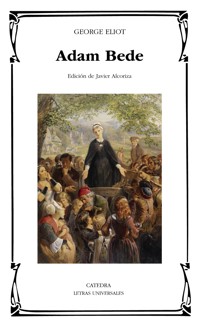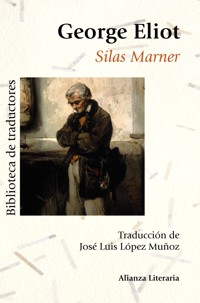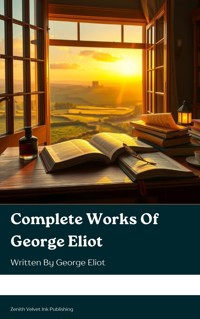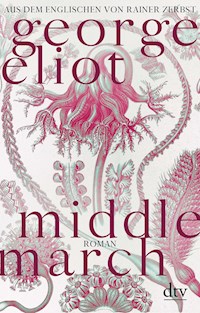
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Tausend Seiten Leseglück.« NZZ am Sonntag Die Grenzen des Dorfes sind die Grenzen unserer Welt. Das akzeptieren vielleicht die restlichen Bewohner von Middlemarch, aber nicht Dorothea und Tertius. Wieso sollte einer jungen Frau der Zugang zu Wissen und Geist verschlossen bleiben, wenn die alten Männer damit nur Schindluder treiben? Und warum sollte ein junger Arzt nicht neue Methoden anwenden dürfen, wenn man dadurch Menschenleben retten kann? Neugier ist Pflicht für Dorothea und Tertius. Und um ihre Pflicht zu erfüllen, setzen sie vieles aufs Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1678
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Der berühmteste Roman von George Eliot eröffnet einen ganzen Kosmos: den des englischen Provinzstädtchens Middlemarch um 1830. Im Mittelpunkt stehen eine Frau und ein Mann, die sich gegen die Beschränkungen ihrer Zeit auflehnen. Dorothea Brooke heiratet, um ihre Wissbegier zu befriedigen, den um einiges älteren Gelehrten Casaubon. Dieser allerdings ist weniger an ihrem Intellekt als an ihren Qualitäten als Haushälterin interessiert. Und der Arzt Tertius Lydgate forscht neugierig nach neuen Behandlungsmethoden, denen seine Patienten verständnislos gegenüberstehen. Neugier ist Pflicht für Dorothea und Tertius – und um ihre Pflicht zu erfüllen, setzen sie einiges aufs Spiel. Virtuos erzählt George Eliot von den Verstrickungen zwischen persönlichen Wünschen und den gesellschaftlichen Erwartungen. Mit ihren eindrucksvollen Charakterstudien schuf sie ein Meisterwerk des literarischen Realismus.
Vorwort
Elisabeth Bronfen
Weibliches Leben im Verborgenen?
Die Einzelschicksale, die George Eliot in ihrem Roman »Middlemarch« in acht Episoden miteinander verbindet, ergeben eine ›Studie über das Leben in der Provinz‹ – so der Untertitel. In der englischen Provinz Anfang des 19. Jahrhunderts heiraten die Familien des Großbürgertums untereinander, da wenig Fremde von außerhalb nach Middlemarch kommen. Zugleich ist der Umgang, den die Mitglieder der Gemeinde miteinander pflegen, von Vorurteilen, Gerüchten und Intrigen geprägt. Auch das Geld spielt eine große Rolle: Mal weckt es Hoffnungen, mal vereitelt es Erwartungen.
In dieser Auslegeordnung sind verschiedene Facetten von Weiblichkeit zu entdecken. Sich dem begrenzten Fokus ihrer Geschichte bewusst, erklärt die Erzählerin am Anfang des 15. Kapitels: »Ich zumindest habe so viel damit zu tun, bestimmte menschliche Schicksale zu entwirren und zu sehen, wie sie gewoben und ineinander verwoben sind, dass ich alles Licht, über das ich verfüge, auf dieses spezielle Gewebe konzentrieren muss und nicht über jene verlockende Fülle von Bedeutsamkeiten verstreuen darf, die man das Universum nennt«. Im Zentrum dieses Gewebes steht die verwaiste Dorothea Brooke, die zusammen mit ihrer Schwester Celia auf Tipton Grange wohnt, dem Gutshof ihres Onkels. Deutet ihr religiöser Wunsch nach Märtyrertum auf ein puritanisches Familienerbe, bezeugt ihre erhabene Weltanschauung zugleich einen leidenschaftlichen Freimut. Ihr Wunsch nach einem hehren geistigen Leben kann als Kompensation dafür verstanden werden, dass sie als Frau kein College besuchen kann und sich stattdessen mit wohltätigen Projekten auf dem Anwesen ihres Onkels begnügen muss. Dorothea hat aber auch einen Hang zu kühnen Entscheidungen. Die Ehe mit Edward Casaubon, einem älteren Pastor, soll ihren Wissensdurst befriedigen. Sucht er in seinen Studien unermüdlich nach dem Schlüssel zu allen Mythologien, hofft sie in dieser Forschung ihre eigene intellektuelle Erfüllung zu finden. Sein Pfarrhaus trägt den sprechenden Namen Lowick, was so viel bedeutet wie »kurzer Docht«. In diesem Haus ist es nicht nur tatsächlich sehr düster, dort wird sich auch die Heirat bald als nur spärlich von gegenseitiger Liebe erleuchtet erweisen. Dorotheas hoffnungsvolle Bewunderung für den Gelehrten trifft bei ihrem Gatten auf ein fundamentales Missverständnis, will er doch nur eine gehorsame Gehilfin, keine Mitdenkerin.
Bereits sechs Wochen nach der Hochzeit hat die naive Braut ihre feurige Einbildungskraft der Realität anpassen müssen. Sie beginnt zu begreifen, wie fruchtlos jene Forschung ist, die Casaubon in seiner Bibliothek gefangen hält. Durch dessen Vetter Will Ladislaw, der auf Wunsch von Arthur Brooke nach Middlemarch gekommen ist, um bei seiner neu gegründeten Zeitung mitzuwirken, erhält Dorothea die Gelegenheit, ihre brachliegende Leidenschaft auf ein neues Anliegen zu übertragen. Sie versucht ihrem Gatten einzureden, den mittellosen Idealisten in seinem Testament zu begünstigen. Dabei ahnt sie nicht, dass sie damit in dem bereits von Selbstzweifel gepeinigten Geistlichen eine blinde Eifersucht schürt – Shakespeares Desdemona ganz ähnlich. Casaubon seinerseits wittert in der Inbrunst, mit der seine junge Gattin sich für den unliebsamen Vetter einsetzt, sowohl Kritik an seiner Forschung als auch Rebellion gegen seine Vorherrschaft. Achtzehn Monate nach ihrer Trauung wird er Dorothea zwar im Gegensatz zu Othello für diese Untreue nicht ermorden, doch ihr Gatte vollzieht mit einem Testamentsnachtrag einen Rufmord: Sollte seine Witwe Will heiraten, würde sie den geerbten Besitz gänzlich verlieren. Die Ironie dieses boshaften Eingriffs: In seiner blinden Eifersucht hat Casaubon jenes Begehren richtig erkannt, welches sich Dorothea erst ganz am Ende des Romans offen eingestehen kann.
Geschärft wird dieses Portrait einer in ihrem Tatendrang beeinträchtigten jungen Frau durch drei weitere Lebensentwürfe, die es kontrastieren. Dorotheas Schwester Celia entspricht ganz dem viktorianischen Weiblichkeitsbild. Von fröhlichem und umgänglichen Gemüt gezeichnet, ist ihr die Bereitschaft ihrer Schwester zur Selbstkasteiung ebenso fremd wie deren Hunger nach Wissen. Celia setzt alles auf eine unbekümmerte Lebenslust und ist gewandt in der Kunst des Singens und Klavierspielens, die damals als angemessene Ausdrucksformen weiblicher Kreativität galten. Ihre liebenswürdige und unschuldige Erscheinung ist allerdings mit einem gesunden Menschenverstand gekoppelt. Weniger klug und fantasievoll als ihre Schwester ist Celia auch weniger bereit, sich etwas vorzumachen. Zwar streitet sie sich mit Dorothea nie, zugleich ist sie diejenige, die mit ihrem nüchternen Blick die Schwester immer wieder auf deren Selbsttäuschungen aufmerksam macht.
Nach ihrer Heirat mit Sir James Chettam bekommt Celia als erste im Roman einen Sohn und stellt somit die Nachkommenschaft sicher. Gänzlich mit dem beschränkten Wirkungsfeld zufrieden, das ihr das Leben auf Freshitt Hall bietet, verkörpert sie eine ruhige, von Lebensweisheit geprägte weibliche Stabilität. Die pragmatische Tugendhaftigkeit, die sie von Anbeginn zur Schau stellt, braucht keine Veränderung, und so nimmt sie am wenigsten Platz im Roman ein. Die Erzählerin interessiert sich für sie nur als Beispiel für eine Frau, die den an sie herangetragenen Erwartungen perfekt entspricht, weil sie sich diese unhinterfragt zu eigen machen kann. Um darin ein Stück weibliche List zu erkennen, muss man zwischen den Zeilen lesen: Denn im Gegensatz zu Dorothea kann Celia sich bei ihrem Gatten erfolgreich durchsetzen, weil sie die weiblichste aller Waffen – die Tränen der empfindsamen Gattin – perfekt beherrscht.
Eine andere Art Bodenständigkeit wird von Mary Garth verkörpert, der Tochter eines Grundstückverwalters, die sich im Gegensatz zu Dorothea und ihrer Schwester ihren Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Auch sie akzeptiert die Grenzen, die ihr das Schicksal ihrer Geburt vorgibt. Es entspricht ebenfalls dem Standesdünkel, den George Eliot mit ihrem Roman zu spiegeln sucht, dass Mary von einer schlichten Erscheinung ist, klein gewachsen, mit einem gewöhnlichen Gesicht und braunem, lockigen Haar. Mit Ehrlichkeit als ihrer entscheidenden Tugend hat sie weder Verständnis für leere Ambitionen noch für einen dem eigenen Status unangemessenen Genuss. Die Bauernschläue, die ihr erlaubt, sich ihren von wirtschaftlichen Rückschlägen gezeichneten Lebensumständen anzupassen, ist mit einer guten Portion satirischem Witz versehen. Dieser bildet das adäquate Beiwerk zu jener moralischen Haltung, für die sie von George Eliot als Leitbild eingesetzt wird: Von ihrer Überzeugung, dass man aufrichtig leben muss, weicht Mary nie ab. Am eindrücklichsten zeigt sich diese Strenge in ihrem Umgang mit ihrem Jugendfreund Fred Vincy, der sich in der falschen Erwartung, eine große Erbschaft zu machen, hoffnungslos verschuldet, und diejenigen, die ihm vertrauen, in den Ruin zu stürzen droht. Sie liebt ihn zwar, doch in eine Ehe will sie nur dann einwilligen, wenn er von seiner verschwenderischen Lebensweise absieht und einen ordentlichen Beruf ergreift.
Die einzige Ambition, die Mary sich zu hegen erlaubt, betrifft somit das ganz persönliche Glück. Sie will sich weder einem Gatten gehorsam unterwerfen, noch sich im Schatten seines Wohlstandes ausruhen. Die Handlungsfähigkeit, die ihr eingeräumt wird, mag ihrem Stand entsprechend zwar gering sein, sie aber darf ihren Bräutigam dazu erziehen, sich ihrer Liebe würdig zu erweisen. Mit ihrem Beharren auf Umsicht verkörpert Mary Garth somit eine weitere Facette des viktorianischen Weiblichkeitsideals. Ganz dem puritanischen Arbeitsethos entsprechend kommt die Forderung, die sie nicht nur an sich, sondern auch an ihre Mitmenschen stellt, einer bereitwilligen Selbsteinschränkung gleich. Dass die Erzählerin jene Standhaftigkeit lobt, mit der Mary an ihrer Aufrichtigkeit festhält, könnte man aber auch als verstohlene Kritik verstehen. Zwar darf Mary sich den Ehemann nach ihren eigenen Vorstellungen erziehen, doch das Familienglück geht mit dem Verzicht auf jegliche soziale Abweichung einher. Es ist regelrecht an das Verbot geknüpft, die Standesgrenze der Kaufleute zu überschreiten, aus der sie stammt. Die gänzlich private Reform, für die sie eintritt, ist eine Selbstbildung zur Bescheidenheit, kein offener politischer Wandel.
Wesentlich schillernder wird Rosamond Vincy gezeichnet, die Schwester von Fred Vincy und Marys Jugendfreundin. Auch sie verkörpert eine weitere Facette des damaligen Weiblichkeitsideals: die elegante viktorianische Lady. Rosamonds Schönheit wird wiederholt mit ihren engelhaft blonden Haaren begründet, doch sie sticht zugleich auch durch ihre elegante Erscheinung, die Angemessenheit ihrer Sprache und ihren herausragenden Geschmack hervor. Ihre musikalische Darbietung als Sängerin ist ebenso vollkommen wie ihre Stickarbeit makellos und ihre Zeichnungen exquisit sind. Als Tochter eines der erfolgreichsten Fabrikanten von Middlemarch hat der Wohlstand, in dem sie groß geworden ist, in ihr zusammen mit einer guten Portion Snobismus auch eine Gesellschaftsfantasie geschürt: Sie will eine gute Heiratspartie machen, wünscht sich Wohlstand und soziale Anerkennung, die mit diesem im viktorianischen Großbürgertum einhergeht. Erfolgreich stellt sie dem Arzt Tertius Lydgate nach, der nach Middlemarch gekommen ist, um sich einen Namen mit Forschungen zu ansteckenden Erkrankungen zu machen. Wie Dorothea ist auch Rosamond von Ehrgeiz getrieben, da auch sie von jenem kulturellen Kapitel stellvertretend profitieren will, das ihre Einbildung ihrem zukünftigen Gatten zugeschrieben hat.
Dass es sich bei ihrer amourösen Verblendung um den Glamour eines Lebens im Luxus handelt, rückt sie allerdings in die Nähe der Femme Fatale. Als würde eine weibliche Selbstbestimmung, die in einem standhaften Egoismus zu Tage tritt, der Erzählerin Angst machen, trifft deren Ironie diese junge Frau am schärfsten. Zugleich ist die Vereitelung Rosamonds ambitionierter Ehefantasie, mit der ihr Lebensentwurf dramaturgisch als Abschreckung eingesetzt wird, ambivalent. Diese Heldin erweist sich nicht nur als schicksalshaft, weil ihr Hang zum Luxus, von dem sie um keinen Preis abweichen will, ihren Gatten in den finanziellen Ruin zu stürzen droht. Sie entpuppt sich auch deshalb als Femme Fatale, weil sie nicht bereit ist – und darin nimmt sie die dunklen Heldinnen des Film Noir vorweg – Lydgates Forderung nachzugeben und besonnen auf ihre Ansprüche zu verzichten. Ihr unverfrorener Narzissmus verbietet ihr, sich dem Los ihres Gatten zu unterwerfen, um ihm mit empfindsamer Nachsicht bei seinen Enttäuschungen stützend zur Seite zu stehen. Zugleich ist sie diejenige, die deshalb in ihrem Ehestreit obsiegt, weil sie ihren Gatten zu der Erkenntnis zwingt: Eben weil er sich in seiner Arztpraxis entfalten darf, während sie auf eine häusliche Existenz beschränkt ist, hat sie ein Anrecht darauf, ihr Heim ihrem Begehren entsprechend auszustatten. Celia nicht unähnlich, setzt somit auch Rosamond eine der viktorianischen Frau zugeschriebene Waffe ein, welche die Herrschaft ihres Gatten erfolgreich entmachtet. Auch in ihrem Fall erweist sich nämlich eine aufgezwungene Schwäche als weibliche Stärke. Weist die Gesellschaft Rosamond die Rolle der politisch unmündigen Kindfrau zu, die vom finanziellen Schicksal ihres Gatten gänzlich abhängig ist, so schuldet Tertius ihr eine dieser Zuweisung entsprechende Lebenssituation. Für sie verantwortlich muss vor allem er seine Ambitionen ihren Ansprüchen anpassen.
So ergibt die in Middlemarch entfaltete Palette an Weiblichkeitsentwürfen ein dichtes Gewebe, das seriell konzipiert zwar verschiedene Möglichkeiten miteinander kontrastiert, in jedem Fall aber die Frage umkreist: Was sind die Bedingungen für eine geglückte, wenn auch nicht gänzlich glückliche Ehe? Jede der Heldinnen sucht einen Kompromiss zwischen ihren Wünschen und den gesellschaftlichen Erwartungen, die diese notgedrungen beschränken. Macht Celia kaum eine Entwicklung durch, weil sie sich von Anfang an für das Leben der Gutsherrin entschlossen hat, werden die anderen drei Frauen an den Entscheidungen gemessen, die sie fällen. Für Mary bedeutet dies, ihren Bräutigam hartnäckig zu erziehen, um auch ihm zu ermöglichen, den Weg einer moralischen Selbstverbesserung einzuschlagen. Die Erziehung, die Rosamond ihrem Gatten auferlegt, stellt hingegen nicht nur eine eigenwillige Variation jener passiven Selbstbehauptung dar, derer auch Celia sich bedient. Sie legt auch einen anderen Akzent auf Dorotheas Ehrgeiz, in der Verbindung mit einem Ehemann, den sie sich selber ausgesucht hat, ihre beschränkte Wirkungsmacht zu erweitern. Rosamond ist weder bereit, gänzlich in der Forschung Lydgates aufzugehen, noch, ihren Lebensdrang diesem zu opfern.
Der Umstand, dass George Eliot sich ein weibliches Glück jenseits der Ehe nicht vorstellen kann, wirkt altmodisch. Aktuell hingegen bleibt, dass wir durch den seriellen Aufbau des Romans, der diese Parallelgeschichten miteinander verknotet, den Prozess der moralischen Bildung stellvertretend nachvollziehen können, den die Heldinnen durchlaufen. Auch wenn wir die Beurteilungen der Erzählerin nicht immer teilen: Wir sind aufgerufen, emphatisch teilzunehmen an dem Abwägen und Korrigieren von Einbildungen dieser vier Frauen, an deren Missverständnissen und Fehleinschätzungen, aber auch an deren Herausbilden einer Selbsterkenntnis.
Diese Verwebung von Parallelgeschichten als narratives Verfahren ist noch aus einem anderen Grund entscheidend: Die Moralphilosophie, die George Eliots Roman zugrunde liegt, setzt eine geglückte Selbsterkenntnis mit der Korrektur der eigenen Einbildung gleich. Jener Einbildung, die die Bedürfnisse anderer ausblendet, weil sie sich nur auf sich selbst bezieht. Als dramaturgischer Höhepunkt dieses um vier Frauenschicksale kreisenden Bildungsromans fungiert somit jene Nacht der radikalen Selbstbefragung, in der Dorothea mit ihren ambivalenten Gefühlen für Will ringt, nachdem sie ihn in einem vertrauten Gespräch mit Rosamond überrascht hat. Zuerst entlässt sie ihren Bediensteten, bricht anschließend auf dem kahlen Boden ihres Schlafzimmers schluchzend zusammen und schläft schließlich von ihrem Kummer überwältigt ein. Mit den ersten Strahlen der Morgendämmerung aber kommt eine Einsicht, die ihr erlaubt, den eigenen Egoismus zu überwinden. Einmal mehr durchlebt sie in Gedanken die Szene des Vortages, kann nun aber mit einem klaren Blick jedes Detail überprüfen, und begreift, dass diese nicht nur sie allein betrifft. Die Einsicht, dass sie auch die Situation der anderen Frau in ihre Beurteilung miteinbeziehen muss, lässt blinde Eifersucht in Mitgefühl umschwingen. Die zwischen ihr und Rosamond bestehende Verbindung zu Will verpflichtet sie regelrecht, die andere Frau als von ihr unabhängig anzuerkennen. Der Großmut, mit dem Dorothea daraufhin Rosamond nochmals aufsucht, hat zur Folge, dass auch sie bereit ist, Verantwortung für das von ihr mitverschuldete Missverständnis anzunehmen. Das offene Gespräch zwischen den beiden Frauen führt dazu, dass jede für sich einen Ausweg aus der emotionalen Verwirrung findet, in die sie ihre Selbstbezogenheit verstrickt hat.
Unsere Aufmerksamkeit wird somit einerseits auf die sozialen Beschränkungen gelenkt, die einer tatkräftigen Frau in der Zeit vor der Parlamentsreform auferlegt wurden. Diese Reform drang 1832 in die Gemeinde ein und begleitet als politischer Unterton die einzelnen Schicksale. Bei dem hart umkämpften Gesetz wurden die Wahlbezirke neu eingeteilt und die Zahl der Wähler erweitert. Es ging darum, eingefahrene Standesunterschiede aufzuweichen. Zwar wurden die Frauen von dieser Parlamentsreform gänzlich ausgeschlossen, doch nachträglich lässt sich mutmaßen: Damals wurden die Weichen so gestellt, dass ein Jahrhundert später auch die Engländerinnen das Stimmrecht erhalten.
Wir werden zugleich aber auch auf die leise Hoffnung aufmerksam, die George Eliot dennoch – oder eben deshalb – in die weibliche Wirkungsmacht legt. Eingeleitet hatte sie ihren Sittenroman mit dem Denkbild einer modernen Heiligen Theresa, die in ein Leben in der Provinz geboren worden ist, in dem sie keine Gelegenheit hat, eine gesellschaftliche Transformation in Gang zu setzen. Am Ende kommt George Eliot auf das Bild der in Vergessenheit geratenen Frau zurück, deren Taten unbemerkt bleiben. Es mag sein, dass Dorotheas edler Geist für ihre Nachtwelt nicht sichtbar geblieben ist, doch die Wirkung ihres Wesens auf ihre Mitmenschen darf nicht unterschätzt werden. Anrührend und beunruhigend zugleich klingt der letzte Satz des Romans: »Und dass es um den Leser und mich nicht so schlecht steht, wie es sein könnte, das verdanken wir zur Hälfte den zahlreichen Menschen, die voll gläubigen Vertrauens ein Leben im Verborgenen geführt haben und in Gräbern ruhen, die kein Mensch besucht.« Diese Lobeshymne an all jene anonymen Frauen, welche unter dem Radar der Geschichtsschreibung tätig waren, dient keinem Ruf nach revolutionärer Reform. Es gilt vielmehr, in den Worten und Handlungen dieser unbeachteten Frauen eine eigene Kraft zur Erneuerung zu entdecken. Deren Nachhaltigkeit besteht darin – und eben das ist es, wozu sie uns als Leserinnen verpflichtet – dass wir uns nachträglich an diese Unbekannten erinnern, und sei es in der Gestalt erfundener Heldinnen.
GEORGE ELIOT
Middlemarch
Vorspiel
Wer von uns, der sich sehr für die Geschichte des Menschen interessiert und dafür, wie sich die geheimnisvolle Mischung unter den verschiedenartigen Experimenten verhält, welche die Zeit mit jener anstellt, hat sich nicht schon, zumindest kurz, mit dem Leben der Heiligen Therese beschäftigt, hat nicht milde gelächelt bei dem Gedanken daran, wie das kleine Mädchen eines Morgens Hand in Hand mit ihrem noch kleineren Bruder auszog, um im Lande der Mauren das Martyrium zu suchen? Mit großen Augen und hilflosem Blick anzusehen wie zwei Rehkitze, aber mit Menschenherzen, die schon für eine nationale Idee schlugen, so trotteten sie hinaus aus dem trutzigen Avila, bis die Realität des Alltags ihnen in der Gestalt von Onkeln entgegentrat und sie von ihrem großen Entschluss abbrachte. Diese Kinderwallfahrt war ein angemessener Anfang. Thereses leidenschaftliche, aufs Ideale gerichtete Natur verlangte nach einem Leben wie in einem höfischen Roman: Was bedeuteten ihr vielbändige Ritterromanzen und die gesellschaftlichen Eroberungen eines klugen Mädchens? Ihre Flamme verzehrte diesen leichten Brennstoff schnell und sehnte sich, von innen genährt, nach grenzenloser Erfüllung, einem Ziel, bei dem Ermüdung keine Entschuldigung war und das die Verzweiflung an sich selbst durch das verzückte Bewusstsein von einem Leben jenseits des eigenen Ich versöhnte. Sie fand ihren Roman in der Reform eines geistlichen Ordens.
Diese spanische Frau, die vor 300 Jahren lebte, war natürlich nicht die Letzte ihrer Art. Viele Theresen wurden geboren, die für sich kein solch heldenhaftes Leben fanden, in dem eine unablässige Entfaltung weitreichender Taten Platz gefunden hätte; vielleicht nur ein Leben voller Fehler, Frucht einer gewissen geistigen Größe, die nur schlecht zu den mittelmäßigen Gelegenheiten passte; vielleicht ein tragisches Scheitern, das keinen geweihten Sänger fand und so unbeklagt der Vergessenheit anheimfiel. Bei trübem Licht und inmitten wirrer Verhältnisse versuchten sie, Gedanken und Tat in edle Harmonie zu bringen; doch erschienen ihre Kämpfe gewöhnlichen Augen letzten Endes bloß nicht stimmig und ohne Form; denn diesen späteren Theresen half kein geschlossenes soziales Credo und Gefüge, die für die inbrünstige Seele anstelle von Wissen treten mochten. Ihre Leidenschaft schwankte zwischen einem vagen Ideal und den üblichen Sehnsüchten einer Frau; so wurde das eine als Überspanntheit verworfen, das andere als Entgleisung verurteilt.
Einige waren der Meinung, dass ein mit derartigen Makeln behaftetes Leben aus der lästigen Vagheit herrührt, mit der der Allmächtige das Wesen der Frau ausgestattet hat. Gäbe es nur einen Grad weiblicher Inkompetenz, der so genau bestimmbar wäre wie die Unfähigkeit, weiter als bis drei zu zählen, so könnte man das gesellschaftliche Los der Frauen mit wissenschaftlicher Zuverlässigkeit abhandeln. Indes bleibt ihre Vagheit bestehen, und die Grenzen für Vielfalt sind in Wirklichkeit viel weiter gezogen, als man es sich angesichts der Gleichförmigkeit der weiblichen Haartracht und der populären Liebesromane in Prosa und Vers vorstellen mag. Hier und da wächst unbehaglich ein junger Schwan inmitten der kleinen Entlein auf dem braunen Teich heran und findet nie zum lebendigen Strom in Gemeinschaft mit seinen eigenen ruderfüßigen Artgenossen. Hier und da wird eine Heilige Therese geboren, Begründerin von nichts, deren liebevolle Herzschläge und Seufzer in Sehnsucht nach einem unerreichten Guten verklingen und zwischen den Hindernissen sich zerstreuen, anstatt in eine Tat zu münden, die noch lange sichtbar bliebe.
erstesbuch
MISS BROOKE
Kapitel 1
[Daß ich], wenn ich, als ein Frauenzimmer, nichts Gutes von mir hoffen lassen darf, dennoch den Willen habe, diesem Guten in einem gewissen Grade nahe zu kommen.
Beaumont und Fletcher, Die Braut, IV/i
Miss Brooke besaß jene Art von Schönheit, die durch ärmliche Kleidung offenbar besonders zur Geltung kommt. Hand und Armgelenk waren so makellos geformt, dass sie Ärmel tragen konnte, die nicht weniger schlicht waren als jene, in denen die Jungfrau Maria den italienischen Malern erschien; und ihr Profil wie ihre Figur und ihr Auftreten schienen durch ihre schmucklose Kleidung an Würde nur noch zu gewinnen, was ihr im Verhältnis zu kleinstädtischer Mode die Eindrücklichkeit eines gewählten Zitats aus der Bibel – oder eines von einem unserer älteren Dichter – in einem Zeitungsabsatz von heute verlieh. Man sagte ihr gemeinhin bemerkenswerte Klugheit nach, freilich mit dem Zusatz, ihre Schwester Celia habe mehr gesunden Menschenverstand. Nichtsdestoweniger trug auch Celia kaum mehr Zierrat, und nur für genaue Beobachter unterschieden sich ihre Kleider von denen ihrer Schwester und hatten in der Art, wie sie zusammengestellt waren, einen Hauch von Koketterie. Denn Miss Brookes einfache Kleidung hatte ihren Grund in verschiedenen Umständen, von denen die meisten auch ihre Schwester betrafen. Der Stolz darauf, Damen zu sein, hatte etwas damit zu tun: Die Verwandtschaft der Brookes, zwar nicht eigentlich aristokratisch, war doch fraglos »von Rang«: Ging man zwei oder drei Generationen zurück, so fand sich kein Vorfahr, der etwa Stoffe abgemessen oder Pakete geschnürt hätte – eigentlich nichts unter einem Admiral oder einem Geistlichen; es ließ sich sogar ein Ahn ausmachen, der als puritanischer Edelmann unter Cromwell gedient hatte, später allerdings der Staatskirche beigetreten und aus all den politischen Wirren als Eigentümer eines ansehnlichen Familienbesitzes hervorgegangen war. Junge Frauen solcher Herkunft, die in einem ruhigen Landhaus wohnten und eine Dorfkirche besuchten, die kaum größer war als ein Salon, betrachteten modischen Firlefanz ganz natürlich als die Ambitionen einer Krämerstochter. Ferner gehörte es damals zur guten Erziehung, zur Sparsamkeit zu mahnen, die in jenen Tagen zuallererst an der Kleidung Abstriche machte, wann immer Geldmittel für Ausgaben benötigt wurden, welche die gesellschaftliche Stellung besser hervortreten ließen. Solche Gründe hätten ausgereicht, um schlichte Kleidung zu erklären, ganz abgesehen vom religiösen Empfinden. Im Falle von Miss Brooke jedoch wäre schon die Religion allein entscheidend dafür gewesen, und Celia fügte sich sanft allen Maßgaben ihrer Schwester, erfüllte sie jedoch nur mit jenem gesunden Menschenverstand, der bedeutsame Doktrinen ohne jede übertriebene Aufregung annimmt. Dorothea kannte viele Stellen aus Pascals Pensées1 und von Jeremy Taylor2 auswendig, und für sie waren, wenn man sie mit dem künftigen Schicksal der Menschheit verglich und im Lichte der Christenheit betrachtete, die Sorgen um die Frauenmode eher eine Beschäftigung für das Irrenhaus. Sie konnte die Besorgnisse eines geistigen Lebens, das die Bedeutung für die Ewigkeit in sich barg, nicht mit einem heftigen Interesse für Spitzen und wallenden Faltenwurf vereinbaren. Ihr Geist war aufs Theoretische gerichtet und sehnte sich in seiner Veranlagung nach einer irgendwie erhabenen Weltauffassung, in der aber problemlos auch die Pfarrgemeinde Tipton und ihre eigenen Verhaltensgrundsätze untergebracht werden konnten. Kraft und Größe entzückten ihr Herz, und kurz entschlossen nahm sie alles in sich auf, was ihr diese Eigenschaften zu besitzen schien. Es entsprach ihrem Charakter, das Martyrium zu suchen, sich wieder davon abzukehren und dann doch das Martyrium auf einem Feld zu erleiden, wo sie es gar nicht gesucht hatte. Natürlich beeinflussten derartige Wesenszüge, gerade bei einem heiratsfähigen Mädchen, nur zu leicht ihr Geschick und verhinderten, dass es in der üblichen Weise von gutem Aussehen, Eitelkeit und bloßer unterwürfiger Liebe bestimmt wurde. Bei all dem war sie, die ältere der Schwestern, noch nicht einmal zwanzig, und beide waren sie, seit sie mit ungefähr zwölf Jahren ihre Eltern verloren hatten, nach eng begrenzten und zugleich bunt durcheinandergewürfelten Vorstellungen zuerst bei einer englischen und dann bei einer schweizerischen Familie in Lausanne erzogen worden; ihr lediger Onkel und Vormund versuchte auf diese Weise, die Nachteile, die aus ihrem Waisenstatus erwuchsen, auszugleichen.
Es war gerade ein Jahr vergangen, seit sie nach Tipton Grange gekommen waren, um bei ihrem Onkel zu wohnen, einem Mann nahe sechzig mit nachgiebigem Charakter, gemischten Ansichten und wankelmütigem Wahlverhalten. In seinen jüngeren Jahren war er gereist, und man glaubte in dieser Gegend der Grafschaft, er habe sich dabei eine allzu sprunghafte Denkweise zugelegt. Mr. Brookes Schlussfolgerungen ließen sich ebenso schwer voraussagen wie das Wetter: Mit Sicherheit konnte man lediglich sagen, dass er in wohlwollender Absicht handeln und bei der Durchführung so wenig Geld wie möglich ausgeben würde. Denn hartnäckig vage Geister halten gerne an Gewohnheiten fest, und so mochte jemand durchaus bei allem nachlässig sein, was ihn anging, außer bezüglich seiner Schnupftabakdose, die er wachsam und misstrauisch in Reichweite zu halten pflegte.
Bei Mr. Brooke war der traditionelle, puritanische Hang zur Tatkraft deutlich in der Schwebe; bei seiner Nichte Dorothea aber drang er durch alle Fehler und Tugenden glühend hindurch und geriet bisweilen zur Ungeduld über das Geschwätz ihres Onkels oder seine Art, auf dem Gut »die Dinge laufen zu lassen«; das ließ sie nur noch mehr die Zeit herbeisehnen, wo sie volljährig sein würde und über etwas Geld für großzügige Projekte verfügen könnte. Sie galt als Erbin, denn nicht nur hatten die Schwestern 700 Pfund im Jahr von ihren Eltern, sondern, wenn Dorothea heiraten und einen Sohn haben würde, so würde dieser Sohn Mr. Brookes Besitz erben, der vermutlich 3000 Pfund im Jahr abwarf – eine Pachtsumme, die den Familien in der Provinz wie ein Reichtum vorkam; hier diskutierte man noch über Mr. Peels3 jüngste Stellungnahme in der katholischen Frage und hatte noch keine Ahnung von künftigen Goldfeldern und von jener prunkvollen Geldaristokratie, die die Bedürfnisse eines vornehmen Lebens so stattlich in die Höhe getrieben hatte.
Und warum sollte Dorothea nicht heiraten? – ein so hübsches Mädchen mit solchen Aussichten? Nichts konnte das verhindern, außer ihre Vorliebe für das Außergewöhnliche und ihr Vorsatz, ihr Leben nach Vorstellungen auszurichten, die einen vorsichtigen Mann zum Zögern veranlassen konnten, ehe er ihr einen Antrag machte, oder sie sogar dazu bringen mochten, überhaupt alle Anträge abzulehnen. Eine junge Frau von einigem Rang und Vermögen, die plötzlich auf dem Steinboden neben einem kranken Arbeiter niederkniete und voll Hingabe betete, als glaubte sie, zur Zeit der Apostel zu leben –, die den launenhaften Einfall hatte, wie eine Papistin zu fasten, und die des Nachts lang aufblieb, um alte theologische Bücher zu lesen! Eines schönen Morgens könnte so eine Frau einen mit einem neuen Projekt für die Anlage ihres Vermögens aufwecken, das mit der politischen Ökonomie und der Haltung von Reitpferden unvereinbar wäre: Ein Mann würde es sich natürlich zweimal überlegen, ehe er eine solche Gemeinschaft riskierte. Bei Frauen erwartete man keine festen Überzeugungen; überhaupt bestand die beste Garantie für Gesellschaft und Familienleben darin, dass man überhaupt nicht nach seinen Überzeugungen handelte. Vernünftige Leute taten, was ihre Nachbarn taten, sodass man Verrückte, falls irgendwelche auf freiem Fuße wären, erkennen würde und ihnen aus dem Weg gehen konnte.
Man neigte in der ländlichen Nachbarschaft, selbst unter den Pächtern, allgemein Celia zu, denn sie war so liebenswürdig und wirkte so unschuldig, während Miss Brookes große Augen wie auch ihre Religion wirklich gar zu ungewöhnlich und auffällig erschienen. Arme Dorothea! Verglichen mit ihr war die unschuldig wirkende Celia schlau und weltklug; der menschliche Geist ist um so vieles subtiler als das äußere Gewebe, das eher eine Art Wappen oder Zifferblatt für ihn abgibt.
Doch wer Dorothea näherkam, der fand, wiewohl von solch erschreckendem Hörensagen gegen sie eingenommen, dass sie einen Charme besaß, der unerklärlicherweise damit vereinbar war. Die meisten Männer hielten sie für bezaubernd, wenn sie zu Pferd saß. Sie liebte die frische Luft und die abwechslungsreiche Landschaft, und wenn ihre Augen und Wangen vor Vergnügen glühten, so sah sie nur wenig einer Eiferin gleich. Reiten war eine Schwäche, die sie sich trotz einiger Gewissensbisse erlaubte; sie merkte, dass sie es auf heidnisch sinnliche Weise genoss, und freute sich immer darauf, dem zu entsagen.
Sie war offen, enthusiastisch und nicht im Geringsten von sich eingenommen. Ja, es war eigentlich reizend anzusehen, wie sie in ihrer Phantasie ihre Schwester Celia mit Reizen ausstattete, die weit über ihren eigenen standen, und wenn je ein Herr auftauchte, der offenbar aus anderen Gründen auf das Gut gekommen war, als Mr. Brooke zu besuchen, so schloss sie daraus, er müsse sich in Celia verliebt haben: zum Beispiel Sir James Chettam, den sie unablässig von Celias Standpunkt aus betrachtete und dabei im Innern mit sich diskutierte, ob es gut für Celia wäre, seinen Heiratsantrag anzunehmen. Dass er eigentlich um sie warb, hätte sie als lächerlich abgetan. Dorothea hatte bei all ihrem Streben, die Wahrheiten des Lebens kennenzulernen, noch recht kindliche Vorstellungen von der Ehe. Sie war sich sicher, dass sie den weisen Hooker4 akzeptiert hätte, wäre sie rechtzeitig zur Welt gekommen, um ihn vor jenem unglücklichen Fehler zu bewahren, den er durch seine Heirat begangen hatte; oder John Milton5, als seine Erblindung fortgeschritten war; oder irgendeinen der anderen großen Männer, deren seltsame Angewohnheiten zu ertragen glorreiche Christenpflicht gewesen wäre. Aber ein liebenswürdiger, gut aussehender Landadeliger, der »Ganz recht« auf ihre Bemerkungen erwiderte, selbst wenn sie Ungewissheit zum Ausdruck brachte – wie konnte der auf sie als Liebhaber Eindruck machen? In einer wahrhaft bezaubernden Ehe war der Gatte eine Art Vater und konnte einem Hebräisch beibringen, falls man es wünschte.
Diese Eigenheiten in Dorotheas Charakter führten dazu, dass Mr. Brooke bei den benachbarten Familien nur noch mehr dafür getadelt wurde, dass er für seine Nichten nicht eine Dame mittleren Alters als Beraterin und Gefährtin eingestellt hatte. Doch er selbst fürchtete diesen Typ überlegener Frauen, der für eine solche Anstellung verfügbar gewesen wäre, sodass er es zuließ, sich von Dorotheas Einwänden überzeugen zu lassen, und er war in diesem Fall tapfer genug, der Welt zu trotzen – das heißt Mrs. Cadwallader, der Frau des Stadtpfarrers, und der kleinen Gruppe von Landadeligen, mit denen er im Nordosten von Loamshire Umgang pflegte. So stand Miss Brooke dem Haushalt ihres Onkels vor, und ihr missfielen die damit verbundene neue Autorität und Ehrerbietung durchaus nicht.
Heute sollte Sir James Chettam zum Essen aufs Gut kommen zusammen mit einem anderen Herrn, den die Mädchen noch nie gesehen hatten und um dessentwegen Dorothea ehrfürchtige Erwartungen hegte. Es war dies Reverend Edward Casaubon, in der Grafschaft bekannt als ein Mann von profunder Bildung, dem Vernehmen nach schon seit vielen Jahren mit einem großen Werk über Religionsgeschichte befasst; außerdem ein Mann von ausreichendem Vermögen, um seiner Frömmigkeit Glanz zu verleihen, und mit eigenen Ansichten, die nach der Veröffentlichung seines Buches klarer hervortreten sollten. Schon sein Name hatte etwas Beeindruckendes, das ohne eine genaue Kenntnis der Wissenschaftsgeschichte kaum recht ermessen werden konnte.
Schon früh am Tag war Dorothea vom Kindergarten, den sie im Dorf eingerichtet hatte, zurückgekehrt und nahm gerade ihren gewohnten Platz in dem hübschen Wohnzimmer ein, das die Schlafzimmer der Schwestern trennte, eifrig damit beschäftigt, einen Plan für ein paar Gebäude zu beenden (eine Arbeit, die sie entzückte); da meinte Celia, die sie mit zögerndem Verlangen, ihr etwas vorzuschlagen, beobachtet hatte:
»Liebe Dorothea, wenn es dir nichts ausmacht – wenn du nicht sehr beschäftigt bist –, wie wäre es, wenn wir uns heute Mamas Juwelen ansehen und unter uns aufteilen würden? Es ist heute genau sechs Monate her, seit Onkel sie uns gegeben hat, und du hast sie noch nicht einmal angeschaut.«
Auf Celias Gesicht lag ein leichtes Schmollen, ein richtiges Schmollen wurde jedoch aus gewohnheitsmäßiger Scheu vor Dorothea wie auch aus Prinzip unterdrückt – zwei miteinander verbundene Dinge, die, wenn unvorsichtigerweise berührt, einen geheimnisvollen Stromschlag auslösen konnten. Zu ihrer Erleichterung lachten Dorotheas Augen, als sie aufblickte.
»Was bist du doch für ein wunderbarer kleiner Kalender, Celia. Waren es sechs kalendarische oder lunarische Monate?«
»Heute ist der 1. September, und Onkel hat sie dir am 1. April gegeben. Du weißt, er sagte, er habe sie bis dahin vergessen. Ich glaube, du hast nie mehr an sie gedacht, seit du sie hier in der Kommode eingeschlossen hast.«
»Nun, meine Liebe, eigentlich sollten wir sie ja nie tragen.« Dorotheas Stimme klang voll und herzlich, halb wie eine Liebkosung, halb wie eine Erklärung. Sie hielt ihren Stift in der Hand und zeichnete winzige Skizzen auf den Rand des Blattes.
Celia errötete und sah sehr ernst aus. »Ich glaube, meine Liebe, wir lassen es etwas an Respekt für Mamas Andenken fehlen, wenn wir sie beiseitelegen und nicht beachten. Und«, fügte sie nach kurzem Zögern hinzu, und ein verschämter Seufzer stieg in ihr hoch, »Halsketten trägt man jetzt allgemein; und selbst Madame Poinçon, die in manchen Dingen sogar noch strenger war als du, trug durchaus Schmuck. Und Christen überhaupt – sicher gibt es jetzt Frauen im Himmel, die einmal Juwelen getragen haben.« Celia war sich einer gewissen geistigen Kraft bewusst, wenn sie sich richtig um Argumente bemühte.
»Du würdest sie gern tragen?«, rief Dorothea aus, und ein Ausdruck des Erstaunens über diese Entdeckung versetzte sie in eine exaltierte Lebhaftigkeit, die sie eben von jener Madame Poinçon mit dem Schmuck übernommen hatte. »Ja, dann wollen wir sie natürlich hervorholen. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Aber die Schlüssel, die Schlüssel!« Sie drückte die Hände an ihre Schläfen und schien an ihrem Gedächtnis zu verzweifeln.
»Die sind hier«, sagte Celia, die sich diese Erörterung schon lange überlegt und vorbereitet hatte.
»Bitte mach die große Schublade der Kommode auf und hole die Schmuckkassette heraus.«
Das Kästchen stand bald offen vor ihnen, und die verschiedenen Juwelen waren vor ihnen ausgebreitet und bildeten auf dem Tisch ein leuchtendes Beet. Es war keine große Sammlung, aber es waren bemerkenswerte Stücke darunter; das schönste, das sofort ins Auge fiel, war ein Halsband aus purpurnen Amethysten in erlesener Goldfassung und ein Kreuz aus Perlen und fünf Brillanten. Dorothea nahm das Halsband sogleich hoch und legte es ihrer Schwester um den Hals, wo es fast so eng anlag wie ein Armband; aber das ringförmige Band passte zum Henrietta-Maria-Stil6 von Celias Kopf und Hals, und im gegenüberliegenden Wandspiegel konnte sie das auch sehen.
»Da, Celia! Du kannst das zu deinem einfachen Musselinkleid tragen. Aber dieses Kreuz musst du zu deinen dunklen Kleidern anlegen.«
Celia bemühte sich, nicht vor Entzücken zu lächeln. »Oh, Dodo, das Kreuz musst du behalten.«
»Nein, nein, Kind, nein«, sagte Dorothea und hob ihre Hand in schwacher Missbilligung.
»Doch, du musst. Es würde dir stehen – jetzt in deinem schwarzen Kleid«, beharrte Celia. »Das könntest du gut tragen.«
»Um nichts in der Welt, um nichts in der Welt. Ein Kreuz wäre das Letzte, das ich als Schmuck tragen würde.« Dorothea erschauerte leicht.
»Dann findest du, es ist verwerflich, wenn ich es trage?«, meinte Celia unsicher.
»Nein, Kind, nein«, wehrte Dorothea ab und streichelte ihrer Schwester über die Wange. »Auch Seelen haben ihr Äußeres; was der einen steht, steht nicht unbedingt der anderen.«
»Aber vielleicht möchtest du es als Andenken an Mama behalten.«
»Nein, ich habe andere Sachen von Mama – ihre Sandelholzschachtel, die ich so mag – viele Sachen. Wirklich, es gehört alles dir, Liebes. Wir brauchen darüber nicht mehr zu reden. Da – nimm dein Eigentum.«
Celia fühlte sich ein wenig gekränkt. In dieser puritanischen Duldung lag ein großer Überlegenheitsdünkel, der für die blonde Sinnlichkeit einer religiös weniger eifrigen Schwester fast so unerträglich war wie puritanische Verdächtigung.
»Aber wie kann ich Schmuck tragen, wenn du als die ältere Schwester nie welchen trägst?«
»Na, Celia, das wäre zu viel verlangt, dass ich Tand anlegen soll, nur damit es bei dir schicklich ist. Wenn ich so ein Halsband anlegen würde, käme ich mir vor, als hätte ich eine Pirouette gedreht. Mir würde schwindelig vor Augen, und ich wüsste nicht, wie ich laufen soll.«
Celia hatte das Halsband aufgemacht und abgelegt. »Es wäre ein wenig eng für deinen Hals; etwas Längeres, das weiter herunterhinge, würde dir besser stehen«, meinte sie mit einiger Genugtuung. Die Tatsache, dass sich das Halsband für Dorothea nicht eignete, von welcher Seite man es auch betrachtete, vermehrte nur Celias Glück, es anzunehmen. Sie öffnete einige Kästchen mit Ringen, die einen schönen Smaragd mit Diamanten bargen, und gerade in diesem Augenblick warf die Sonne einen hellen Strahl hinter einer Wolke hervor auf den Tisch.
»Wie wunderschön diese Edelsteine sind«, sagte Dorothea, von einem neuerlichen Gefühlsstrom erfasst, der ebenso plötzlich kam wie der Sonnenstrahl. »Es ist seltsam, wie tief die Farben in einen einzudringen scheinen, wie ein Duft. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb Edelsteine als spirituelle Embleme bei der Offenbarung des Heiligen Johannes verwendet werden. Sie sehen aus wie Himmelssplitter. Ich glaube, dieser Smaragd ist der schönste von allen.«
»Und da ist auch ein passendes Armband«, sagte Celia. »Wir haben es zuerst gar nicht bemerkt.«
»Sie sind herrlich«, sagte Dorothea, streifte sich Ring und Armband auf einen ihrer wohlgeformten Finger und das Handgelenk und hielt sie in Augenhöhe gegen das Fenster. Die ganze Zeit versuchte sie, in Gedanken ihr Entzücken an den Farben zu rechtfertigen, indem sie es mit ihrem mystischen religiösen Entzücken verschmolz.
»Die würden dir sicher gefallen, Dorothea«, meinte Celia stockend; sie begann, sich darüber zu wundern, dass ihre Schwester eine Schwäche zeigte, und sie dachte auch daran, dass die Smaragde zu ihrem eigenen Teint sogar noch besser passen würden als die purpurnen Amethyste. »Du musst wenigstens den Ring und das Armband behalten.. Aber schau mal, diese Achate sind sehr hübsch – und schlicht.«
»Ja! Ich werde beides behalten – Ring und Armband«, sagte Dorothea. Dann ließ sie ihre Hand auf den Tisch fallen und meinte in anderem Ton: »Aber wie elend sind doch die Menschen, die solche Sachen finden, daran arbeiten und sie verkaufen!« Sie hielt wieder inne, und Celia glaubte, ihre Schwester sei drauf und dran, den Schmuck wieder abzulehnen, was sie jetzt folgerichtig hätte tun müssen.
»Ja, Liebes, ich werde diese hier behalten«, sagte Dorothea entschlossen. »Aber nimm du alles andere weg, auch das Kästchen.«
Sie griff wieder zum Stift, ohne die Schmuckstücke abzulegen, und sah sie immer noch an. Sie dachte daran, dass sie sie oft anhaben wollte, um ihre Augen an diesen kleinen Quellen reinster Farbe zu laben.
»Wirst du sie in Gesellschaft tragen?«, fragte Celia, die ihr Tun mit aufrichtiger Neugier verfolgte.
Dorothea warf ihrer Schwester einen raschen Blick zu. In das liebevolle Bild, das sie in Gedanken von all denen, die sie liebte, zeichnete, drängte sich ab und zu eine scharfe Erkenntnis, die etwas Verletzendes an sich hatte. Sollte Miss Brooke je makellose Sanftmut erreichen, dann nicht ohne inneres Feuer.
»Vielleicht«, sagte sie etwas hochmütig. »Ich weiß nicht, wie tief ich noch sinken werde.«
Celia errötete und war unglücklich; sie sah, dass sie ihre Schwester beleidigt hatte, und wagte nun nicht, etwas Nettes über den geschenkten Schmuck zu sagen, den sie in die Schachtel zurücklegte und wegtrug. Auch Dorothea war unglücklich, als sie an ihren Plänen weiterzeichnete, und stellte die Reinheit ihres eigenen Gefühls und ihrer Rede in der Szene, die mit diesem kleinen Gefühlsausbruch geendet hatte, in Frage.
Celias Gewissen sagte ihr, dass sie überhaupt nicht im Unrecht war: Es war nur natürlich und durchaus gerechtfertigt, dass sie diese Frage gestellt hatte, und sie wiederholte vor sich, dass Dorotheas Verhalten widersprüchlich sei: Sie hätte entweder ihren vollen Anteil am Schmuck nehmen sollen, oder aber sie hätte nach allem, was sie gesagt hatte, auf alles verzichten müssen.
»Ich bin sicher – ich glaube es wenigstens fest«, dachte Celia, »dass mich ein Halsband nicht beim Beten stört. Und ich sehe nicht ein, dass ich durch Dorotheas Meinung gebunden sein soll, jetzt, wo wir in die Gesellschaft eingeführt werden, obwohl sie selbst natürlich daran gebunden sein sollte. Aber Dorothea ist nicht immer konsequent.«
Soweit Celia, stumm über ihre Stickerei gebeugt, bis sie hörte, wie ihre Schwester nach ihr rief.
»Hier, Kitty, komm und sieh dir meinen Plan an. Ich halte mich schon für eine große Architektin, wenn ich nicht an der falschen Stelle Treppen und Kamine hineingezeichnet habe.«
Als Celia sich über das Blatt Papier beugte, lehnte Dorothea ihr Kinn zärtlich gegen den Arm ihrer Schwester. Celia begriff ihre Geste. Dorothea sah, dass sie unrecht gehabt hatte, und Celia verzieh ihr. Solange sie denken konnten, lag in Celias Haltung der älteren Schwester gegenüber stets eine Mischung von Kritik und Scheu. Die Jüngere hatte stets ein Joch getragen; aber gibt es ein unterjochtes Wesen ohne eigene Meinung?
Kapitel 2
«Dime; no ves aquel caballero que hácia nostros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro?» «Lo que veo y columbro,» respondió Sancho,«no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra.» «Pues ése es el yelmo de Mambrino,» dijo Don Quijote.
»Siehst Du nicht den Ritter dort, der uns auf einem Apfelschimmel entgegenkommt und einen Goldhelm auf dem Kopf trägt?« »Was ich von hier aus sehe und erspähe«, entgegnete Sancho, »ist nichts weiter als Mann auf einem graubraunen Esel, ganz wie der meine, und auf dem Kopf trägt er etwas Glänzendes.« »Nun, das ist der Helm des Mambrin«, sagte Don Quijote.
Miguel de Cervantes, Don Quijote, Kap. 21
»Sir Humphrey Davy?«, fragte Mr. Brooke, als er bei der Suppe in seiner ungezwungenen, lächelnden Art Sir James Chettams Bemerkung, er studiere gerade Davys Elemente der Agrikultur-Chemie7, aufnahm. »Je nun, Sir Humphrey Davy: Ich habe mit ihm vor Jahren einmal bei den Cartwrights gespeist; Wordsworth war auch da – Sie wissen, der Dichter Wordsworth. Das war schon einzigartig. Ich war in Cambridge, als Wordsworth auch da war, und ich habe ihn nie getroffen – und dann habe ich zwanzig Jahre später mit ihm bei den Cartwrights gespeist. Also es gibt schon seltsame Sachen. Aber Davy war da: Auch er war ein Dichter. Oder ich will mal sagen, Wordsworth war Dichter Nummer eins und Davy Dichter Nummer zwei. Das traf eigentlich in jeder Hinsicht zu.«
Dorothea fühlte sich etwas unbehaglicher als sonst. Das Essen hatte gerade begonnen, die Gruppe war klein, und es war still im Raum, da fielen diese Körnchen aus der geistigen Vorratskammer eines Magistraten allzu sehr auf. Sie fragte sich, wie ein Mann wie Mr. Casaubon derartige Trivialitäten ertragen würde. Sein Gebaren erschien ihr würdevoll: Der Schnitt seines stahlgrauen Haares und die tiefen Augenhöhlen ließen ihn wie das Porträt John Lockes8 aussehen. Er hatte die hagere Figur und die bleiche Gesichtshaut, die einem Gelehrten anstanden – ein größtmöglicher Kontrast zum Typ des blühenden Engländers mit rotem Schnurrbart, wie ihn Sir James Chettam vertrat.
»Ich lese gerade die Elemente der Agrikultur-Chemie«, sagte dieser vortreffliche Baronet, »weil ich im Begriff stehe, einen der Bauernhöfe selber in die Hand zu nehmen, um zu sehen, ob man nicht etwas erreichen kann, wenn man den Pächtern ein Beispiel für gute Landwirtschaft gibt. Stimmen Sie dem zu, Miss Brooke?«
»Es ist ganz falsch, Chettam«, warf Mr. Brooke ein, »Ihre Äcker mit Elektrizität ausstatten zu lassen oder so und aus Ihrem Kuhstall einen Salon machen zu wollen. Das wird nicht klappen. Ich habe mich selbst einmal sehr mit den Naturwissenschaften beschäftigt; aber ich habe gesehen, das klappt nicht. Das führt zu allem Möglichen; man darf nichts sich selbst überlassen. Nein, nein – sehen Sie zu, dass Ihre Pächter nicht ihr Stroh verkaufen und so weiter, und sorgen Sie für die richtige Drainage, wissen Sie? Aber Ihre Musterwirtschaft wird nicht klappen – das ist so ziemlich das teuerste Spielzeug, das man sich denken kann; genauso gut können Sie sich eine Hundemeute halten.«
»Sicherlich«, meinte Dorothea, »ist es doch besser, man gibt Geld dafür aus, herauszufinden, wie man sich das Land am meisten zunutze macht, das alle ernährt, als für Hunde und Pferde, die nur darüber hinweggaloppieren. Es ist keine Sünde, sich mit Experimenten arm zu machen, die dem Wohle aller dienen.«
Sie sprach mit mehr Nachdruck, als man es von einer so jungen Dame erwartet hätte, aber Sir James hatte sich ja an sie gewandt. Er tat das für gewöhnlich, und sie hatte schon oft bei sich gedacht, sie könnte ihn zu vielen guten Taten drängen, wenn er erst einmal ihr Schwager sein würde.
Mr. Casaubon richtete den Blick sehr betont auf Dorothea, während sie sprach, und schien sie von Neuem zu beobachten.
»Wissen Sie, junge Damen haben keine Ahnung von politischer Ökonomie«, sagte Mr. Brooke lächelnd zu Mr. Casaubon. »Ich erinnere mich daran, wie wir alle Adam Smith9 gelesen haben. Das ist ein Buch! Ich habe mal all die neuen Ideen in mich aufgenommen. – Vervollkommnung des Menschen und so weiter. Aber manche sagen, die Geschichte verläuft kreisförmig; und dafür lassen sich ganz gute Gründe finden; ich habe selbst einmal solche Gründe gehabt. Es ist doch so, dass die menschliche Vernunft einen ein bisschen zu weit führen kann – ganz schön ab vom Schuss. Hat mich mal ganz hübsch weit gebracht: Aber ich habe gesehen, es klappt nicht. Da habe ich die Bremse gezogen; rechtzeitig. Aber nicht zu fest. Ich war immer schon für ein bisschen Theorie. Wir brauchen Ideen; sonst landen wir wieder im finsteren Mittelalter. Aber wo wir gerade von Büchern reden; da gibt es Southeys Spanischen Unabhängigkeitskrieg10.Ich lese das gerade morgens. Sie kennen Southey?«
»Nein«, sagte Mr. Casaubon, der mit Mr. Brookes wildem Gedankengang nicht Schritt hielt und nur an das Buch dachte. »Ich habe gerade wenig Muße für solche Literatur. Ich habe meine Augen kürzlich beim Entziffern alter Schriftzeichen überanstrengt; ich brauche eigentlich einen Vorleser für meine Abende. Aber bei Stimmen bin ich wählerisch, und ich kann es nicht ertragen, einem unvollkommenen Vorleser zuzuhören. In gewisser Hinsicht ist das ein Unglück. Ich nähre mich zu sehr von inneren Quellen; ich lebe zu sehr bei den Toten. Mein Geist ist wie der Geist aus alter Zeit: Er wandert in der Welt umher und versucht, sie in der Vorstellung so aufzubauen, wie sie einmal war, trotz des Verfalls und der verwirrenden Veränderungen. Ich halte es aber für notwendig, äußerste Vorsicht walten zu lassen, was mein Augenlicht anlangt.«
Es war das erste Mal, dass Mr. Casaubon etwas länger gesprochen hatte. Er drückte sich sehr präzise aus, als sei er aufgerufen worden, eine öffentliche Erklärung abzugeben. Und der abgewogene, zierliche Singsang seiner Rede, der gelegentlich von einer Bewegung seines Kopfes begleitet war, unterschied sich umso deutlicher von der abgehackten Schludrigkeit des guten Mr. Brooke. Dorothea sagte sich, Mr. Casaubon sei der interessanteste Mann, den sie je getroffen habe, Monsieur Liret sogar eingeschlossen, dem Geistlichen aus dem Waadt, der Vorträge über die Geschichte der Waldenser gehalten hatte. Eine vergangene Welt zu rekonstruieren, zweifellos mit Blick auf den höchsten Sinn und Zweck der Wahrheit – was für eine Aufgabe, bei einem solchen Werk dabei zu sein, mitzuhelfen, sei es auch nur, indem man die Lampe hielt! Dieser erhebende Gedanke trug sie über ihren Ärger darüber hinweg, dass sie wegen ihrer Unwissenheit in politischer Ökonomie aufgezogen worden war, jener nie erklärten Wissenschaft, die man wie einen Kerzenlöscher über all ihre Gedankenblitze stülpte.
»Sie reiten aber gern, Miss Brooke.« Sir James ergriff sogleich die Gelegenheit, etwas zu sagen. »Ich könnte mir vorstellen, Sie sollten auch ein wenig ins Jagdvergnügen einsteigen. Ich wollte, Sie ließen mich Ihnen einen Braunen herüberschicken, damit Sie es probieren können. Er ist für den Damenritt abgerichtet. Letzten Samstag habe ich Sie auf einem Klepper über den Hügel galoppieren sehen, der Ihrer nicht wert war. Mein Knecht wird Ihnen Croydon jeden Tag bringen, wenn Sie nur die Zeit nennen wollten.«
»Ich danke Ihnen, Sie sind sehr freundlich. Ich habe vor, das Reiten aufzugeben. Ich werde nicht mehr reiten«, erwiderte Dorothea, die zu dieser abrupten Entscheidung durch eine kleine Verärgerung darüber getrieben wurde, dass Sir James sich gerade dann um ihre Aufmerksamkeit bemühte, als sie sie ganz Mr. Casaubon zuwenden wollte.
»Nein, das ist zu hart«, meinte Sir James mit vorwurfsvollem Ton, in dem tiefe Anteilnahme durchklang. »Ihre Schwester neigt wohl dazu, sich zu kasteien?«, fuhr er fort, wobei er sich an Celia wandte, die zu seiner Rechten saß.
»Ich glaube schon«, antwortete Celia; sie war besorgt, etwas zu sagen, was ihrer Schwester missfallen könnte, und errötete, so hübsch es nur ging, über ihrem Halsband. »Sie liebt es, sich in Verzicht zu üben.«
»Wenn das wahr wäre, Celia, würde ich mit meinem Verzicht doch innersten Wünschen nachgeben und mich nicht kasteien. Es könnte jedoch gute Gründe dafür geben, sich dafür zu entscheiden, etwas sehr Angenehmes nicht zu tun«, meinte Dorothea.
Mr. Brooke sprach zur selben Zeit auch, aber es war offenkundig, dass Mr. Casaubon Dorothea beobachtete, und sie war sich dessen bewusst.
»Genau«, sagte Sir James. »Sie verzichten aus einem hohen, großmütigen Motiv heraus.«
»Nein, eigentlich nicht. Ich habe das nicht von mir behauptet«, erwiderte Dorothea und errötete. Anders als Celia errötete sie selten und nur vor höchstem Entzücken oder Ärger. In diesem Augenblick war sie böse auf den aufdringlichen Sir James. Warum wandte er seine Aufmerksamkeit nicht Celia zu und ließ sie Mr. Casaubon lauschen? Wenn dieser gelehrte Mann nur reden würde, anstatt Mr. Brooke auf sich einreden zu lassen, der ihn gerade darüber informierte, dass die Reformation entweder etwas bedeutete oder nicht, dass er bis ins Mark Protestant sei, dass aber der Katholizismus nun einmal da sei; und was die Frage anlange, ob man für den Bau einer römisch-katholischen Kapelle den Boden verweigern solle – schließlich brauche jeder Mensch die Zügel der Religion, die genau genommen eigentlich nur die Furcht vor dem Leben nach dem Tode sei.
»Ich habe einmal intensiv Theologie studiert«, sagte Mr. Brooke, als wollte er die Einsichten, die er soeben an den Tag gelegt hatte, erklären. »Ich weiß von allen Schulen etwas. Ich kannte Wilberforce11 in seiner besten Zeit. Kennen Sie Wilberforce?«
Mr. Casaubon sagte: »Nein.«
»Na, Wilberforce war vielleicht nicht der größte Denker. Aber wenn ich ins Parlament ginge, und man hat mich schon darum gebeten, dann würde ich bei den Parteilosen12 sitzen, wie damals Wilberforce, und mich philanthropischen Aufgaben widmen.«
Mr. Casaubon verbeugte sich und bemerkte, das sei ein weites Feld. –
»Ja«, stimmte Mr. Brooke mit gefälligem Lächeln zu, »aber ich habe Unterlagen. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen, Unterlagen zu sammeln. Sie müssen geordnet werden; aber immer wenn mich eine Frage gepackt hat, habe ich an jemanden geschrieben und auch Antwort bekommen. Ich verfüge über Unterlagen. Wie ordnen Sie eigentlich Ihre Unterlagen?«
»Zum Teil in Ablagefächern«, gab Mr. Casaubon zur Antwort, etwas überrascht und mit einiger Anstrengung.
»Ah, mit Ablagefächern klappt es nicht. Ich habe sie ausprobiert, aber dabei geht alles durcheinander: Ich weiß nie, ob ein Papier unter A oder Z liegt.«
»Ich wünschte, du würdest mich deine Papiere für dich ordnen lassen, Onkel«, warf Dorothea ein. »Ich würde ein jedes mit Buchstaben versehen und dann ein alphabetisches Sachregister davon anlegen.«
Mr. Casaubon lächelte würdevoll und zustimmend und meinte zu Mr. Brooke: »Wie ich sehe, haben Sie eine ausgezeichnete Sekretärin zur Hand.«
»Nein, nein«, widersprach Mr. Brooke und schüttelte den Kopf. »Ich kann es nicht zulassen, dass junge Damen sich in meine Unterlagen einmischen. Junge Damen sind da zu unberechenbar.«
Dorothea war gekränkt. Mr. Casaubon würde glauben, ihr Onkel hätte einen besonderen Grund, diese Meinung kundzutun, während die Bemerkung doch nur leicht wie ein abgebrochener Flügel eines Insekts unter all den anderen Bruchstücken in seinem Geist herumlag und von einem zufälligen Windstoß nun eben ihr zugeweht worden war.
Als die beiden Mädchen allein im Salon waren, meinte Celia: »Wie hässlich Mr. Casaubon doch ist.«
»Celia! Er ist eine der bedeutendsten Erscheinungen, die ich je unter Männern gesehen habe. Er sieht dem Porträt von Locke außerordentlich ähnlich. Er hat die gleichen tiefen Augenhöhlen.«
»Hatte Locke auch zwei weiße Muttermale mit Haaren?«
»Oh, vermutlich, wenn gewisse Leute ihn angesehen haben«, sagte Dorothea und entfernte sich ein paar Schritte.
»Mr. Casaubon sieht so bleich aus.«
»Umso besser. Ich nehme an, du liebst Männer mit der Hautfarbe eines cochon de lait13.«
»Dodo!«, rief Celia und sah sie erstaunt an. »Ich habe noch nie einen solchen Vergleich von dir gehört.«
»Warum sollte ich ihn verwenden, ehe sich eine Gelegenheit dazu bot? Der Vergleich ist gut; er passt hervorragend.«
Miss Brooke vergaß sich offensichtlich; so kam es auch Celia vor.
»Ich wundere mich über deine Gereiztheit, Dorothea.«
»Das ist an dir so unangenehm, Celia, dass du die Menschen meist anschaust, als wären sie Tiere im Frack, und nie die erhabene Seele im Gesicht eines Menschen siehst.«
»Hat Mr. Casaubon eine erhabene Seele?« Celia fehlte es nicht an einem Hauch naiver Boshaftigkeit.
»Ja, ich glaube, die hat er«, sagte Dorothea entschieden. »Alles, was ich in ihm sehe, passt zu seinem Traktat über die biblische Kosmologie.«
»Er spricht sehr wenig«, meinte Celia.
»Es ist niemand da, mit dem er sprechen könnte.«
Celia dachte bei sich: »Dorothea verachtet Sir James Chettam völlig; ich glaube, sie würde seinen Heiratsantrag nicht annehmen.« Celia hielt das für schade. Sie hatte sich nie darüber getäuscht, wem das Interesse des Baronets galt. Manchmal kam ihr allerdings der Gedanke, Dodo würde nie einen Mann glücklich machen, der nicht ihre Ansichten teilte. Und tief im Herzen regte sich zaghaft das Gefühl, dass ihre Schwester zu religiös für ein gemütliches Familienleben sei. Ahnungen und Zweifel sind wie verstreute Nadeln: Man traut sich nicht aufzutreten, sich zu setzen oder auch nur zu essen.
Als Miss Brooke am Teetisch saß, kam Sir James, um sich neben sie zu setzen: Er hatte die Art, wie sie ihm geantwortet hatte, nicht im Geringsten als kränkend empfunden. Warum sollte er? Er hielt es für wahrscheinlich, dass Miss Brooke ihn mochte, und ein Verhalten muss schon sehr deutlich sein, bis es nicht mehr von vorgefassten Meinungen, entweder wohlwollender oder misstrauischer Natur, ausgelegt wird. Sie war vollkommen reizend zu ihm, aber natürlich hatte er auch ein paar theoretische Gründe dafür, dass er sich zu ihr hingezogen fühlte. Die Natur hatte ihn großzügig bedacht, und er hatte den seltenen Vorzug, genau zu wissen, dass seine Talente, selbst wenn sie ungehindert ihren Lauf nehmen könnten, keinen müden Hund hinter dem Ofen hervorlocken würden. Daher gefiel ihm die Vorstellung von einer Frau, zu der er hier und da würde sagen können: »Was sollen wir machen?«, die ihren Mann mit Argumenten versorgen konnte und dazu auch noch mit Vermögen ausgestattet war. Und was diese übertriebene Religiosität betraf, die man Miss Brooke nachsagte, sie würde sich mit der Heirat schon legen. Kurz, er glaubte sich mit seiner Liebe am rechten Ort und war bereit, ein gerüttelt Maß an Überlegenheit zu dulden, die ein Mann schließlich jederzeit unterdrücken konnte, wenn er wollte. Sir James fiel es jedoch keineswegs ein, jemals die Überlegenheit dieses hübschen Mädchens unterdrücken zu wollen, dessen Klugheit ihn entzückte. Warum nicht? Der Geist eines Mannes – jedenfalls so weit vorhanden – hat eben stets den Vorzug, männlich zu sein – so wie die kleinste Birke immer noch von höherer Art ist als eine noch so hochwachsende Palme – und selbst seine Unwissenheit ist von soliderer Qualität. Sir James hatte dieses Urteil nicht selber erfunden; doch eine gütige Vorsehung versorgt auch die banalste Persönlichkeit mit ein wenig Stoff und Kleister in Form von Tradition.
»Lassen Sie mich hoffen, dass Sie Ihren Entschluss wegen des Pferdes wieder zurücknehmen werden, Miss Brooke«, sagte der beharrliche Verehrer. »Ich versichere Ihnen, Reiten ist der gesündeste Sport.«
»Ich weiß«, erwiderte Dorothea kühl. »Ich glaube, Celia würde es guttun – wenn sie nur Gefallen daran fände.«
»Aber Sie sind doch eine so exzellente Reiterin.«
»Verzeihen Sie, aber ich hatte nur sehr wenig Übung und könnte zu leicht abgeworfen werden.«
»Umso mehr Grund, weiter zu üben. Jede Dame sollte eine perfekte Reiterin sein, damit sie ihren Gatten begleiten kann.«
»Da sehen Sie, wie sehr wir uns unterscheiden, Sir James. Ich habe mich entschlossen, keine perfekte Reiterin zu sein, also werde ich nie Ihrem Ideal einer Dame entsprechen.« Dorothea blickte geradeaus vor sich hin und redete kühl und schroff, ganz so wie ein hübscher Junge, was in erheiterndem Kontrast zu der betulichen Liebenswürdigkeit ihres Verehrers stand.
»Ich würde gern Ihre Gründe für diesen grausamen Entschluss erfahren. Sie halten doch wohl das Reiten nicht für etwas Unrechtes?«
»Es ist durchaus möglich, dass ich es für mich selbst für etwas Unrechtes halte.«
»Aber warum?«, fragte Sir James sanft vorwurfsvoll.
Mr. Casaubon war mit seiner Teetasse in der Hand an den Tisch gekommen und hörte zu.
»Wir sollten nicht allzu neugierig in Motive dringen«, warf er in seiner gemessenen Art ein. »Miss Brooke weiß, dass sie leicht an Kraft verlieren, sobald man sie ausspricht: Das Aroma mischt sich mit der raueren Luft. Wir müssen den keimenden Samen vor Licht schützen.«
Dorothea errötete vor Entzücken und blickte dankbar zum Sprecher auf. Hier war ein Mann, der das höhere innere Leben verstand und mit dem eine Gemeinsamkeit auf geistigem Gebiet möglich wäre, ja, der ein Prinzip mit umfassendstem Wissen erhellen könnte: ein Mann, dessen Gelehrsamkeit fast schon als Beweis all dessen genügte, was er glaubte!
Dorotheas Folgerungen mögen gewaltig erscheinen; doch könnte das Leben nie und nimmer weitergehen ohne diese großzügigen Schlussfolgerungen, welche die Ehe unter den schwierigen Bedingungen der Zivilisation überhaupt erst ermöglicht haben. Hat schon einmal jemand das weit ausgespannte Spinnennetz vorehelicher Bekanntschaft auf seinen eigentlich winzigen Extrakt reduziert?
»Natürlich«, gab der gute Sir James zu. »Wir wollen Miss Brooke selbstverständlich nicht drängen, ihre Gründe zu verraten, wenn sie sie lieber für sich behalten will. Ich bin sicher, sie würden ihr zur Ehre gereichen.«
Er hegte nicht die geringste Eifersucht, weil Dorothea voll Interesse auf Mr. Casaubon geblickt hatte: Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass ein Mädchen, dem er einen Heiratsantrag zu machen gedachte, sich für einen ausgetrockneten Bücherwurm von fast fünfzig Jahren interessieren konnte, außer natürlich auf religiösem Gebiet, wie eben für einen Geistlichen von einigem Rang.
Als jedoch Miss Brooke mit Mr. Casaubon ein Gespräch über den Klerus im Waadt führte, begab sich Sir James zu Celia und sprach mit ihr über ihre Schwester, sprach von einem Haus in der Stadt und fragte, ob Miss Brooke etwas gegen London habe. In einiger Entfernung von ihrer Schwester redete Celia ganz unbeschwert, und Sir James sagte sich, die zweite Miss Brooke sei sicher sehr angenehm und ebenfalls hübsch, wenn auch nicht klüger und sensibler als ihre ältere Schwester, wie manche behaupteten. Er spürte, er hatte die in jeder Hinsicht überlegenere Frau gewählt; und ein Mann freut sich naturgemäß darüber, wenn er das Beste hat. Ein Heuchler14, wer da behauptete, er würde nicht genau das erwarten.
Kapitel 3
Sprich, Göttin, was geschah, als Raphael,Der milde Engel […]
Er hatte aufmerksamMit seiner Gattin Eva zugehört,Und saß verwundert und gedankenvoll.Zu fremd war, zu unfaßlich seinem SinnWas er vernahm.
John Milton, Das Verlorene Paradies, Buch VII
Sollte es Mr. Casaubon wirklich in den Sinn gekommen sein, Miss Brooke als geeignete Ehefrau in Betracht zu ziehen, so waren die Gründe, die sie dazu hätten veranlassen können, seinen Heiratsantrag anzunehmen, bereits in ihren Geist gesät, und schon am Abend des folgenden Tages waren ebendiese Gründe zu Knospen und Blüten gereift. Denn sie hatten am Vormittag ein langes Gespräch miteinander geführt, während Celia, die die Gesellschaft von Mr. Casaubons Muttermalen und Blässlichkeit nicht mochte, in das Pfarrhaus geflüchtet war, um mit den zwar schlechtbeschuhten, aber lustigen Kindern des Vikars zu spielen.
Dorothea hatte inzwischen tief in das noch unausgelotete Reservoir von Mr. Casaubons Geist geblickt und dort in unklarer labyrinthischer Ausdehnung jede Eigenschaft, die sie selbst mitbrachte, widergespiegelt gesehen; sie hatte ihm viel von ihren eigenen Erfahrungen eröffnet und hatte durch ihn von der Reichweite seines großen Werkes vernommen, das gleichfalls von anziehend labyrinthischem Ausmaß war. Er war nämlich ebenso lehrreich gewesen wie Miltons »leutseliger Erzengel«. Und etwa in der Art des Erzengels erzählte er ihr, wie er zu zeigen unternommen hatte (was zwar vor ihm schon versucht worden sei, freilich ohne jene Gründlichkeit, jene Angemessenheit des Vergleichs und jene wirkungsvolle Anordnung, die Mr. Casaubon anstrebte), dass alle mythischen Systeme oder die über die Welt verstreuten mythischen Fragmente nur Verfälschungen einer einmal ursprünglich geoffenbarten Überlieferung waren. Hatte man einmal den wahren Ausgangspunkt errungen und darauf fest Fuß gefasst, so würde das weite Feld der Mythenkonstruktionen einsichtig, ja hell erleuchtet vom Licht, das sich in den Übereinstimmungen widerspiegelte. Doch diese große Ernte an Wahrheit einzubringen war keine leichte oder schnelle Arbeit. Seine Notizen machten bereits eine gewaltige Reihe von Bänden aus, doch die krönende Aufgabe würde es sein, diese umfangreichen und immer noch anwachsenden Ergebnisse zu komprimieren, bis sie, wie bei der Leseernte der hippokratischen Bücher15, auf ein kleines Bücherbrett passten. Als Mr. Casaubon dies Dorothea erklärte, drückte er sich beinahe so aus wie vor einem Fachkollegen, denn er beherrschte nicht zwei verschiedene Sprechstile: Sicher, wenn er einen griechischen oder lateinischen Satz verwendete, so lieferte er stets mit äußerster Sorgfalt auch die englische Übersetzung, aber das hätte er vermutlich in jedem Fall getan. Ein gelehrter Landgeistlicher hält seine Bekannten gewöhnlich für »Herren, Ritter und andere adelig und würdig Männer, die wisseten Latein gar wenig«.16
Dorothea war ganz und gar eingenommen von der umfassenden Weite dieses Plans. Hier war etwas, das über die seichte Literatur der Mädchenpensionate hinausging; hier war ein lebender Bossuet17, dessen Werk vollständiges Wissen mit ergebener Frömmigkeit vereinen würde; hier war ein moderner Augustinus, der den Ruhm eines Gelehrten und eines Heiligen vereinte.
Seine Heiligkeit schien nicht weniger ausgeprägt als seine Gelehrsamkeit, denn als Dorothea das Bedürfnis verspürte, ihre Gedanken über gewisse Themen zu eröffnen, über die sie mit niemandem, den sie bislang in Tipton getroffen hatte, sprechen konnte – insbesondere über die untergeordnete Bedeutung der kirchlichen Formen und Glaubensartikel verglichen mit jener geistigen Religion, jenem Eintauchen des Ich in die Gemeinschaft mit der Vollkommenheit Gottes, die für sie in den besten christlichen Schriften längst vergangener Zeiten Ausdruck gefunden hatte –, fand sie in Mr. Casaubon einen Zuhörer, der sie sofort verstand, der sie seiner Zustimmung zu dieser Ansicht versichern konnte, so sie gebührend durch weise Rechtgläubigkeit gemäßigt war, und der historische Beispiele beibringen konnte, die ihr bisher unbekannt waren.
»Er denkt wie ich«, sagte sich Dorothea, »oder vielmehr, sein Denken ist eine ganze Welt, von der mein Denken nur ein billiges Spiegelbild ist. Und dann sein Fühlen, seine ganze Erfahrung – was für ein See verglichen mit meinem kleinen Tümpel!«