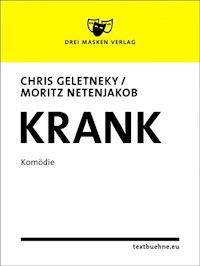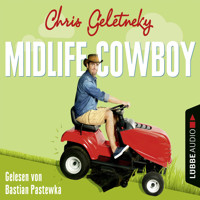
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein denkwürdiger Moment auf seinem Rasentraktor macht Tillmann klar, dass er in einer ausgewachsenen Midlife-Crisis steckt. Wann genau sind seine ambitionierten Träume bloß zu diesem Spießerleben mit Reihenhaus und Gartenteich mutiert? Eins steht fest - er muss dringend etwas ändern! Prompt schlittert er in eine Affäre, die ausgerechnet an seinem 10. Hochzeitstag auffliegt. Und als er versehentlich ein Video veröffentlicht, das Tausende Beziehungen zerstört, hasst ihn außer seiner Frau jetzt auch noch der Rest der Welt. So hatte sich Tillmann sein neues Leben irgendwie nicht vorgestellt ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 32 min
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog: Das Naseneisen
1. Mein Rasentraktor und ich
2. Der Kükenmörder von Hannover-Ricklingen
3. Einmal crazy Berlin und zurück
4. Dosenwerfen, Heimvideo, Krebsvorsorge
5. Tortenjagd im FettinghansPark
6. Spieglein, Spieglein an der Wand
7. Bodyshaping für Larissa Ley
8. Joggen mit dem Heckenpenner
9. Vegetarischer Rock'n'Roll
10. Mit Larissa im Olymp
11. Der lesbische Pumpgriechen-Bruder
12. Die Geister des Grand Budapest Hotels
13. Wie angelt man sich eine Anglerin?
14. Eine Affäre zum Spa-Tarif
15. Dirty Dancing in Franz Liszt
16. Alles im Fluss!
17. Rückkehr in die Musterfamilie
18. Der Scheiße-Tsunami rollt langsam an
19. Thick as a Brick
20. Gipfeltreffen im FertighausPark
21. The day after
22. Folgen Sie dem rosa Flamingo!
23. Im Dorf der einsamen Seelen brennt noch Licht
24. Eine Ex-Musterhaussiedlung
25. Endlich YouTube-Star
26. Ein Freund, ein guter Freund ...
27. Klaus, der Frosch und der Skorpion
28. Zurück in die Zukunft
Danksagung
Internetlinks
Chris Geletneky
MIDLIFE COWBOY
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock /Oleksandr Lysenko, © getty-images/Karan Kapoor und © getty-images/Logorilla E-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2417-4
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Iris, Bela, Fanny und Lia – die lauteste, lustigste und beste Familie unseres Sonnensystems.Und für meine Mutter Henni.
»Glück ist was für Arschlöcher. Glück braucht immer nur der, der nix auf dem Kasten hat.«
PROLOG DAS NASENEISEN
»Der Mensch ist ein Schüler, Schmerz ist sein Lehrer.«
ALFRED DE MUSSET
Und bitte einmal freundlich lächeln!«
Ich drehte mich um. Gereon hielt mir sein iPhone vors Gesicht und drückte auf den Auslöser. Ich versuchte mich wegzuducken, aber mein Reaktionsvermögen war momentan ungefähr so gut wie das einer Lederschildkröte nach einem Whisky-Tasting.
Gereon betrachtete das Ergebnis auf seinem Display und nickte anerkennend. »Sehr schön. Das kann ich gut als Vorher-Bild für meinen Artikel über Gesichtsrekonstruktionen gebrauchen. Wenn Sie mal schauen möchten?«
Er hielt mir das Foto vor die Nase. Leider hatte er nicht übertrieben – ich sah einfach nur erbärmlich aus. Die verschorfte Platzwunde in der Mitte meiner Stirn, das inzwischen lila angelaufene Auge, die gebrochene Nase, die geschwollene und verschorfte Lippe, der stark gerötete Wangenknochen, der unter dem Ausläufer meines falschen Barts zu erkennen war, die Schürfwunden an Kinn und Stirn … Wenn das nicht ich gewesen wäre, dem ich da in die ramponierte Hackfresse schaute, ich hätte wahrscheinlich selber gelacht. Aber leider war das ich, oder jedenfalls das, was von mir übrig war.
Draußen prasselte der Regen gegen die große Panoramascheibe von Gereons Behandlungszimmer. Gereon wandte sich ab und holte etwas aus einer Schublade seines Nussbaumschranks, der in der Ecke des Raumes stand. Ich kniff die Augen zusammen, um das Ding gegen das blendende Weiß seines Polohemdes zu erkennen: eine etwa dreißig Zentimeter lange Stange, vielleicht fingerdick, mit löffelartigen Rundungen an beiden Enden.
»Setz dich auf den Stuhl da. Und versuch bitte, ihn nicht vollzubluten! Das Teil hat achttausend Euro gekostet, dafür muss ein alter Schönheitschirurg so manchen Arsch absaugen! Und nimm endlich deinen albernen Bart ab – du siehst aus wie Conchita Wurst nach einem Kampf gegen beide Klitschkos.«
Ich humpelte zum Behandlungsstuhl und zog langsam meinen falschen Bart ab. Der Kleber riss ein paar nachgewachsene echte Barthaare aus ihren Wurzeln – aber diese Art von Schmerz nahm ich schon gar nicht mehr wahr.
»Was ist das?«, fragte ich Gereon und deutete auf den seltsamen Riesen-Eislöffel in seiner Hand.
»Oh, das ist ein Naseneisen – damit werde ich deine Nase wieder richten! Die ist nämlich gebrochen.«
»Ja, das hab ich auch schon gemerkt.«
»Und warum kommst du damit ausgerechnet zu mir? Soll ich dir vielleicht ein süßes Stupsnäschen machen? Oder willst du größere Brüste?« Gereon zwickte mir scherzhaft in die linke Brust.
Ich versuchte seine Hand wegzuwischen, war aber zu langsam.
»Sehr lustig, Gereon. Ich war gerade bei einem richtigen Arzt in der Innenstadt – wegen meiner gebrochenen Rippen. War sogar eine Ärztin. Aber die Irre hat mich erkannt und mir eine Kopfnuss verpasst!«
»Was? Echt? Dann hat ihr Typ bestimmt auch dein Video gesehen! Interessant!«
»Ja, wahnsinnig interessant«, brummte ich düster und starrte weiter auf die seltsame Stange in Gereons Hand.
Allmählich bastelte mein Gehirn aus dem, was ich sah, und dem Begriff Naseneisen ein Szenario zusammen, das etwas äußerst Beunruhigendes an sich hatte. Ich versuchte, es zu verdrängen, aber es gelang mir nicht. Die Gedanken falteten sich auseinander wie ein Transformer vor Shia La Beouf, und genau wie er war auch ich dazu verdammt, mit einer Mischung aus Angst und Faszination dabei zuzusehen, wie sich vor mir das Grauen zusammensetzte.
»Pass auf!«, sagte Gereon, stellte sich vor mich und wippte in seinen weißen Lederslippern auf und ab. »Gibt jetzt zwei Behandlungsmöglichkeiten. Die eine ist schmerzvoll, aber kurz …«
»Ich nehm die andere!«, rief ich so schnell und laut ich konnte.
»Ja, das hab ich mir gedacht. Das hieße aber, dass du ins Krankenhaus in stationäre Behandlung müsstest. Und ich behaupte mal, dass auch dort mindestens ein Arzt oder Pfleger dabei ist, dessen Beziehung du mit deinem beknackten Video ebenfalls in Schutt und Asche gelegt hast. Und eventuell hast du nach deinem Aufenthalt dann gar keine Nase mehr!«
Ich stöhnte. »Du machst deine Brust-OPs doch auch mit Vollnarkose – kann ich nicht …«
»Tillmann! Dann muss ich einen OP mieten – das kostet ein Vermögen! Der Spuk hier dauert zwanzig Sekunden. Das tut einmal ein bisschen weh, und das war’s dann. Gut, zweimal. Und vielleicht ist ›ein bisschen‹ auch nicht ganz die richtige Umschreibung.«
Es klopfte an die Tür.
»Ja!«, bellte Gereon laut, und seine Arzthelferin Heidrun kam herein, eine stämmige Frau mittleren Alters mit gütigen Augen und einer ausladenden Achtzigerjahre-Betonfrisur, die in ihrem Leben bestimmt schon so manche Containerladung Haarspray aufgesaugt hatte.
Gereon ging Schwester Heidrun lächelnd entgegen und legte kumpelhaft den Arm um ihre Schultern. »Heidrun, können Sie sich das vorstellen: Der Herr Klein hat sich für eine Nasenrichtung ohne Narkose entschieden! Ist das nicht mutig?«
Schwester Heidruns kleine Augen weiteten sich voller Bewunderung, Staunen und Fassungslosigkeit. »Uiuiui – das ist aber wirklich sehr tapfer von Ihnen!«
Gereon setzte ein breites Grinsen auf und verschwand dann aus dem Zimmer.
»Am besten, Sie lehnen sich erst mal zurück und versuchen, sich so gut wie möglich zu entspannen, Herr Klein«, sagte sie sanft, und ich versuchte im Rahmen meiner Möglichkeiten, ihren Anweisungen zu folgen.
»Ich fand das übrigens klasse, was Sie da in Ihrem Video gesagt haben!«
Ich sah sie erstaunt an. »Oh, danke. Das … sehen nicht alle so …«, sagte ich matt.
»Na ja, das sind halt die Leute, die erwischt wurden. Ändert ja nichts daran, dass es stimmt, was Sie gesagt haben. Und das finde ich mutig!«
»Ich muss aber zugeben, dass ich ziemlich betrunken war, als das Video aufgenommen wurde … Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig …«
»Das ist ja egal«, sagte Heidrun. »Wie sagt man so schön: Kleine Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit!«
Normalerweise hätte ich darauf wahrscheinlich mit einem Scherz über betrunkene kleine Kinder geantwortet, die dann eine Art Superwahrheit sagen müssten, aber dazu war mein Gehirn zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr imstande. Stattdessen stieß ich lediglich ein undefiniertes Krächzen aus.
Schwester Heidrun tätschelte mir die Schulter. »Das wird schon wieder, Herr Klein!«
Dann nahm sie die ersten Tamponagen aus der Petrischale und bat mich, den Kopf nach hinten zu legen. »Das wird jetzt ein klitzekleines bisschen drücken – atmen Sie ab jetzt am besten durch den Mund.«
Heidrun begann, mir Tamponagen in die Nasenlöcher zu stopfen – tief in die Nasenhöhle, erst links, dann rechts, bis ich kaum noch Luft bekam. Als ich gerade einen tiefen Atemzug durch den Mund nehmen wollte, stopfte sie mir die Dinger noch tiefer in die Nase, sodass ich sie im Rachen spürte und würgen musste. So ähnlich mussten sich Mastgänse fühlen, wenn sie genudelt wurden. Und auch in Guantanamo hätte Heidruns Tamponagen-Anwendung bestimmt gute Ergebnisse erzielt.
Als sie fertig war und ich den Kopf wieder hob, sah ich Gereon vor mir stehen. Er hatte eine kleine Ampulle in der Hand.
»Hier, trink das!«
»Wassdas?«, näselte ich.
»Zaubertinktur – das, was die Quacksalber mit den großen Zylindern damals im Wilden Westen von ihren Pferdekarren verkauft haben. Trink einfach!«
Er hielt mir die offene Ampulle an die Lippen, und ich trank. Zum Glück schmeckte ich nichts mehr – ich hatte zu viel Watte im Hals.
»Wschnellwirktndas?«, nuschelte ich noch, als ich schon merkte, dass die Welt um mich herum zu zerlaufen begann wie auf einem Salvador-Dalí-Gemälde. Was für ein Teufelszeug. Einen ähnlichen Effekt hatte ich bis jetzt nur bei dem tschechischen ›Spezial-Absinth‹ erlebt, den Gereon mal von einer Fortbildung in Prag mitgebracht hatte – neben einer saftigen Hepatitis-C-Infektion, von deren Entstehung er uns leider in aller Ausführlichkeit erzählte.
Jetzt sah ich, wie Gereon Heidrun zunickte.
»Weißt du noch, Tillmann? Damals Silvester?«, fragte er, während er mir langsam und so unauffällig wie möglich die Eisenstange in die Nase schob. »Als wir die Pfandkästen aus dem Lager vom Kaiser’s geklaut haben, um uns das Riesen-Böllersortiment zu kaufen?«
»Halls Maul, Geheon – ihweiß, dassudas nur sags, ummich absulenkn, weillu dein blöes Nasneisn …«
»Das ist vollkommen richtig!«, sagte Gereon und riss das Naseneisen mit einer blitzschnellen kräftigen Bewegung in die Höhe.
Ich weiß noch, dass mich das Geräusch daran erinnerte, wie wir als Kinder im Wald waren und trockene Äste über dem Knie zerbrachen.
Dann legte sich Dunkelheit über mich.
Als ich die Augen wieder öffnete, dachte ich für einen kurzen Moment, ich wäre wieder zu Hause in meinem Wohnzimmer bei Sonja, den Kindern und Gustav, und die letzten Wochen seien nur ein böser Traum gewesen. So wie bei Bobby Ewing im bräsigen Finale von Dallas.
Aber im selben Moment spürte ich bereits, wie der Schmerz wie wild in meinem Gesicht pulsierte, und ich schielte herunter auf meine bandagierte Nase.
Gereon musste mich zurück in die Musterhaussiedlung gebracht haben, in der ich mich zuletzt verkrochen hatte – ich saß also nur in dem tristen Duplikat meines richtigen Zuhauses.
Und dann nahm ich noch etwas wahr – das wolllüstige Stöhnen einer Frau in sexueller Ekstase, und zwar aus meiner Hose! Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dann friemelte ich mein Handy aus der Hosentasche und schaute auf das Display. Es war Tom. Wahrscheinlich hatte Gereon ihn instruiert, nachzuhören, wie es mir ging. Als ich endlich ranging, war das Gespräch aber schon wieder weg.
Stöhnend legte ich das Handy auf den Couchtisch, auf dem ein Zettel lag. Ich nahm ihn und las:
Herzlichen Glückwunsch zur neuen Nase. Macht 6000 Euro – wenn du noch’n neuen Arsch dazunimmst, gibt’s 20 % Rabatt. Hahaha! Komme nachher kurz vorbei, um die Bandagen zu wechseln. Und dann lass mal quatschen. Alles wird gut, wirst sehen!
Ich bin wunderschön,
Gruß, Gereon
P.S. Wie gefällt dir dein neuer Klingelton? Selbst aufgenommen! Willst du wissen, wer es ist?
Ich ließ den Zettel fallen, quälte mich vom Sofa hoch und begutachtete mein Spiegelbild in der Terrassentür. Mit dem riesigen Pflaster über der Nase sah ich aus wie Jack Nicholson in Chinatown, nachdem Roman Polanski ihm die Nase aufgeschlitzt hatte. Durch mein Spiegelbild sah ich in der Dämmerung die anderen Musterhäuser – oder vielmehr die Ruinen, die nach dem Brand vor zwei Tagen von den meisten Häusern übriggeblieben waren.
Eine ausgebrannte Ruine – genau das war ich im Grunde auch. In den vergangenen drei Tagen hatte ich alles verloren: meine Familie, meinen Job (gut, das war zu verkraften), viele Freunde und Kollegen, meinen Rasentraktor und die Möglichkeit, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen, ohne Angst haben zu müssen, von wildfremden Menschen ausgiebig die Visage poliert zu bekommen.
Wie zum Teufel war es nur so weit gekommen?
1. MEIN RASENTRAKTOR UND ICH
»Ich würde nie einem Club beitreten, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt.«
GROUCHO MARX
Ich musste der Wahrheit ins Auge sehen: Ich steckte tatsächlich knietief in einer verschissenen Midlife-Crisis.
Als das alles losging, war ich noch neununddreißig Jahre alt und fand mich eigentlich deutlich zu jung für eine Midlife-Crisis. Und glaubte man dem Fernsehen, hätte ich überhaupt keine haben dürfen: Ich hatte mal eine Doku zu dem Thema auf ARTE gesehen, in der man nach neunzig Minuten fundierter öffentlich-rechtlicher Recherche zu dem Schluss kam, dass es so etwas wie eine Midlife-Crisis – zumindest aus medizinischer Sicht – bei Männern gar nicht gebe.
Im Gegenteil: Während bei Frauen, die in die Wechseljahre kämen, der komplette Hormonhaushalt quasi auf den Kopf gestellt werde (was zu den bekannten Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen und dem plötzlichen Interesse an Musicals, Deko-Tinnef aus alten Dachziegeln und Zeitschriften wie Landlust führen kann), bleibe der Testosteron-Spiegel beim Mann zwischen seinem vierzigsten und fünfzigsten Lebensjahr im Prinzip konstant. Er nehme zwar kontinuierlich etwas ab – aber eben nur sehr verhalten und nicht so radikal wie bei den Frauen.
Für die ARTE-Autoren war dies anscheinend der Beweis dafür, dass die männliche Midlife-Crisis im medizinischen Sinn reine Einbildung sei.
Dabei liegt die Erklärung doch auf der Hand: Denn eben weil der Testosteron-Spiegel nahezu konstant bleibt, kommt es bei Männern um die vierzig doch zur Krise.
Dein Hormonhaushalt sagt dir: »Hey, du bist ein zwanzigjähriger Superstecher, der sie alle haben kann!«
Aber dein Spiegelbild antwortet: »Nein. Du bist ein aufgedunsener Spießer mit Bierranzen und Geheimratsecken, der langsam aus dem Leim geht und mittwochs pünktlich die Biotonne auf die Straße schiebt.«
Ist doch logisch, dass das kollidiert und zur Krise führt!
Bei Frauen ist es einfacher. Da sagt der Hormonhaushalt irgendwann: »Mädchen, du hast deine beste Zeit hinter dir.«
Und der Spiegel antwortet: »Jau, kann ich bestätigen.«
Da diese Schere bei uns Männern eben auseinandergeht, drehen wir in dem Alter halt oft am Rad. Ob man das nun Midlife-Crisisnennt oder Sinnkrise, oder ob es einfach heißt »Der Typ hat plötzlich irgendwie einen an der Murmel« – kommt alles aufs Gleiche raus. Irgendwann packt es dich halt bei den Cochones – sofern man noch welche hat.
Ehrlich gesagt kann ich gar nicht mehr genau sagen, wann das bei mir mit der Midlife-Crisis so anfing. Zunächst benennt man das ja nicht. Es ist ja eher so ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Oder besser: dass etwas nicht mehr stimmt. Gepaart mit dem Wunsch, auszubrechen und etwas zu verändern – was auch immer.
Es ist der Moment, in dem sich das ganze Leben plötzlich so anfühlt wie zu enge Schuhe zu tragen, und der Gedanke, man könnte etwas verpassen, so kontinuierlich an einem nagt wie ein Biber an seinem Baum. Dann hat man zwei Möglichkeiten: dem Herrn Biber einen gewaltigen Tritt in sein haariges Hinterteil verpassen – oder ihn nagen lassen und dem Baum beim Fallen zusehen.
Ich tat Letzteres.
Rückblickend betrachtet gab es natürlich genug Anzeichen für eine Midlife-Crisis. Der doofe Bootsführerschein, zu dem ich Gereon, Tom und Guido überredet hatte und den ich seitdem erst ein einziges Mal gebraucht habe (zweistündige Hafenrundfahrt in Roermond). Mein plötzlich auftauchendes Interesse an einem 65er Ford Mustang Fastback, von dem ich plötzlich felsenfest überzeugt war, dass ich ihn kaufen müsste (wovon eigentlich?). Oder auch, dass ich fast jeder Frau auf den Hintern guckte, die jünger als meine eigene war.
Sonja – das ist meine Frau – fiel diese Marotte schon viel früher auf als mir selbst, und sie quittierte sie meist mit einem ungläubigen Blick und den Worten: »Sag mal – geht’s noch?«
Nein, irgendwie ging es eben nicht mehr.
Und da mir langsam die Scherze ausgingen, mit denen ich mich in solchen Momenten rausredete – zum Beispiel »Haste gesehen, das arme Mädchen hatte ’n Beckenschiefstand, schlimm!« oder »Sag mal, war das nicht Beate Zschäpe? Ist die schon draußen?« –, musste ich mich schwer zusammenreißen, wenn ich mit Sonja in der Stadt unterwegs war.
Die Stadt war übrigens Hannover, und wenn mir noch ein Grund gefehlt hätte, in einer Lebens- und Sinnkrise zu stecken – Hannover wäre in die Bresche gesprungen. Dabei passte Hannover im Grunde sehr gut zu mir, denn diese Stadt hatte denselben Ruf wie ich: Sie galt in jeder Beziehung irgendwie als Mittelmaß.
Ich war eins neunundsiebzig groß (so mittelgroß halt), wog neundundachtzig Kilo (okay, das waren vielleicht ein paar zu viel) und sah halbwegs okay aus. Früher galt ich sogar mal als drittheißester Export des Heinrich-Heine-Gymnasiums, aber das war halt auch schon viele Nackenkoteletts und Weizenbiere her. Inzwischen kamen Situationen, in denen sich Frauen reflexartig staunend nach mir umdrehten, jedenfalls eher selten vor.
Und trotzdem war es mir plötzlich unangenehm, wenn Sonja in der Fußgängerzone meine Hand nahm. Als wäre der fünfundzwanzigjährige Superschuss im Tanktop, der uns entgegenkam, dann nicht auf die Idee gekommen, dass der unspektakuläre Typ um die vierzig mit der Bratwurst im Mund zu der hübschen gleichaltrigen Frau mit den vier Einkaufstüten neben ihm gehörte.
Aber ich hatte die Hand lieber frei, und sei es nur, um in Gedanken ein Protestschild darin zu halten, auf dem stand:
Ja, ich bin mit der Frau neben mir irgendwie verheiratet, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch nicht für Monogamie gemacht ist (zumindest nicht der Teil mit dem unterschiedlichen Chromosomenpaar), und deswegen stehe ich erotischen Abenteuern mit jüngeren Frauen per se aufgeschlossen gegenüber.
Darunter dann meine Telefonnummer und die Adresse meiner Webseite: www.seitensprung-mit-tillmann.de
Verdammt, ich schämte mich ja selbst für solche Gedanken. Aber was sollte ich machen? Sie waren nun mal da. Genau wie die ersten grauen Haare, auf die Sonja mich irgendwann mit offensichtlicher Freude aufmerksam machte. Das war einfach nicht fair! Volles schwarzes Haar war bislang das Einzige gewesen, womit ich noch punkten konnte. Und jetzt war selbst das Geschichte. Was war das für ein Gott, der so etwas zuließ?
Der Moment, in dem mir meine Lebenskrise endgültig bewusst wurde, war dann vor drei Wochen.
Ich saß im Garten auf meinem John-Deere-Rasentraktor und bemerkte, wie die Freunde meines Sohnes Jakob aus seinem Zimmerfenster auf mich hinuntersahen – mit einer seltsamen Mixtur aus Belustigung und Mitleid.
Vielleicht war das, was in ihrem Blick lag, aber auch einfach die pure Angst: »Lieber Gott, lass mich nicht zu so einer Wurst werden wie der da!«
In diesem Augenblick wurde mir schlagartig bewusst, was für ein armseliges Bild ich abgeben musste: Ein für seine Größe etwas zu rumsiger Typ sitzt im Jogginganzug mit Kippe im Mund in seinem kleinen Garten auf einem riesigen Rasentraktor, der den Lärm eines Kampfpanzers produziert, und starrt ins Leere. Es war einfach erbärmlich.
Ich hatte gerade beschlossen, meine Mäharbeiten auf unbestimmte Zeit zu verschieben, als plötzlich ein junger DHL-Bote in unserem Garten stand und mir mit einem Paket zuwinkte.
Ich hielt den Traktor an und schaltete ihn in den Leerlauf.
»Hi! Sind Sie Tillmann Klein?«
»Nein«, rief ich zurück. »Ich bin nur der Gärtner! Tillmann Klein ist viel zu reich und erfolgreich, um noch selbst was im Garten zu machen.«
Es sollte natürlich ein Scherz sein, aber der DHL-Bote glaubte es anscheinend. »Echt? Krass …«
Er kam ein paar Schritte auf mich zu und sah sich skeptisch um. »Ich meine, wenn der so viel Kohle hat – warum kauft er sich kein geiles Haus?«
Ich schaltete den Motor aus. Der Typ machte mich irgendwie neugierig.
»Weiß nicht. Vielleicht findet er das Haus ja super?«, entgegnete ich, aber der DHL-Bote grunzte nur.
»Diese Spießerhütte!? Kann ich mir nicht vorstellen! Also, ehrlich gesagt: Ich würde hier nicht tot überm Zaun hängen wollen … Diese ganze Siedlung hier mit diesen Fertighäusern … Jeder hat nur so ’n Handtuchgarten. Und dann der doofe Teich.« Er zeigte abfällig mit dem Paket auf unseren Gartenteich. »Fehlen doch echt nur noch die Gartenzwerge.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wäre gerne wütend geworden, doch stattdessen spürte ich, wie etwas anderes in mir aufstieg: Scham! Tiefe, ehrliche Scham. Trotzdem wollte ich einem Typen, der gerade mal halb so alt war wie ich, nicht kampflos den Sieg überlassen.
»Und als DHL-Bote verdient man so viel Kohle, dass man sich später ein Strandhaus in Malibu Beach kaufen kann?«
Er stieß einen ironischen Kiekser aus. »Nee, überhaupt nicht – die zahlen total beschissen. Aber das is nur ’n Ferienjob für mich. Nach den Sommerferien studier ich in London BWL. Ich will mal richtig fett Kohle machen – damit mir so was hier nicht passiert!« Er drehte seinen Zeigefinger im Kreis.
Dieses kleine Arschloch! Scham hin oder her – am liebsten hätte ich seinen Klugscheißer-Finger spontan ins Mähwerk des John Deere gehalten.
»Tja. Die Geschmäcker sind halt verschieden«, sagte ich bemüht lässig. »Der eine mag ’n Loft in der Stadt lieber, der andere eben so was hier.«
»Ja? Meinen Sie? Ich hab immer das Gefühl, das sind Typen, die irgendwie den Absprung nicht geschafft haben. Oder von ihren Frauen da reingequatscht wurden.« Er ließ sinnierend den Blick über unser Haus wandern. »War bei meinem Bruder auch so: Freundin schwanger geworden, zack wurde geheiratet, und ehe er sichs versehen hat, saß er in ’nem Reihenhaus in ’ner Neubausiedlung in Wolfsburg.«
Er sah mich an und lupfte die Augenbrauen. »Sorry, ich quatsche zu viel.«
»Das stimmt!«, sagte ich, worauf er mich irritiert anschaute. »Ich nehme an, ich soll das Paket annehmen?«
Ich wollte, dass dieser neunmalkluge Fatzke jetzt auf der Stelle verschwand! Oder explodierte. Oder was auch immer.
»Äh, ja, hier unterschreiben, bitte!« Er hielt mir den kleinen grauen Kasten entgegen und drückte mir den Plastikstift in die Hand.
Ich kritzelte undeutlich Fick dich ins Display. Er schaute kurz stirnrunzelnd darauf, dann steckte er das Gerät zurück in seinen Gürtelhalfter.
»Mann, Sie haben vielleicht ’ne Klaue – das sieht fast aus wie ›Fick dich‹.«
»Bin halt nur der Gärtner«, sagte ich.
Und hoffte, dass er jetzt endlich die Biege machen würde.
»Übrigens – kennen Sie die Frau, die hier wohnt?«, fragte er plötzlich.
»Frau Klein? Natürlich – wieso?«
»Alter, die ist mal scharf, oder? Ist ja eigentlich nicht ganz mein Jahrgang, aber bei der würde ich echt ’ne Ausnahme machen!«
»Ja, da würde sie sich sicher freuen.«
Er grinste schmierig und hielt einen Daumen in die Höhe.
»Ich muss jetzt mal weitermachen«, sagte ich unfreundlich, »sonst schlägt mich der Herr Klein wieder!« Ich ließ den Rasentraktor wieder an. »Der Typ ist supercholerisch!«
Dem DHL-Boten fielen die Mundwinkel in den Keller, und er sah sich ängstlich um. Mein Gott, war der Kerl dämlich – aber in London BWL studieren …
»Oh, echt?«, fragte er bräsig. »Tja, ich muss dann auch mal weiter!«
Er grüßte noch mal über die Schulter, dann verschwand er durch den Carport netterweise aus meinem Leben und steuerte langsam, aber zielstrebig auf eine Zukunft voller Britpop, Mixbier und Freunden mit über die Schulter geknoteten Zopfmusterpullis und grünen Barbourjacken zu.
Aber verdammt noch mal, so dämlich er auch war – hatte der DHL-Nervarsch am Ende sogar recht? War ich – wie sein Bruder – der klassische Fall eines Typen, der den Absprung nicht geschafft hatte? Der seine Träume aufgegeben hatte, um in einer Neubausiedlung ein Spießerleben zu führen?
Ich ließ jetzt ebenfalls meinen Blick über unseren Garten wandern – der eigentlich ›viiiiel zu klein‹ für einen Rasentraktor war, wie Sonja, ihr Vater Klaus und auch Guido hartnäckig behauptet hatten, als ich das Ding damals kaufte.
Guido als Inhaber von Walther Gartengeräte tat zwar den ganzen Tag nichts anderes, als solche Geräte an Typen zu verkaufen, die sie eigentlich nicht brauchten. Aber ich bin nun mal einer seiner besten Freunde, und deswegen war er ehrlich zu mir und riet mir vom Kauf ab.
Auf den Rat von Sonjas Vater hörte ich prinzipiell nicht, und deswegen machte ich von meinem Recht Gebrauch, auch seine gut gemeinten Tipps gepflegt zu ignorieren. Weder Guido noch Sonjas Vater mussten ja schließlich unseren Rasen mähen, sondern ich.
Und warum sollte ich eine Stunde lang hinter einem Rasenmäher herlaufen, wenn ich auch eine halbe Stunde lang auf einem sitzen und dabei rauchen, Bier trinken und auf dem Handy rumdaddeln konnte? Außerdem ist nun mal den meisten Männern eine Leidenschaft für motorisierte Fahrzeuge in die Wiege gelegt. Warum sich dagegen wehren?
Natürlich hatten Guido, Klaus und Sonja eigentlich recht: Unser Garten warzu klein für so einen großen Traktor – die weiteste Strecke, die man geradeaus fahren konnte, betrug knapp acht Meter. Eigentlich war ich mit dem Ding ständig nur am Hin- und Her- oder Vor- und Zurückhuddeln. Und natürlich kam man nicht in die Ecken, was in unserem Fall besonders ungünstig war, da unser kleines Eckgrundstück so speziell geschnitten war, dass es im Prinzip nur aus Ecken bestand.
So musste man nach dem eigentlichen Mähen noch mal mindestens die gleiche Zeit aufwenden, um mit einem Kantenschneider das Gras aus den Ecken wegzusäbeln. Oder man ließ es bleiben, und es sah dann halt scheiße aus. Was eher die Regel war. Zudem hatte der Rasentraktor einen Konstruktionsfehler: Er hatte einen relativ langen Vorbau, sodass man vom Fahrersitz aus schlecht sehen konnte, was direkt vor einem auf dem Rasen lag – was wiederum zur Folge hatte, dass ich bei jedem Mähen mindestens zwei Spielzeuge unserer Kinder zerschredderte. Bälle, Frisbees, Plastikgießkannen – irgendwas lag immer im Gras versteckt.
Sonja hatte noch Jahre, nachdem ich uns das Monster in die Garage gestellt hatte, großen Spaß daran, mich damit aufzuziehen, wenn ich gerade wieder laut fluchend vom Traktor sprang, weil sich irgendwas im Mähwerk verfangen hatte.
Sie kam dann in aller Seelenruhe genüsslich mit ihrer Kaffeetasse in der Hand barfuß über den Rasen geschlurft, ein zufriedenes Lächeln im Gesicht, und fragte: »Du, Tillmann? Wenn man jetzt einen ganz normalen Rasenmäher hätte, so einen, wie ihn Guido uns damals empfohlen hat und den alle anderen haben – dann hätte man das doch gesehen, oder?«
Und dann schlurfte sie mit einem noch breiteren Grinsen wieder weg.
Wenn sie Glück hatte, standen dann noch Jakob oder Maya mit entsetztem Gesichtsausdruck auf der Terrasse und erkundigten sich aufgeregt, ob ich wieder eines ihrer Spielzeuge überfahren hätte.
»Ja, das hat er – aber er kauft euch dafür selbstverständlich was Neues!«
Meistens quengelten die Kinder dann so lange, bis ich irgendwann vom Rasentraktor stieg und mit ihnen zum nächsten Spielzeuggeschäft fuhr, während Sonja zwei ruhige Stunden zum Lesen im Garten hatte.
Einmal allerdings hatte ich mich mit dem John Deere fast in die gesellschaftliche Isolation gefahren. Das war im Frühjahr vor drei Jahren. Ein Blaumeisenküken war wohl aus dem Nest gefallen und hüpfte jetzt orientierungslos durch das hohe Gras unseres Gartens, während ich mit dem Rasentraktor unschuldig meine kurzen Bahnen zog, ohne den Kollegen Piepmatz zu bemerken. Plötzlich hörte ich laute Stimmen von der Terrasse und sah Sonja und die Kinder dort stehen, die mich voller Panik anbrüllten.
»Papaaaaaa!«
»Tillmaaaaaann!«
»Der Voooogel!«
Vogel? Was für ein Vogel? Ich überlegte kurz, ob Maya oder Jakob einen Spielzeugvogel hatten. Eigentlich nicht. Oder meinten sie etwa gar keinen Spielzeugvogel …?
Oh, Gott! So schnell ich konnte, latschte ich auf die Bremse des Traktors und stoppte den Motor. Aber es war zu spät.
»Papa, du bist jetzt mein Ernstfeind!«, rief Maya zornig und stampfte wütend auf die Terrassendielen.
Keine Ahnung, wo sie das Wort »Erzfeind« falsch aufgeschnappt hatte.
Dann lief sie mit Jakob ins Haus, und beide sprachen geschlagene drei Wochen kein Wort mehr mit mir. Das war wirklich schlimm.
Noch schlimmer war allerdings Sonjas Reaktion. Wie immer, wenn sie richtig sauer auf mich war, erfolgte die Auseinandersetzung nahezu nonverbal und hauptsächlich mit Blicken. Und was für Blicken! Es war unglaublich, dass diese großen grünen, sonst so unfassbar schönen Augen plötzlich so viel Zorn verströmen konnten.
Aber diesmal garnierte Sonja ihren Todesblick mit einem einzigen Wort: »Kükenmörder!«
Damit drehte sie sich um, ließ mich alleine auf dem Rasen neben dem Tatort stehen und schloss sich meiner familiären Verbannung an.
»Kükenmörder? Ist das dein Ernst?«, rief ich ihr hinterher, aber ich erwartete nicht wirklich eine Antwort – bei Tieren hörte der Spaß für sie auf.
Sonja war schon immer Vegetarierin, aber seit sie den Kindern eine Reportage über Massentierhaltung gezeigt hatte, in der süße Hühnerküken auf einem Laufband in männliche und weibliche sortiert wurden, wobei die weiblichen in eine Kiste »zur Weiterverarbeitung« kamen, die männlichen dagegen auf dem Laufband rechts abbogen und direkt in einen Schredder fuhren, wollten Maya und Jakob – Überraschung! – ebenfalls kein Fleisch mehr essen.
Natürlich hatte sie prinzipiell recht – Massentierhaltung ist eine Riesenschweinerei. Aber dem stand die nüchterne Tatsache gegenüber, dass zum Beispiel die Hähnchen von Amirs Hühnergrill am Baumarkt unfassbar gut schmeckten! Ich liebte die Dinger.
Also ließ ich mir mindestens jeden zweiten Samstag einen Grund einfallen, warum ich nach der Arbeit doch noch mal rasch zum Obi musste, besorgte schnell das, was ich angeblich benötigte, und holte mir dann von Amir zwei Hähnchenschenkel, die ich heimlich im Auto herunterschlang.
Weil es in der Karre dann natürlich tierisch nach Hähnchen stank, ließ ich auf dem Rückweg nach Hause alle Fenster runter. Einmal hatte ich mir dabei im Winter eine Erkältung geholt, die ich dann auf »Zugluft im Büro« schieben musste.
Mein Gott – wie tief war ich eigentlich gesunken, dass ich jetzt schon heimlich im Auto Brathähnchen aß!? Jeder Crack-Junkie ging selbstbewusster mit seiner Sucht um.
Und jetzt hatte ich auch noch höchstpersönlich ein armes Meisenküken mit dem Traktor geschreddert!
Sonja hatte zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einmal wurde ich vor den Kindern als Fleischesser jetzt vollends geächtet, und zweitens konnte sie mir noch ein letztes Mal genüsslich unter die Nase reiben, dass der Kauf des Rasentraktors damals ein Fehler gewesen war.
Das jahrelange Auskosten von Fehlentscheidungen ihrer Partner scheint aber überhaupt in der Natur vieler Frauen zu liegen. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass diese Entscheidungen oft erst einmal entgegen einer gewissen Logik und eher aus einem Bauchgefühl heraus getroffen werden.
Aber hey: Sind das nicht oft die besten Entscheidungen?
Sonja und ich hätten schließlich weder Jakob noch Maya, wenn wir damals auf so etwas wie Logik und Vernunft gehört hätten.
Und hielt ich Sonja ihre eklatanten Fehlentscheidungen etwa genauso penetrant vor wie sie mir meine? Nein, tat ich nicht.
Es war damals ganz klar ein Fehler von ihr gewesen, nach dem Tod ihrer Mutter Ingrid ihr Musikstudium in Hamburg abzubrechen und nach Hannover zurückzukehren, um sich um ihren Vater zu kümmern – ihrem doofen Bruder Magnus, der zu diesem Zeitpunkt in Göttingen Jura studierte, war das offenbar nicht zuzumuten. Also zog Sonja zu ihrem Vater und förderte damit noch dessen ohnehin schon spektakuläre Unselbständigkeit, statt die Gelegenheit zu nutzen, ihn zur Eigenständigkeit zu erziehen.
Das Ende vom Lied war, dass der gute Klaus heute verhätschelter ist denn je und uns mehrfach täglich unangekündigte Besuche abstattet. Entweder, um an irgendwas herumzumäkeln oder aber, um von seiner Tochter das erledigen zu lassen, was vorher siebenunddreißig Jahre lang die arme Ingrid für ihn hatte erledigen müssen – nämlich alles.
Der Mann kann mit seinen dreiundsiebzig Lenzen noch nicht mal alleine eine Kaffeemaschine bedienen. Wozu auch, wenn es zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben jemanden gegeben hat, der das für ihn erledigte?
Eigentlich wäre Hilfe zur Selbsthilfe hier der richtige Weg gewesen: »Klaus, das ist jetzt hart für dich, aber Ingrid ist tot und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben. Aber die gute Nachricht ist: Eine Kaffeemaschine ist gar nicht so kompliziert, wie sie nicht aussieht.«
Doch stattdessen ließ Sonja ihn gewähren, und wir haben neben unseren eigenen beiden Kindern noch ein drittes – und zwar eins, das dreiundsiebzig Jahre alt ist, seinen Michelin-Männchen-artigen Körper bevorzugt ohne Unterwäsche in eine blaue Latzhose und Gummistiefel zwängt und der Welt beweist, dass Altenheime vielleicht doch keine so schlechte Idee sind.
Dieser folgenschwere Fehler ging ganz allein auf Sonjas Konto – aber ich hatte mich damit abgefunden und hielt es ihr nicht vor.
Tatsächlich beschäftigten mich meine eigenen Fehler plötzlich viel mehr. Oder jedenfalls die Frage, ob die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen hatte und die den seltsamen Typen geformt hatten, der mich inzwischen aus dem Spiegel anschaute, nicht vielleicht die falschen gewesen waren.
Der doofe DHL-Mann mochte ein arroganter kleiner Fatzke ohne jede Lebenserfahrung sein – aber er hatte ein paar Knöpfe bei mir gedrückt, die mich plötzlich ins Grübeln brachten. War ich tatsächlich der klassische Fall eines Mannes, der von einem jungen Typen mit Ideen, Abenteuerlust und Idealen im Kopf zu einem tumben Gartenteich-Rasentraktor-Carport-Biotonnen-Spießer mutiert war?
Zum ersten Mal ließ ich einen Gedanken zu, den ich vorher immer beiseitegeschoben hatte – und eigentlich war es gar kein Gedanke, sondern vielmehr ein Gefühl: Ich war nicht mehr glücklich! Mit meinem Job, mit der Stadt, in der ich lebte, und vielleicht sogar mit meiner Beziehung zu Sonja.
Liebte ich sie wirklich noch so wie früher? Und liebte sie mich noch so wie früher? Und das Leben, das wir zusammen aufgebaut hatten? Oder gehörte ich eigentlich woanders hin und traute mich nur nicht, aus meiner Welt auszubrechen?
Wegen des noch nicht abbezahlten Kredits für unser Haus. Wegen unseres Eheversprechens. Und natürlich: wegen der Kinder – das finale Totschlagargument, das die Beziehungen von Millionen von Paaren auf der ganzen Welt so notdürftig zusammenhält wie Schnürsenkel und Tesafilm ein ägyptisches Taxi.
Natürlich liebte ich meine Kinder. Jeder Vater tut das. Oder zumindest sollte er das. Aber mich störte plötzlich, dass ich mich inzwischen lediglich über ein paar Grundfunktionen definierte: Mann, Vater, Ernährer. Wo blieb Tillmann, der Abenteurer? Der Haudegen? Der Musiker, Klassenkasper, Freigeist und Verführer? Der Unberechenbare?
Wie viel Tillmann Klein hatte ich in den letzten zehn, fünfzehn Jahren aufgegeben? Ich hatte das Gefühl, als seien Teile meiner Persönlichkeit durch das Leben, das ich lebte, über die Jahre in einen tiefen Winterschlaf gefallen und erwachten jetzt plötzlich wieder zum Leben. Und ich begann, die Welt, die ich mir aufgebaut hatte, meine Welt, auf einmal mit den Augen eines Fremden zu betrachten und zu hinterfragen.
Es war, als sei mein altes Ich in die Zukunft gereist, um mir eine schallende Ohrfeige zu geben und zu rufen: »Sag mal, Tillmann – das hier ist doch nicht dein Ernst, oder? Ein Fertighaus in einer Neubausiedlung? Mit Gartenteich und Stelzenhaus? Echt jetzt? Alter, wie bist du denn drauf?«
2. DER KÜKENMÖRDER VON HANNOVER-RICKLINGEN
»It’s better to burn out than to fade away«
NEIL YOUNG
Hatte mein altes Ich vielleicht recht?
Skeptisch betrachtete ich das Stelzenhaus der Kinder zu meiner Rechten, das die zu mähende Rasenfläche noch einmal verkleinerte. Wir hatten es 2011 gekauft, aber schon ein Jahr später hatten die Kinder kaum noch darin gespielt. Höchstens, wenn Besuch da war, kletterte mal eins der fremden Kinder die kesseldruck-imprägnierte Leiter hoch, schaute einmal durch das blaue Plastikfernrohr mit dem vergilbten Piratenaufkleber, wandte sich dann enttäuscht ab und stieg gelangweilt die Leiter wieder runter, um anschließend Xbox oder Wii zu spielen.
Das gleiche Schicksal hatte den Sandkasten ereilt, den wir direkt nach unserem Hausbau für Jakob aufgestellt hatten. Ein paar Jahre lang war der Sandkasten für Klein-Jakob und -Maya the place to be, aber als in ihrem Kindergarten dann ein Riesensandkasten inklusive eines großen Piratenschiffs aus Holz eingeweiht wurde, war unser Nullachtfuffzehn-Modell plötzlich the place to links liegen lassen.
Das bemerkten dann auch die Katzen aus der Umgebung, die den Sandkasten nach und nach in ein gigantisches Fünf-Sterne-Katzenklo umfunktionierten, was uns leider immer erst dann wieder bewusst wurde, wenn mal Kinder zu Besuch da waren und sich in den Sandkasten verirrten.
So wie an einem Abend vor vier Jahren, als wir mit unseren furchtbaren Nachbarn, den Ojewskis, auf unserer frisch verlegten Bangkirai-Terrasse saßen, während ihre Söhne Matteo und Anselm im Garten spielten. Matteo und Anselm! Allein für die Namen ihrer Kinder hätte man die Ojewskis für mindestens zwanzig Jahre in einen dunklen russischen Gulag stecken müssen. Oder ins Dschungelcamp.
Ich hielt gerade einen Vortrag darüber, warum man auch heute noch, nein: gerade heute bestimmte asiatische Tropen-Harthölzer für seine Terrasse kaufen und nicht auf heimische Hölzer zurückgreifen sollte, als die beiden Jungen mit ausgestreckten Händen auf uns zugelaufen kamen und aufgeregt riefen: »Mama, Papa, was ist das? Davon liegen ganz viele im Sandkasten!«
Wie zwei Schildkröten schoben die Ojewskis ihre Köpfe vor, und Kerstins kleine graue Augen blitzten giftig hinter den rahmenlosen Brillengläsern hervor, die tatsächlich die Form von Wölkchen hatten. Wahrscheinlich ein Unikat, angefertigt auf den besonderen Kundenwunsch, die lächerlichste Brille der Welt herzustellen. Aber immerhin passte sie damit ganz hervorragend zu Kerstin Ojewski.
Auf den kleinen Handtellern ihrer Kinder lag etwas Dunkles, Längliches, an dem ringsum Sand klebte. Kerstin nahm Anselm eine der Sandwürste aus der Hand.
»Nicht!«, riefen Sonja und ich, denn uns dämmerte gleichzeitig, was die Ojewski-Kinder da aus dem Sand gefischt hatten.
Aber zu spät – Kerstin hatte die Sandwurst schon vor ihrer Nase zwischen zwei Fingern zusammengedrückt und kämpfte jetzt gegen ihren Würgereiz, während sie panisch ins Haus lief.
Natürlich war nach Sonjas Meinung ich schuld. Weil ich nie die Abdeckung über den Sandkasten legte. Denn das war selbstverständlich meine Aufgabe, wie ich erfuhr, als Kerstin vom Klo kam und flötete, es sei wieder »alles in Ordnuuuung«.
»Wieso hätte ich denn die Abdeckung drübermachen sollen? Die Kinder spielen doch seit Jahren nicht mehr in dem blöden Ding!«
»Ja, und warum wohl? Eben weildu nie die Abdeckung draufgelegt hast und deswegen alles voller Katzenscheiße ist!«
»So ’n Quatsch, die finden einfach nur den Riesensandkasten im Kindergarten viel besser!«
»Ach, ihr wusstet, dass der Sandkasten voller Katzenkot ist?«, hakte Karsten Ojewski in einem Anfall von Courage nach und wurde wie üblich ignoriert.
»Tillmann, ich mach echt schon alles andere hier im Garten!«, insistierte Sonja. »Das Einzige, was du überhaupt noch machen musst, ist Rasenmähen, und wenn du damit fertig bist, kann ich hinterher noch eine Stunde lang die Kanten schneiden, weil dein bekloppter Riesentraktor nicht in die Ecken kommt! Oder du gerade Vogelküken überfährst!«
»Du hast ein Vogelküken überfahren, Tillmann? Ist das wahr?«
Karsten schaute mich an, als hätte ich gerade lächelnd seine Kinder von einer Klippe geschubst.
»Ja, hat er!«, kam Sonja mir zuvor.
Ich sank stöhnend in mich zusammen. »Ja, okay, ich bin der Kükenmörder von Hannover-Ricklingen! Hängt doch Fahndungsplakate auf!«
Kerstin Ojewski schenkte sich noch ein Glas Weißwein ein, machte es sich mit ihrem dicken Hintern in unserem Terrassensessel bequem und lächelte mich an. Sie schien es regelrecht zu genießen, wenn wir uns stritten. Vielleicht, weil sie es insgeheim schade fand, dass ihr eigener Mann ihr kaum noch Widerworte gab und es deswegen selten dazu kam, dass sie sich richtig stritten. Wahrscheinlich war sie eine Streitfetischistin auf Entzug.
Deswegen gängelte sie ihren Mann auch ununterbrochen. Aber das arme kleine Männlein hatte schon vor Jahren aufgegeben, ihr zu widersprechen – er nahm nur noch willenlos Anweisungen entgegen und führte sie aus. Oder wurde verbessert oder gemaßregelt.
Für mich war Kerstin Ojewski die schrecklichste Frau der Welt. Selbst wenn es nach einem nuklearen Holocaust nur noch sie und mich als letzte zeugungsfähige Vertreter der menschlichen Rasse auf der Erde geben würde, die für den Fortbestand unserer Spezies verantwortlich wären – ich würde ihr in der ersten mondlosen Nacht einen Klappspaten über den Schädel ziehen und mich freuen, dass endlich Ruhe ist.
Und ich glaube, Karsten hätte gerne genauso gedacht – wenn er sich getraut hätte. Aber die Tyrannei seiner Frau ging so weit, ihm kraft Suggestion schon den puren Gedanken an eine Rebellion zu untersagen. Und so saß der arme Karsten stattdessen mit seinem kratzigen Pulli aus reiner Schurwolle und Fahrradklammern an der Cordhose in unserem Gartenstuhl und fügte sich in sein Schicksal.
»Bangkirai nimmt man aber inzwischen nicht mehr, Tillmann!«, sagte Karsten jetzt plötzlich. Ein kurzer Seitenblick Richtung Ehefrau, ob er alles richtig gemacht hatte.
Kerstin lächelte, ohne ihn anzuschauen – was bedeutete: Gut gemacht, ab hier übernehme ich.
»Richtig. Deswegen haben wiiir unsere Terrasse aus einem neuen, rein biologischen Verbundstoff aus Leinöl und Kokosraspel gebaut. Was dazu noch eine hervorragende CO₂-Bilanz hat!«
Karsten schaute mich zaghaft grinsend an und nickte in devoter Zustimmung. Er war wirklich das letzte, fleischgewordene Argument gegen die Institution Ehe.
Kommen und staunen Sie, verehrte Zuschauer – so sehr kann die Ehe das letzte bisschen Individualismus und Spaß am Leben aus Ihnen heraussaugen! Übrig bleibt nur eine willen- und freudlose, abgemagerte Hülle aus Leinöl und Kokosraspel. Aaaber mit einer hervorragenden CO₂-Bilanz! Sie können jetzt Ihre Fotos schießen!
Vier Jahre später saß ich also auf meinem Rasentraktor, starrte auf die inzwischen ergraute Terrasse, und mir war plötzlich erschreckend egal, ob die Terrasse nun aus Bangkirai, einem Leinölverbundstoff oder getrockneter Katzenscheiße war. Ich empfand sie plötzlich als Ballast.
Genau wie unseren spießigen Gartenteich, in dem sich meines Wissens nach nur noch ein einziger Koi-Karpfen befand. Die anderen hatten sich entweder die Reiher oder die Katzen geholt.
Ob die Katzen wohl eine feste Reihenfolge hatten, wenn sie auf unser Grundstück kamen, oder ob sie spontan entschieden?
»Hey Rufus, was steht heute bei dir an?«
»Du, ich glaube, heute hole ich mir erst einen Karpfen aus dem Teich, und dann kack ich den Kindern in ihren Sandkasten. Wie sieht’s bei dir aus, Caruso?«
»Also, ich kack erst in den Sandkasten, dann gönn ich mir ’n Karpfen, und dann kack ich noch mal in den Sandkasten!«
»Alles klar – viel Spaß, bis gleich!«
Der Teich war natürlich eine Idee von Klaus gewesen, der selber einen hatte und so lange behauptete, dass man »mit einem Teich ein Leben lang Spaß« habe, bis Sonja ihm glaubte. Vielleicht erinnerte sie der Teich auch an ihre Kindheit und schuf ein zusätzliches Gefühl der Geborgenheit. Ich weiß es nicht.
Ich mochte Gartenteiche jedenfalls noch nie. Sie waren für mich der Inbegriff der Spießigkeit – noch vor Rasenkantenschneidern, Gartenzwergen und Fußmatten, auf denen »Welcome« oder »My home is my castle« stand.
Der Teich war ungefähr drei Quadratmeter groß und tropfenförmig – genau wie Klaus. Vorne hatten wir Sand und kleinere Kiesel drapiert, die eine flache Brandung simulierten. Nach hinten breitete sich der Teich dann aber beidseitig aus und grenzte mit seiner langen Seite an die linke Ecke unseres Gartens. Dort türmten sich größer werdende Kalksteine, und zwischen den beiden größten plätscherte ein kleiner künstlicher Wasserfall durch die scheußlichen Rostskulpturen, die Klaus uns mal geschenkt hatte. Als wäre der Teich nicht sowieso schon hässlich genug.
Tatsächlich war dieses Plätschern das Einzige, was ich an dem Teich mochte, aber die Kehrseite der Medaille war, dass man ständig das Gefühl hatte, auf Toilette zu müssen, wenn man im Sommer auf der Terrasse saß und ein paar Bierchen vernichtete.
Und das taten wir oft und viel, Gereon, Guido, Tom und ich.
»Mach deinen doofen Spießerbrunnen aus, oder ich lass gleich einfach laufen!«, sagte Gereon dann immer – und meistens stand Sonja spätestens dann auf, um sich ins Haus zu verziehen.
Gereon wusste natürlich, dass ich mir den Teich hatte aufdrücken lassen, und ließ es sich nicht nehmen, mir dafür, wann immer es ging, einen reinzuwürgen – doch neulich hatte er für seine Arroganz bitter bezahlen müssen.
Sonja und ich saßen mit den Jungs auf der Terrasse, und Gereon erzählte gerade in seiner ihm eigenen Detailversessenheit, dass er einer Patientin Silikonbrüste einpflanzen sollte, die Frau allerdings »soooo unfassbar fett« gewesen sei, dass er Schwierigkeiten gehabt habe, sich mit dem Skalpell durch das Fettgewebe zu schneiden.
Wir fragten uns öfter, ob wohl alle Schönheitschirurgen so ungeniert und distanzlos über ihre Patientinnen redeten, aber wir kannten nur den einen.
Es war kaum zu glauben, dass dieser Typ, der – jeden hippokratischen Eid verhöhnend – seine Patientinnen und ihre Probleme zu Zielscheiben von anzüglichen Witzen machte, noch vor ein paar Jahren im Bürgerkriegsgebiet von Somalia für Ärzte ohne Grenzen Kriegsopfer behandelt und damit wahrscheinlich reihenweise Leben gerettet hatte.
Vielleicht war das ja seine Art, sein persönliches Trauma des dort Erlebten zu überwinden: Er war in seinem Beruf geblieben, hatte sich aber der banalen Seite seiner Profession zugewandt, und vielleicht war die Art und Weise, wie er seine Arbeit vor uns öffentlich machte und ins Lächerliche zog, auch eine Art Selbstkasteiung dafür, dass er als »echter Arzt« nicht durchgehalten hatte.
Vielleicht war er aber auch einfach ein riesiges Arschloch, dem jegliche Moral und Ethik piepegal war. Könnte genauso hinkommen.
Jedenfalls ersparte uns Gereon mal wieder kein Detail, als er uns beschrieb, wie er der dicken Frau die Silikonbrüste einsetzte. Der Zeitpunkt, an dem Sonja zu viel kriegte, kam allerdings erst kurz danach, als Gereon Vermutungen darüber anstellte, warum die Frau so füllig war.
»Das war natürlich irgend so ’ne Ökemöke, die von ihrem Typen verlassen wurde. Und zwar zu Recht. Wahrscheinlich hat sie ihn jahrelang mit ihrer veganen Pampe und Batikscheiße genervt, dann hat er irgendwann ’ne süße Büromaus vors Rohr gekriegt, und zack, weg war er. Und aus Frust hat sie sich dann fettgefressen.«
Sonja stand stöhnend auf.
»Mensch, Gereon, echt der Wahnsinn, wie gut du uns Frauen kennst«, sagte sie genervt und räumte reflexhaft ein paar Gläser ab, auch die von Tom und Guido, die irritiert zu mir schauten.
Ich schüttelte unmerklich den Kopf, um ihnen zu bedeuten, dass sie jetzt besser nichts sagen sollten.
Sonja war wütend und kurz vorm Platzen. Das war ungewöhnlich für sie – denn normalerweise war sie ein eher leiser, zurückhaltender Mensch, der sich lieber in der Defensive aufhielt. Aber Gereon schaffte es immer wieder, das tief in ihr ruhende Aggressionspotential zu mobilisieren.
Er schaute sie nur an und pulte schmatzend mit der Zunge Fleischreste aus seinem Eckzahn. Eine furchtbare Angewohnheit, begleitet von einem ekelhaften Geräusch. In solchen Momenten war er einfach ein unfassbarer Widerling, und man sah Sonja an, dass sie ihn wirklich abgrundtief hasste.
»Tja, Sonja, ich spreche nur aus, was offensichtlich ist. Ich erwarte dafür keinen Applaus.«
»Keine Angst, den wirst du auch nicht bekommen.«
Gereon zuckte mit den Schultern, nahm einen Schluck Bier, schlug seine dürren Beine übereinander und ließ sie in seinen Dreiviertel-Khaki-Shorts wippen.
Meine Frau wandte den Blick von ihm ab. »Nacht, Tom, Nacht, Guido.« Sie gab mir einen Kuss. »Nacht, Schatz. Mach nachher bitte das Licht aus und schließ die Terrassentür ab.«
Ich nickte brav.
Sobald Sonja im Haus verschwunden war, fing Gereon an, blöd zu grunzen.
»Na, die hatte heute ja mal richtiggute Laune … Auf mich!«, sagte er und prostete uns mit seinem Bierglas zu.
Ein Standard-Gag von ihm. Beifall heischend grinste er in die Runde, erntete aber diesmal nicht die Zustimmung, die er sich erhofft hatte.
Tom sprach netterweise aus, was wir alle dachten. »Gereon, vielleicht solltest du in Betracht ziehen, dass das Ausplaudern intimer Details einer Brust-OP von Frauen tendenziell kritischer gesehen wird als von uns.«
Gereon schnaubte noch mal. »Ach, was – wahrscheinlich ist sie einfach nur sauer, weil sie weiß, dass sie in zehn Jahren selbst …«
»Gereon, halt einfach die Fresse!«, unterbrach ich ihn.
»Ja, das wäre schön«, pflichtete Guido bei, während er eine alte Filmdose aus schwarzem Kunststoff aus seiner Jackentasche holte. »Und um sicherzustellen, dass er auch wirklich den Rand hält, hab ich uns was Feines mitgebracht!«
Er öffnete die Dose – sie war halb voll mit Gras.
»Aus Amsterdam!«, sagte er stolz.
Er ließ die Dose rumgehen, und wir hielten alle kurz unsere Nase rein, um dann anerkennend zu nicken.
»Wow«, sagte Tom, »ein sehr gutes Riech!«
Guido hatte fast alles dabei: das Gras, große Blättchen und Tabak. Nur keinen Filter. Den riss Gereon einfach spontan aus dem Cover von Sonjas Jojo-Moyes-Roman, der auf dem Tisch lag.
»Spinnst du?«, raunzte ich ihn an. »Das ist Sonjas Buch!«
»Ach, echt?« Gereon setzte ein überraschtes Gesicht auf. »Ich dachte, das wär eins von den Kindern?«
»Ja, wie? Und dann isses okay, es kaputtzureißen, wenn das den Kindern gehört, oder was?« Ich schaute ihn ungläubig an. Er konnte einen wirklich zur Weißglut bringen.
Gereon öffnete sich ein weiteres Bier. »Kack dir nicht ins Hemd, du Spießer. Ich dachte, Kinder sehen das nicht so eng. Die machen doch selbst auch ständig alles kaputt.«
Guido bröselte kopfschüttelnd Gras in das Blättchen. »Bestechende Logik, Gereon! Du kennst dich auch echt gut mit Kindern aus!«
Und Tom ergänzte: »Und dass die Kinder Jojo Moyes lesen, ist natürlich ebenfalls sehr wahrscheinlich.«
»Pfff. Was weiß ich denn, was das für ’n Buch ist?!«, sagte Gereon, wie um meinen Gedanken zu bestätigen. »Allerdings, jetzt, wo du’s sagst – sieht tatsächlich nach Weiberkram aus.«
Es war wirklich hoffnungslos.
»Voilà, la Tüté!«
Guido hielt stolz sein Werk hoch. Ein konisches Meisterwerk in Formvollendung.
Zwanzig Minuten später saßen wir giggelnd um den Tisch und überlegten, wie wir unserem Fress-Flash entgegenwirken sollten. Ich hatte zwar noch eine Tüte Jumbo-Flips, aber als Guido vorschlug, noch »’ne schön schmierige Gyros-Pita« vom Griechen zu holen, leuchteten spontan alle Augen. Die Frage war: Wer konnte noch fahren?
Aber für so was war Gereon immer gut. Er stand auf und kramte den Schlüssel aus seiner Jacke. »Los Buam, pack mer’s!«
Der Plan stand: alle in Gereons Angeber-Cabrio und dann zum Olympia-Grill von Mama Vratolis. Wir waren schon fast in unserer Einfahrt, als Gereon plötzlich Richtung Teich verschwand.
»Wartet, ich muss kurz schiffen!«
Er stellte sich tatsächlich ans Ufer und öffnete seine Hose.
Vom Pfosten des Carports zischte ich ihn an: »Verdammt, Gereon – nicht in den Teich! Die Fische!«
Aber da hörte ich es schon plätschern.
»So, meine Lieben«, sprach Gereon mit sanfter Stimme zu den damals noch zwei verbliebenen Koi-Karpfen, »jetzt kommt was ganz Feines für euch! Empfohlen von führenden Zoohändlern weltweit …«
Plötzlich sah ich einen Schatten durch die Terrassentür schießen und schnurstracks auf den Teich zusteuern, während Gereon ungerührt weitersprach.
»Und der Vorteil: Das Wasser wird gleichzeitig sterilisiert und mollig warm, denn …«
Weiter kam er nicht, denn an dieser Stelle schubste ihn Sonja von hinten in den Teich. Sie wartete, bis Gereon prustend wieder an die Wasseroberfläche kam. Es war kein schöner Anblick. Er hatte Wasser geschluckt, das er sich jetzt aus den Lungen hustete, die Koi-Karpfen schwammen in Panik über und unter ihm durch, und zu allem Überfluss hing natürlich noch sein Pimmel aus der Hose.
Sonja wartete, bis er gesehen hatte, wer ihn in den Teich gestoßen hatte, dann sagte sie ruhig: »Und morgen hab ich ein neues Buch auf dem Tisch. Übrigens: Ich empfehle dir, deinen Penis wieder in die Hose zu packen, bevor ihr zum Olympia-Grill fahrt. Guten Appetit.«
Damit drehte sie sich um und verschwand wieder im Haus.
Der Motor des John Deere blubberte monoton vor sich hin wie ein Didgeridoo-Spieler in der Innenstadt, während ich jetzt lächelnd auf unseren Gartenteich starrte, in dem ich vor meinem inneren Auge noch den vor sich hin prustenden Gereon sah, der sich vergeblich bemühte, aus dem Teich zu krabbeln und gleichzeitig seine Genitalien zurück in die Hose zu stopfen.
Nach und nach verblasste das Bild, bis es irgendwann verschwunden war und nur noch der leere Teich übrig blieb. Mir fiel auf, dass ich auch den letzten Koi schon lange nicht mehr gesehen hatte. Wahrscheinlich hatten auch ihn inzwischen die Katzen vertilgt.
Da wirst du ein Leben lang Spaß dran haben!
Unfassbar. Was sollte das für ein Leben sein, bei dem man an einem Gartenteich Spaß hatte, bis man ins Gras beißt?
Verdammt noch mal. Da stand man im einen Moment noch mit seinem Fender-Jazz-Bass auf der Bühne, wurde von Abiturientinnen angehimmelt und war auf dem besten Weg, Rockstar zu werden (das dachte ich damals jedenfalls), und gerade mal zehn Jahre später hockte man in einer Neubausiedlung am Rande von Hannover-Ricklingen hinter seinem Fertighaus in einem Loch im Garten und verlegte schwarze Teichfolie, um überzüchteten dicken Fischen ein unnatürliches Zuhause zu bauen. Aus dem sie dann von überzüchteten dicken Katzen herausgefischt und gefressen werden würden.
Und mir kam der beängstigende Gedanke, dass ich am Ende vielleicht selbst nichts anderes war als ein überzüchteter dicker Fisch in einem unnatürlichen Zuhause.
Zumindest war ich dazu geworden.
3. EINMAL CRAZY BERLIN UND ZURÜCK
»Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin.«
FRANZ VON SUPPÉ
Kaum zu glauben, aber kurz bevor ich im Hannoveraner Neubaugebiet hinter einem Fertighaus in einer Erdkuhle stand und mit einem dicken schwitzenden Mann in Latzhosen Teichfolie verlegte, hatte ich noch in Berlin Architektur studiert.
Wie sagt man so schön: Wer nichts wird, wird Wirt, und wer auch darauf keinen Bock hat, studiert halt irgendwas in Berlin. Das galt zumindest damals, als Berlin ein paar Jahre nach der Wende noch als wild und hip und crazy galt. Heute besteht der damals verrückte Osten der Stadt ja nur noch aus Ökemöken-Cafés für schwäbische Stillmütter, und Westberlin wirkt wie ein gigantischer Apple-Store.
Damals war das aber tatsächlich noch anders, und deswegen wollte ich unbedingt nach Berlin – nachdem der Staat mir zwei der besten Jahre meines Lebens geraubt hatte (Zivildienst als Hausmeister im Seniorenstift Hubertus) und meine Eltern sich spontan dazu entschlossen hatten, nach Kanada auszuwandern, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus waren.
Das Problem war nur – ich war eigentlich noch gar nicht aus dem Haus. Doch ich gönnte meinen Eltern die Erfüllung ihres alten Traums, irgendwann in Kanada zu leben, und fand es toll, dass sie das wirklich durchzogen. Jetzt musste ich nur noch selbst sehen, was aus meinem Leben werden sollte.
Aus meiner Musikerkarriere war nichts geworden, weil unsere Band sich aufgelöst hatte, nachdem wir doch irgendwann feststellen mussten, dass unsere Songs allesamt ziemlich unterirdisch waren und ich als Bassist bestenfalls Mittelmaß war. Vielleicht noch nicht mal das.
Und auch meinen Plan, Fotograf für National Geographic zu werden, musste ich zurückstellen, nachdem ich nach mehrfachen Bewerbungen mit Fotos meiner mühsam zusammengesparten Nikon FM2 ein ernüchterndes Antwortschreiben bekommen hatte.
Sehr geehrter Herr Klein,
vielen Dank für Ihre erneute Bewerbung als Fotograf bei National Geographic, die wir diesmal gerne FINALabsagen möchten. (Sie hatten das Wort »final« wirklich fett und in Großbuchstaben geschrieben – als hätte eins von beiden nicht gereicht!) Ihre Bilder haben zwar nicht unbedingt Amateurcharakter, sind allerdings auch weit davon entfernt, in der internationalen Top-Liga mithalten zu können – zumal das von Ihnen bevorzugte Motiv »Band-Bus« unserer Meinung nach stark überstrapaziert wurde.
Wir hoffen, Sie können unsere Entscheidung nachvollziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Blablabla
Da hatte ich es schwarz auf weiß: »… weit davon entfernt, in der internationalen Top-Liga mithalten zu können.«
Brennt es mir doch einfach gleich auf die Stirn: »Tillmann Klein ist bloß Mittelmaß!«
Es war also Essig mit dem angestrebten Abenteurerleben als Fotograf.
Deshalb konzentrierte ich mich auf das letzte Interesse oder Talent, das ich in mir noch finden konnte: das Zeichnen.