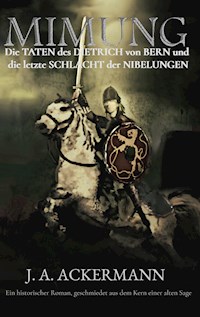
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Roman dürfte die wohl unterhaltsamste Art und Weise darstellen, um sich einen Überblick über die Herkunft der Dietrich- und Nibelungensage zu verschaffen. Die Sage ist hier getreu den ursprünglichen Quellen, insbesondere der nordischen Thidrekssaga, wiedergegeben. Die Handlung wird schnörkellos und in packenden Bildern erzählt, die Charaktere sind so beschrieben, wie es die alten Quellen andeuten. Zahlreiche Anmerkungen ermöglichen eine historische Einordnung. Der Autor folgt hier primär der Hypothese des Sagenforschers Heinz-Ritter Schaumburg, der einen Ursprung der Sage im heutigen Nordwestdeutschland vermutete. Diese Hypothese wurde von der Fachwelt nie widerlegt, dennoch gilt sie als abgelehnt. In den Anmerkungen wird die Hypothese daher stets von der allgemein anerkannten Lehrmeinung unterschieden und ist als solche gekennzeichnet. So kann sich der Leser selbst ein Bild machen. Zusätzlich bietet das Werk in den Anmerkungen einige bisher unveröffentlichte neue Vorschläge zur Sagengeografie, die vom Autor selbst stammen, insbesondere zu den Ursprüngen der Rytzen und Wilkinen. Fazit: Spannend und sehr lehrreich. Ein Muss für jeden Sageninteressierten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Schnell ließen die Kühnen ihre gezäumten Rösser dahin stürmen über die Berge, durch den pfadlosen Myrkwald.
Der Boden der Huna-Mark bebte, Wo die Furchtlosen geritten kamen. Sie trieben die Pferde über grüne und grasreiche Wiesen. Bis sie sahen Atlis Halle...“(Aus dem Atli-Lied der älteren Edda)
Dieses Buch ist Heinz Ritter-Schaumburg gewidmet, der die Geschichte dem Dunkel der Sage entrissen hat.
Mein größter Dank gebührt Reinhard Schmoeckel, der mich durch sein Buch „Bevor es Deutschland gab“ auf Ritters Thesen aufmerksam machte und eine historische Einordnung ausgearbeitet hat. Er war mir auch bei der Veröffentlichung des Buches eine große Stütze.
Großer Dank gebührt außerdem Jürgen Jakobi für zahllose stilistische, semantische und orthographische Korrekturen.
Weiterhin danke ich Walter Böckmann, der das geistige Innenleben der Helden anschaulich dargestellt hat, Edo Wilbert Oostebrink, dessen Bücher mir eine große Hilfe waren, Werner Keinhorst und Ulrich Steffens, die stets kritische Diskussionspartner waren, Harry Böseke, Karl Weinand, sowie zahlreichen Mitgliedern und Autoren des „Dietrich von Bern-Forums“ in der Zeitschrift der BERNER.
Ich danke außerdem der Schriftstellerin Auguste Lechner und J.R.R. Tolkien, deren Bücher in meinen Jugendtagen mein Interesse für die nordische Sagenwelt geweckt haben. Ich danke nicht zuletzt auch den Schreibern des Mittelalters, die diese Sagen durch ihre Arbeit vor dem Vergessen bewahrt haben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
DER WETTSTREIT DER SCHMIEDE
HILDEBRANDS ZUG NACH BERN
SIEGFRIED
HILDEGRIM
HEIME
WITEGES RITT NACH BERN
ZWEIKAMPF MIT WITEGE
WIELANDS GESCHICHTE
DIETRICHS RITT ZUM OSNING
ERMENRICHS HOFTAG
KÖNIG DIETMARS TOD
SCHLACHT IM WILCINALAND
ZUG GEGEN JARL RIMSTEIN
ZUG INS BERTANGALAND
DIE ZWEIKÄMPFE
HEIRAT
SIBICHS RACHE
DIE RYTZENKÄMPFE
DIE SCHLACHT BEI GRÄNSPORT
DER STREIT DER KÖNIGINNEN
KÖNIGIN HELCHES TOD
DER ZUG DER NIBELUNGEN
DIE SCHLACHT IM HORNGARTEN
HAGENS TOD
DIETRICHS HEIMKEHR
ALEBRAND
SPÄTE RACHE
Nachwort
Die Orts- und Personennamen
Mögliche Zeitskala
Stammbaum Dietrichs von Bern
Vorwort
Es war ein dunkles und zugleich schillerndes Zeitalter, das in unseren Gefilden herrschte, nachdem das Römische Reich zertrümmert worden war, und es keinen Kaiser mehr gab im Westen. Wenige Jahre, nachdem die Reiterheere der Hunnen unter ihrem Führer Attila von den Völkern des Westens zurückgeschlagen wurden, gab es in den Ländern am Rhein zahlreiche Könige und Königreiche, von denen heute nicht einmal mehr der Name überliefert ist.
Es war auch eine Zeit der Helden, Königinnen und Krieger. Dieses Buch erzählt von einigen dieser Helden und Königinnen, deren Namen bis in unsere Tage herüberhallen. Seine Quellen sind uralte Sagen aus dem Norden Europas. Es sind die Sagen um König Dietrich von Bern und die Nibelungen. Sie handeln von Siegfried und Hagen, von Krimhild und anderen großen Namen. Ihre Taten wurden noch Jahrhunderte später in den Hallen großer Könige besungen. Und noch heute werden sie besungen und gelesen. So kann man auch hier die Geschichten lesen, die so manches von den Geschehnissen des dunklen Zeitalters der Völkerwanderung bewahrt haben.
Die Nibelungen der Sage werden meist mit den Burgundern gleichgesetzt, einem ostgermanischen Volksstamm, der bis zum Jahr 436 am Rhein siedelte und dort fast vernichtet wurde, bevor er sich wenige Jahre später im Gebiet des Genfer Sees ansiedelte. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit zogen die historischen Burgunder nicht vom Rhein bis in das Reich der asiatischen Hunnen um dort unterzugehen, wie es das Nibelungenlied erzählt.
In den skandinavischen Erzählungen über die Nibelungen (dort Niflungen genannt) heißen diese niemals Burgunder. Demnach spricht einiges dafür, dass die Nibelungen in Wahrheit nichts mit den Burgundern zu tun hatten, oder nur ein burgundischer Teilstamm waren. Wohin diese Nibelungen aber gezogen sein könnten, falls es sie gegeben haben sollte, werden wir noch berichten.
Seit dem Mittelalter wird ebenso die Meinung vertreten, der legendäre Heldenkönig Dietrich von Bern sei der berühmte Ostgotenkönig Theoderich der Große, der bis 526 n. Chr. in Italien herrschte. Dietrich und Theoderich sind (ebenso wie Didrik oder Thidrek) tatsächlich verschiedene Formen ein und desselben Namens. Doch scheinen beide Könige außer dem Namen kaum etwas gemeinsam zu haben. Das gleiche trifft übrigens auch auf den Frankenkönig Theuderich I. zu, der um dieselbe Zeit lebte und theoretisch ebenfalls als mögliches Vorbild für Dietrich von Bern in Frage kommt.
Deshalb wurde ebenfalls seit dem Mittelalter auch die Vermutung geäußert, dass es neben Theoderich dem Großen einen weiteren König namens Dietrich gegeben haben könnte, der ursprünglich in der Sage besungen wurde. Der erste, der dies äußerte, war der berühmte Frutolf von Michelsberg im 11. Jahrhundert.
Verschiedene Fassungen der Sage, wie das hochdeutsche Nibelungenlied und die nordische Edda und die Völsungasaga, sowie die Thidrekssaga, erzählen die Sagen um Dietrich von Bern überraschend ähnlich, jedoch in verschiedenem Gewand. Dabei scheint vor allem die Thidrekssaga die Geschichten nicht nur vollständig, sondern auch in ihrer reinsten Form bewahrt zu haben. Nach dieser Erzählung kämpften die Nibelungen ihren letzten Kampf in Susat, der heutigen Stadt Soest in Westfalen, und nicht im fernen Ungarn, wie es im mittelhochdeutschen Nibelungenlied erzählt wird.
Die Thidrekssaga erzählt das Leben des Dietrich von Bern in altwestnordischer beziehungsweise altschwedischer Sprache. Die älteste heute noch existierende Abschrift der Thidrekssaga, Membrane (Mb) genannt, dürfte aus dem 13. Jahrhundert stammen. Daneben existieren zwei altwestnordische Texte als isländische Abschriften (IsA, IsB) sowie eine altschwedische Fassung (Didrikschronik) mit zwei ähnlichen Texten (SvA, SvB), deren Abschriften jünger sind.
Es ist bis heute umstritten, ob die Membrane eine der ersten schriftlichen Fixierungen der Thidrekssaga darstellt, oder ob sie auf eine ganze Reihe von älteren Vorgängerversionen zurückblickt. Es wäre dann nicht unwahrscheinlich, dass die ältesten dieser Vorgänger der Thidrekssaga einst in altniederdeutscher Sprache verfasst waren. Möglicherweise liegt ihr Ursprung bei den alten Heldenliedern, die Karl der Große um 800 n. Chr. aufschreiben ließ, die aber heute verschollen sind. Der Sagenforscher Heinz Ritter-Schaumburg (eigentlich Heinz Ritter) stellte auf dieser Grundlage die Hypothese auf, dass die Thidrekssaga, und hier insbesondere die altschwedische Didrikschronik, die ursprünglichste Version der Sage ist und direkt auf Vorgänge in Nordwestdeutschland zurück geht.
Die Nibelungen scheinen der Thidrekssaga zufolge westlich des Rheins gewohnt zu haben. Auf ihrem Zug in den Untergang nach Susat überqueren sie den Rin, wo dieser mit der „Duna“ zusammenfließt. Lange nahm man an, diese Flüsse der Sage müssten Rhein und Donau meinen. Da allgemein bekannt ist, dass Rhein und Donau nicht ineinanderfließen, verlor die Sage schon deshalb in den Augen vieler jeden Anspruch auf wahrheitsgetreue Überlieferung.
Mit der Entdeckung einer real existierenden Duna, der heutigen Dhünn (im Mittelalter Dune genannt), die einst in den Rhein mündete, lieferte Ritter ein Fundament für den historischen Kern der Sage. Die Dhünn passt genau auf die Duna der Sage. An ihrer Mündung lag einst eine Furt, die sich zum Überqueren des Rheins eignete. Die Nibelungenburg Vernica fand Ritter in der heute verschwundenen Burg Virnich, nahe Zülpich im Bereich des Flüsschens Neffel. Die ehemalige Furt an der Dhünn-Mündung liegt genau zwischen Burg Virnich und Susat.
Zahlreiche weitere in der Sage genannte Orte, allen voran Bern (=Bonn) und die Musala (Mosel) sprechen ebenfalls für einen Ursprung der Sage im nordwestlichen Deutschland, insbesondere im Rheinland und in Westfalen. Weitere geographische Fixpunkte, die zweifelsfrei in diesen Raum verweisen sind etwa der Osning, der Lürwald und die Weser. Ritter vermutete in diesem Raum den Ursprung der Sage und postulierte, dass sie Chronik historischer Ereignisse ist. Und tatsächlich berichtet die altschwedische Didrikschronik meist sehr nüchtern und ist nahezu frei von italienischen Ortsangaben, sofern man das Rom der Sage mit einer anderen Stadt als der Tibermetropole gleichsetzt.
Demnach wäre Dietrich von Bern eben nicht Theoderich der Große, sondern vielmehr ein heute nicht mehr bekannter germanischer König am Rhein, mit einem gänzlich anderen Schicksal. Ähnliches gilt für die Könige der Nibelungen, die oft mit den Burgundern gleichgesetzt werden, und für den König Etzel der Sage, der im Walthari-Lied und im Nibelungenlied mit Attila dem Hunnen gleichgesetzt wird. Falls der Etzel der Sage direkt auf eine historische Person zurückgeht, dürfte er vielmehr ein König friesischer Abstammung im Raum Soest gewesen sein. Sein wirklicher Name könnte Atala oder ähnlich gelautet haben. Es existieren zahlreiche, exzellente Fachbücher zu dieser Hypothese. Einige sind für den interessierten Leser am Ende des Buches aufgeführt.
Heinz Ritter mag über das Ziel hinausgeschossen sein, als er die Thidrekssaga einen „chronikalischen Bericht“ nannte. Er maß den legendenhaften Episoden oftmals sehr viel Gewicht bei und versuchte sie bis ins Detail zu erklären. Auch gelang es ihm nicht, die Mehrheit der Fachwelt zu überzeugen. In Fachkreisen wurde seine Hypothese wenig beachtet oder verrissen. Kaum wurde ein Versuch gemacht, seine Thesen sachlich zurückzuweisen oder zu bestätigen. Seine Grundhypothese, wonach die Sage direkt auf Ereignisse in Nordwestdeutschland zurückgeht, ist in sich stimmig und kaum zu widerlegen.
Könnte es also sein, dass ursprünglich ein Heldenkönig in den Sagen besungen wurde, über den wir sonst keine Kunde mehr haben und, dass seine Geschichte später mit jener Theoderichs des Großen verwoben wurde. Wenn es einen solchen König jemals gab, dann wird er am ehesten in Bonn am Rhein gewohnt haben, das einstmals tatsächlich Berne hieß. Und wenn die Nibelungen tatsächlich jemals in ihren Untergang zogen, dann über die Dhünn-Mündung nach Soest und sicher nicht an der Donau entlang nach Ungarn. Hier wird versucht diese Geschichte so wiederzugeben, wie sie sich ereignet haben könnte, ohne sich dabei unnötig weit von den Quellen zu entfernen, die im Wesentlichen die Thidrekssaga und die Edda und nur am Rande das Walthari-Lied und das Nibelungenlied sind.
Die wichtigsten Quellen für diese Zeit, allen voran Gregor von Tours, nennen nur wenige Einzelheiten zu den Vorkommnissen in den Rheinlanden und östlich davon. Sie widersprechen Ritters Hypothese damit nicht.
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass alle hier geschilderten Ereignisse, sich tatsächlich einst genau so zugetragen haben. Mit großer Sicherheit werden Elemente in die Sage eingeflossen sein, die für immer unbekannt bleiben und nie enträtselt werden können. Sicherlich wurde so manche Begebenheit von den Erzählern der Sage nachträglich ausgeschmückt und zur Heldentat verklärt.
Auch in dieser Erzählung werden die Helden nicht völlig entzaubert und manches ist ähnlich wie in den Vorlagen mythisch ausgeschmückt. Die Geschichte erzählt etwa von Zwergen und Riesen, wobei offenbleiben kann, wie groß diese jeweils waren. Für die damaligen Menschen, war die Welt um sie herum voll Zauberei und Magie und auch die Thidrekssaga ist voller wundersamer Elemente. Diese wurden in der Erzählung oft beibehalten, außer wenn sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen völlig unvereinbar sind. Dies dient dem Lesevergnügen und soll dem Leser die überlieferte Sage nahebringen. In Wahrheit dürfte es weniger mythisch zugegangen sein.
Derartige Elemente sind in der Regel durch Fußnoten als solche gekennzeichnet. Ebenso werden in den Fußnoten Vorschläge zur heutigen Lage, der in der Sage genannten Orte gemacht. Diese stammen zum Teil noch vom Erstübersetzer der Thidrekssaga, Friedrich Heinrich von der Hagen, der sich aber vielfach irrte und kein Licht ins Dunkel bringen konnte. Die meisten Ortsangaben stammen von Ritter, sowie mit Abweichungen im Detail von Edo Wilbert Oostebrink und von mir selbst. Die Fußnoten sind für den sagenhistorisch interessierten Leser gedacht. Für die Handlung sind sie nicht von Belang, und können einfach ausgelassen werden.
Zumindest der Kern der Sage um König Dietrich und den Untergang der Nibelungen scheint auf realen Ereignissen zu beruhen. Er findet sich in allen wichtigen Strängen der Sagenüberlieferung. Dabei kann der Ursprung der Sage aber kaum bei Theoderich dem Großen liegen, der bekanntlich nicht in Verona (dem italischen Bern) regierte und nicht fliehen musste vor einem König Ermenrich. Es scheint vielmehr einen weiteren König Dietrich gegeben zu haben, der heute vergessen ist. Und es ist nicht unmöglich, dass sich seine Geschichte doch recht ähnlich zugetragen hat, wie es in den alten Sagen geschildert ist.
Und schließlich gibt die Thidrekssaga selbst vor, von wahren Begebenheiten zu erzählen:
„Diese Saga ist zusammengesetzt nach den Aussagen deutscher Männer, doch einige nach deren Liedern, welche vornehme Männer ergötzen sollen und welche einstmals gedichtet wurden gleich nach den Ereignissen, welche in dieser Saga erzählt werden...“
„…Und wenn du einen Mann nimmst aus jeder beliebigen Burg in ganz Sachsland, so werden alle diese Saga auf die gleiche Weise erzählen. Das bewirken aber ihre alten Gesänge“(Aus der Thidrekssaga)
Das Land der Sage:
DER WETTSTREIT DER SCHMIEDE
Man nannte einen Berg damals Ballofa1. Er lag abseits von den großen Siedlungen der Menschen in einem unwegsamen Gebirge. Es war kein sehr hohes Gebirge, aber es war überzogen von dichten, unzugänglichen Wäldern, in die sich tiefe Felsschluchten eingegraben hatten. Nur wenige bewohnte Weiler schmiegten sich an die Hänge. Im näheren Umkreis um den Berg herum lebten keine Menschen, jedenfalls keine, die man so bezeichnet hätte. Einige Ruinen und verfallene Häuser zeigten an, dass es hier einst eine Menschensiedlung gab. Was aus ihren ehemaligen Bewohnern geworden war, wusste niemand.
Der Berg Ballofa war nicht hoch, eher ein Hügel, aber er war innen hohl und in seinem Inneren lebten damals kleinwüchsige, menschliche Wesen. Diese kleinen Leute hatten sich hier unter der Erde eingerichtet und bearbeiteten eifrig Metalle. Sie lebten in alter Zeit oft von den großen Menschen getrennt und sie waren Meister des Bergbaus und Meister der Schmiedekunst. Dies lag daran, dass sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße hervorragend geeignet waren, in enge Stollen zu kriechen, um dort Erze abzubauen. Daher waren sie seit alters her eng mit dem Metallhandwerk verbunden. Damals wurden sie Zwerge2 genannt. Zwei von ihnen hausten in jenen Tagen in der Höhle unter dem Berge Ballofa.
Der Zugang zur Höhle war halb verschüttet. Dahinter lag tief unten im Gestein unter der Erde eine große, steinerne Halle. Das Innere der Höhle war Finster, und die wenigen Fackeln, die brannten, wenn die Zwerge dort waren, erhellten die Dunkelheit kaum. Hier gab es Werkbänke, Tische, Truhen und überall waren Werkzeuge, dazwischen hingen Schädelknochen von Drachen und anderen Wesen, deren Überreste3 die Zwerge hier unter der Erde gefunden hatten.
Vor der Höhle standen auf einer Wiese zwei kleine strohgedeckte Hütten. In einer davon glühte unter dem Rauchabzug ein heißes Feuer 4 . Darüber stand, zwischen den Zwergen, ein blonder Junge, gerade alt genug, ein Mann genannt zu werden. Er war ganz sicher kein Zwerg und fast zwei Schritt hoch. So überragte er die übrigen Höhlenbewohner bei weitem. Er schlug ein Eisen so hart, dass ihm der Schweiß von der Stirn rann und in dicken Tropfen vom Kinn herabfiel. Es zischte ein ums andere Mal, wenn einer der Tropfen in die rote Glut einschlug. Der junge Schmied trug kein Hemd, nur eine Leinenhose und einen Lederschurz. Bei jedem Schlag zitterten die sehnigen Muskeln unter seiner Haut. Sein Name war Wieland.
Zu seiner Rechten stand ein stämmiger, langbärtiger Zwerg, der zwischen den Schlägen zustimmend nickte, wobei er sich über den zerzausten, aschgrauen Bart strich. Dabei funkelten seine kleinen dunklen Äuglein feurig und böse unter den dichten, buschigen Augenbrauen hervor. Die dicke Knollennase beherrschte das Gesicht und schlug einen großen Schatten über dessen eine Hälfte. Ein weiterer Zwerg zu seiner linken sah nicht viel anders aus, nur war er dünner mit rotbraunem Bart. Auch war seine Nase kleiner als die des ersten und ragte spitz nach vorn.
Während der Junge weiter auf das Schwert einschlug, das sich unter seinen Hieben formte, nickten die Zwerge anerkennend. Die kräftigen, kurzen Arme hielten sie verschränkt vor der Brust. Als Wieland kurz innehielt und sich den Schweiß von der Stirn wischte, begann der graue Zwerg neben ihm mit hämischer Miene: „Schon bald kommt vielleicht dein Vater und wird dich holen, junger Wieland.“ „Vielleicht! Vielleicht auch nicht“, zischte der dünnere mit singender, belustigter Stimme. „Und wenn nicht, dann wirst du sterben müssen“, raunte der andere wiederum, „so ist es Brauch bei den Zwergen“ Dabei warf er den Kopf in den Nacken und lachte laut und dröhnend. Und der andere fiel mit heißerem Kichern mit ein. Dieses widerliche, schadenfrohe Gelächter ging Wieland durch Mark und Bein. Eine Mischung aus Zorn und Furcht stieg in ihm auf.
Den größten Grimm fühlte Wieland aber gegen seinen eigenen Vater, der ihn vor zwei Jahren zu den abscheulichen Zwergen in dieses dunkle Verlies geschickt hatte. Wieland hasste die Zwerge, obwohl sie ihm nie etwas zu leide getan hatten und ihn eigentlich immer gut versorgten. Und doch hasste er sie. Dieses traurige Leben im Berg hatte an seinen Nerven gezehrt. Wütend schlug er auf sein Werkstück ein und die Wut verlieh ihm große Kraft und Ausdauer. Als er mit der Arbeit fertig war, ging er wortlos hinaus. „Bei Dämmerung bist du wieder da!“, riefen ihm die Zwerge hinterher, als er hinausging.
Die Luft und die ganze Landschaft um ihn herum waren eigenartig still und unwirklich, als befände er sich in einem Traum. Plätschernd und gurgelnd folgte das Wasser des kleinen Flüsschens5, das an der Höhle vorbeiging, seinem Lauf. Es war Wieland als würde es säuselnd zu ihm reden. Als wollte ihm das Flüsschen etwas sagen. Ihn warnen.
Es war windig an diesem Tag und die Wolken flogen mit großer Geschwindigkeit über den Himmel. Wieland blickte ihnen sehnsüchtig hinterher. Er ging grübelnd ein Stück den steinigen Weg entlang und überlegte, ob er einfach weglaufen sollte. Doch hätte er nicht gewusst, wohin er gehen sollte. Auch würde er damit seinen Vater maßlos enttäuschen.
Grübelnd folgte er dem Weg, der hier entlang einer steilen Böschung verlief und auf eine größere Lichtung zustrebte. Wie aus dem Nichts stand ein Pferd in der Mitte der Lichtung. Wieland blieb wie versteinert stehen. Auf dem Boden vor dem Pferd lag ein Mann, halb verschüttet von einem Haufen Geröll. Er rührte sich nicht. Beim Näherkommen, erkannte Wieland ihn. Es war sein eigener Vater, der riesige Wade, der da tot am Boden lag.
Eine ganze Weile stand Wieland wie angewurzelt da. Erst nach einiger Zeit beugte er sich über den Leichnam und sank verzweifelt darüber zusammen. Während er so da lag, überlegte Wieland, ob die Zwerge das Gestein gelöst hatten. Er war sicher sie hätten es gekonnt, sei es durch ihre Bodenkunde oder durch Zauberei. Er hörte unentwegt die Zwerge in seinem Kopf, wie sie riefen, dass er sterben müsse, falls sein Vater ihn nicht zur rechten Zeit abholen würde. Wieland hatte nie an diese alten Gebräuche geglaubt, aber nun war er sich nicht mehr so sicher. Alles schien nach einer dunklen Vorsehung zu verlaufen.
Nach einer Weile, die er so gelegen hatte, bemerkte er die Kühle des Abends. Er konnte nicht ewig so liegen bleiben. Und doch vermochte er nicht aufzustehen. Was mochte jetzt aus ihm werden? Je länger er lag, desto stärker stieg grenzenlose Wut und Verzweiflung in ihm auf. Wie von Sinnen erhob er sich schließlich, nahm seinem Vater das Schwert vom Gürtel ab und schwang sich auf dessen Pferd. So galoppierte er zur Höhle zurück.
Mit gezogenem Schwert betrat er die Höhle und ging auf die Zwerge los. Er ließ keinen am Leben. Als Wieland schließlich innehielt und auf die Niedergehauenen blickte, konnte er nicht fassen, was er getan hatte. Er ließ die Waffe sinken und sah sich erschrocken in der Halle um.
Es war totenstill. Wieland seufzte tief und schloss die Augen. Einer der Zwerge atmete noch und sein Röcheln enthielt die Worte: “Wieland, warum? Warum? Verflucht sollst du sein..., du und alle deine Werke.“ Danach ließ er den bärtigen Kopf zur Seite sinken und bewegte sich nicht mehr. Die Worte des Zwergs hallten in Wielands Kopf wider. Er konnte die Augen nicht von der Blutlache lassen, die unter seine Stiefel kroch.
Dann stürmte er nach draußen und hörte schon die krächzenden Rufe der Krähen, die über der Leiche seines Vaters flogen. Eine Weile stand er nur da und betrachtete die schwarzen Vögel beim Leichenschmaus. Die Aasvögel freuen sich über den Tod, nur um einige Bissen des Kadavers zu ergattern, dachte Wieland voller Abscheu.
Da kam ihm ein Gedanke. Warum sollte er nicht wie die Aaskrähe sein? Und er beschloss es ihnen gleichzutun. Sogleich steckte er sein Schwert ein, sprang in die Höhle zurück und ging zur Wand, an der die Werkzeuge der Zwerge aufgereiht waren. Er nahm sich die besten Werkzeuge und rannte dann durch die Stollen und Gänge, um die wertvollsten Schätze und etwas zu Essen einzusammeln. Er lud Gold auf und edle Steine. Dazu nahm er sich Käse, Dörrfleisch, Brot und Wurst.
Das brachte er alles zum Höhleneingang, um es auf Wades Pferd zu laden, das immer noch geduldig dort wartete. Er belud das Pferd, schwang sich darauf und ritt davon, so schnell es ihn trug. Bald versanken seine Gedanken in Wirrnis und wurden zu einzelnen grässlichen Bildern. Er galoppierte die steinige Straße entlang und hörte nur noch die Krähen und Zwerge in seinem Kopf schreien.
Er bemerkte bald, dass sein Pferd müde wurde und doch trieb er es weiter, fast bis zur Erschöpfung. Er ritt tagelang, bis er zum Fluss Wisara6 kam. Als er sein müdes Pferd tränkte, überlegte er, ob er den Fluss nicht besser nutzen könne für seine Flucht. Da beschloss er, sich einen verschließbaren Einbaum zu bauen, mit dem er den Fluss unerkannt hinabfahren und zugleich sein ganzes Werkzeug mit sich führen könnte. Aus einiger Entfernung würde der Kahn so aussehen wie ein Baumstamm, der im Fluss trieb und so keinerlei Aufmerksamkeit erregen. Er wählte sorgfältig einen Baum aus und begann ihn zu fällen.
Immer wieder flog die Zwergenaxt gegen den Stamm und Splitter flogen in alle Richtungen davon. Nun geschah etwas gänzlich Eigenartiges. Vor Wielands Augen verwandelte der Stamm sich zu einem Stück Eisen und seine Axt wurde ein Hammer. Gleichsam verwandelte sich der Wald um ihn herum und Wieland fand sich plötzlich erneut in der Werkstatt der Zwerge wieder. Der bärtige Zwerg stand wieder neben ihm und johlte vor Lachen.
Wieland schreckte entsetzt auf. „Nein!“, rief er mehrmals aus voller Kehle. Ein Klumpen formte sich in seinem Hals, Schweiß strömte ihm von der Stirn. Das durfte nicht sein. Die Höhle, der Fluch!
Dann erwachte Wieland schweißgebadet. Er hörte den Sturmwind am Dach rütteln. Er atmete erleichtert auf, als er erkannte, dass er nur geträumt hatte. Aber er war sich sicher diesen Traum ganz ähnlich erlebt zu haben. So gingen ihm die Bilder der toten Zwerge die ganze Nacht hindurch nicht aus dem Kopf. Immer wieder schrien die Zwerge und verfluchten ihn. Er wusste, dass er unrecht gehandelt hatte und dass ihn dieser Fluch und diese Albträume nie loslassen würden.
Dann stand er auf, ging zur Esse und begann nun wirklich, ein Eisen zu schlagen. Er war nun aber nicht mehr in der Zwergenhöhle, sondern in seiner Werkstatt in König Nidungs Reich7. In Nidungs Königreich war Wieland vor einem Jahr mit seinem Einbaum aus dem Wasser gefischt worden, nachdem er von den Zwergen geflohen war.
Nun lebte er schon seit einiger Zeit dort. Schwarzgraue Wolkenberge erhoben sich an diesem Tag ringsum gegen die Burg und heftige Winde drückten die wenigen Büsche und Bäume nieder. Draußen begannen Regentropfen auf das Dach zu prasseln, doch Wieland schien es nicht zu bemerken. Er konzentrierte sich allein auf sein Werkstück.
Lange Zeit arbeitete er so und hielt selten inne, um zu ruhen. Denn Wieland schmiedete dieses Schwert nur aus einem einzigen Grund. Er musste es schmieden, um sein eigenes Leben zu retten. Immer wieder flog der schwere Hammer auf das Eisen nieder, und mehr und mehr verwandelte es sich zu einem gewaltigen Schwert. Die Klinge war am Ende so groß, dass nur ein leibhaftiger Riese sie hätte führen können.
Am folgenden Tag betrachtete der Erschaffer argwöhnisch sein Werk, legte es nach einer Weile ab und nahm sich eine Feile. Dann begann er zu feilen. Er feilte unermüdlich, die ganze Nacht hindurch und den folgenden Tag und noch einen Tag und noch länger. Er wusste nicht, wie viele Tage er gefeilt hatte, bis das Schwert völlig verschwunden war und nur noch ein Häuflein Späne in der Schale lag, die er unter das Schwert gestellt hatte.
Er nahm die Späne auf und vermischte sie mit Brotteig. Daraus formte er kleine Klöße und trug sie hinaus auf den Hof, wo gerade warme Sonnenstrahlen die Kühle des Vortages zu vertreiben begannen. Er betrat den kleinen Holzverschlag, in dem einige hungrige Gänse begierig warteten, gab ihnen die Klöße mit den Eisenspänen zu fressen und ging wieder.
An den folgenden Tagen sammelte er sorgsam die Hinterlassenschaften der Vögel ein. Er seihte das Eisen aus ihrem Kot und schmiedete in den folgenden Tagen daraus ein neues Schwert, das kleiner war als das erste, aber immer noch gewaltig. Auch dieses Schwert zerfeilte er und abermals gab er die Eisenspäne vermischt mit Brotteig den Gänsen zum Fressen. Danach seihte er wie zuvor den Kot, um das Eisen zu gewinnen und mit geübter Hand und unzähligen Schlägen schmiedete er aus den verdauten Eisenresten meisterlich eine wundervolle Klinge8. Er wusste um diese geheime Kunst von Mime, dem Meisterschmied, bei dem er einst seine frühen Lehrjahre verbracht hatte, noch bevor er zu den Zwergen nach Ballofa kam.
Im Licht der Glut betrachtete der junge Schmied sein Werk und lächelte voller Zufriedenheit. Blitze und grollender Donner durchschlugen in diesem Augenblick die Nacht. Das Schwert schimmerte vom grellen Schein getroffen wie eine blaue Fackel. Es sollte die beste und furchtbarste Waffe sein, die bis dahin jemals durch einen Menschen erschaffen wurde, und der Erschaffer ahnte es. „Mimung“, hauchte er voller Ehrfurcht und strich prüfend über die Klinge. Er schliff sie danach lange, um die harte Schneide zu schärfen und er fertigte einen Griff dazu. Ein Wollknäuel, das er schließlich sanft über die Klinge zog, zerfiel sogleich in zwei Teile.
Einige Tage waren vergangen, seitdem Wieland die Wunderwaffe geschmiedet hatte. Der Tag der Tage war für Wieland angebrochen. Dunkle Wolkentürme zogen über das Land, wie so oft in dieser Jahreszeit. Die Fahnen auf Nidungs hölzerner Burg flatterten laut im Wind. Der junge Schmied hielt das Schwert in der Hand und ging damit auf den Hügel, wo König Nidungs Halle stand. Er wusste, dass dies sein letzter Gang sein konnte. Zitternd umfasste er die Schwertscheide in der jene Waffe steckte, in deren Gewalt er sein Leben geben musste. Schweigend betrat er so die Burg und ging unter den Augen aller auf Nidungs große Halle zu.
In der Halle stand Amelias, der alte Hofschmied des Königs, und erwartete ihn mit einem breiten Grinsen. Amelias hielt einen mächtigen Eisenhelm mit verstärkten Kreuz-Bändern und übergroßen Wangenklappen in seinen Händen. Der König und seine Recken standen um ihn herum, eine breite Gasse bildend.
„Nun wollen wir sehen, wer von euch der bessere Schmied ist.“ begann der König, „...du Amelias, mein Hofschmied... oder Wieland, der das harte Messer gemacht hat.“ Alle im Raum starrten Wieland an, der mit seinem Schwert in der Hand noch immer in der Tür stand. „Wenn dein Schwert nicht auf den Helm beißt, sollst du, wie es ausgemacht war, des Todes sein, Wieland.“
Wieland blickte auf den klobigen Helm, der wie ein eisernes Bollwerk in Amelias Händen lag. Er sah so wuchtig aus und hatte so große Nieten, dass man glauben konnte, Wodan selbst hätte ihn gemacht. Die Männer im Saal wiegten argwöhnisch die Köpfe und blickten ungläubig auf den eisenstarrenden Panzerhelm.
Noch immer grinsend setzte sich Amelias betont feierlich den Helm auf den Kopf und nahm genüsslich auf einem Schemel in der Mitte des Raumes Platz. Dabei verschränkte er überlegen die Arme und lächelte triumphierend. „Schlag nur mit beiden Händen kräftig zu, junger Wieland“, forderte er ihn frohmütig auf. Dann kicherte er hämisch und blickte grinsend in die Runde. Er hatte sich von Beginn an gewundert, weshalb Wieland die Wette in dieser Form angenommen hatte. Er war sicher, kein Schwert dieser Welt konnte einen solchen Helm durchschlagen.
Als Wieland Mimung dann aus der Scheide zog, war es vielen zumute als hätte er ein lebendiges aber dunkles Geschöpf aus einem Käfig befreit. Gebannt starrten alle im Saal auf die dunkel schimmernde Klinge, die ruhig in Wielands Hand lag. Ohne eine Miene zu verziehen, trat Wieland einige Schritte nach vorn. Keiner im Raum atmete, als Mimung im dumpfen Licht des Raumes kurz aufblitzte, weil ein Sonnenstrahl seine Klinge streifte.
Das Gesicht von Amelias verlor für einen Augenblick sein überlegenes Grinsen und nahm ein ahnungsvolles Staunen an. König Nidung nickte zustimmend, als Wieland fragend zu ihm blickte. Dann hob der junge Schmied sein Schwert, holte mit beiden Händen aus und ließ die Klinge mit voller Wucht herab fliegen. Quietschend und fauchend durchdrang sie die eisernen Spangen und brach in die Schädeldecke ein, bis sie tief in Amelias Kopf stecken blieb, ohne dass sie selbst eine größere Scharte bekam.
Der Blick des alten Schmiedes war schockstarr, der Mund war weit aufgerissen, aber ein Schrei entfuhr ihm nicht mehr. Ein erstauntes, ungläubiges Raunen ging durch die Halle, als er leblos zur Seite plumpste.
1 Ballofa, wie der Ort in der isländischen Handschrift A der Thidrekssaga heißt, ist der älteste überlieferte Name von Balve (Ballova) in NordrheinWestfalen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist in der Sage die Balver Höhle oder die benachbarte Höhle unterhalb von Burg Klusenstein gemeint. In der Membrane Kallava, in der altschwedischen Fassung Kallaffua genannt.
2 Dieser Teil der Sage ist stark von Legenden geprägt. Vor allem die Existenz von „Zwergen“ in einem Berg erscheint unglaubwürdig. Ein wahrer Kern ist aber durch die Nennung von Ballofa belegt. Auch lag im Sauerland einsteines der wichtigsten Zentren zur Herstellung von hochwertigem Eisen in Europa. Eisenherstellung ist auch um Balve bezeugt. Der bekannte Zwergenkönig Laurin und sein Rosengarten werden in der Thidrekssaga übrigens nicht erwähnt.
3 Prähistorische Tierknochen hielt man früher für Drachenknochen.
4 Im Inneren einer der genannten Höhlen ist eine ehemalige Schmiedestelle unwahrscheinlich, da man dann wohl Feuerspuren gefunden hätte.
5 Die Hönne. In der Sage allerdings nicht genannt.
6 Die Weser. In den isländischen Thidrekssaga-Handschriften steht allerdings Etissa beziehungsweise Edilla, ein sonst unbekannter Fluss, der in der Thidrekssaga an anderer Stelle als Eidisa (eigentlich Eidis A) vorkommt. Vielleicht ist dies ein alter Name der Weser. Möglicherweise ist aber die Eder gemeint, die über die Fulda in die Weser mündet.
7 In der Thidrekssaga in Jütland gelegen und in einigen Fassungen (Mb, IsA, IsB) Thiod genannt. Eine Lage im Norden Jütlands (Thy) erfordert allerdings eine nahezu unmöglich lange Fahrt mit Wielands Einbaum. Vielleicht ist Jütland eine spätere Hinzufügung der Sage und das Reich Nidungs lag in Wirklichkeit in Norddeutschland an der Weser. Im Wölundlied der älteren Edda wird Nidung (dort Nidud) Herrscher der Njaren genannt. Wer diese Njaren waren, ist allerdings ungeklärt.
8 Dieses Verfahren, das in der Sage erstmals erwähnt wird, ist nachweislich geeignet (und 1936 patentiert worden), um hervorragenden Stahl herzustellen.
HILDEBRANDS ZUG NACH BERN
Mehrere Winter waren vergangen, seitdem das Schwert Mimung durch Wieland geschmiedet worden war9. Auf einer offenen Hochfläche, wenige Tagesmärsche vom Berg Ballofa entfernt, lag in dieser alten Zeit ein Ort, der Venedi10 genannt wurde. Auf einem Rundhügel darüber erhob sich eine kleine Burg. Die Burg selbst war nur eine einfache Holzburg und bestand aus einem Wall und einigen Fachwerkhäusern. Aber in diesem dunklen Zeitalter, das ständig von Kriegslärm erfüllt war, stellte selbst eine so einfache Wehranlage eine Zuflucht gleich einem wackeligen Floß inmitten der tobenden See dar. Es gab sonst nur wenige wehrhafte Flecken und ringsum lagen nur kleinere Höfe und Weiler. Räuberhorden und wilde Tiere hausten in den umliegenden Wäldern und streiften unstet über die Heiden.
Es war ein grauer Morgen, und im Nebelmeer kurz unterhalb der Burg standen, Statuen gleich, rund ein Dutzend bewaffnete Krieger mit Pferden, die von einer Schar einfach gekleideter Menschen umringt waren.
Ein großer, grauer Krieger stand inmitten der Gruppe. Er stach aus der Menge wie ein Wolf aus einer Hundemeute. Sein vom Wetter gegerbtes Gesicht mit dem verwegenen, grauen Bart gab ihm das Antlitz eines alten, aber noch immer wehrhaften, kampfstolzen Recken. Er war Herzog Ragbald aus dem Geschlecht der Wölflinge, Herr über die Burg Venedi und das gesamte umliegende Gebiet.
Einer der Männer sah ihm sehr ähnlich, aber er war viel jünger. Er war in voller Rüstung und trug ein Schwert am Gürtel. Seinen Schild hatte er auf den Rücken gebunden.
Unter dem metallischen Klirren seiner Kettenrüstung warf er sich auf den schwarzen Hengst, der inmitten der Menschengruppe stand, dabei kurz zuckte und die Ohren aufgeregt nach hinten stellte. Der da auf seinem Pferd saß, hieß Hildebrand und er war Ragbalds Sohn. Er hatte ein waches Gesicht, einen hellen Bart und dunkelblondes Haar. Er war hochgewachsen und schlank aber kraftvoll. Aus seinen ruhigen, grünen Augen funkelte wölfische Schläue.
Ein letztes Mal blickte Hildebrand auf alle, die sich seinetwegen hier versammelt hatten, drehte dann seinen Hengst nach Westen und trabte den alten Heerweg entlang. Zwei junge Männer, ebenfalls in Rüstung, waren mit ihm aufgesessen und folgten ihm in eine ungewisse Zukunft.
So machte sich die kleine Schar auf und ritt immer weiter westwärts über Hügel, Berge und Flüsse, durchquerte offene Heiden, Moore, Wälder und traf nur selten auf einen Weiler oder ein Gehöft. Nur ein Raubvogel folgte ihnen weit oben am Himmel ein Stück des Weges und stieß einen grellen Schrei aus.
Hildebrand wusste wohl, dass er auf dem Weg in ein neues Leben war, doch konnte er damals nicht ahnen, in welch verhängnisvolles Schicksal ihn dieser Ritt führen würde. Die Nornen11 hatten schon lange ein dichtes Gespinst aus Schicksalsfäden gewoben. Verzweiflung und Flucht sollten einst seine Zukunft verdunkeln, Krieg und Tod seine Begleiter sein und der Verlust das einzig Sichere. Doch selbst wenn er diese Zukunft gekannt hätte, wäre er wohl geritten. Denn glanzvoller Ruhm und eine tiefe Freundschaft waren ihm von den Mächten zugedacht worden. Unheilvoll donnerte ein Gewitter weit im Norden, wo sich dunkle Wolken zusammengezogen hatten.
Es war am Morgen, als die Reiter die Nähe Berns12 erreichten. Dies war die Hauptburg in König Dietmars13 Reich. Zuerst konnten sie nur die steinernen Türme der alten Festung erkennen. Die dunklen Wolken hatten sich nun über die gesamte Landschaft ausgebreitet und alles mit einer grauschwarzen Decke überzogen. Als sie den Strom fast erreicht hatten, hielten sie ihre Pferde an und blickten eine Weile auf den Fluss, über dem sich das goldene Morgenlicht durch die Wolken nach unten zwängte. Einige Strahlen trafen die Mauern Berns, um sie majestätisch zu vergolden. Der Rheinstrom14 glitzerte grünlich schimmernd und dampfte in der Kühle des Morgens.
Hildebrand hatte diesen Ort schon oft gesehen, aber jedes Mal, wenn er ihn nach längerer Zeit wieder sah, war er gleichermaßen beeindruckt. Obwohl die Stadt längst nicht mehr ganz besiedelt war, ja ganze Viertel in Ruinen lagen und dem Verfall preisgegeben waren, hatte das römische Kastell dennoch viel vom Glanz des alten, großen Reiches bewahrt. Jenem Reich, das sich einst vom tiefsten Süden bis zum kalten Nordmeer erstreckte. Die uralten, steinernen Mauern waren noch rundherum geschlossen und machten es Feinden schwer einzudringen. Mächtig wachte die alte, steinerne Burg so über das Land der Aumlungen15.
Die Reiter folgten dem steilen Weg zum Fluss herab, trieben ihre Pferde in den dunklen, breiten Strom, durchschritten ihn an der ihnen gut bekannten Furt und trabten bald darauf durch das Maul des mächtigen, steinernen Tores.
Als sie die staubige Hauptstraße entlang ritten, wurden sie von unzähligen Kindern und viel Volk neugierig beäugt. Noch bevor sie Dietmars Halle erreichten, kamen ihnen zwei Krieger in Waffen entgegen. In ihrer Mitte ging König Dietmar selbst, Sohn jenes starken Samson, welcher Bern einst erobert hatte. Er hatte dunkelbraunes Haar und ebensolchen Bart und ein freundliches Gesicht. Hildebrand erkannte den König gleich. Der König hatte die Neuankömmlinge auch erkannt und grüßte freundlich lächelnd mit erhobener Hand. Hildebrand und seine Leute stiegen von ihren Rossen und erwiderten den Gruß.
Dietmar fragte Hildebrand sogleich, was sein Anliegen sei, und als dieser dem König seine Absicht vortrug, künftig an seinem Hof zu dienen, war der König ganz erfreut. Die Miene in Dietmars Gesicht, das in diesem harten Zeitalter durch seine milden Züge auffiel, schlug in ein erfreutes Lächeln um. Voller Freude drückte er den jungen Krieger an seine Schulter. Dieser rückte sich etwas verlegen seinen Helm zurecht und grinste leicht verunsichert. König Dietmar mochte den Sohn Ragbalds schon immer gerne, und einen solchen Kämpen, dem man Mut, Klugheit und Geschick gleichermaßen nachsagte, am Hof zu haben, war ihm mehr als recht.
Dicht neben dem König und dessen Begleitern stand ein blonder Knabe in dreckverschmierten Hosen. Zwischen Neugierde und Argwohn hin und her gerissen blickte er unsicher vom Boden auf und sah die Fremden zweifelnd an. Schon packte Dietmar ihn am Arm und zog ihn unsanft zu sich heran. „Das hier ist mein Sohn Dietrich. Er hat gestern schon zwei Hühner mit Pfeil und Bogen erlegt. Bald wird er ein richtiger Krieger sein“, lachte Dietmar. „Allerdings fehlt ihm manchmal die richtige Führung“, fügte er hinzu, wobei er noch herzhafter lachte und dem Kleinen einen Knuff mitgab. Hildebrand sah kurz auf den Knirps herab und grinste ihn an. Der Kleine erwiderte das Lächeln etwas verwirrt und schaute dann aber doch lieber verlegen zu Boden. Dann riss er seinem Vater den Arm weg und blickte ihn grimmig von unten an. Der lachte auf und freute sich wie ein kleines Kind: „Seht ihr, ein richtiger Kämpfer!“
Dietmar war sichtlich stolz auf seinen Sohn, den jungen Dietrich. Hildebrand gefiel der kleine Wildfang auch gleich. Er und seine Leute bekamen Zimmer innerhalb der Mauern zugewiesen. Die nassen Rösser wurden von Knechten in die königlichen Stallungen geführt und versorgt.
Bald darauf saßen Dietmar und seine Gefolgschaft in der großen Halle bei Tisch, und Hildebrand war mit seiner kleinen Truppe ebenfalls dabei. Er saß nahe beim König und setzte den kleinen Dietrich, den Sohn Dietmars, neben sich. Dietrich, der zu diesem Zeitpunkt gerade sechs Jahre alt war, blickte unentwegt staunend zu Hildebrand hoch, der ihm ab und zu kurz mit einem Auge zuzwinkerte, um sich dann wieder seinem Bratenfleisch zu widmen. Der Kleine gefiel Hildebrand, und er spürte immer mehr, dass etwas zwischen ihnen bestand. Wie eine Verbindung, die keiner Worte bedurfte. Doch konnte er damals noch nicht ahnen, wie sehr bereits an diesem Tag ein unsichtbares Band sein Leben mit dem des Jungen untrennbar verknüpfte.
Der kleine Dietrich dagegen war bereits von diesem Augenblick an zutiefst von dem Neuankömmling beeindruckt und wich ihm nicht mehr von der Seite. Immer wieder sah er staunend zu Hildebrand empor, der das freudig bemerkte, sich aber nichts anmerken ließ. Von da an saßen Hildebrand und Dietrich immer nebeneinander, und Dietrich nannte ihn fortan Meister Hildebrand.
Alle sagten, Dietrich und Hildebrand seien von diesem ersten Tag an wie Brüder gewesen. Vielleicht schien das nur im Rückblick so, aber beide verstanden sich von Anfang an, ohne viel Worte gebrauchen zu müssen.
Hildebrand lehrte seinen jungen Schüler seitdem den Umgang mit Waffen und Pferden und auch gute Sitten. Doch gerade das war nicht immer einfach, weil der junge Hitzkopf nicht immer leicht zu bändigen war. Und schließlich war Dietrich als Königssohn Hildebrands Herr, weshalb der ihm eigentlich zu gehorchen hatte oder zumindest diesen Anschein erwecken musste. Dietmar sah es gerne, dass sein Sohn nun von einem Mann wie Hildebrand Ausbildung und Freundschaft erfuhr. War der doch einer der besten Kämpfer mit dem Schwert zu jener Zeit, und noch mehr für seinen wendigen Verstand und seine tapfere Klugheit bekannt.
9 Wenn die Sage auf historischen Geschehnissen fußt, ereignete sich die im Folgenden geschilderte Begebenheit im späten 5. Jahrhundert n. Chr. Eine mögliche Zeitskala ist am Ende des Buches aufgeführt.
10 Venedi liegt ostwärts von Bern. Ritter vermutet Wenden bei Olpe. Auch wir denken uns Hildebrands Heimat in diesem Raum.
11 Weibliche Wesen der nordischen Mythologie, die das Schicksal bestimmen.
12 Das Bern der Sage ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Verona, sondern Bonn am Rhein, das im Mittelalter nachweislich als „Berne“ bezeugt ist. Die Mauern des einstigen Kastells standen vermutlich noch in nachrömischer Zeit und boten den Bewohnern Schutz.
13 Dietrichs Vater wird in den meisten Sagenfassungen Thetmar beziehungsweise Dietmar genannt, was Thuidimir entspräche, dem Vater Theoderichs des Großen. Dies erscheint als ungewöhnlicher Zufall, falls die Sage nicht auf Theoderich den Großen zurückgeht. Der Name Thetmar könnte allerdings eine sekundäre Veränderung der Sage in Anlehnung an Theoderich den Großen sein. In der altschwedischen Fassung SvB der Thidrekssaga findet sich der Name Tackmar (entspräche vermutlich Dagomer) für Dietrichs Vater. Vielleicht ist dies der ursprüngliche Name, den in diesem Falle nur ein Text der Thidrekssaga bewahrt hätte.
14 Rhein, in der Thidrekssaga Rin genannt.
15 Aumlungen, Humlungen, Amelungen oder Ömlinge sind in der Sage die Bewohner des Berner Aumlungalandes. Vielleicht wurde der Name nachträglich in Anlehnung an Theoderich den Großen eingeführt, da dieser als Amaler bzw. Nachfahre des Amal gilt. Vielleicht stammt er auch vom Auelgau nahe Bonn oder einem Herrscher namens Amlung beziehungsweise Humlung.
SIEGFRIED
Bevor die Geschichte Dietrichs und Hildebrands fortgeführt wird, soll hier eine andere Begebenheit erzählt werden, die für den Fortgang der Geschichte von Bedeutung ist.
Einstmals lag im Hunaland16, am Rande des großen Suavawaldes17 eine einsame Schmiede. Die gehörte einem Schmied namens Mime. Mime war kein gewöhnlicher Hufschmied, der nur einfaches Werkzeug zusammenflickte, sondern er gehörte zu den Meistern seiner Zunft, die magiergleich die härtesten Waffen und Rüstungen für die Könige und Fürsten ihrer Zeit schufen. Einst hatte auch der junge Wieland hier gelernt und sich auch Mimes schwarze Kunst angeeignet. Und mit dieser Kunst hatte er später das Schwert Mimung geschmiedet, dem eine unbezwingbare Kraft innewohnte.
Die Schmiede war das einzige Anwesen im weiten Umkreis und nur ein einsamer Karrenpfad führte zielstrebig an ihr vorbei, als wolle er sich nicht zu lange in ihrer Nähe aufhalten und keine unnötigen Windungen wagen. Zusammen mit der angebauten Schmiedehalle und einigen Gesindehäusern stand Mimes Haus am Rand einer öden, offenen Heidefläche. Dabei lag es gleichsam am Rand der dunklen Wälder, die sich auf der anderen Seite weithin erstreckten. Sie versorgten die Schmiede mit dem nötigen Holz. In der Ferne konnte man die strohgedeckten Dächer eines kleinen Dorfes erkennen. Mime zog es jedoch vor, abseits zu wohnen und für sich zu bleiben.
Der Himmel war an diesem Tag trüb und grau, und die einzige Unregelmäßigkeit darin waren einige Aaskrähen, die über das Land hinwegflogen und dabei ihre krächzenden Rufe erklingen ließen. Ein Bach schlängelte sich über die fahle, offene Fläche, auf der einige Schafe weideten. Das Gras, das sie dort suchten, war bereits vergilbt und das Laub der beiden alten Eichen, die in der Mitte der Weidefläche standen, war schon gelbbraun um diese Jahreszeit. Einige Blätter fielen tot herab und wurden in den Hof der Schmiede geweht. Dort stand Mime mit seinem Ziehsohn Siegfried18.
Siegfried war kräftig, hatte blaue Augen und halblanges, goldblondes Haar. Die Wildnis des Waldes sprach aus den reinen Augen des Jungen. Der Schmied selbst war dagegen klein und klobig, hatte ein rohes, ausdrucksloses Gesicht und schwarzes strähniges Haar.
Mime ging in die Schmiedehalle und Siegfried folgte ihm. Der alte Schmied blickte auf den Jungen, der neben ihm am Amboss stand: „Jetzt wollen wir doch einmal sehen, ob wir deine überschüssigen Kräfte nicht lenken können. Nicht dass du mir wieder meine Gesellen verprügelst!“
Der Junge nickte folgsam und rechtfertigte sich nicht, obwohl er nie den Anfang gemacht hatte, wenn es zum Streit mit den Gesellen gekommen war. Wie ihm geheißen, griff er sich das heiße Eisen mit der Zange aus der Glut und legte es auf den Amboss. Er presste die Lippen zusammen, holte mit dem Hammer aus, und schlug mit voller Wucht zu. Der Schlag war so heftig, dass die Zange abbrach und das Stück Schmiedeeisen durch die ganze Werkstatt schoss. Mime war wütend. Er griff nach der Zange und betrachtete sie verstört: „Verflucht! Was auch immer aus dir wird, Siegfried, niemals wirst du zum Handwerk taugen.“ Siegfried verließ wortlos die Halle, ging ins Wohnhaus und setzte sich an einen Tisch. Er saß eine lange Weile schweigend dort.
Mimes Wut über die zerstörte Zange wich aber bald einem Entsetzen über die schiere Kraft seines Zöglings. Ganz genau untersuchte er die Zange, ob sie nicht doch schon vorher schadhaft gewesen sein könnte. Dann begutachtete er besorgt seinen Amboss, als ob dieser auch gerissen sein könnte. Dann ergriff ihn eine große Angst. Lange stand er so in der Halle und grübelte, was er tun könnte um den Jungen loszuwerden. Der ungestüme Rebell könnte ihn jederzeit erschlagen und seine Schmiedegesellen dazu, sei es aus Wut oder um alle Kostbarkeiten des Anwesens an sich zu reißen. Und wenn er ehrlich zu sich war, wäre das nicht einmal ungerechtfertigt. Schlecht hatte er den Jungen behandelt in all den Jahren.
Vor Jahren hatte Mime ihn im Wald gefunden und aufgenommen. Der Schmied hatte oft überlegt, ob es Vorbestimmung war, dass er ihn fand, oder ob ihn jemand so ausgesetzt hatte, dass er ihn hatte finden müssen. Denn der Junge war dem Reden der Leute nach, ein leiblicher Sohn des Königs Sigmunds 19 von Tarlungaland20. Sie sagten, dass der König seine Frau töten ließ und das Kind im Wald ausgesetzt wurde. Anfangs glaubte Mime nicht, dass sein Junge dieser Königssohn sei. Schnell war der Zögling sehr groß und kräftig geworden. Und er wurde stärker und mutiger als es Mime recht war. Inzwischen war Mime selbst sicher, dass Siegfried von königlichem Blut war.
Während Mime diesen finsteren Gedanken nachhing, kam ihm ein böser Plan in den Sinn. Er würde versuchen den Jungen ein für alle Mal loszuwerden. Er würde ihn unbewaffnet in den Wald schicken, dorthin, wo sein Bruder hauste, der grässliche Fafnir. Der würde ihn töten und verschwinden lassen. Mimes Bruder, der einst Regin genannt wurde, hatte sich vor langer Zeit in einen Drachen21 verwandelt und nannte sich seitdem selbst Fafnir22. Mime ging ins Haus. Aus dem Augenwinkel beobachtete er den arglosen Jungen, während er seine dunklen Gedanken sponn.
Wenige Tage waren seitdem vergangen. Viele Blätter waren inzwischen von den Eichen herab in den Hof der Schmiede gefallen. Mime hatte Siegfried tatsächlich in die Wälder geschickt um Kohlen zu brennen, geradewegs zum Versteck des grässlichen Fafnir. Dort war Siegfried auf die Bestie getroffen und es war zum Kampf gekommen.
Zwischen den Blättern im Hof der Schmiede lag nun der leblose Leib eines Mannes auf der Erde. Aber es war nicht Siegfried der da lag, sondern Mime selbst. Sein abgeschlagener Kopf lag einige Schritte entfernt in einer Blutlache. Mime war auch im Leben kein schöner Mensch gewesen. Aber nun, da sein Gesicht todesstarr entstellt und vom Rumpf getrennt war, sah er aus wie ein Troll.
Blutbespritzt stand sein Todbringer über ihm. Der war jung und kräftig und sah trotz seiner schäbigen Kleidung aus wie das genaue Gegenteil von Mime. Siegfrieds Antlitz verriet bereits sein aufrichtiges und mutiges Wesen. Seine eisblauen Augen ließen dahinter einen Geist erahnen, so gerade wie ein fallender Stein. Sein Körper war schlank und stark, sein Gesicht lang und kräftig und von einfacher Schönheit. Blonde, halblange Haare fielen in leichten locken bis an die Schultern herab.
Siegfried blickte eine Weile auf den toten Mime herab, und fragte sich ob er ihn aus Hass oder Mitleid getötet hatte oder aus Enttäuschung. Er kam zum Schluss, richtig gehandelt zu haben und wischte sein blutiges Schwert an einem Lappen ab, den er vor der Werkstatt gefunden hatte.
Vor seinem geistigen Auge erwachte Fafnir erneut zum Leben. Fafnir war im Leben übermannshoch gewesen, überall mit harten Schuppen gepanzert. Er trug einen Helm, der Aussah wie ein Drachenhaupt und das Gesicht des Trägers darunter völlig verbarg. Dieser Drachenkopfhelm wurde Schreckenshelm genannt und er verwandelte Fafnir in einen leibhaftigen Drachen.
Die alten Geschichten erzählen, dass Fafnir von üblem Wesen war und die Gesellschaft von Menschen und Tieren scheute. Am Ende saß er nur noch auf seinem Schatzhort und bewachte ihn voller Eifersucht. Einen Teil des Schatzgoldes hatte er seinem Vater geraubt, den er dafür erschlug. Am teuersten war ihm aus dieser Beute der goldene Ring, den der Zwerg Alberich einst schmiedete. Damals nannte sich dieser Zwerg auch Andwari, und so wurde der Ring später Andwaris Gabe genannt. 23
Diesem Ring sagte man große Fähigkeiten nach. Man glaubte, er habe die Macht Gold zu mehren. Und tatsächlich schien dem Kleinod irgendeine Macht innezuwohnen. Denn es gelang Fafnir, seit er den Ring besaß, große Mengen reinsten Goldes in seinen Besitz zu bringen. Große Teile von Fafnirs Gold lagen seitdem in seinem Versteck auf der Gnithaheide24.
Doch es lag ein Fluch auf dem Ring Andwaris, der jedem den Tod bringen würde, der ihn zu lange besaß. Lange hatte der Ring nur Fafnirs Wesen verändert und ihn einsam und böse werden lassen. Vielleicht war es die Kraft des Rings, die ihn immer mehr zu einem Drachen werden ließ.
Doch nun hatte der Ring seinen Fluch erfüllt und so lag Fafnirs erschlagener Leib vor dem Eingang seiner Behausung tief in den Wäldern. Sein schwarzer Schuppenpanzer war von Blut besudelt. Der blutbespritzte Eichenknüppel, der ihn erschlug, lag neben ihm.
Das Drachenhaupt lag indes nicht in den Wäldern, sondern in der Schmiede neben Mimes Kopf. Dessen Gesellen waren alle geflohen, als sie Siegfried mit Fafnirs schwarzem Panzerhaupt aus dem Wald kommen sahen. Und sie taten gut daran. Sonst wären sie wohl neben ihrem Meister zu liegen gekommen.
Ein letztes Mal blickte Siegfried voller Abscheu auf das Gesicht seines Ziehvaters Mime und dann auf Fafnirs Drachenhelm. So lagen die abgetrennten Häupter der Brüder nun in ihrem eigenen Blut im Tode vereint. Mime war oft böse gewesen aber er war Siegfried dennoch wie ein Vater und nie hätte der junge Held geahnt, dass Mime ihn eines Tages töten wolle. Doch nun wusste er es besser und er hatte nur noch Verachtung für ihn übrig.
Siegfried wischte Mimes restliches Blut von dem Schwert, das der einst selbst geschmiedet hatte, und schob es in die Scheide zurück. Mime hatte es auf den Namen Gram25 getauft, weil es seinen Feinden Gram bringen sollte. Und nun hatte es ihn selbst getötet. Siegfried band es an die Seite nachdem er ein kostbares Kettenhemd angezogen hatte. Darüber warf er seinen hellbraunen Mantel und er nahm sich einen prächtigen Schild und einen vergoldeten Helm. Schließlich hievte er den Sack mit den kostbarsten Schätzen des erschlagenen Fafnir auf ein Maultier. Hunderte Münzen und zahlreiche Becher und Schalen aus Gold und Silber waren in dem einfachen Leinensack.
Nur ein Kleinod aus dem Schatz war nicht in dem Sack. Es war der Ring Andwaris. Er sah ihn genauer an. Eine ganze Weile hielt dieser seinen Blick gefangen. Der Ring schien beinahe lebendig zu sein, so schimmerte er in der Sonne des Waldes. Siegfried konnte die große Macht spüren, die dem Kleinod innewohnte. Andächtig steckte er ihn an seinen Finger und fühlte die Macht des Ringes auf sich übergehen. Er fühlte sich hellwach und unbesiegbar.
Nachdem Siegfried die Ladung festgezurrt hatte, verließ er mit seinem Maultier diesen Ort des Grauens. Vorsichtig umging er die benachbarte Ansiedlung und durchquerte dann lange die dichten Wälder der Umgebung. Nebelschwaden überzogen die Berge und hüllten alles in dumpfe Trübnis. Der junge Held führte sein Lasttier unermüdlich immer weiter. Immer wieder kamen ihm die Bilder seines Drachenkampfes durch den Kopf.
Er sah den unheimlichen Gegner immer wieder vor sich, wie er im Wald lauerte. Fafnir war überall gepanzert und glaubte sich unverwundbar. In seinen Klauen hatte er eine gewaltige Klinge als Waffe.
So hatte er sich auf Siegfried gestürzt, als dieser sich arglos an sein Feuer setzte. Doch Siegfried hatte ihm den glühenden Ast seines Feuers ins Auge gestoßen, das eine Schwachstelle bildete. Fafnir war daraufhin umhergetaumelt und hatte grimmige Flüche ausgespien. Siegfried ergriff eine Axt und noch bevor Fafnir sich gefangen hatte, schlug er ihm den Kopf ab. Über und über wurde der junge Held dabei vom heißen Blut Fafnirs besudelt, das an dem kalten Tag heftig dampfte. Es war eine Mischung aus angenehmer Wärme und kaltem Ekel, die Siegfried bei dem Gedanken daran durchfuhr.
Siegfried konnte es noch immer kaum fassen, dass er den gewaltigen Feind allein besiegt hatte. 26
Voller Stolz blickte der junge Siegfried immer wieder über seine vom Blut verkrusteten Arme. Er hatte das Blut mit Absicht nicht abgewaschen, da man den Säften von Drachen damals große Zauberkraft zuschrieb. Dann zog er den goldenen Ring Andwaris nochmals vom Finger, den Fafnir getragen hatte. Er betrachtete ihn lange und es kam ihm so vor, als ob der Ring ihn auch beobachtete.
Gerade als er den Ring wieder angesteckt hatte, bemerkte er, dass auf der Haut zwischen seinen Schultern etwas klebte. Er zog es von der Haut und hielt ein blutverschmiertes Lindenblatt27 in der Hand. Auf der Unterseite war das Blatt nicht rot. Siegfried fragte sich, ob es ein böses Omen sei, dass er nun eine Stelle am Rücken hatte, die nicht vom Drachenblut bedeckt worden war. Er ahnte nicht, wie sehr er mit dieser Befürchtung Recht hatte.
Lange zog er durch die Wälder. Auf einer Lichtung trabte in größerer Entfernung eine aufgeschreckte Herde Wisente davon. Auch ein Reh kreuzte seinen Weg. Menschen traf er nicht. Er schlief im Wald und zog dann tags darauf weiter, immer darauf bedacht, dass ihn niemand entdecken würde. Schließlich erreichte er eine kleine Ansiedlung, wo er den Weg nach dem Ort Segard28 erfragte. Eine alte Frau wies ihm den Weg, und als sie noch ihre knochigen Finger nach dem Ziel ausstreckte, war er schon weitergezogen. Immer weiter folgte er dem Weg und je weiter er lief, desto mehr schafften es einige Sonnenstrahlen, die Wolkendecke zu durchdringen.
Dann erreichte er ein lichtes Tal, dem er folgte, bis er offenes Land und schließlich Segard erreichte. Der Ort lag auf einem Hügel inmitten einer fruchtbaren Ebene vor dem Nordgebirge29. Es war ein großer Hof mit Ställen und Gesindehäusern, der von einer Holzmauer aus Eichenstämmen eingefasst war. Zahlreiche prächtige Pferde weideten auf den Weiden und den Eichenhainen, die vor dieser Mauer lagen. Die meisten der Rosse waren grau oder weiß. Der junge Held folgte dem Weg bis zu einem offenbar unbewachten Tor. Er schlug dagegen, brach den Riegel dabei auf und betrat den Hof, wo ihn eine Wache, mit Speer und Schild bewaffnet, erwartete. Man konnte nicht sehen, dass Siegfried eine kostbare Kettenrüstung unter dem Umhang trug, und auch das Schwert war unter dem Packsattel des Maultieres verborgen. Die ärmliche, schmutzige Kleidung und die ungekämmten Haare verliehen ihm das Aussehen eines Landstreichers.
Ein Wächter stellte sich ihm entgegen und rief: „Wer seid Ihr? Und was wollt Ihr, Fremder?“ „Ich bin Siegfried und ich will zu Brünhild“, begann er recht unbeholfen, „man hat mir eines ihrer Pferde versprochen.“ „Ich würde sagen, ihr bleibt bei dem, was ihr habt, Herr Maultiertreiber!“, höhnte die Wache, „so ein richtiges Pferd ist nichts für Ungeübte.“
Der zweite Wächter, der dazugekommen war, lachte laut schallend, und auch ein dritter gesellte sich grinsend hinzu. Aus der offenen Tür eines großen Langhauses blickte ein junges Mädchen neugierig auf das Geschehen. Der Fremde gefiel ihr gleich. Trotz seiner schäbigen Kleidung sah er sehr gut aus, wie sie fand. Die verwegen aussehenden, langen, blonden Locken wollten nicht so recht zu seinem leicht einfältigen Blick passen, und dennoch besaß sein Antlitz etwas, das sie völlig in den Bann zog.
„Mir hat jemand ein Schwert mit Goldgriff versprochen“, äffte ihn einer der Wächter mit hoher Näselstimme nach. „Mir hat einer eine Burg versprochen!“, höhnte der andere, und alle drei brachen in schallendes Gelächter aus, um sich vor Lachen zu krümmen. Siegfried ließ ihnen geduldig Zeit, zu Ende zu lachen und erklärte dann trocken: „Eine Burg habe ich nicht. Aber ein Goldgriffschwert kann ich euch geben... Wo wollt ihr es denn hineingesteckt haben, Meister? Ins Herz oder ins Hirn?“ Die Wache verstummte und blickte nur noch ungläubig in Siegfrieds kalte Augen.
Schnell ergriff der Wächter das Heft seines Schwertes. Aber noch schneller zog Siegfried das Schwert unter der Decke seines Maultieres hervor, und fast gleichzeitig flog die Klinge durch die Luft. Sie schoss der erschrockenen Wache in den Hals, so dass der Kopf absprang.
Die Wächter starrten ungläubig auf ihren toten Kameraden und dann auf die blutige Waffe in Siegfrieds Hand. Sie versuchten noch ihre Speere gegen ihn zu heben, doch bevor sie zustoßen konnten, sanken sie niedergestreckt zu Boden. Drei weitere Knechte hoben ihre Speere und stürmten herbei. Siegfried zog ruhig das Schild vom Rücken des Maultieres und stellte sich unerschrocken dagegen. „Genug, hört auf“, ertönte eine schöne, aber herrische Stimme. „Empfangt den Fremden wohl und lasst ihn herein.“
Siegfried blickte erstaunt in Richtung der Stimme und erkannte die Umrisse einer jungen Frau in der Tür. Die Knechte blickten sich furchtsam und doch erleichtert an und atmeten tief durch. Dann zogen sie wortlos ihre toten Kameraden fort. Siegfried ging mit seinem Maultier durch die Pforte und sah sich argwöhnisch um.
Als er das Mädchen nun sah, das gerade herausgekommen war, stockte ihm der Atem, so schön war sie. Ihr helles Kleid umschlang einen schlanken und doch weiblichen Körper, und goldblondes Haar wehte in leichten Locken um ihr liebliches, helles Gesicht. Ihre Gesichtszüge waren von vollkommener Schönheit, die Augen funkelten wie Sterne. An einem Schwertgurt an ihrer Seite hing ein kostbares Hiebschwert.
Siegfried fragte sich einen Augenblick, ob er vielleicht schon gefallen war und vor einer Walküre vor den Toren Walhalls30 stand. „Wer bist du? Und woher kommst du“, fragte das schöne Mädchen den Krieger. „Ich heiße Siegfried und komme aus Mime.. äh.. von Mime.. also dem Schmied.“, stotterte Siegfried. Sie musste lachen und jetzt konnte Siegfried schon gar nichts mehr sagen, so ergriffen war er von dem lieblichen Wesen.
Brünhild sah man nicht an, dass sie ähnlich empfand. Doch sie rügte ihn mit keinem Wort für den Verlust ihrer Wachen. Stattdessen ließ sie ihm etwas zu Essen bringen. Amüsiert sah sie zu, wie der Wildfang alles hastig hinunterschlang, als hätte er drei Tage nichts gegessen. Sie musste schmunzeln, und als er das bemerkte, versuchte er anständig zu essen, doch das wirkte gleich noch unbeholfener.
Dann gingen sie vom Hof und liefen den, von alten Linden gesäumten Weg entlang, der von den Gebäuden wegführte. Herrliche Pferde grasten in den lichten Wäldern um das Anwesen. „Wer hat dir nun eines meiner Pferde versprochen?“ „Das war Mime der Schmied.“ „Das kann gut sein, ihm habe ich tatsächlich ein Pferd versprochen“, nickte sie. „Wie geht es ihm“, fragte sie unbeteiligt. Siegfried kratzte sich am Kopf und überlegte kurz. „Nicht besonders gut“, antwortete er ausweichend und blickte betreten zur Seite. Brünhild blickte ihn kurz verwundert an, fragte aber nicht weiter. „An deinen Waffen sehe ich auch, dass du wirklich von Mime kommst. So sollst du es also haben.“
Siegfried fragte geradewegs, weshalb so ein junges Mädchen allein auf einem so großen Gut wohnte. Sie erzählte ihm daraufhin, dass ihre Eltern beide gestorben waren und dass ihr Ziehvater31 häufig nicht zuhause war und dass darum sie sich oft um Haus und Hof kümmern musste.
Als sie sich noch ein paar Schritte der Herde genähert hatten, fragte sie: „Welches willst du? Such dir eines aus, das dir gefällt.“ Siegfried blickte auf die vielen Pferde, die friedlich grasten, und fühlte sich beinahe überfordert. Herrliche Schimmel, Graue und Rappen grasten auf der Weide. Einige trabten auch umher oder trugen spielerische Kämpfe untereinander aus. Dann fiel sein Blick auf einen schwarzen Hengst, der laut wieherte und seine Mähne heftig schüttelte. „Den nimm lieber nicht, das ist Grane, den hat noch keiner geritten“, erklärte Brünhild, als sie bemerkte, dass ihm ausgerechnet dieses Tier gefiel.
Siegfried nickte, um zu bedeuten, dass er genau das im Sinn hatte. „Er ist nicht zu reiten“, beteuerte Brünhild und schüttelte energisch mit dem Kopf. „Ich will es trotzdem versuchen“, erklärte Siegfried knapp, nahm sich ein Halfter und ging auf die Weide. Vor dem schwarzen Hengst blieb er stehen. Der Hengst blickte ihn witternd an, als hätte er eine drohende Naturgewalt ausgemacht. Er zögerte und überlegte wohl, ob er fliehen sollte. Doch das Tier schien sich nicht von dem jungen Krieger lösen zu können. Siegfried sprach ruhig zu dem Pferd und näherte sich ganz langsam. Es blickte ihn nun neugierig an, als sei Siegfried ebenfalls ein Pferd. Eine ganze Weile standen sich die beiden so gegenüber. Schließlich ging Siegfried langsam auf das Tier zu, das nicht vor ihm floh. Als er nahe genug war, streichelte er vorsichtig die Mähne. Nach kurzer Zeit flüsterte er dem wilden Hengst ins Ohr, und ohne sich zu wehren, ließ der sich ein Halfter umlegen.





























