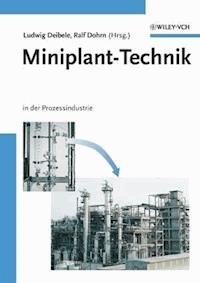
Miniplant-Technik E-Book
129,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nur in Ausnahmefällen lassen sich technische Anlagen für neue Produktionsverfahren der chemischen Industrie an Hand von Literaturdaten und rechnerischer Simulation entwickeln und auslegen. Der übliche Weg des Scale-up führt über den Laborversuch und den anschließenden Aufbau einer Technikumsanlage zur technischen Großanlage.
Die Miniplanttechnik ermöglicht die Entwicklung technischer Anlagen in nur einem Schritt vom Labor zur funktionierenden Großanlage. Dabei werden alle Verfahrensschritte im kleinstmöglichen Maßstab, der noch einen reproduzierbaren Dauerbetrieb erlaubt, als Gesamtverfahren aufgebaut und mit Originalprodukten betrieben. Der zeitaufwendige und kostenintensive Zwischenschritt vom Laborversuch über die Technikumsanlage entfällt.
Das vorliegende Buch beschreibt allgemeine Anforderungen an Miniplantanlagen und befasst sich mit Fragen, die vor dem Bau einer verfahrensspezifischen Anlage geklärt werden müssen. Hierzu gehören sowohl die Festlegung des Reaktionsablaufs und der Aufarbeitung mit den erforderlichen Verfahrensschritten, Trennsequenzen und Verfahrensabläufe als auch die Verschaltung der Einzelschritte. Den Hauptteil des Buches nimmt die Beschreibung der Apparaturen ein, die heute für die einzelnen verfahrenstechnischen Grundoperationen in Miniplantanlagen zur Verfügung stehen. Chemiker, Verfahrenstechniker und Ingenieure aus der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, die sich mit der Planung und dem Aufbau großtechnischer Anlagen befassen, finden in diesem Buch wertvolle Informationen für ihre tägliche Arbeit; Berufseinsteiger und Wissenschaftler an Technischen Hochschulen und Informationen wird ein leichter Einstieg in das faszinierende Gebiet der Miniplanttechnik ermöglicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Der Weg zur Miniplant-Technik – ein historischer ÜberblickLudwig Deibele
2 Grundsätze der Miniplant-TechnikLudwig Deibele
2.1 Gründe für Laborversuche
2.2 Anforderungen an die Miniplant-Technik
2.3 Vorteile von Miniplant-Anlagen gegenüber Technikumsanlagen
2.4 Apparate- und Verfahrens-Scale-up
3 Voraussetzungen zum Bau von Anlagen der Miniplant-Technik
3.1 Arbeitsumfeld Hans Bernd Kuhnhen
3.2 Werkstoffe Hans Bernd Kuhnhen
3.3 Baukastenprinzip für Miniplant-Anlagen Hans Bernd Kuhnhen
3.4 Steuerung und Regelung Werner Zang
3.5 Messdatenaufnehmer Werner Zang
3.6 Sicherheitskonzept bei Miniplant-Versuchsanlagen Jürgen Spriewald
4 Stoffdaten und Verfahrensablauf
4.1 Physikalische Stoffdaten und Thermodynamik Ralf Dohm
4.2 Festlegung des Verfahrensablaufs und einzelner Verfahrensschritte Ludwig Deibele
5 Apparaturen der einzelnen Crundoperationen
5.1 Reaktionstechnik Philip Bahke, Arno Behr, Andrzej Cörak, Achim Hoffmann
5.2 Fluidverfahrenstechnik
5.3 Feststoffverfahrenstechnik
6 Betrieb von Miniplant-AnlagenJuan R. Herguijuela
6.1 An- und Abfahren
7 Beispiele von Miniplant-AnlagenJuan R. Herguijuela
7.1 Einleitung
7.2 Aufarbeitung einer Kristallisationsmutterlauge
7.3 Katalysatorrückführung mittels Reaktivrektifikation
7.4 Quenchkondensation eines Reaktionsprodukts
7.5 Einsatz von neuen Trennverfahren zur Gleichgewichtverschiebung bei einer chemischen Reaktion398
7.6 Schlussbemerkung
8 Geht es noch kleiner?Andreas Pfennig
8.1 Miniaturisierung zum Schließen der Stoffkreisläufe
8.2 Miniaturisierung in der Produktion
8.3 Miniaturisierung für das Scale-up
8.4 Detailmodellierung basierend auf Laborversuchen
Sachverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
F.P. Heimus
AnlagenplanungVon der Anfrage bis zur Abnahme2003, ISBN 3-527-30439-8
R. Goedecke (Hrsg.)FluidverfahrenstechnikGrundlagen, Methodik, Technik, Praxis2006, ISBN 3-527-31198-X
K. Ohlrogge, K. Ebert (Hrsg.)MembranenGrundlagen, Verfahren und industrielle Anwendungen2006, ISBN 3-527-30979-9
V. Hessel, S. Hardt, H. Löwe, A. Müller, G. KolbChemical Micro Process Engineering2 Volumes2005, ISBN 3-527-31407-5
Herausgeber:
Dr. Ludwig Deibele
Schäfflerstr. 680333 München(ehemals Bayer AG, Leverkusen)
Dr. Ralf Dohrn
Bayer Technology Services GmbHProcess TechnologiesReaction and Polymer TechnologyThermophysical PropertiesGebäude B31051368 Leverkusen
Titelbild Anlagenfotos mit freundlicher Genehmigung der QVF Engineering GmbH
1. Auflage 2006
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information
Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-30739-5
Epdf ISBN 978-3-527-66095-7
Epub ISBN 978-3-527-66037-7
Mobi ISBN 978-3-527-66036-0
Vorwort
Mit dem Begriff Miniplant-Technik verbindet sich die Vorstellung, eine geplante technische Großanlage im kleinstmöglichen Maßstab mit allen verfahrenstechnischen Grundoperationen funktionsfähig aufzubauen und mit Originalprodukt zu betreiben. Mithilfe der so gewonnenen experimentellen Daten wird ein direktes Scale-up auf die technische Größe ermöglicht, wodurch Versuche im Technikumsmaßstab entbehrlich werden.
Die Miniplant-Technik ist aus den Entwicklungslabors der Verfahrenstechnik und der Chemie hervorgegangen. Dabei wurde der Begriff Miniplant-Technik erst vor einigen Jahren geprägt. Aus diesem Grund existiert bisher nur wenig an Literatur zu diesem weiten Arbeitsgebiet, und wir haben uns das Ziel gesetzt, diese Lücke mit dem vorliegenden Buch zu schließen.
Das Buch richtet sich sowohl an Ingenieure und Chemiker, deren Arbeitsgebiet die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Miniplant-Anlagen und das Scale-up der Versuchsergebnisse auf die technische Anlage beinhaltet, als auch an Studenten der Bereiche Verfahrenstechnik und Chemie, die sich während des Studiums mit diesen Aufgabenstellungen befassen.
Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert, die in ihrer Reihenfolge in groben Zügen der Vorgehensweise des Betreibers einer Miniplant-Anlage folgen. Dieser prüft zuerst, ob Versuche erforderlich sind, sucht sich den dafür geeigneten Laborplatz, plant die Miniplant-Anlage, baut sie mit allen verfahrenstechnischen Grundoperationen und Verbindungsleitungen auf und führt schließlich die Versuche durch. So wird im Einleitungskapitel 1 zunächst der geschichtlichen Entwicklung der Labortechnik nachgegangen und gezeigt, wie sich der Begriff Miniplant-Technik entwickelt hat. In Kapitel 2 werden die Fragen aufgeworfen, warum und wozu heute Laborversuche erforderlich sind und wie ihre Ergebnisse auf einen technischen Maßstab übertragen werden können. Kapitel 3 geht sowohl auf die Bauteile der Miniplant-Technik als auch auf die Werkstoffe der Apparaturen ein, zeigt den Mess- und Regelaufwand bei diesem Anlagenmaßstab und gibt Hinweise auf Sicherheitstechnik. Kapitel 4 befasst sich mit der Planung der Miniplant-Anlage, wobei auf die Ermittlung der Stoffdaten besonderes Augenmerk gelegt wird.
In Kapitel 5, dem umfangreichsten, wird der Stand der Miniplant-Technik in der Reaktionstechnik und bei den Verfahren der Fluid- und Feststoffverfahrenstechnik beschrieben. Dabei zeigt sich der unterschiedliche Stand der Miniplant- Technik bei den verschiedenen Grundoperationen. In der Destillationstechnik ist die Miniplant-Technik beispielsweise schon sehr weit entwickelt. Es existiert ein gesichertes Vorgehen für das Scale-up, und es liegt bereits eine langjährige Erfahrung vor. Bei der Zerkleinerung gibt es dagegen nur erste Überlegungen zu kleineren Apparaturen und zum Scale-up. Hauptgrund hierfür sind verfahrenstechnische und apparative Probleme bei der Maßstabsverkleinerung. Hier will das vorliegende Buch zeigen, inwieweit heute ein Scale-up bei den verschiedenen Grundoperationen möglich ist, und Hinweise geben, wo weiterer Forschungsaufwand sinnvoll und nötig ist.
In Kapitel 6 wird das Anfahren von Miniplant-Anlagen beschrieben und die Versuchsdauer diskutiert. In Kapitel 7 werden einige Miniplant-Anlagen mit unterschiedlichen Grundoperationen vorgestellt und damit gezeigt, was heute machbar ist. Das Abschlusskapitel 8 geht der Frage nach, ob und bei welchen Verfahren eine weitere Verkleinerung möglich und sinnvoll ist.
Die Herausgeber hoffen, mit diesem Buch eine Bestandsaufnahme des heutigen Wissens der Miniplant-Technik geliefert und einen Anstoß zum weiteren Vorgehen in dieser interessanten Technik gegeben zu haben. Da speziell das Wissen über die einzelnen Grundoperationen sehr vielschichtig und komplex ist, wurden 14 Koautoren gewonnen, die ausgewiesene Spezialisten auf ihrem Fachgebiet sind. Ihnen möchten die Herausgeber an dieser Stelle für die erfolgreiche Mitarbeit herzlich danken. Das gleiche Dankeschön gilt auch dem Verlag für die gute Zusammenarbeit.
München und LeverkusenDezember 2005
Ludwig DeibeleRalf Dohrn
Autorenliste
Philip Bahke
Universität DortmundLehrstuhl für Technische Chemie AEmil-Figge-Straße 7044221 Dortmund(Abschnitt 5.1)
Arno Behr
Universität DortmundLehrstuhl für Technische Chemie AEmil-Figge-Straße 7044221 Dortmund(Abschnitt 5.1)
Ralf Dohrn
Bayer Technology Services GmbHProcess TechnologiesReaction and Polymer TechnologyThermophysical PropertiesGebäude B 31051368 Leverkusen(Abschnitt 4.1)
Ludwig Deibele
Schäfflerstraße 680333 München(Kapitel 1 und 2, Abschnitte 4.2 und 5.2.1)
Andrzej Górak
Universität DortmundLehrstuhl für ThermischeVerfahrenstechnikEmil-Figge-Straße 7044221 Dortmund(Abschnitt 5.1)
Juan R. Herguijuela
Separation Processes & TechnologiesGewerbestraße 284123 AllschwilSchweiz(Kapitel 6 und 7)
Achim HoffmannUniversität DortmundLehrstuhl für ThermischeVerfahrenstechnikEmil-Figge-Straße 7044221 Dortmund(Abschnitt 5.1)
Axel KönigUniversität Erlangen/NürnbergLehrstuhl für TrenntechnikEgerlandstraße 391058 Erlangen(Abschnitt 5.3.2)
Hans Bernd KuhnhenGoethestraße 1335083 Wetter(Abschnitte 3.1, 3.2 und 3.3)
Reiner LaibleROSENMUND VTA AGGestadeckplatz 64410 LiestalSchweiz(Abschnitt 5.3.3)
Andreas PfennigRWTH AachenLehrstuhl für ThermischeVerfahrenstechnikWüllnerstraße 552062 Aachen(Kapitel 8)
Joachim Ritter
Bayer Technology Services GmbHProcess TechnologyRPT-MST, Geb. E4151368 Leverkusen(Abschnitt 5.3.4)
Thomas Runowski
Bayer Technology Services GmbHProcess TechnologyDistillation and Heat Transfer,Geb. B 31051368 Leverkusen(Abschnitt 5.2.2)
Wolfgang ScheibeUVR-FIA GmbHChemnitzer Straße 4009596 Freiberg/Sachsen(Abschnitt 5.3.5)
Jörg Schwarzer
Cognis Deutschland GmbHCRT-Process TechnologyHenkelstraße 6740589 Düsseldorf(Abschnitt 5.2.4)
Jürgen SpriewaldBayer Technology Services GmbHZT-TE – FIVT-Dest Geb. B 31051368 Leverkusen(Abschnitt 3.6)
Martin Steiner
ROSENMUND VTA AGGestadeckplatz 64410 LiestalSchweiz(Abschnitt 5.3.1)
Michael TravingBayer Technology Services GmbHProcess TechnologyAdsorpt., Chrom., Extrac. & Mem.Tech., Geb. B31051368 Leverkusen(Abschnitt 5.2.3)
Werner ZangHiTec ZangEbertstraße 30–3252134 Herzogenrath(Abschnitte 3.4 und 3.5)
1
Der Weg zur Miniplant-Technik – ein historischer Überblick
Mithilfe der Miniplant-Technik wird versucht, eine technische Anlage mit all ihren verfahrenstechnischen Schritten voll funktionsfähig im kleinstmöglichen Maßstab nachzubilden. Hierzu bieten sich die im chemischen Labor vorhandenen Apparate und die über Jahrhunderte angesammelte experimentelle Erfahrung an. Somit stellen die Miniplant-Technik und die mit ihr aufgebauten Miniplants nichts grundsätzlich Neues dar, sondern basieren auf vorhandenem Wissen. Deshalb ist es interessant, in diesem Einleitungskapitel auf die historische Entwicklung der Labortechnik einzugehen und damit die Wurzeln und den Weg zur Miniplant-Technik aufzuzeigen. Das soll am Beispiel der Destillation und Rektifikation erfolgen [1–2], da sich auf diesem verfahrenstechnischen Gebiet das größte experimentelle Wissen angesammelt hat, wie auch in weiteren Kapiteln gezeigt wird.
Erste konkrete Abbildungen zu Destillationsapparaturen finden sich bereits bei den alexandrinischen Alchemisten im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. So sind in Abb. 1.1 bereits Destillationskolben zu erkennen, die mit Öfen beheizt werden. Die Dämpfe steigen durch ein Rohr aufwärts und kondensieren in einem kugelförmigen Aufsatz, dem Alembik, wobei die Umgebungsluft als Kühlmittel dient. Das Kondensat sammelt sich in einer Rinne und wird durch ein oder mehrere Röhrchen in Fläschchen abgefüllt [3]. Mit diesen Apparaturen wurden wahrscheinlich höher siedende ätherische Öle für die Parfümherstellung destilliert.
In den nächsten Jahrhunderten änderte sich grundsätzlich nur wenig am Aufbau der Destillationsapparatur. Erst um etwa 1200 wurde die Effektivität der Kondensation durch die Einführung von Wasser als Kühlmittel entscheidend gesteigert. Dadurch gelangen auch die Destillation und Kondensation von Ethylalkohol, der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das wichtigste Destillationsprodukt darstellt. Abb. 1.2 zeigt eine Destillationsapparatur vom Ende des 16. Jahrhunderts von Conrad Gesner [4]. Deutlich sind der Herd mit eingebauter Heizblase und die fallende Kühlschlange im mit Wasser befüllten Kühlfass zu erkennen. Außerdem erreicht die Apparatur bereits technische Dimensionen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Destillationsapparatur nur Labordimensionen. Größere Anlagen mit Technikums oder technischen Dimensionen tauchen erst im 15. Jahrhundert auf. Eine eigenständige Entwicklung von Laborapparaturen wird jedoch erst möglich, nachdem Johann Kunckel (1630–1702), Leiter des kurfürstlichen Labors in Berlin, durch Einführung des sog. Blasens vor der Lampe mit der Glasmacherpfeife, Glas ausreichender Qualität herstellen konnte und damit Glas zum Hauptwerkstoff im Labor wurde. Schöne Beispiele der Glasbläserkunst des 18. Jahrhunderts zeigen Laborapparaturen aus dem Deutschen Museum in München (Abb. 1.3). Mit beiden Apparaturen sollten Gemische in mehrere Fraktionen zerlegt werden, was aber ohne Einbauten zur Erhöhung der Trennleistung nur unzureichend gelingen dürfte.
Abb. 1.1 Destillationsgeräte der alexandrinischen Alchemisten aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus.
Abb. 1.4 zeigt gläserne Laborgeräte des französischen Apothekers Antoine Baumé (1728–1804) aus seinem Werk Chimie expérimentale et raisonnée [5]. Beachtenswert sind die Destilliergeräte mit Tubus und Stopfen, die gläserne Kühlschlange und die sog. Florentinerflaschen zur Trennung zweier flüssiger Phasen, zuerst in Florenz zur Trennung ätherischer Öle von Wasser eingesetzt.
Abb. 1.2 Destillationsapparatur aus dem 16. Jahrhundert nach Conrad Gesner.
Abb. 1.3 Glasapparatur für das Labor aus dem 18. Jahrhundert.
Abb. 1.4 Gläserne Laborgeräte von Antoine Baumé aus dem 18. Jahrhundert.
Zur selben Zeit wurde bereits die Gegenstromkühlung im Labor eingeführt, wie Abb. 1.5 aus der Dissertation Observationes chemicae et mineralogicae [6] von Christian Ehrenfried von Weigel (1748–1831) zeigt. Der Gegenstromkühler, der sog. Liebig-Kühler, bestand aus zwei ineinander gesteckten Rohren, von denen das Innere als Glasrohr und das Äußere als Weißblechrohr ausgeführt wurden. Auch die Haltevorrichtungen für den Kühler wurden von Weigel entwickelt und sind Vorläufer unserer heutigen Stativklammern.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unterschieden sich die Destillationsapparaturen im Labor und in der Technik nur in den Dimensionen. Erst mit der stürmischen Entwicklung der organischen Chemie ab 1850 entstanden eigenständige Destilliergeräte, die völlig auf die Belange der Experimentalchemie zugeschnitten waren. Deshalb sind die Laborapparaturen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts häufig mit den Namen bedeutender Chemiker verbunden.
Zunächst versuchte man durch sog. Destillationsaufsätze die Trennleistung der Destillationskolonnen zu verbessern. Den ersten Schritt stellen die Kugelaufsätze (Abb. 1.6) nach Charles Adolphe Wurtz (1817–1884) von 1854 dar, Professor an der Sorbonne in Paris und Entdecker der nach ihm benannten Wurtz-Synthese zur Herstellung langkettiger Alkane aus den entsprechenden Alkylhalogenen. Aus den Kugelaufsätzen entwickelte sich im 20. Jahrhundert die Vigreux-Kolonne (Abb. 1.7), hier bereits mit einem mit Luft gefülltem Mantel zur besseren Isolierung.
Die Siebbodenaufsätze in Abb. 1.8 von Linnemann von 1871 und von Glinsky von 1875 sind Vorstufen der Laborsiebbodenkolonne.
1881 wurde von Walter Hempel (1851–1916), Professor an der TH Dresden mit der Gasanalyse als Spezialgebiet, die Füllkörperkolonne mit Glaskugeln im Labor eingeführt. Abb. 1.9 zeigt den Gesamtaufbau einer Vakuumdestillieranlage von 1910 nach einer Abb. von Carl von Rechenberg aus seinem Standardwerk Einfache und fraktionierte Destillation in Theorie und Praxis [7] mit Hempel-Kolonne und Vakuumschleuse. Dieses wichtige Bauteil von Vakuumanlagen wurde um 1900 von Gabriel Emile Bertrand (1867–1962) erstmals eingesetzt, Professor am Pasteur-Institut in Paris und Verfasser wichtiger Arbeiten über Koffein und koffeinfreien Kaffee. Bei der abgebildeten Laboranlage erfolgt die Beheizung der Kolonne mit einem Bunsenbrenner. Die Dämpfe werden zweistufig kondensiert. Das im unisolierten Bereich oberhalb der Kolonne anfallende Kondensat fließt als Rücklauf im Gegenstrom zu den aufsteigenden Dämpfen direkt zur Kolonne zurück. Die verbleibenden Dämpfe werden in einem fallenden Schlangenrohrkühler vollständig kondensiert und fließen dann über die Vakuumschleuse in das Abnahmegefäß. Mit dieser Apparatur kann natürlich die Rücklaufmenge nicht mengenmäßig erfasst werden.
Abb. 1.5 Laborapparatur mit Liebigkühler nach Weigel.
Abb. 1.6 Destillationsaufsatz nach Wurtz in Kugelform von 1854.
Abb. 1.7 Vigreux-Kolonne mit Luftisolationsmantel von 1930.
Abb. 1.8 Siebbodenaufsätze nach Linnemann (links) von 1871 und nach Glinsky (rechts) von 1875.
Abb. 1.9 Gesamtaufbau einer Vakuumdestillationsapparatur nach Rechenberg [7] von 1910.
Die meisten der bisher aufgeführten Kolonnen und Kolonnenaufsätze folgen dem Prinzip der Füllkörperkolonne; durch Einbauten wird eine möglichst große Oberfläche geschaffen, an der Dampf und Flüssigkeit aneinander vorbeiströmen. Dagegen perlt bei den Bodenkolonnen der Dampf auf den Böden durch aufgestaute Flüssigkeitsschichten, und zwischen den Böden werden beide Phasen getrennt geführt. Dabei wurde die Flüssigkeit zunächst meist außerhalb, heute innerhalb des Kolonnenmantels zum nächst tiefer liegenden Boden geführt.
Beispiele für frühe Siebbodenkolonnen sind die Kolonnen von Oldershaw von 1941 mit innen liegender Flüssigkeitsführung (Abb. 1.10) und von Karl Sigwart (1906–1990) von 1950 mit außen liegender Flüssigkeitsführung (Abb. 1.11). Bei der Kolonne von Oldershaw wird durch die senkrecht angeordneten Sieblöcher verhältnismäßig viel Flüssigkeit auf den darüber liegenden Boden mitgerissen, was seine Wirksamkeit vermindert. Bei Sigwart sind deshalb die Löcher seitlich in vertieften Böden angeordnet, und die Dämpfe werden umgelenkt.
Abb. 1.10 Laborkolonne mit Siebböden nach Oldershaw von 1941.
Abb. 1.11 Laborkolonne mit Siebböden nach Sigwart von 1950.
Eine der ersten Glockenbodenkolonnen für das Labor konstruierte Bruun 1931 mit außen liegender Flüssigkeitsführung (Abb. 1.12), wobei jedoch zur besseren Isolierung ein zweiter Kolonnenmantel um die Glockenbodenkolonne und die Flüssigkeitsführung gelegt wurde. Bei dieser Konstruktion liegen Zu-und Ablaufrohr einander gegenüber, sodass nur der halbe Glockenumfang als Flüssigkeitsweg zur Verfügung steht. Damit halbiert sich die Verweilzeit der Flüssigkeit auf dem Boden, und seine Wirksamkeit nimmt ab. Diesen Nachteil vermeidet der Glockenboden nach Schmickler-Fritz mit seiner Kreisstromführung, außerdem besitzt er eine innen liegende Flüssigkeitsführung (Abb. 1.13). Mit diesem um 1970 entwickelten Bodentyp dürfte eine auch nach heutigen Gesichtspunkten optimale Laborglockenbodenkolonne vorliegen. Sie wurde zunächst von der Firma Normag produziert, und heute wird sie von der Firma QVF hergestellt.
Abb. 1.12 Laborkolonne mit Glockenböden nach Bruun von 1931.
Mit Karl Sigwart, einem Ingenieur und Begründer der verfahrenstechnischen Abteilung der Firma Bayer, treten etwa ab 1940 Verfahrensingenieure in dem bisher von Chemikern dominierten Laborbereich in Erscheinung. Ihr Ziel ist es, die Laborapparaturen für die verfahrenstechnischen Grundoperationen zu optimieren und schließlich ein direktes Übertragen der Laborversuchsergebnisse auf technische Großanlagen ohne aufwendige Zwischenschritte im Technikum zu ermöglichen.
Abb. 1.13 Laborkolonne mit Glockenböden in Kreisstromführung von Schmickler-Fritz von 1970.
Bis 1960 wurden die Laborkolonnen weit gehend diskontinuierlich betrieben und für die Siedeanalyse eingesetzt. Die Anlage bestand aus elektrisch beheizter Blase, Kolonne und Kondensationssystem, wobei die Rücklaufmenge durch Abzählen von Tropfen ermittelt und über Ventile dosiert wurde. Ab 1965 wurden bereits viele Laborkolonnen kontinuierlich betrieben, was zur Entwicklung von Pumpen für den Zulauf, speziellen Verdampfern mit Sumpfentnahme und Kondensatoren mit geregelter Flüssigkeits- oder Dampfteilung führte. Auch wurde jetzt verstärkt die Wirksamkeit der Laborkolonnen mithilfe von Testmessungen ermittelt, um ein direktes Scale-up auf technische Anlagen zu ermöglichen, wobei im Labor und in der Technik das gleiche Testsystem verwendet wurde.
Bald wurden nicht nur einzelne Kolonnen, sondern mehrere Kolonnen zu ganzen Anlagen verschaltet, die ein Abbild der geplanten technischen Anlage ergaben. Zum Betrieb dieser komplexen Anlagen ist eine den Labormengen angepasste Mess- und Regeltechnik erforderlich. Um 1990 führte man für diese Laboranlagen den Begriff Miniplants und für die hierzu speziell benötigte Technik den Begriff Miniplant-Technik ein. Heute beschränkt sich eine in Miniplant-Technik ausgeführte Laboranlage nicht nur auf die Destillation und Rektifikation, sondern enthält auch Apparate anderer verfahrenstechnischer Grundoperationen.
Literatur zu Abschnitt 1
1. E. Krell, Handbuch der Laboratoriumsdestillation, Verlag Alfred Hüthig, Heidelberg–Basel–Mainz, 1976.
2. L. Deibele, Die Entwicklung der Destillationstechnik im 19. Jahrhundert, Dissertation an der TU München, 1992.
3. A. J.V. Underwood, Transactions-Institution of Chem. Engineers, 1935, 34–63.
4. C. Gesner, Ander Teil des Schatzs Evonymi von allerhand kunstlichen und bewerten Oelen, Wassern und heimlichen Artzneyen, Zürich (Rara der Bibliothek des Deutschen Museums, München), 1593.
5. A. Baumé, Chimie expérimentale et raisonnée, in deutscher Übersetzung von J.C. Gehlem, Leipzig, 1775.
6. C. E. v. Weigel, Observationes chemicae et mineralogicae, Dissertation an der Universität Göttingen, 1773.
7. C. v. Rechenberg, Einfache und fraktionierte Destillation in Theorie und Praxis, Miltitz bei Leipzig, 1923.
2
Grundsätze der Miniplant-Technik
2.1 Gründe für Laborversuche
Ziel der chemischen, pharmazeutischen und petrochemischen Industrie ist es, aus Naturstoffen, heute meist Erdöl, zunächst Grundchemikalien und weiterhin immer komplexere chemische Verbindungen herzustellen. Die Auswahl des erforderlichen Reaktionsweges, die Aufarbeitungsverfahren und die Festlegung ihrer Reihenfolge erfolgen in enger Zusammenarbeit von Chemiker und Verfahrensingenieur. Ihnen stehen dazu der Stand des Wissens in der einschlägigen Literatur und die Erfahrungen aus bereits ausgeführten technischen Anlagen zur Verfügung. Die physikalischen und chemischen Stoffdaten können sie umfangreichen Datenbänken entnehmen [1]. Fehlende Daten müssen je nach erforderlicher Genauigkeit geschätzt, berechnet oder gemessen werden (Abschnitt 4.1).
Nach der Festlegung der einzelnen Verfahrensschritte erfolgen die Auswahl der erforderlichen Apparate und schließlich ihre Dimensionierung für die technische Anlage. Diese Arbeiten werden heute durch verschiedene Hilfsmittel erleichtert, die in den letzten Jahren entwickelt wurden. Hierzu zählen Programme zur Auswahl der Apparate, Simulationsprogramme zur Erstellung der Mengen- und Wärmebilanzen des Gesamtverfahrens und Programme zur Beschreibung der thermodynamischen und hydrodynamischen Vorgänge in den einzelnen Apparaten.
Bei bereits vorhandenen Anlagen im technischen Maßstab genügen deren Abmessungen und Betriebsdaten, um das Gesamtverfahren zu modellieren und Neuanlagen anderer Kapazität auszulegen. Bei neuen Verfahren oder Verfahrensänderungen von bekannten Verfahren reichen dagegen rein rechnerische Ansätze nicht aus, um eine funktionssichere technische Anlage zu dimensionieren. Auch größere Sicherheitszuschläge sind keine Garantie für das Funktionieren der Anlage. Hier bleibt nur das Experiment, um verlässliche Ausgangsdaten für die Rechnung zu liefern [2]. Versuche sind zwingend erforderlich, wenn modellmäßig nicht fassbare Anforderungen gestellt werden. Bei den Produkten sind dies extreme Reinheitsforderungen im ppm- und ppb-Bereich oder spezielle Reinheitsforderungen wie beispielsweise Farbzahlen nach Hazen und beim Abwasser TOC-, CSB- und AOX-Werte [3]. Außerdem wird häufig erst durch Experimente das Vorhandensein unerwünschter Komponenten festgestellt, die durch Neben- oder Zerfallsreaktionen entstehen oder durch Aufarbeitungsverfahren und Rückführungen stark angereichert werden. Weiterhin geben Versuche auch über längere Zeiträume Auskunft über
die thermische Stabilität der Stoffe,Hinweise zum Schaumverhalten von Flüssigkeiten,das Fouling an den Wandflächen von Wärmetauschern,das Korrosionsverhalten der hier eingesetzten Materialien oder mithilfe von Werkstoffproben anderer Materialien, die in der technischen Anlage eingesetzt werden sollen.An das Experiment sind dabei folgende Anforderungen zu stellen:
Als Einsatzprodukt sollte nur ein Originalprodukt verwendet werden.Jeder Verfahrensschritt sollte einem Versuchsapparat zugeordnet werden können.Der Versuchsapparat sollte die gleiche Funktion wie die geplante technische Apparatur besitzen.Die Versuchsbedingungen sollten denen der späteren technischen Anlage entsprechen.Bei ersten Verfahrensstudien wird im Labor zunächst experimentell die Machbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte erprobt. Zur Auslegung technischer Anlagen sind jedoch gezielte Experimente erforderlich. Sie müssen Daten für ein sicheres Scale-up auf die spätere technische Anlage liefern. Dabei wird aus Kostengründen eine möglichst kleine Versuchsanlage angestrebt und damit ein möglichst großer Übertragungsfaktor zur technischen Anlage.
2.2 Anforderungen an die Miniplant-Technik
Früher erfolgten nach dem Versuch in einer Laboranlage weitere Untersuchungen im Technikumsmaßstab in einer Technikumsanlage. Dabei wurde beispielsweise für den Durchmesser von Destillationskolonnen ein Übertragungsfaktor zwischen 3 und 10 sowohl vom Labor zum Technikum als auch vom Technikum zur Technik erreicht. Heute entfällt weitestgehend der Schritt über das Technikum bzw. den Pilotplant, und der Weg erfolgt direkt von der Laboranlage bzw. dem Miniplant zur Technik. Dann liegt der Übertragungsfaktor für den Durchmesser von Destillationskolonnen zwischen 10 und 100.
Voraussetzung für ein sicheres Scale-up ist, dass der untersuchte Verfahrensschritt in der Miniplant-Apparatur nicht durch zusätzliche Einflüsse verändert wird und somit nicht mehr dem auszulegenden technischen Verfahren entspricht. Zu den Einflüssen zählen beispielsweise Wandeinflüsse, die ja durch das mit abnehmenden Apparatedimensionen ansteigende Verhältnis von Apparateoberfläche zu Volumen zunehmen, oder katalytische Wirkungen der verwendeten Materialien. Weitere Überlegungen zum Grad der Miniaturisierung enthält Kapitel 8.
Der Übertragungsfaktor vom Miniplant zur Technik unterscheidet sich bei den verschiedenen Grundoperationen. Bei den Fluidverfahren (Abschnitt 5.2), wozu Destillation, Rektifikation, Eindampfung, Kondensation, Flüssig/Flüssig- Extration und Membrantechnik zählen, werden, wie gezeigt, problemlos Übertragungsfaktoren von 100 erreicht. Bei den Feststoffverfahren (Abschnitt 5.2), wie Filtration, Kristallisation, Trocknung, Mischen und Zerkleinern, sind die Übertragungsfaktoren viel kleiner. Grundsätzlich gilt, dass ein größerer Übertragungsfaktor ein tieferes theoretisches Verständnis der Vorgänge der untersuchten Grundoperation erfordert, was wiederum zu einer genaueren Modellierung führt. Dieses Phänomen wird bei den Fluidverfahren im Vergleich zu den Feststoffverfahren bestätigt.
Unterschiedliche Übertragungsfaktoren erschweren den Betrieb von Miniplants mit verschiedenen Grundoperationen. Während für Miniplant-Anlagen der Fluidverfahrenstechnik Durchsätze zwischen 1 kg/h und 10 kg/h ausreichen, benötigen Anlagen der Feststoffverfahrenstechnik häufig 100 kg/h Mindestdurchsatz, um eine sichere Aussage zum Scale-up treffen zu können. Hier hilft die Tatsache, dass die Aufarbeitungsverfahren der Feststoffverfahrenstechnik meist End- oder Anfangsstufen des Gesamtverfahrens sind. So können sie durch einen Pufferbehälter von den anderen Stufen getrennt und sporadisch betrieben werden, ohne die Stoffströme in kontinuierlich betriebenen Anlagen zu unterbrechen. Befindet sich die Feststoffstufe jedoch im Zuge des Gesamtverfahrens, so sind zwei Zwischenpuffer erforderlich.
Wichtige Anforderungen an die Miniplant-Technik sind
die Möglichkeit eines schnellen Aufbaus der Versuchanlage;ihre hohe Flexibilität bei Umbauten, die ja durch Änderungen der Versuchsbedingungen häufig auftreten;ein problemloser Betrieb über längere Zeiträume, der beispielsweise zur Klärung von Fragen zur Anreicherung von Nebenprodukten erforderlich ist [4].Aus diesen Gründen sollten für die einzelnen Verfahrensschritte möglichst keine Neukonstruktionen zum Einsatz kommen, sondern die einzelnen Bauteile der Anlage sollten erprobt, funktionssicher und möglichst als Normbauteile mit genormten Anschlüssen und Verbindungen greifbar sein. Für die Fluidverfahren ist die Entwicklung dieses „Baukastens“ schon weit fortgeschritten; hier stehen die Normbauteile der verschiedenen Glashersteller zur Verfügung. Für die Miniplant-Anlagen hat der Werkstoff Glas verschiedene Vorteile. Er zeichnet sich durch eine große Chemikalienbeständigkeit aus und erlaubt außerdem, die Vorgänge im Inneren der Apparatur zu beobachten. Bei den Feststoffverfahren ist die Entwicklung des „Baukastens“ noch nicht so weit fortgeschritten, und man ist häufig auf Eigenentwicklungen angewiesen.
Bei den einzelnen Bauteilen im Labormaßstab ist die Abstufung gröber als in einer technischen Anlage. Deshalb müssen die Apparate einen weiten Belastungsbereich besitzen, um große Mengenänderungen bei gleicher Wirksamkeit problemlos verarbeiten zu können.
Häufig haben Miniplant-Anlagen nicht nur die Aufgabe, Daten für ein Scale- up zu liefern, sondern man stellt mit ihnen auch Bemusterungsmengen her. Speziell bei teuren Produkten, von denen nur kleine Mengen benötigt werden, erfolgt die Produktion in Miniplant-Anlagen. Außerdem können Miniplant-Anlagen zum Trainieren der Fahrmannschaft für die spätere technische Anlage eingesetzt und Ab- und Anfahrvorgänge oder Störfälle studiert werden. Auch Analyseverfahren lassen sich mit den anfallenden End- und Zwischenproduktströmen testen. All diese Arbeiten sind zeitaufwendig und verlängern die Anfahrphase der technischen Anlage.
2.3 Vorteile von Miniplant-Anlagen gegenüber Technikumsanlagen
Mitentscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines neuen Produkts ist seine möglichst schnelle Markteinführung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von der Idee bis zum wirtschaftlichen Betrieb der technischen Großanlage Zeiträume von bis zu zehn Jahren vergehen und Entwicklungskosten von bis zu 25 Millionen Euro anfallen können [5]. Diese Kosten werden erst mit dem wirtschaftlichen Betrieb der technischen Anlage wieder eingespielt. Deshalb verschafft ein kürzerer Entwicklungszeitraum Kostenvorteile und einen Zeitvorsprung vor der Konkurrenz.
Einen großen Teil der Entwicklungszeit eines neuen Produkts nehmen der Bau und Betrieb der Pilot- bzw. Miniplant-Anlage ein. Tabelle 1 zeigt einen groben Vergleich des Zeitbedarfs für beide Typen von Versuchsanlagen. Danach können durch Einsatz einer Miniplant-Anlage bis zu zwei Jahre an Entwicklungszeit bei etwa einem Zehntel der Kosten eingespart werden. Das verdeutlicht auch Abb. 1, wo die Summe der anfallenden Kosten während des Entwicklungsverlaufs über der Zeit für Pilot- und Miniplant-Anlage aufgetragen sind.
Neben diesen Kosten- und Zeitvorteilen haben die folgenden Vorteile zur weit gehenden Verdrängung der Pilotanlagen durch die Miniplants geführt:
Tabelle 2.1 Vergleich des Zeitbedarfs zwischen Pilotanlage und Miniplant nach [2]
PilotanlageMiniplantPlanungszeit1 Jahr3–4 MonateBestell-/Aufbauzeit1 Jahrmax. 3 Monate (inkl. Bestellung Sonderteile)Anfahrzeit3 Monate1 MonatVersuchsdauer6–9 Monate6–9 MonateGesamtdauer3 Jahre1–1,5 JahreAbb. 2.1 Kosten für eine Verfahrensentwicklung als Funktion der Zeit einer Pilotanlage und eines Miniplants.
Neben diesen vielen Vorteilen hat die Miniplant-Technik auch Nachteile gegenüber der Technikumsanlage. So machen die kleineren Abmessungen Miniplants empfindlicher gegen äußere Einflüsse, außerdem erhöht der größere Übertragungsfaktor die Anforderungen an die Modellbildung.
2.4 Apparate- und Verfahrens-Scale-up
Beim Apparate-Scale-up wird der einzelne Apparat untersucht, dabei sollen die Experimente Daten zu einem Scale-up für eine optimale technische Anlage liefern. Hierfür ist es erforderlich die Belastungsgrenzen der Apparatur hinsichtlich Durchsatz und Trennergebnis auszuloten. Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn die Versuchsapparatur gerade die an sie gestellte Aufgabe erfüllt. Dabei kommt der Vorteil von Miniplant-Anlagen in Bezug auf die Flexibilität bei Umbaumaßnahmen zum Tragen. Mit diesen Daten kann man bei der technischen Anlage Überdimensionierungen vermeiden und hat ein Gefühl für die erforderlichen Sicherheitszuschläge.
Für ein Verfahrens-Scale-up wird das gesamte Verfahren mit sämtlichen Rückführungen im Miniplant-Maßstab aufgebaut und betrieben. Hauptvorteil bei diesen Versuchen sind die Beobachtung sowohl des Zusammenspiels der einzelnen Verfahrensschritte als auch der Bildung von Nebenprodukten und ihr Aufschaukeln durch Rückführungen auch über längere Zeiträume. Dafür ist die Versuchsanlage so zu dimensionieren, dass auch der kleinste Mengenstrom noch handhabbar ist. Mit dieser Vorgabe wird die Größe der einzelnen Apparate festgelegt, eventuell muss auch mit Puffergefäßen gearbeitet werden. Da die Apparate die vorgegebenen Anforderungen in Bezug auf Menge und Trennergebnis erfüllen müssen, werden sie überdimensioniert, um sonst erforderliche Umbaumaßnahmen möglichst einzuschränken. Erfüllt jedoch ein Apparat nicht die an ihn gestellten Forderungen, so liefern auch die Folgeapparate mit ihren Rückführungen nur bedingt brauchbare Daten. Schlimmstenfalls wird die gesamte Versuchsaussage verfälscht. Aus diesen Gründen sind Ergebnisse für ein Verfahrens-Scale-up nur bedingt zur Dimensionierung von Einzelapparaten geeignet. Doch können bei diesen Versuchen Produkte nach jedem einzelnen Verfahrensschritt gewonnen werden, mit denen dann gesonderte Versuche für ein spezielles Apparate-Scale-up durchgeführt werden können.
Literatur zu Abschnitt 2
1. J. Gmehling, U. Oncken, Vapour-Liquid Equilibrium Data Collection, Chemistry Data Series, DECHEMA, Frankfurt/Main ab 1977.
2. H. Steude, L. Deibele, J. Schröter, Chemie Ingenieur Technik 1997, 5, 623–631.
3. T. Mann, ATV-Handbuch Industrieabwässer Grundlagen, 4. Aufl., Verlag Ernst & Sohn, Berlin 1999.
4. S. Maier, G. Kaibel, Chem. Ing. Tech. 1990, 3, 169–174.
5. B. Blumenberg, Nachr. Chem. Tech. Lab. 1994, 5, 480–485.
3
Voraussetzungen zum Bau von Anlagen der Miniplant-Technik
3.1 Arbeitsumfeld
Die Miniplant-Technik hat sich überwiegend aus der Labortechnik entwickelt und ist deshalb zunächst in den herkömmlich bekannten Laborräumen betrieben worden. Ein anderer nicht oft beschrittener Weg war, Miniplant-Anlagen in den Technika für Pilotplant-Anlagen zu integrieren, wobei hier ein Scale-down von Prozesstechnikanlagen zu Miniplant-Anlagen erfolgte. In den letzten Jahren hat sich im Laborbau vieles geändert, vor allem im Hinblick auf die Arbeitsplätze in den belüfteten Abzügen. Grundsätzlich ist die mangelnde Arbeitshöhe für Miniplant-Anlagen in den Abzügen mit etwa 2,4 m und im Laborraum selbst üblicherweise mit 3,0 m zu beklagen. Für Reaktionsanlagen mit Destillationsaufsatz reichen diese Arbeitshöhen oft nicht aus, bei Destillations- und Flüssig- Flüssig-Extraktions-Kolonnenanlagen i.d. R. nicht.
Die Improvisationen im bestehenden Laborbau für den Anwender oder den Anlagenbauer sind groß und meist auch zu bewundern. Der finanzielle Aufwand für den Vorortumbau der Labormöbel und der Anlagen ist allerdings sehr hoch. Deshalb müssen für den Arbeitsraum mit Miniplant-Apparaturen undanlagen neue Richtlinien formuliert und ideenreich umgesetzt werden, wenn die Flexibilität und Mobilität als sehr wichtige Gesichtspunkte für die Miniplant-Technik in den Vordergrund gestellt werden.
3.1.1 Arbeitsraum
Im Gegensatz zu den bisher bekannten Laboreinrichtungen muss vor allem auf fest eingebaute Labormöbel in den belüfteten Abzügen und im Laborraum selbst weitestgehend verzichtet werden.
An der Außenfront sind zumeist Fenster und großzügige Glasflächen für gute Tageslichtausleuchtung vorzusehen. An der Fensterseite können Arbeitsplätze für PC-Steuer-, Regel- und Auswertesysteme sowie für sonstige Schreibtischarbeiten fest eingebaut werden.
An den Seitenwänden des Arbeitsraumes ist es besonders vorteilhaft, wenn über die ganze Länge hinweg begehbare, belüftete Abzüge zur Verfügung stehen. An der Rückwand, die in den meisten Fällen als Zwischenwand zum Flurbereich mit der notwendigen Verkehrsfläche für das Betriebspersonal und für den Transport der Betriebsmittel dient, sollte innen wie außen ausreichend Platz für Versorgungsschränke mit Geräten, Chemikalien oder Betriebsmitteln vorgesehen werden. Auch ist es denkbar, dass größere Aggregate wie z. B. Wärmeübertragungsanlagen, Vakuumpumpen oder Stahlflaschen für Versorgungsund Reaktionsgase außerhalb des Arbeitsraumes im Flurbereich Platz finden oder in seitlich angrenzenden Nebenräumen unter Berücksichtigung der Bauund Sicherheitsvorschriften untergebracht werden. Über fest installierte oder überwiegend flexible Versorgungsleitungen in leicht zugänglichen Installationskanälen werden die Anlagen im Arbeitsraum angeschlossen und versorgt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























