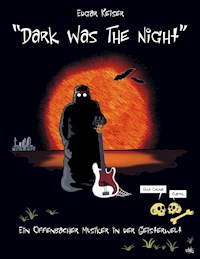Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
MINOTAURUS von Edgar Keiser ist eine Zusammenstellung von Kurzgeschichten, deren Themen von Geistern, Parallelwelten, Zeitreisen sowie der Vielfalt menschlicher Abgründe bestimmt sind. Der Begriff 'Horror' wird dabei weitläufig ausgelegt, wodurch die Grenzen zu 'Thriller', 'Fantasy' und 'Science Fiction' fließend bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchdeckelgestaltung: Edgar Keiser Vielen Dank an Vera für ihren Beitrag zu „Midas“.
Inhalt
Rot
Die Geschichte von dem Eroberer, der nicht zuhören wollte
Mrs. Shelleys Tagebuch
Die Geschichte von dem Buch, in dem die Wahrheit stand
Midas
Die Geschichte von der fünften Zerfallsreihe
Hydra
Die Geschichte von der Frau, die alles verlor, was sie liebte
Der neunte Tag
Die Geschichte von dem Mann, der seine große Liebe stahl
Le Dentiste
Die Geschichte von dem Mann, der am falschen Ort Zahnschmerzen bekam
Irgendwann, zur Weihnachtszeit
Die Geschichte von dem Mann, der sich selbst fand
Mermaid
Die Geschichte von der Frau, die ihr Herz verlor
Jolinda
Die Geschichte von der Anhalterin, die Kuscheltiere mochte
Charon
Die Geschichte von dem Mann, dessen Abschied missglückte
Minotaurus
Die Geschichte von der Engländerin, die nach links ging
Rot
*
Erster Tag
Die Staubwolke, die hinter den Hügeln aufstieg, konnte keine natürliche Ursache haben.
Pater Claudius hatte bereits zuvor an anderen Orten ähnliche Bilder gesehen und wusste, dass es Reiter waren, die sich der Stadt näherten. Es musste sich um ein Heer handeln, dessen Größe jedes Vorstellungsvermögen übertraf.
Der Pater hatte auf seinen Reisen bereits von diesem fremden Reitervolk aus dem Osten gehört, das alles und jeden erbarmungslos überrannte. Die Armee wuchs täglich, da die heimgesuchten Menschen meistens kampflos die Waffen streckten und sich den Reitern lieber anschlossen, als in einem kurzen, ungleichen Kampf niedergemacht zu werden.
Man nannte sie auch die Armee der Finsternis, da die Reiter immer nur nachts angriffen und ihrem entsetzlichen Treiben frönten. Hoch ließen sie die Feuer der zerstörten Städte in den Nachthimmel lodern, was selbst die Sterne zum Verblassen brachte.
Und über alldem stand mit rotem Blut der furchteinflößende Name ihres Anführers geschrieben.
Arakoona.
Schlimmste Dinge waren Pater Claudius über diesen gottlosen Mann zu Ohren gekommen, und wenn auch nur die Hälfte der Wahrheit entsprach, dann konnte es kein Mensch sein, der diese Legion marodierender Bestien befehligte.
Wenn ihn sein Schicksal eines Tages ereilte, dann würde er in der Hölle brennen, so viel war gewiss.
Claudius schloss die Augen und entzog sich somit dem Anblick der sich nähernden Staubwolke, die nur den Tod bringen konnte.
Allerdings war die Stadt wehrhaft, auch wenn es hier nicht mehr so viele Menschen gab. Hier, an diesem trostlosen Ort, könnte Arakoonas Weg enden.
So mochte das Unheil, das Gott über die Menschheit gebracht hatte, doch noch einem höheren Zweck dienen, welcher Claudius bisher verschlossen gewesen war. Und den verbliebenen Bewohnern dieser Stadt ebenso.
Der Gottesmann stieg die Treppe von der Stadtmauer hinab und sah Tantra, die Königin, auf sich zukommen. Sie saß erst seit wenigen Tagen auf dem Thron, denn ihr greiser Vater Tolodorich war gestorben. Sie war die letzte Verbliebene der königlichen Familie. Ihr Gesicht war schmal und sorgenvoll.
„Ich habe gehört, sie essen Menschen, wenn ihre Vorräte knapp werden“, sagte die junge Frau. „Stimmt das, Pater?“
Also wusste auch sie bereits, welches Gewürm sich da auf die Stadt zubewegte.
„Man hört viel“, wich der Pater aus.
„Was ratet Ihr mir, Mann Gottes?“, fragte Tantra kühl. „Soll ich mich Arakoona anbieten und die Stadt damit retten?“
Claudius und die neue Königin waren sehr schnell von etwa fünfzig Menschen umkreist, die aus trüben Augen blickten und warteten. Sie waren in Lumpen gehüllt, ohne Hoffnung und wohl auch ohne Zukunft.
„Die Stadt ist nicht zu retten, wie Ihr wohl wisst“, entgegnete Claudius behutsam nach einer kurzen Pause. „Euer Opfer wäre umsonst. Und sicher ist: Arakoona wird Euch nicht erst fragen, wenn er Euch begehrt. Seid gewiss, dass Ihr ihm gehören werdet, wenn er Eurer ansichtig wird.“
„Wie könnt Ihr es wagen?“, empörte sich Tantra. „Vor Euch steht Eure Königin.“
Claudius schüttelte den Kopf.
„Ihr seid nicht meine Königin“, widersprach er. „Allein Jesus Christus ist mein König.“
Damit ließ er sie stehen und kehrte in seine bescheidene Unterkunft zurück.
Dort dachte er nach.
Er konnte nicht so viele Menschen in den Tod gehen lassen, auch wenn es sengende und brennende Barbaren waren, mit einem wahren Teufel als Anführer. Gottes Worte sagten etwas anderes.
In Wahrheit war auch Arakoona nur ein Mensch, wenn es auch nach allen Berichten und Erzählungen nur schwer zu glauben war. Und Menschen hatten Ohren zum Hören. Selbst Arakoona würde vielleicht zuhören.
Solange es etwas Hoffnung gab, musste sie genährt werden. Wenn dazu keiner imstande war, dann musste er, Claudius, es selbst tun.
*
Zweiter Tag
Das Zeltlager von Arakoonas Heer umringte den größten Teil der Stadt. Schonungslos ließ die Morgenröte mit jedem weiteren Sonnenstrahl mehr von den Ankömmlingen gewahr werden. Das Zelt des Anführers war nicht zu übersehen. Dorthin würde den Pater sein vielleicht letzter Weg führen.
Er wollte gerade aufbrechen, als Tantra ihn aufsuchte. Obwohl die Frau ein Tuch trug, das Gesicht und Hals bedeckte, erkannte er die Königin sofort. Ihre Verschleierung konnte nur eines bedeuten. Betroffen senkte Claudius den Kopf.
„Es tut mir leid, Königin“, sagte er leise.
Aus schmalen Sichtschlitzen im Tuch sah Tantra ihn schweigend an.
„Spart Euch das, Pater“, sagte sie schließlich. „Ihr wollt wirklich gehen? Weshalb?“
„Weil unser Heiland sich ebenso verhalten hätte“, antwortete Claudius ohne zu zögern.
„Dann stellt Ihr Euch mit Ihm auf eine Stufe?“
„Nein, ich folge nur dem Wort.“
Tantra lachte dumpf und verächtlich durch das Tuch, doch hinter dem Lachen lag Angst.
„Dann geht, Pater. Geht in Euer Verderben.“
Pater Claudius ging.
*
„Seht her, wer uns hier die Ehre erweist“, grölte einer der beiden Männer in das Zelt seines Anführers hinein. Sie hatten rasierte Schädel und trugen als einziges Haupthaar am Hinterkopf dicke Zöpfe, mit ledernen Bändern und silbernen Spangen zusammengefasst. Der, der gesprochen hatte, entblößte seine spitz gefeilten Zähne mit einem breiten Grinsen.
Zwischen den beiden Kriegern stand Claudius. Er kannte die Worte, denn er hatte die Sprache der Barbaren auf seinen Reisen gelernt. Wie sehr hatte er gehofft, sie nie wieder sprechen zu müssen, aber nun war es doch anders gekommen.
Sie standen vor Arakoonas Zelt, dessen Eingang von einem halben Dutzend Spieße gesäumt war, auf denen die Köpfe Erschlagener steckten. Es waren zweifellos Männer des Reitervolks, die hier ihr Leben ausgehaucht hatten. Claudius fragte sich, welchen Verrat sie wohl begangen haben mochten, um auf solche Weise zu enden.
Das ganze Lager war erfüllt von Hundegebell. Es waren streunende Hunde, die dem Tross folgten, da sie sich hier etwas Essbares erhofften.
In dem Zelt tat sich lange Zeit nichts, der Eingang blieb dunkel.
Dann taten sich die schweren Vorhänge auf und Arakoona stand vor ihnen. Die beiden Männer senkten augenblicklich in Demut die Häupter und wichen einen Schritt zurück. Claudius blieb, wo er war. Ihn schauderte.
Arakoona war schrecklich anzusehen, ein Riese, der den nicht eben klein gewachsenen Pater noch um zwei Haupteslängen überragte. Seine braune Haut glich gegerbtem Leder, faltig und von der Steppensonne verbrannt. Die Gesichtszüge waren hart, unbarmherzig, und Claudius konnte darin keine Spur von Freundlichkeit erkennen. Zu beiden Seiten hingen Kurzschwerter von den Hüften des Kriegsfürsten herab, deren Griffe er mit seinen gewaltigen Händen umfasst hielt.
Lange fixierte Arakoona den Pater mit seinen rabenschwarzen Augen.
Dann, auf einmal, warf er den Kopf in den Nacken und lachte schallend.
„Ein Pfaffe“, brüllte er erstaunt, aber auch belustigt. „Was hat ein armseliger Pfaffe auf meinem Land verloren?“
„Eurem Land?“, fragte Claudius nach.
„Da, wo ich meinen Fuß hinsetze, ist mein Land“, erklärte Arakoona. Er grinste und zeigte zwei lückenhafte Reihen spitzer, gelber Zähne, die Claudius an die gefährlichsten Raubtiere des Schwarzen Kontinents erinnerten, welchen er vor vielen Jahren bereist hatte.
„Nun, Vater, was führt dich her?“, fragte Arakoona, und sein Grinsen war jetzt verschwunden. In Vater lag nichts anderes als Verachtung.
„Sprich, solange du noch am Leben bist.“
Claudius holte tief Luft. Seine Worte hatte er sich schon lange zurechtgelegt.
„Ich bin gekommen“, begann er, „um für die Stadt zu bitten, die vor Euch liegt. Es würde Euch nicht zum Ruhm gereichen, sie zu erobern und die Menschen niederzumachen. Es … es wäre Eurer nicht würdig.“
Arakoona schwieg, aber Claudius beobachtete, wie sich die Knöchel seiner Hände, die die Schwertgriffe umfassten, weiß färbten.
„Wisset“, fuhr er hastig fort, „dass dort nur Alte und Schwache leben, deren Ende nicht mehr fern ist.“
Arakoona rang sich ein kaltes Lächeln ab.
„Wohl gesprochen, Pfäfflein, ihr Ende ist nicht mehr fern.“ Er beugte sich zu Claudius herab, seinen schwarzen Blick in die Augen des Paters bohrend.
„Wisset“, ahmte er dessen Tonfall nach, „dass unsere Vorräte knapp werden und wir uns dort holen werden, was wir brauchen.“ Sein Arm, so dick wie ein Baumstamm, zeigte auf die Mauern der Stadt.
„Und wenn die Speicher nichts mehr hergeben, das Vieh geschlachtet und der Wein getrunken ist, dann werden eure Leiber sich an Spießen über den Feuern drehen, und wir werden euer Blut saufen.“
Er richtete sich wieder zur vollen Größe auf.
„Und mit dem, was übrig bleibt, werden wir die Stadtmauern rot färben.“
Zum ersten Mal zweifelte Claudius. Vielleicht hätte er auf die Königin hören sollen.
„Haltet ein damit“, sagte er eindringlich. „Ihr werdet auf eine Armee treffen, gegen die Ihr nicht gewinnen könnt.“
„Was fällt dir ein, Wurm?“, brüllte Arakoona, jetzt nicht mehr lächelnd. „Du wagst es, hierherzukommen und mich anzulügen? Erzählst mir von Alten und Schwachen? Und gleich darauf von einer unbesiegbaren Armee?“
„Ihr werdet untergehen“, rief Claudius aus. „Ihr werdet sterben, denn hinter diesen Mauern …“
Blitzschnell zog Arakoona eines seiner beiden Schwerter und hieb Claudius in einer einzigen Bewegung den Kopf ab. Das erstaunte Gesicht des Paters lag schon lange im Sand, da sackte der kopflose Rumpf erst zusammen.
„Schneidet dem Pfaffen die Augen heraus und füttert die Hunde damit“, wies Arakoona die beiden Männer an und verschwand wieder in seinem Zelt.
Ohne eine Regung in ihren Gesichtern erkennen zu lassen, folgten die Männer dem Befehl. Gleich darauf balgten sich einige Hundebastarde um die ihnen hingeworfenen Happen.
*
Nacht
Sie erfuhren keine nennenswerte Gegenwehr.
Die Reiter fielen in die Stadt ein, nachdem sie mit schwerem Gerät die Tore zertrümmert hatten, und machten alle nieder, Männer wie Frauen und Kinder. Es gab bald kein Haus mehr, das nicht brannte. Heller Lichtschein erhob sich weit in den schwarzen Himmel und ließ die Nacht zum Tag werden.
Der Gestank von Tod und verbranntem Fleisch war allgegenwärtig, während die Schreie der Sterbenden sich mit dem Gelächter der Krieger vermischten, die den Frauen Gewalt antaten, bevor sie sie umbrachten.
Die Vorratskammern der Stadt waren jedoch leer, und das Vieh verschwunden oder verendet. Auch hatten die Reiter weitaus weniger Menschen hier vorgefunden, als sie erwartet hatten.
Aber es war ihnen einerlei.
Noch bevor der Morgen graute, drehten sich die Spieße über den Lagerfeuern, die in den Straßen entzündet worden waren. Und mit den Spießen drehten sich die Leiber der Erschlagenen.
*
Tantra, die Königin, wurde zu Arakoona ins Lager gebracht. Vorher hatte sie mit scharfen Klingen ihr eigenes Gesicht bis zum Hals zerschnitten und ihren Körper mit Pech bestrichen. Blutend und geschwärzt stand sie vor Arakoona.
Der Kriegsfürst musterte sie aus trüben Augen. Trunken vom Branntwein, von dem es im Lager mehr gab, als sauberes Wasser, schwankte der Riese gefährlich.
„Weshalb hast du das getan, Tochter des Tolodorich?“, knurrte er schließlich mit schwerer Zunge in schlechtem Latein und zeigte auf ihr Gesicht. „Wolltest du etwa nicht, dass ich mich an deiner Schönheit erfreue?“
„Dies war der einzige Grund“, log Tantra.
„Nun, was schert mich dein hässliches Gesicht, Weib“, grunzte Arakoona, packte die Königin an den Haaren und riss ihren Kopf nach hinten.
„Ich lade dich ein, an einem großen Festmahl teilzuhaben, Königin. Aber davor noch wirst du deinen König kennenlernen.“
Er verging sich an ihr und trank ihr Blut, nachdem er sie erschlagen hatte.
Dann ließ er ihren zerbrochenen Leib vor seinem Zelt über einem gewaltigen Feuer zusammen mit den hingerichteten Stadtvätern für das Festmahl rösten.
Von einer Stange herab schaute der Kopf von Pater Claudius aus leeren Augenhöhlen traurig zu.
*
Dritter Tag
Das kräftige Licht der Morgenröte offenbarte den Reitern mehr, als ihnen lieb war.
Ohne die Erlaubnis dafür erhalten zu haben, stürmte ein Krieger in Arakoonas Zelt, womit er riskierte, augenblicklich sein Leben zu verlieren. Es war verboten, das Zelt des Kriegsfürsten ohne wichtigen Grund zu betreten.
Er fand den Riesen schlafend und laut schnarchend auf Stroh und Ochsenhäuten liegen.
„Wacht auf“, rief der Mann. „Um alles in der Welt, kommt zu Euch.“
Arakoona öffnete ein Auge.
„Was gibt es, du Wicht?“, blaffte er ungnädig. „Möchtest du den Häuptern vor meinem Zelt Gesellschaft leisten? Überlege, was du sagst, sonst ist es um dich geschehen.“
„Es ist wohl um uns alle geschehen“, erwiderte der kreidebleiche Mann. „Kommt schnell heraus und seht selbst.“
Arakoona wurde an den Rand des Lagers geführt und hörte schon bald die Schreie.
Dort lag ein Mann im Staub, der sich in üblem Zustand befand. Es war ein Bewohner der Stadt, der sich da schreiend und offensichtlich unter größten Schmerzen mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wand. Um ihn herum standen einige Krieger, allerdings in respektvollem Abstand. Immer mehr traten hinzu.
Die Hunde dagegen blieben fern und begannen zu winseln.
„Wir haben ihn in einem der Häuser gefunden“, berichtete einer der Männer. „Außer ihm ist niemand mehr in der Stadt am Leben.“
Hunderte von Geiern, die zwischen den Rauchsäulen über der Stadt kreisten, schienen seine Worte nur bestätigen zu wollen.
„Macht ein Ende mit ihm“, knurrte Arakoona, weniger aus Barmherzigkeit, sondern eher wegen der schrillen Schreie des Sterbenden, durch die er sich gestört fühlte.
Der Krieger, der am nächsten stand, zog sofort sein Schwert und folgte der Anweisung. In einem Gurgeln erstarben die Schreie.
Arakoona wollte sich schon abwenden, da fielen ihm die dunklen Flecken auf. Er trat näher an den Toten heran und besah ihn sich genauer. Selbst seinem durch Branntwein getrübten Blick entgingen nicht die schwarzen Beulen, die den Leib bis zu den Wangen bedeckten. Manche waren aufgebrochen und ließen das rohe Fleisch darunter sichtbar werden. Dunkles Blut und Eiter rannen heraus.
Arakoona sprach so leise, wie ihn seine Krieger noch nie zuvor gehört hatten.
„Die Pest.“
*
Letzter Tag
Arakoona stand vor seinem Zelt und sah die Sonne aufgehen. Die leuchtende Scheibe war bereits zur Hälfte hinter den Hügeln erschienen und tauchte die Welt war in ein unwirkliches Rot.
Es würde ein heißer Tag werden. Ein warmer Wind wehte bereits jetzt und ließ das Tuch der Zelte, die noch standen, leicht flattern.
Viele Zelte waren inzwischen verlassen.
Es herrschte Stille. Kein Hundegebell war mehr zu hören, und von den Hunden war nichts mehr zu sehen.
Die Toten waren außerhalb des Lagers zu Bergen aufgetürmt worden und brannten noch immer. Dieses Mal hatten die großen Feuer nicht die Leiber der Besiegten verzehrt und die Nacht erleuchtet.
Dieses Mal war es das Reitervolk, das besiegt war und lichterloh brannte.
Arakoona war den Geruch von Aas und versengtem Menschenfleisch gewohnt, aber dies hier war selbst für ihn nur schwer zu ertragen.
Gleichwohl, es würde nicht mehr lange dauern.
Beim ersten Tageslicht nach Einnahme der Stadt waren die Gruben entdeckt worden, in denen die meisten Einwohner gelegen hatten, Männer, Frauen und Kinder. Sie alle waren an der Pest gestorben. Das Sonnenlicht hatte schließlich auch die schwarzen Beulen an den Körpern der Erschlagenen sichtbar werden lassen, die noch in den Straßen herumlagen.
Die übrigen hatten die Reiter nachts zuvor gegessen.
Arakoona ahnte, dass die Königin ihn absichtlich getäuscht hatte. Wohl wissend um ihr eigenes Schicksal hatte sie die Zeichen der Krankheit vor ihm verborgen, sich ihm ohne Gegenwehr hingegeben und ihn ihr warmes Blut trinken lassen.
Und er hatte von ihrem Fleisch gegessen.
Langsam ließ er seinen Blick über die Reste des Lagers gleiten.
Seine Armee existierte nicht mehr, sie hatte sich aufgelöst. Viele von denen, die nicht gestorben waren und jetzt auf den Scheiterhaufen loderten, hatten sich auf und davongemacht, manche von ihnen bereits krank. Sie würden den Tod in die Welt hinaustragen, aber anders, als bisher.
Er sah an sich herab.
Sein Leib war bereits mit schmerzenden Beulen bedeckt, die sich immer dunkler verfärbten und bald aufbrechen würden. Das unvermeidliche Fieber hatte ihn schon längst befallen und schien ihn von innen zu verbrennen.
Dies nun sollte sein letzter Sonnenaufgang sein, die Abenddämmerung würde er nicht mehr sehen. Eine Hand hatte er bereits am Schwert.
Arakoona fiel der Gottesmann ein, der auf seiner Stange noch immer das Zelt bewachte, blind und stumm. Er wandte sich dem allmählich zerfallenden Gesicht zu und starrte in die Augenhöhlen. Plötzlich sah er dort wieder Augen, die ihm entgegenblickten, aber es musste das Fieber sein, das ihn verwirrte. Seine Sinne ließen ihn bereits im Stich.
Ihr werdet auf eine Armee treffen, gegen die Ihr nicht gewinnen könnt.
„Was hattest du mir noch sagen wollen, Pfaffe?“, fragte der sterbenskranke Kriegsfürst den Kopf. „Hättest du mich wirklich gewarnt? Hast du denn die Menschen so sehr geliebt, dass du selbst mich und mein Heer vor dem sicheren Verderben bewahren wolltest?“
Der Kopf schwieg.
„Habe ich dir etwa das Haupt wahrhaftig zu früh abgeschlagen?“, schrie Arakoona im Fieberwahn und zog sein Schwert.
„Antworte, Pfaffe! Hättest du sogar mich getauft, wenn ich es dir gestattet hätte?“
Der Kopf gab keine Antwort. Nun, was auch kommen mochte, heute würde es zu keiner Zeit zu früh sein für das, was er zu tun hatte.
Ein letztes Mal betrachtete er die blutrote Sonnenscheibe, die jetzt majestätisch über den Hügeln schwebte.
Bevor er die Schwertspitze auf sein Herz richtete, gedachte er noch einmal der letzten Worte des Paters.
Ihr werdet sterben, denn hinter diesen Mauern ...
ENDE
Mrs. Shelleys Tagebuch
*
Colin machte es sich in meinem großen Ohrensessel bequem und begutachtete mit Wohlwollen und voller Vorfreude den Farbton des Cognacs, den ich ihm gerade eingeschenkt hatte. Mein alter Freund Colin Hayward gehörte zu den Männern, die einen guten Cognac durchaus zu schätzen wussten, und nicht zuletzt deswegen machte es stets Spaß, ihn zu bewirten. Diese Zusammenkünfte, die in locker gehaltenem Turnus etwa einmal im Monat zustande kamen, waren inzwischen lieb gewordene Tradition.
„Der Umstand, dass Sie höchstselbst die Gläser holen mussten, lässt vermuten, dass der gute Mr. Fingers wohl aushäusig ist“, bemerkte Colin, während er den bauchigen Schwenker unter seiner beachtlichen Nase kreisen ließ. Mit ‘Mr. Fingers’ war natürlich mein treuer Haushälter Nathan gemeint, der seinen Spitznamen einem Andenken aus dem letzten Burenkrieg verdankte, an dem er in jungen Jahren teilgenommen hatte. Nach einem sauberen Machetenhieb waren drei Finger seiner rechten Hand in Afrika verblieben.
„Mr. Fingers erbat sich einige freie Tage, um Verwandte in Yorkshire zu besuchen“, erklärte ich Nathans Abwesenheit. „Ich hoffe sehr, er erinnert sich irgendwann an mich und kehrt wieder zurück.“
Colin lächelte amüsiert.
„Nun, mein Lieber, was halten Sie denn nun von diesem Hitler und seinen Prahlereien?“, spann er einen ersten ernsteren Gesprächsfaden. Meistens begann es mit Politik, wechselte dann zu Literatur oder Geschichte und endete nach genügend geleerten Gläsern sowie mehreren kubanischen Zigarren bei den Damen.
„Finden Sie Chamberlains unterwürfiges Auftreten diesem aufgeblasenen Kerl gegenüber nicht auch unerträglich?“
„Da bin ich ganz Ihrer Meinung“, pflichtete ich ihm bei. In Wahrheit jedoch hatte ich mir bisher weder über unseren Premier noch über den deutschen Reichskanzler eine Meinung gebildet, denn tatsächlich hatten mich in letzter Zeit wichtigere Dinge beansprucht, auf die näher einzugehen ich gleichwohl für unser Treffen vorgesehen hatte.
„Allerdings glaube ich nicht, dass wir von den Deutschen etwas zu befürchten haben“, fügte ich hinzu, um höflicherweise noch etwas zu diesem Thema beizutragen. „Sie wissen ja, bellende Hunde beißen nicht.“
„Nun, mein lieber, harmloser Freund, da muss ich Ihnen jedoch ...“
Ich konnte nicht mehr an mich halten, denn zu sehr brannte ich darauf, Colin etwas zu präsentieren, mit dem ich ihn sprachlos zu machen hoffte.
„Bitte vergeben Sie mir meine Unhöflichkeit, aber ich muss Ihnen nun auf der Stelle zeigen, was ich kürzlich in dem Antiquariat erstanden habe, in welchem ich sehr häufig – viel zu häufig, wie mein Buchhalter meint – verkehre.“
„Dann spannen Sie mich nicht weiter auf die Folter“, forderte Colin mich auf und nippte von seinem Glas.
Ich begab mich in mein Arbeitszimmer und kehrte gleich darauf wieder mit meiner Errungenschaft in den Salon zurück. Stolz überreichte ich meinem Gast das in schwarzem, abgegriffenem Glattleder eingebundene Buch, auf dessen Vorderseite eine goldene Feder eingeprägt war.
Mit prüfendem, leicht abschätzigem Blick untersuchte Colin den Band, nachdem er umständlich seine Brille hervorgeholt hatte. Augenblicklich trat die für ihn so typische Überheblichkeit des Experten zutage, gepaart mit Skepsis und einem nachsichtigen Lächeln.
„Ein gewöhnliches, handgeschriebenes Tagebuch“, stellte er schließlich mit einem Achselzucken fest und blätterte die Seiten zügig durch, ohne sie jedoch eingehender zu prüfen. Einige hatten sich bereits gelöst und waren lose in dem Band eingeheftet, doch Colin, der als Bibliothekar eigentlich den lieben langen Tag mit nichts anderem als mit wertvollen Büchern zu tun hatte, ließ zumindest hier die nötige Sorgfalt walten.
„Ein Tagebuch, sehr richtig“, bestätigte ich und fühlte leichte Ungeduld in mir aufkommen. War es denn so schwer zu erkennen?
„Es ist ein besonderes Tagebuch“, ergänzte ich, und als ich Colins fragendem bis mitleidigem Blick lange genug standgehalten hatte, ließ ich die Katze aus dem Sack: „Es handelt sich um das Tagebuch von Mrs. Mary Shelley.“
Absurderweise befürchtete ich anfangs, Colin wäre der Name nicht geläufig, so verständnislos blickte er drein, doch dann sah ich, wie beeindruckt er aufgrund dieser Behauptung war.
„Sie meinen doch nicht etwa die Schriftstellerin? Die Schöpferin des ‚Modernen Prometheus’? … Frankenstein?“
Sein Tonfall verriet, dass er erhebliche Zweifel hegte.
„Eben diese“, vermeldete ich nicht ohne Genugtuung. „Streng genommen ist es das Tagebuch von Mary Godwin, da die Dame zu jener Zeit noch ihren Mädchennamen trug.“
Colin blätterte sich abermals durch die Seiten, erst langsam, dann immer schneller, und er zeigte sich nun erheblich interessierter, als es noch vor wenigen Augenblicken der Fall gewesen war.
„Allmächtiger im Himmel“, stieß er bald darauf hervor. „Wie, um alles in der Welt, sind Sie an dieses Buch gelangt? Es muss Sie ein Vermögen gekostet haben.“
„In der Tat“, gab ich ihm recht, „und es ist jeden Penny wert, wie ich ihnen versichern darf. Ein Freund eines Freundes des Besitzers von besagtem Antiquariat hatte es sehr eilig, an Bargeld zu kommen. Spielschulden, Sie verstehen?“
Er blätterte, las einige Zeilen und blätterte weiter. Belustigt beobachtete ich seine Lippen, die beim Lesen stumm die Worte formten.
Schließlich klappte er das Buch zu und sah mich entgeistert an.
„Es ist das verschollene Tagebuch“, flüsterte er heiser. „Die uns bekannten Aufzeichnungen von Mary Shelley beginnen erst Ende Juli im Jahre 1816. Diese hier – und nach ihnen hat die halbe Welt gesucht – umfassen den Zeitraum bis zu eben jenem Datum. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, welchen Schatz Sie mir da gerade zur Begutachtung anvertraut haben? Wie hoch der Betrag auch immer gewesen sein mag, den Sie dafür entrichtet haben, er spricht dem wahren Wert dieses Gegenstands Hohn.“
Ich schenkte ihm ein mildes Lächeln, nahm ihm das Buch wieder aus der Hand und schlug es an einer bestimmten Stelle auf.
„Erlauben Sie mir, Ihnen einige Passagen vorzulesen, die mir nächtelang den Schlaf geraubt haben“, bat ich, wohl wissend, dass er nicht ablehnen konnte. „Ich würde sehr gerne Ihre Meinung in dieser Angelegenheit hören.“
„Bitte tun Sie das“, sagte Colin, dem die Verblüffung noch immer ins Gesicht geschrieben stand. „Ich bin bereits mehr als gespannt.“
„Ausgezeichnet“, freute ich mich und brachte nun meinerseits eine Lesebrille zum Vorschein.
„Es handelt sich explizit um den Sommer 1816, den Miss Godwin mit ihrem späteren Ehegatten Percy Shelley und ihrer Stiefschwester Claire in der Schweiz verbrachte. In Gesellschaft von keinem Geringeren als dem Dichter Lord Byron, nebenbei bemerkt.“
Nachdem ich mich in dem anderen großen Sessel Colin gegenüber niedergelassen hatte, suchte ich mit dem Zeigefinger den Anfang des betreffenden Abschnitts und begann laut zu lesen.
*
25. Mai 1816
Nimmt man alle Orte, an denen ich bisher gewesen bin, so gehört der Genfer See vielleicht nicht gerade zu den einsamsten, wohl aber zu den malerischsten Landschaften. Es ist, als ob man ein Bilderbuch aufschlägt, sich darin verliert und dem Geist endlich die Ruhe gönnt, die er von Zeit zu Zeit braucht.
Bedauerlicherweise sind sehr viele Landsleute wohl der gleichen Auffassung, was dazu führt, dass es hier, in dem kleinen Dorf Cologny, von Engländern nur so wimmelt. In unserer Umgebung beobachte ich vorwiegend leichtlebige Parvenüs, die mit ihrer Zeit und ihrem Geld nichts anderes anzufangen wissen, als dem Müßiggang zu frönen und sich in solcher Weise der mit Ferngläsern bewaffneten einheimischen Bevölkerung zur Schau stellen. Auch unsere kleine Gemeinschaft wird von den Schweizern aufs Genaueste beobachtet, was uns wiederum nicht verborgen bleibt.
Mein Schwesterchen Clary, die natürlich nichts anderes im Sinn hatte, als Lord Byron, den Vater ihres noch ungeborenen Kindes, hier zu treffen, ist offenbar etwas bedrückt ob der nicht übermäßig erfreuten Reaktion des Dichters auf ihr Erscheinen. Und doch scheint sich die von ihr vorgeschlagene Reise - nun durch die Gesellschaft von Lord Byron und seinem Leibarzt bereichert - zu einem durchaus inspirierenden Erlebnis zu entwickeln.
Aber es sind nicht nur Engländer als Sommergäste hier anzutreffen.
Heute fielen mir zwei Männer auf, die, obwohl starker Regen dauerhaft niederging, sich auf einem ausgedehnten Spaziergang befanden. Auf Nachfrage berichtete mir Lord Byron, der hier Jeden kennt, dass es sich bei einem der beiden um einen hochrangigen preußischen Offizier handelt, der hier in Begleitung seines Arztes seine im letzten Krieg gegen Napoleon erlittenen Verwundungen kuriert. Der Name des Soldaten, so erfuhr ich von unserem Freund, lautet Theodor Ferdinand von Dennewitz. Er diente unter Blücher und wurde vor einem Jahr bei Waterloo schwer verwundet. Sein Leibarzt, ebenfalls ein Mann von preußischem Adel, heißt August von Bitterleben und weicht seinem Patienten nicht von der Seite.
Während von dem Veteran, der seinen Zylinder über dem hochgeschlagenen Mantelkragen tief ins Gesicht gezogen trug, nur wenig zu erkennen war, machte der Arzt einen sehr ansehnlichen Eindruck.
Von Dennewitz hingegen, gebeugt und stark humpelnd, scheint gut daran zu tun, seine Züge zu verbergen, denn nach Lord Byrons Erzählungen muss er von schrecklichen Wunden entstellt sein. Offenbar machen die beiden täglich ihren Spaziergang, ob es nun regnet oder stürmt.
In unserem Domizil ‘Maison Chapuis’ herrscht Langeweile, da aufgrund des überraschend schlechten Wetters an weitläufige Unternehmungen nicht zu denken ist. Für die Preußen allerdings scheint das Wetter noch nicht schlecht genug zu sein, wie ich erfuhr.
Die beiden adligen Herren haben meine Neugier geweckt.
Vielleicht mache ich mich morgen einmal diesen Männern bekannt und schließe mich ihrem nasskalten Spaziergang an, sofern sie es akzeptieren, von einer vorwitzigen, unbekannten Frau mit einem Regenschirm begleitet zu werden.
*
26. Mai 1816
Es war unterhaltsam, bisweilen sogar charmant und dennoch etwas unheimlich, den heutigen Nachmittag mit den beiden preußischen Adligen zu verbringen. Aufgrund seiner schweren Halsverletzungen war es von Dennewitz nicht möglich gewesen, sich an der Konservation zu beteiligen. Ungelenk hinkte er die ganze Zeit schweigend neben uns her, während der Arzt und ich uns vorwiegend über klassische Literatur unterhielten. Von Bitterleben ist ein höflicher, sehr belesener wiewohl wortgewandter Zeitgenosse, überdies auch noch von stattlicher Statur und wohlgefälligem Aussehen.
Tatsächlich kann man dies von Theodor Ferdinand von Dennewitz nicht mehr behaupten. Die wenigen Blicke, die ich auf sein geschundenes Antlitz zu erhaschen vermochte, ließen mich erschaudern, und noch jetzt läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich mich seiner starren Augen erinnere. Oh, was diese Augen wohl gesehen haben mögen, ich mag es mir nicht vorstellen. Quer über seine Stirn verläuft eine breite Narbe, eine Wunde wohl von einem Degenstreich, die, gewisslich noch im Felde, nur aufs Gröbste vernäht worden war. Seinen Mund hielt er hinter einem Schal verborgen, worüber ich, wie ich zugeben muss, nicht unglücklich gewesen bin. Aber seine Handgelenke lugten manchmal unter den Mantelärmeln hervor, und die Narben, die um seine Unterarme verliefen, lassen ahnen, welche Leiden der arme Mann hatte erfahren müssen.
Während Percy und Claire mit Lord Byron und John Polidori, seinem Arzt, den Abend bei Wein und tiefgründigen Gesprächen verbringen, habe ich mich bereits zurückgezogen. Percy gegenüber gab ich starke Kopfschmerzen vor, kann ich ihm doch nicht sagen, dass die Gedanken seiner zukünftigen Frau ständig um August von Bitterleben kreisen, und dies in höchst unziemlicher Weise.
Und um den armen Soldaten, der mich irgendwie ängstigt.
*
Ich sah von der Lektüre auf.
Colin hatte die ganze Zeit andächtig gelauscht und dabei vollkommen seinen Cognac vergessen. Dies allein war an sich schon bemerkenswert.
„Selbstverständlich ahnen Sie schon, welche Richtung die folgenden Abschnitte einschlagen werden?“, forschte ich nach.
„Ich habe einen Verdacht“, sinnierte mein Gast. „Ich bitte Sie, fahren Sie fort.“
„Nun denn“, sagte ich und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich las weiter.
*
27. Mai 1816
Heute war wieder alles von schlechtem Wetter bestimmt, wie die vorhergegangenen Tage. Es regnete junge Hunde, und die Temperaturen ließen es mir nicht ratsam erscheinen, mich für sommerliche Kleidung zu entscheiden. Diesmal zogen es sogar meine beiden neuen Bekannten vor, auf ihren Rundgang zu verzichten und stattdessen den Tag in ihrer Villa zu verbringen. Jedenfalls habe ich sie heute bis jetzt noch nicht gesehen.
So kehrte ich wieder zu unserer kleinen Gemeinschaft zurück, und es entwickelte sich geselliger Nachmittag, bei heißem Tee, Rum, Zigarren und knisterndem Kaminfeuer.
Ich erzählte von den beiden Männern, die ich tags zuvor begleitet und etwas besser kennengelernt hatte, und mein Bericht stieß in unserer Runde auf großes Interesse, insbesondere bei John Polidori, Lord Byrons Arzt. Während meiner gestrigen Abwesenheit war hier viel über Galvanismus sowie über die Möglichkeit zur Erschaffung von künstlichem Leben gesprochen worden. John befragte mich eingehend über die Art der Verwundungen, die den wackeren Preußen so entstellt hatten, und nach kurzer Zeit entspann sich daraus in unserer Gesprächsrunde eine gar schauerliche Geschichte.
John stellte die Vermutung an - natürlich nicht in ernst gemeinter Weise - dass es sich bei Doktor August von Bitterleben um einen verrückten Quacksalber handeln könnte, der aus verschiedenen Körperteilen von im Felde gefallener Soldaten einen Homunkulus geschaffen habe, eben jenen Theodor Ferdinand von Dennewitz, den es in Wahrheit gar nicht geben dürfe. Percy - wie hätte es anders sein können - wob den Faden noch weiter, indem er dem künstlichen Menschen erhöhte Mordlust andichtete, da dieser das Gehirn eines garstigen, bis zum Tode zu kämpfen und töten bereiten Mannes im aufgesägten Kopfe trüge. Besser noch: das Gehirn eines Mörders.
Solcherlei Gräuelgeschichten beseelen auch unfrohe Regentage mit Kurzweil und lassen die Zeit schnell vergehen.
Ich werde mir diese Geschichte merken, da ich finde, dass sie dazu angetan sein könnte, einmal Gegenstand eines ernsthafteren Buches zu sein.
*
28. Mai 1816
Am heutigen Tag war großer Aufruhr in der Gegend, und als wir den Grund dafür erfuhren, da fuhr uns allen der Schrecken durch Mark und Bein.
Obwohl ich es zunächst nicht glauben mochte, hat es sich dennoch wohl zugetragen, dass Theodor Ferdinand von Dennewitz zu Tode gekommen ist, niedergestreckt durch die Kugel seines eigenen Leibarztes, August von Bitterleben. Welch eine Tragödie musste sich zwischen ihnen abgespielt haben, welch ein Unglück war da über die beiden Preußen gekommen. Mitten in die Stirn war der Soldat getroffen worden, hatte er doch zuvor allen Todesengeln auf dem Schlachtfeld getrotzt, wenn auch zu einem hohen Preise. Der Arzt ließ verlauten, er habe in allerhöchster Not geschossen, zur Rettung des eigenen Lebens. Die eidgenössische Gendarmerie mochte ihm wohl Glauben schenken, verbrachte ihn aber zur endgültigen Befragung auf die Wache, wo er noch bis zur Stunde verblieben ist.
Wie Lord Byron erfahren haben will, muss der Soldat wohl den Verstand verloren haben und trachtete seinem Arzt mit scharfer Klinge jäh nach dem Leben. Von Bitterfeld gelang erst in letztem Augenblick der rettende Schuss aus seiner Waffe, die er zum eigenen Schutze stets mit sich trägt.
*
Ich machte eine Pause und prüfte Collins Miene. Tatsächlich schien er tief beeindruckt von dem soeben Gehörten, während sein Blick geradezu um Fortsetzung flehte.
„Ich überspringe nun einige Tage“, kündigte ich an, „und komme gleich zu einem Abschnitt, der nach meinem Dafürhalten von allergrößter Wichtigkeit ist.“
Ich blätterte einige Seiten weiter, bis ich die betreffenden Zeilen gefunden hatte.
„Danach werden Sie verstehen“, setzte ich etwas kryptisch hinzu, nicht ohne einen gewissen Spaß dabei zu verspüren.
Und ich fuhr fort.
*
09. Juni 1816
Heute, nach beinahe zwei Wochen trübsinnigsten Wetters, blinzelte zum ersten Mal wieder die Sonne zaghaft durch die Wolken. Wie sehr haben wir alle es uns ersehnt, diesen himmlischen Ort im warmen Sonnenglanze zu erleben, und nun scheint unser Harren endlich belohnt zu werden.
Gleichwohl wurde August von Bitterleben aus dem Arrest in die Freiheit entlassen, wie man mir vorhin berichtete. Ohne ein Wort des Abschieds hat er jedoch einen Zug bestiegen und sich mit unbekanntem Ziele von dannen gemacht. Es macht mich etwas traurig, aber nach dem beklagenswerten Vorfall erscheint mir der Arzt - trotz seiner offensichtlichen Unschuld - nun in anderem Lichte, und der Verlust seiner Gesellschaft wiegt daher nicht allzu schwer.
Von Dennewitz soll morgen auf dem kleinen Friedhof in Cologny beigesetzt werden. Sein trauriges Schicksal hat mich wahrlich gebarmt, obgleich er seinem Arzte grimme Gewalt hatte antun wollen. Aus welchem Grunde auch immer.
Ich werde wohl zugegen sein und als Zeichen meines Respekts einen kleinen Blumenstrauß an seinem Grabe hinterlegen.
*
Ich klappte das Buch zu und legte es beiseite.
„Ich habe Nachforschungen angestellt“, verkündete ich, „und zwar über das preußische Korps, welches im Juni 1815 bei Waterloo zu Wellingtons Armee stieß.“
„Nachforschungen?“ Colin sah mich fragend an.
„Es hat niemals einen Theodor Ferdinand von Dennewitz gegeben“, gab ich mein Wissen preis, „geschweige denn einen Offizier dieses vollen Namens, der gegen Napoleon gekämpft hätte. Tatsächlich stand das 4. Armeekorps der Preußen in jener Schlacht unter der Führung von General Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz, doch dieser starb nachweislich bereits im Februar 1816 und konnte daher – sofern wir die Möglichkeit der Auferstehung einmal außer Acht lassen – nicht im Sommer desselben Jahres mit unserer Protagonistin spazieren gegangen sein.“
„Interessant“, bemerkte Colin, wobei ihm anzusehen war, dass er nicht so recht wusste, was er davon zu halten hatte.
„Dr. August von Bitterleben“, führte ich aus, „ein brillanter Kollege, der sich nach meinen Recherchen tatsächlich im Jahre 1816 in der Schweiz aufgehalten hatte, tauchte danach noch einmal kurz darauf in Paris auf, doch hier verliert sich seine Spur. Was den Namen seines Patienten betrifft, so hat er jedenfalls gelogen. Dass er in Cologny beigesetzt wurde, ist dagegen unstrittig.“
Es dauerte einen Augenblick, bis die Bedeutung dieser Worte zu Colin durchgedrungen war.
„Unstrittig?“, wiederholte er verblüfft. „Sie konnten sich dessen versichern?“
Ich entschied, dass nun der Augenblick gekommen war, ihn mit den Tatsachen vertraut zu machen.
„Wenn Sie, mein lieber Freund, wohl die Güte hätten, mir in mein Labor zu folgen?“, bat ich ihn und erhob mich. „Gleich werden Sie verstehen, was mich seit längerer Zeit umtreibt.“
Ich nahm die Cognacflasche und hielt sie hoch.
„Die nehmen wir selbstverständlich mit.“
Beinahe tat mir Colin ein wenig leid, wurde er doch nun von mir so unerwartet aus dem bequemen Sessel hochgescheucht. Er machte einen etwas unglücklichen Eindruck.
„Sie machen es heute wahrhaftig spannend, mein Bester“, bemerkte er und stand ebenfalls auf.
Ich ging vor und sah aus dem Augenwinkel, dass er sein Glas nahm und mir folgte.
Natürlich.