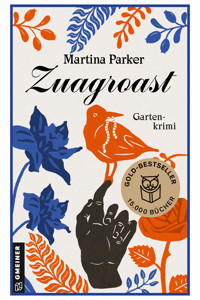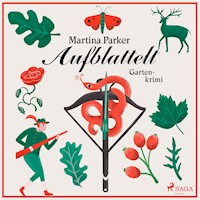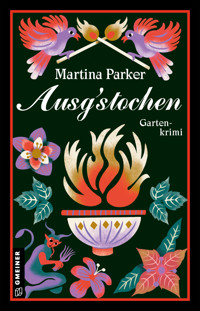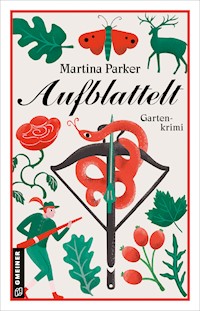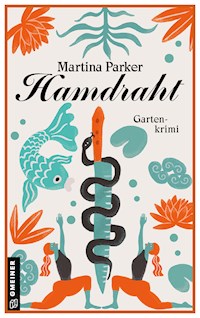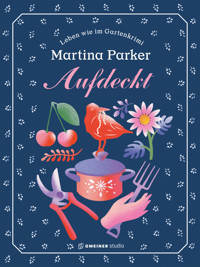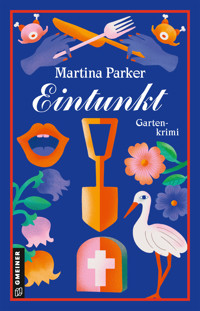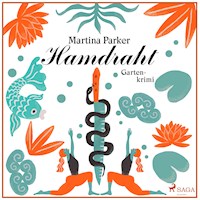Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Miss Brooks ermittelt
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn man vom eigenen Ehemann in einer fremden Stadt ausgesetzt wird? Sorgenpüppchen häkeln?! Eine Katze mit Sprachfehler adoptieren?! In der Spelunke ums Eck „Earl Grey Tea“ trinken?! Im Zweifelsfall alles. Denn Miss Brooks ist eine liebenswerte Britin mit ausgeprägten Eigenheiten. Während sie Pläne für ihren Neustart schmiedet, überschlagen sich die Ereignisse. Ein Kosmetikmogul verschwindet. Bei der glamourösen Verleihung der „Parfum-Oscars“ gibt es ein Attentat. Und in der Porzellanmanufaktur tauchen Knochen im Ofen auf. Hat die Beautybranche Dreck am Stecken? Als frischgebackene Beauty-Beraterin des Luxus-Konzerns Très Loué erhält die britische Neo-Ermittlerin Miss Brooks Zutritt in die glitzernde Welt der High Society - und fördert so manche ungeschminkte Wahrheit zutage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Parker
Miss Vergnügen
Ein Miss Brooks Krimi
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig
und nicht beabsichtigt. Ausnahmen sind Personen des öffentlichen Lebens, mit denen eine Namensnennung abgesprochen wurde.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Illustration und Coverdesign: Magdalena Zotti
ISBN 978-3-7349-3430-8
Zitat
Wenn die Welt untergeht, hält man sich am besten in Wien auf – dort passiert nämlich alles ein paar Jahre später.
Anonym
Kapitel 1 _ Mandelflan
Auf physiologischer Ebene ist Sterben ganz einfach erklärt. Herzschlag oder Atmung hört auf, das Gehirn wird nicht mehr durchblutet, das Bewusstsein erlischt und der Mensch stirbt. Interessant für die Forschung ist dabei folgender Aspekt: Auch wenn Herz und Lunge nicht mehr funktionieren, arbeitet das Gehirn noch einige Minuten lang weiter.
Jacques Bernard war Franzose, aber er lebte keine Klischees. Er war weder arrogant noch mürrisch, und Käse kam ihm ob seiner Laktoseintoleranz auch nicht mehr auf den Teller. Er dachte genauso oft an Sex wie Männer anderer Nationen. Und er wusste, dass es kein Kompliment war, einer Frau offensichtlich auf die Titten zu starren. Dennoch konnte er seinen Blick kaum abwenden. Die Brüste der Frau waren in ein barockes Korsage-Kleid geschnürt. Ihr Dekolleté wölbte sich Jacques regelrecht entgegen, prall, üppig. Die Frau begann zu sprechen. Sie war eine, die jedes Wort mit einer Geste unterstrich. Die Brüste begannen dabei zu zittern. Wie milchweißer bebender Mandelflan, die Leibspeise seiner Kindheit.
Jacques verdrängte den Gedanken, wie es sich wohl anfühlen würde, sein Gesicht in diesem Dekolleté zu verbergen, und zwang sich, den Blick zu heben. Die Frau trug eine schwarze venezianische Maske und eine weiße, hoch aufgetürmte Lockenperücke.
»Das ist sehr interessant, was Sie da sagen.« Obwohl nichts von dem vorangegangenen Small Talk in seinen Gehirnwindungen angekommen war, bemühte sich Jacques, mit dieser Floskel den Eindruck von Aufmerksamkeit zu hinterlassen.
»Das ist die Natur. Du kannst nichts dafür«, beruhigte er sich. »Reine Biologie. Du bist ein Mann. Du siehst Brüste. Du reagierst, wie die Natur es vorgesehen hat.«
»In ihren Augen bist du ein geiler alter Bock«, schalt die zweite Stimme in seinem Kopf. »Stell dir vor, ein anderer geiler Bock hätte solche Gedanken beim Anblick deiner Tochter.« Er merkte, wie er bei diesen Gedanken Scham und Wut zugleich verspürte.
Ihm wurde heiß in seiner wattierten Weste und der langen Jacke mit den breiten geknöpften Aufschlägen, die er zu Kniehosen trug. Jacques fand das Kostüm lächerlich, aber er hatte ebenso wie die anderen Gäste keine andere Wahl gehabt. Die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten hatte zu einem Barockball geladen, der an die Gründungszeit des Unternehmens erinnern sollte – eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert, das modisch von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, geprägt war. Jacques fühlte sich aber nicht wie ein Sonnenkönig. Er fühlte sich mit Kniestrümpfen und Schnallenschuhen wie ein Depp. Warum habe ich das Thema nicht cooler interpretiert, dachte er, als sich ein Kellner mit einem Tablett voller Häppchen galant vor ihm verbeugte. Der Typ musste Model sein. Er hatte eine Kinnlinie, die wie gemeißelt aussah, und trug eine graue Kurzhaarperücke, in der blaue Federn steckten. Er war unglaublich schön. Ein griechischer Gott. Seit Jacques’ Gesichtskonturen altersbedingt absackten und sich die überschüssige Haut zu einem Truthahnhals formierte, fielen ihm die markanten Kieferpartien junger Männer neidvoll auf.
Zu seiner Überraschung schien seine Gesprächspartnerin den Kellner gar nicht wahrzunehmen. Sie ließ ihre Hand über die dargereichte Platte mit den Häppchen schweben, griff dann zu einem winzigen Flammkuchen mit Ziegenkäse und Birne und schob das Horsd’œuvre in ihren kirschrot geschminkten Mund. Der kleine Schönheitsfleck über der Oberlippe tanzte, während sie kaute.
»Möchten Sie auch?«, fragte der griechische Gott und hielt die Platte Richtung Jacques. Dieser winkte ab. Ziegenfrischkäse enthielt Laktose. Die Servierplatte, ein Produkt der Porzellanmanufaktur, wurde aus seiner Reichweite entfernt. Jacques wusste sogar, was die Platte kostete. Über 400 Euro. Seine Frau hatte erst kürzlich eine gekauft. Nur eine unvorsichtige Bewegung, und schon läge das gute Stück in Bruchteilen von Sekunden in Scherbenform auf dem Boden.
»Wir können die Fotos also gleich machen?« Die Frau sah ihn fragend an und deutete auf die wattierte Kameratasche zu ihren Füßen.
»Welche Fotos?«, fragte Jacques.
»Die VIP-Fotos«, sagte die Frau. Ach ja. Der Mandelflan war ja Fotografin. Wie hieß sie noch mal? Katharina, Katrin, Karina? Es war nicht wichtig. Wichtig war, dass sie ihn fotografieren und taggen wollte. Was auch immer das hieß. Jacques war nicht auf Social Media. Das PR-Team seines Konzerns kümmerte sich darum, dass er dennoch ab und zu dort gesehen wurde. Die würden schon wissen, was damit zu tun war.
»Wollen Sie die Fotos hier machen?«, fragte Jacques.
Die Frau lachte. »Nein, das würde zu prahlerisch wirken.« Sie deutete in den Raum, der von einer Pyramide aus Champagnerschalen dominiert wurde. »Die Welt reagiert heute sehr sensibel auf Luxus und Dekadenz. Das ist die Empörungs- und Neidkultur unserer Zeit. Wir konzentrieren uns bei der Bildsprache lieber darauf, was Augarten ausmacht. Das präzise Handwerk, die Tradition.«
Sie klopfte mit dem Ringfinger leicht gegen die Oberlippe. »Ich habe mit dem Marketingleiter von Augarten besprochen, dass wir die Aufnahmen im Atelier machen dürfen. Das wirkt echter, authentischer, archaischer.«
Jacques nickte. Archaisch klang gut. Das klang nach gemeißelter Kinnpartie.
»Meine Assistentin sucht gerade die Geschäftsführerin von Augarten, die muss natürlich auch dabei sein.« Sie wandte sich suchend um.
»Natürlich«, sagte Jacques und versuchte, seiner Stimme keinen allzu enttäuschten Klang zu geben. Kurz hatte er gehofft, das mit den Fotos wäre nur ein Vorwand gewesen. Dass diese schöne Frau ihn in das Atelier der Porzellanmanufaktur locken wollte, um ihn zu verführen. »Du bist ein alter Narr«, schalt er sich selber. »Du bist zwar nicht mehr der Jüngste, aber reich und einflussreich«, widersprach die zweite Stimme in seinem Kopf. Vielleicht hatte er doch eine Chance bei ihr – nach den Fotoaufnahmen.
Sie packte ihre Fototasche und ging zielstrebig in Richtung Showroom. Jacques folgte ihr. Sie kamen vorbei an Vitrinen, in denen das »weiße Gold« perfekt ausgeleuchtet war. Porzellan von zarter Transparenz, feinem Glanz, makelloser und höchster Farbreinheit. Stilvolle und außergewöhnliche Entwürfe von Josef Hoffmann, Ena Rottenberg, Michael Powolny, Gundi Dietz. Zeitlose Wiener Tradition. Aber Jacques hatte keine Augen für Teller und Tassen. Sein Blick haftete jetzt an dem schwingenden Reifrock der Frau, der ihre schmale Taille betonte. Er hatte Lust, seine Hände um diese Taille zu legen, den Rock zu heben, einen Blick auf ihren Arsch zu werfen. Ob der so schön war wie die Brüste?
Sie öffnete die Tür zum Atelier. Dahinter befand sich eine andere Welt.
Die Welt des Handwerks. Die Arbeitsplätze waren verlassen, aber man erkannte auf einen Blick, dass hier richtig gearbeitet wurde. Links von ihm befanden sich Säcke und Eimer mit den Rohmaterialien: Kaolin, Feldspat und Quarz. Auf diversen Tischen sah man Werkzeuge und Pinsel, Schürzen, Tücher und Schwämme. Eine staubige Scheibtruhe mit abgeschlagenen Gipsmodeln versperrte den Weg. Der Reifrock kam nur mit Mühe daran vorbei. Jacques tat sich deutlich leichter, das Hindernis zu passieren.
»Wussten Sie, dass ein Spion das Geheimnis des Porzellanmachens nach Wien gebracht hat?« Die Frau drehte sich kurz zu Jacques um. Er konnte ihre Augen unter der Maske nicht gut sehen, aber er war sich sicher, dass sie amüsiert blinzelte.
Jacques schüttelte den Kopf.
»Im Jahr 1717 hat ein Kriegsratsagent von Kaiser Karl VI. einen Arkanisten dazu überredet, das Geheimrezept von Meißen nach Wien zu schmuggeln. Seither gibt es das alles hier.« Sie drehte sich schwungvoll um und deutete mit erhobenen Armen auf ein Regal voller Tassen, die mit winzigen Veilchen bemalt waren. »Auf mich wirkt das, als wäre die Zeit stehen geblieben.«
Sie durchquerten einen weiteren Raum, die Brennerei. Hier war es wärmer. Die Frau musterte ein Regal mit Tellern, die den ersten von 20 verschiedenen Arbeitsschritten durchlaufen hatten.
»Hier, stellen Sie sich bitte davor hin.« Sie blitzte ihn an. »Das ist ein schöner Hintergrund.«
Jacques zögerte. »Sollen wir nicht auf die anderen warten?«
Sie zückte ihr Handy. »Ich mache inzwischen eine Story.«
An seinem fragenden Blick erkannte sie, dass er ein digitaler Dinosaurier war. »Das ist ein kurzes Handyvideo, das auf Instagram gepostet wird.« Sie überlegte.
»Schauen Sie in den Ofen hinein, als ob sie das, was drinnen ist, bewundern wollten.« Sie deutete zur Tür des rund zwei Meter hohen Brennofens.
Jacques tat wie geheißen. Der Ofen war leer.
»Nein. Das sieht blöd aus«, befand sie. »Das wirkt, als wären Sie Bäcker und würden Brot backen.«
Sie verließ kurz den Raum und kam mit einer etwa einen halben Meter großen Statue zurück, einem weißen Pferd.
»Da, halten Sie das hoch.«
»Dürfen wir das?«
»Haben Sie etwa Angst?« Ihre Mundwinkel zuckten amüsiert. »Augarten lässt mir bei meinen Jobs immer freie Hand.«
Jacques hasste nichts mehr, als wenn ihn jemand als feig bezeichnete, und warf sich in Pose. Das Pferd war schwerer, als er gedacht hatte. Er hob es wie eine Trophäe über den Kopf.
Sie richtete das Mobiltelefon auf Jacques, ließ es dann aber gleich wieder enttäuscht sinken.
»Nein. Ihr Hut, das geht gar nicht. Jetzt sehen Sie aus wie ein Bereiter der Spanischen Hofreitschule.«
Jacques nahm den Dreispitz ab. Sein Haar war kurz und grau.
»Ja, das sieht schneidiger aus. Warten Sie. Das nehmen wir im Mittelformat auf.« Sie legte das Handy weg und griff nach der Kamera in ihrer Fototasche.
»Stellen Sie das Pferd wieder ab, hier auf den Tisch. Und jetzt setzen Sie sich davor, hier auf den Schemel, und stützen Sie eine Hand aufs Kinn. Wie so ein französischer Philosoph. Sie sind doch Franzose. Das ist Ihre Paraderolle.«
So sieht sie mich also, dachte Jacques. Aber er fand, dass französischer Philosoph besser zu ihm passte als Bäcker oder Bereiter.
Sie fuhr fort, ihm Anweisungen zu geben. »Schließen Sie die Augen. So als wären Sie ganz in Gedanken versunken.«
Jacques musste schmunzeln.
»Nicht lachen, ernste Mimik. Entspannen Sie sich. Denken Sie an etwas Schönes.«
Jacques tat wie geheißen.
»Nicht bewegen. Augen geschlossen halten. Ich wechsle jetzt die Kamera. Nicht bewegen. Halten Sie die Pose. Sie sehen großartig aus.«
Ein paar Wimpernschläge lang passierte gar nichts. Jacques hielt die Augen geschlossen. Er dachte an Mandelflan, an weiße Brüste und überlegte, wie ihre Haut wohl duftete. Seine Mimik wurde weich.
Er spürte Schritte, die näherkamen. Jemand umkreiste ihn. War sie hinter ihm? Jacques blinzelte. Das Nächste, was er spürte, war ein gewaltiger Hieb, ein krachender Schlag auf den Hinterkopf. Blitze, die in seinem Kopf explodierten. Dann war alles schwarz.
Als er erwachte, war ihm übel. Er lag im Dunkeln. Er spürte, wie das Blut in seinem Schädel pochte. Gleichzeitig war da dieser Schmerz. Schreckliche Kopfschmerzen. Er griff sich an den Schädel. Spürte Feuchtigkeit. Viel Feuchtigkeit. Dick. Klebrig. War das Blut? Er sah nichts. Er roch an seinen zitternden Fingern. Kostete. Ein metallischer Geschmack. Ihm war übel. Wo war er? Er versuchte, sich aufzurichten, stemmte sich mit Mühe hoch, brach aber sofort wieder zusammen, fiel auf die Knie. Er war orientierungslos, schwach. »Hilfe«, krächzte er, »Hilfe.« Er versuchte, den Kopf zu heben, aber alles drehte sich. Stöhnend rollte er zurück auf den Rücken, versuchte, die Beine auszustrecken, schaffte es nicht. Es war eng, viel zu eng. Wo war er? In einer Kiste? Wie war er hierhergekommen? Er konnte sich nicht erinnern. Alles war wie ausgelöscht. Die Bilder, die in seinem Kopf auftauchten, hatten nichts mit seiner jetzigen Situation zu tun. Schwarzer, frisch gegossener Teer. Das Gesicht seiner Frau, über das sich ein anderes schob. Schweiß und Tränen rannen über seine Augen. Oder war es Blut? Sein Herz. Es schlug immer schneller. Es galoppierte. Bis in den Hals hinein spürte er das rasende Pochen. Er bekam keine Luft mehr. Dann war da auf einmal Licht. Licht, das aus sechs Löchern in der Wand kam. Und mit dem Licht kam das Feuer. Das Feuer züngelte aus den Öffnungen. Erst nur kleine blaurote Flammen. Aber dann wurden die Flammen länger. War er in der Hölle? Jacques spürte die brennende Hitze, die ihm von beiden Seiten entgegenschlug. Er schrie auf, als die ersten Flammen auf seine Haut trafen. Er versuchte, sich zu einem Ball zu rollen, zu schützen. Aber es gab keinen Schutz. Die Flammen wurden länger, heißer, fordernder. Sie griffen nach ihm. Sie erfassten ihn.
Jacques schrie erneut. Er versuchte noch einmal, sich aufzurappeln, gegen die Wand zu werfen, am Boden zu wälzen, den Flammen zu entkommen. Aber es gab kein Entkommen. Panik. Nackte Panik. Todeskampf. Er musste hier raus. Aber er schaffte es nicht einmal mehr, sich zu bewegen. Er war längst ein Feuerball. Ein weißes Pferd bäumte sich vor ihm auf. Schlug mit den Vorderhufen nach ihm. Gleich würden seine Hufeisen seine Schädeldecke zertrampeln. »Non«, kreischte Jacques, »non!!!« Aber es war zu spät.
Kapitel 2 _ Sorgenfresser
Studien haben gezeigt, dass Personen, die unter chronischen Schmerzen leiden, beim Häkeln eine gewisse Erleichterung erfahren können. Die Konzentration und das Eintauchen in diese handwerkliche Tätigkeit können dazu beitragen, die Wahrnehmung von Schmerzen zu verringern, indem sie eine Ablenkung bieten.
Miss Brooks stach zu. Der Haken packte den Faden. Die Schlinge zog sich zusammen. Eng. Miss Brooks war flink. Sie stach erneut zu, wiederholte ihr Werk. Noch einmal. Und wieder. Und wieder.
Bertram »Bertie« Sprüngli hatte noch nie jemanden so flink häkeln sehen wie seine Schwägerin. Die Handarbeit wuchs vor seinen Augen, nahm Formen an. Wurde zu einer Art Häkelschlange, die begann, sich wie ein Korkenzieher einzudrehen.
Bertie räusperte sich. »Was wird das? Ein Wurm?«
Miss Brooks nickte. »In der Tat, mein Lieber. In England nennen wir sie Worry Worms.«
Bertie war verunsichert. War ein Worry Worm so etwas Ähnliches wie eine Voodoo-Puppe?
Miss Brooks deutete auf eine Kiste, in der kleine Holzkugeln waren. »Das wird der Kopf, aber so weit bin ich noch nicht.«
Zustechen, Faden mit dem Haken packen, Schlinge zuziehen. Ihre Gelenke schmerzten bereits, und ihr linker Zeigefinger war schon ganz steif. Aber sie wusste, sie durfte nicht aufhören zu häkeln. Zustechen, Faden packen, Schlinge zuziehen.
»Sieht nett aus«, log Bertie. Er fand Häkelarbeiten grässlich.
»Ich habe dir neue Wolle mitgebracht«, sagte er.
Die Nadel verharrte für einen Sekundenbruchteil in der Luft, als Miss Brooks ihren Schwager ansah. »Das ist sehr aufmerksam von dir, Bertie, nimm dir doch noch etwas Tee.« Zustechen, Faden packen, Schlinge zuziehen.
»Möchtest du auch noch eine Tasse?«, fragte er.
Miss Brooks schüttelte den Kopf. Zustechen, Faden packen, Schlinge zuziehen.
Bertie hatte keine große Lust auf Tee, aber er nutzte die Gelegenheit aufzustehen gerne. Er ging in die winzige Küche und schaltete den elektrischen Wasserkocher ein. Der Wasserkocher war hochmodern. Eine schlanke Säule aus gebürstetem Edelstahl. Er wirkte in der schäbigen Küche des Ferienhauses so fremd wie ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie. Der Wasserkocher hatte Bertie 50 Euro gekostet. Der Wohntraum am Mühlwasser hatte 550.000 gekostet. 550.000 Euro für eine 70 Quadratmeter große Holzhütte. Der Wasserkocher war perfekt. Die Hütte war ein Trauerspiel, kackbraun, mit schmiedeeisernen Gittern vor den Fenstern. Die hochbetagten Vorbesitzer hatten nicht nur ihre abgeranzten Möbel dagelassen, sondern auch ihren Geruch. Den Geruch nach alten Menschen, der sich in Böden und Wände, in die schmierigen Küchenfronten, die nussbraunen Möbel und die Fugen der rostrot geflammten Fliesen gefressen hatte. Die Hütte gehört weggeschoben, dachte Bertie. Es war die Lage, die so wertvoll war. Ein Grund am Mühlwasser. Blaue Infrastruktur wird in Zukunft Gold wert sein, sagten die Stadtplaner.
Das Wasser begann sprudelnd zu kochen. Bertie gab einen runden, fadenlosen Schwarzteebeutel in eine Tasse. Das Wasser, das er darüber goss, färbte sich sofort dunkelbraun. Er versuchte, den Beutel per Hand herauszufischen, und verbrannte sich dabei die Fingerspitzen. Er fluchte leise. »Du könntest auch bei uns wohnen«, sagte er lauter, als er beabsichtigt hatte.
Die Häkelnadel bewegte sich weiter im Takt. »Du weißt, dass das keine gute Idee ist, lieber Bertie. Du weißt, SIE wäre davon nicht angetan.«
Er blieb im Türrahmen zwischen Wohnzimmer und Küche stehen und beobachtete sie stumm. Insgeheim gab er ihr recht. SIE war ihre Halbschwester. Und die Beziehung der beiden war noch nie unter einem guten Stern gestanden.
Bertie seufzte. »Dennoch fühle ich mich nicht wohl bei dem Gedanken, dass du hier alleine bist, in deiner Situation. Du sagst es mir, wenn du es dir anders überlegst, nicht wahr? Wenn du wieder nach Hause willst, lasse ich dir sofort einen Flug nach London buchen.«
»Ich habe kein Zuhause mehr«, sagte Miss Brooks steif. Die Nadel legte an Tempo zu. »Ich werde dir nicht lange zur Last fallen, Bertie.«
Er sah sie betroffen an. »Nein, so habe ich das nicht gemeint. Bleib hier, so lange du willst. Ich bin froh, wenn du hier bist. Es ist nur, es ist mir auch unangenehm. Der Zustand des Hauses. Hier ist seit den 80ern nichts gemacht worden …«
Miss Brooks unterbrach ihn. »Das stört mich nicht, ich bin kein moderner Mensch, Bertie.«
Sie lächelte, legte das Handarbeitszeug weg und massierte ihre steifen Gelenke.
Bertie musste lächeln. Es stimmte. Seine Schwägerin war auf eine bezaubernde Art wie aus der Zeit gefallen. Er überlegte, woran es lag. Miss Brooks war eine mittelalte Frau. Sie hatte einen mittelalten zarten, hellen Teint, in dem die Zeit nicht mehr Spuren hinterlassen hatte als bei anderen mittelalten Frauen. Sie trug ihre dunkel getönten Haare kinnlang mit Stirnfransen. Eine Frisur, die auch zu einer 13-jährigen Ballettelevin oder einer 30-jährigen Modebloggerin gepasst hätte. Und ihre mittelalten graublauen Augen mit dem braunen Fleck in der linken Iris blickten nicht weniger interessiert in die Welt als die jüngerer Menschen. Nein, es lag nicht an ihrem Aussehen. Es lag an ihrem Verhalten. Vielleicht auch an der Sprache. Miss Brooks war Britin, hatte aber viel Zeit bei der österreichischen Großmutter verbracht. Das hatte ihr Deutsch geprägt. Sie sagte »famos« statt »geil«, »Grüß dich« statt »Hallo«, »Liebelei« statt »Affäre«. Und alle nannten sie Miss Brooks. Immer schon. Was einst in der Schulzeit als Hänselei für ihre omahafte Attitüde begonnen hatte, war mittlerweile ihr Spitzname. Auch weil sie den Vornamen, der in ihrem Pass stand, nicht leiden konnte.
Miss Brooks griff zu einer Nähnadel. Bertie erwartete, dass sie die Nadel der Puppe ins Herz rammen würde oder in den Kopf. Aber Miss Brooks fädelte den losen Faden, der von dem Püppchen hing, ein und fing an, diesen zu vernähen. Dann nähte sie eine Holzperle an. Aua, Jesus! Sie hatte sich in den Finger gestochen. Sie saugte an der Fingerkuppe. Erst als sie sicher war, dass kein weiterer Blutstropfen austreten würde, nahm sie eine Schere aus dem Handarbeitskoffer und schnitt die Überlänge des Nähfadens ab. Sie griff zu einem Stift und malte der Perle Augen, Nase und Mund auf.
»Hier.« Sie reichte das Püppchen ihrem Schwager. »Für dich.«
Das Püppchen war daumenlang, es schien ihm zuzuzwinkern.
»Danke«, sagte Bertie. Er fand das Ganze sonderbar, aber er bemühte sich um eine Miene, die diesen Umstand nicht preisgab.
Miss Brooks durchschaute ihn trotzdem. »Du solltest dem Püppchen zumindest eine Chance geben«, sagte sie mit sanfter Überzeugung.
Er lächelte. »Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann«, sagte er gespielt höflich. »Du hast dir so viel Mühe damit gemacht.« Er zeigte auf ihre Fingerkuppe. »Blut, Schweiß und Tränen.«
»Oh, ich habe noch mehr davon, du kannst dir so viele nehmen, wie du willst.«
Sie ging zu einem nussbraunen Kasten und öffnete die Tür mit Schwung. Sie griff nach einem großen Pappkarton, der darin stand, und hob ihn hoch. In diesem Moment löste sich der Boden der Schachtel. Hunderte Püppchen kullerten auf den Fußboden, blickten mit starren Puppenaugen in Richtung der mit Resopal verkleideten Zimmerdecke. Schienen ihn mit ihren roten Mündern anzugrinsen.
Bertie sah seine Schwägerin verdattert an. »Die hast alle du gemacht?«
»Natürlich!« Sie sah stolz aus.
»Aber wann? Ich meine, wie? Und vor allem, warum?«
Miss Brooks straffte ihre Schultern. »Mein lieber Bertie, ich bin nicht so anmaßend zu behaupten, dass ich der einzige Mensch bin, der Sorgen hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es auf der Welt sehr viele Probleme gibt, die gelöst gehören.«
Sie ging wieder zum Sofa und nahm ein neues Knäuel Wolle aus der Tüte, die Bertie mitgebracht hatte. Sie wickelte den Faden um die Hand und fing an, Maschen anzuschlagen.
»Ich komme morgen wieder«, sagte Bertie. Sie nickte nur abwesend.
Zustechen, Faden packen, Schlinge zuziehen.
Kapitel 3 _ Pinocchio
Wenn Menschen wütend werden, hat das einen interessanten Effekt auf ihre Wahrnehmung von Zeit. Man nennt das Phänomen »Zeitverzerrung«. Normalerweise fühlen wir uns in stressigen oder emotional aufgeladenen Momenten so, als würde die Zeit langsamer vergehen. Aber wenn Wut ins Spiel kommt, erleben wir plötzlich, dass die Zeit viel schneller zu verrinnen scheint.
Der Augarten erwachte. Jogger zogen ihre Montagmorgenrunden, den Blick starr auf den Kies vor ihnen gerichtet. Kaum einer nahm die Schönheit von Wiens ältestem Barockpark wirklich wahr. Die geometrische Landschaft, die akkurat geschnittenen Hecken, die bunten Broderie-Blumenbeete.
Pensionisten, die die senile Bettflucht frühmorgens aus dem Haus getrieben hatte, saßen auf Parkbänken und streckten ihre Gesichter in die Morgensonne. Eine übermüdete Mutter schob ihr zahnendes Baby im Kinderwagen vor sich her. Hoffentlich würde es an der frischen Luft endlich schlafen.
Der Park sah von oben betrachtet aus wie ein etwas verschobener Rhombus oder ein schiefer Papierdrachen. Am flachen Ende des Drachens stand der Flakturm. Ein Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Er passte optisch so gar nicht zu dem barocken Schloss, zu seiner von Lavendelbüschen eingesäumten Lieblichkeit. Der Park war ein Touristenmagnet, Heimat der Wiener Sängerknaben, Sitz der Porzellanmanufaktur Augarten.
Der Brennmeister stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz der Porzellanmanufaktur ab und ging mit beschwingtem Schritt Richtung Atelier. Vor dem Eingang stand der Lastwagen des Cateringunternehmens. Eine Mitarbeiterin balancierte eine Kiste mit benutzten Tellern und Gläsern an dem Brennmeister vorbei. Die Gläser klirrten. Noch immer waren nicht alle Spuren des Balles, der am Samstag stattgefunden hatte, beseitigt.
Der Brennmeister betrat das Gebäude. Er grüßte die Kollegin, die im Foyer die Karten für das Porzellanmuseum verkaufte, und ging dann in seine Werkstatt. Er stutzte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Es roch anders. Nicht wie gewohnt nach feuchtem Ton und Glasur. Auch nicht nach dem harzigen Tannenduft der Terpentinfarbe. Nein. Der Geruch, der in der Luft hing, erinnerte ihn an die Kartoffelfeuer seiner Kindheit. Ein süßlich-rauchiger Geruch, der über die Felder wehte, wenn das halbtrockene Kartoffelkraut mitsamt den letzten Kartoffelkäfern nach der Ernte verbrannt wurde. Vor dem Brennofen lagen Scherben. Er kannte das Teil, das da zerbrochen war. Es war teuer gewesen. Er kratzte sich am Kopf und überlegte, was hier passiert war. Es war mehr Intuition als Wahrnehmung, als er vorsichtig die Hand auf den Brennofen legte. Dieser war warm, obwohl gestern, Sonntag, kein Brennvorgang gestartet worden war. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Er griff nach einem Lappen und betätigte das große Drehkreuz, mit dem die Tür des Ofens verriegelt war. Der Geruch nach verbranntem Kartoffelkraut wurde stärker. Ruß und Rauch quollen ihm entgegen. Winzig kleine Ascheteilchen schwebten durch die Luft. Der Brennofen war leer, nur der Boden war mit Asche bedeckt. Darin lag ein seltsam verformter Klumpen. Der Brennmeister blickte ratlos auf den Boden. Er entdeckte die Scherben einer Vase und sah, dass eines der Bruchstücke mit einer dunkelroten, klebrig wirkenden Flüssigkeit befleckt war. Er drehte sich um und rannte zurück in Richtung Foyer.
»Was hast du?«, fragten seine Kollegen, die ihm entgegenkamen.
»Geht da nicht rein«, sagte der Brennmeister. »Im Brennraum. Da ist etwas passiert. Wir müssen die Chefin informieren und die Polizei.«
*
Luka Vukovic, jüngster Bezirksinspektor Wiens, Mitglied der Gruppe Baumgartner, Ermittlungsbereich 01 für Leib und Leben, erhielt den Anruf der aufgelösten Augarten-Geschäftsführerin, als er gerade dabei war, Oxymora auf einen Zettel zu kritzeln.
schmerzlich schön
teuflisch gut
geliebter Feind
liebevolle Kampfansage
glücklich verheiratet
Das letzte Oxymoron kritzelte er mit einem sarkastischen Lächeln hin. Luka war verheiratet. Unglücklich verheiratet.
Das Telefon läutete immer noch.
Eine Sekunde lang überlegte er, das lästige Bimmeln zu ignorieren. Er hatte die halbe Nacht mit Nicole gestritten. Er hatte heute wirklich keinen Bock auf Menschen. Aber dann nahm er den Anruf doch an.
Er drehte den Zettel mit den Oxymora um und machte sich darauf während des Gesprächs Notizen. Dann stand er auf und ging zu Rita Baumgartner.
»Da kam gerade ein Anruf von den Kollegen aus dem 2. Bezirk rein. Die vermuten ein Verbrechen in der Porzellanmanufaktur Augarten. Im Brennofen liegen ein Haufen Asche und Zeug, das wie Zähne und kleine Knochen aussieht.«
»Wie bitte?« Rita Baumgartner, Chefinspektorin des LKA und seine direkte Vorgesetzte, blickte auf. »Die verorschen uns, oder?« Sie sah Luka streng an. »Oder verorschst du mich?«
»Ich glaub, da ist wirklich etwas passiert.«
»Und warum stellst du den Anruf dann nicht zu mir durch?«
Luka hatte sich in den sechs Wochen ihrer Zusammenarbeit bereits an Ritas rüde Art gewöhnt. Dass er ungewöhnlich gleichmütig darauf reagierte, lag daran, dass er mit einer äußerst dominanten Mutter und zwei älteren Schwestern aufgewachsen war. Er war daran gewöhnt, von Frauen herumkommandiert zu werden, und auch, seine Ohren auf Durchzug zu schalten. Luka war jung, aber sein Gesicht hatte oft den tragikomischen Ausdruck eines alten Mannes.
»Was schaust denn so belämmert drein?«, fuhr sie ihn an. Rita war bekannt für ihre Wutanfälle. Sie explodierte regelmäßig. Ihrer Attraktivität tat dies interessanterweise aber keinen Abbruch. Selbst wenn ihr Gesicht wutverzerrt war, sah sie für Luka irgendwie sexy aus. Sie hatte kurze dunkle Haare, und einmal hatte Luka den Fehler gemacht, seine Meinung dazu zu sagen. »Nur schöne Frauen, denen alles passt, können kurze Haare tragen«, hatte er gesagt. Er hatte es als Kompliment gemeint, aber Rita war noch wütender geworden und hatte ihn angebrüllt, ob ihm wer ins Hirn geschissen hätte. Seither verkniff sich Luka Komplimente.
Rita rief die Kollegen im 2. Bezirk an und dann die Tatortgruppe. »Mitkommen«, knurrte sie in Lukas Richtung. »Wir fahren in den Augarten.« Es war klar, dass sie den Wagen lenkte. Kollege Hans Tauber von der Spurensicherung musste auf dem Beifahrersitz des Dienstwagens Platz nehmen. Luka quetschte sich in den Fond des Wagens. Das sieht jetzt so aus, als wenn ich das Kind der beiden wäre, dachte er.
Die Fahrt von der Berggasse zum Augarten dauerte keine zehn Minuten. Fünf Minuten davon verbrachte Rita damit, über die E-Scooter-Fahrer links und rechts der Straße zu schimpfen, die verbotenerweise auf den Gehsteigen fuhren. »Bitte gib dir das! Die dort fahren auch noch gegen die Einbahn! Diese Wappler. Das sind gleich einmal fünf Anzeigen«, schimpfte sie. »Und wenn man die anhält, plärrens rum wie trotzige Achtjährige und faseln was von ›Einschränkung der Freiheit‹. Alles Vollpfosten.« Luka sagte nichts. Er fand Roller in der Stadt ganz praktisch und hatte selbst schon überlegt, sich einen anzuschaffen. Dreimal schon war ihm ein Fahrrad gestohlen worden. Einen Roller könnte er mit in die Wohnung hinaufnehmen. Und umweltfreundlich waren die Dinger auch. Aber die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass man Rita besser nicht widersprach, wenn sie sich über irgendetwas echauffierte.
»Ist das Wetter nicht herrlich heute?« Hans versuchte, das Thema zu wechseln. Er hatte schon erlebt, dass Rita in solchen Situationen den Wagen anhielt, sich als Polizistin zu erkennen gab und den Verkehrssündern eine Standpauke hielt. Er fand, diesen Aufwand war die ganze Sache nicht wert.
Vor der Porzellanmanufaktur Augarten wartete ein halbes Dutzend Menschen im Freien. Ein einzelner junger Uniformierter, den Luka nicht kannte, stand am Eingang und bewachte das Gebiet zwischen dem Eingang und den Schaulustigen, die sich in respektvollem Abstand versammelt hatten. Er hielt die Handfläche vor, als wolle er jeden abwehren, der versuchte näherzukommen.
»Wir sind ja nicht blöd, wir haben keine Spuren verwischt«, sagte einer aus der Gruppe, der sich als der Brennmeister vorstellte. Er warf einen Apfelbutzen in die Büsche, bevor er den Kriminalbeamten seine Hand hinstreckte. Was immer geschehen war, es hatte ihm weder den Appetit verdorben noch die Sprache verschlagen.
»Jetzt heben S’ Ihren Dreck aber schön wieder auf, oder wollen S’ uns noch mehr Arbeit machen?«, herrschte ihn Rita an.
Der Brennmeister entschuldigte sich und hob das Kerngehäuse wieder auf.
»Und jetzt erzählen S’ uns g’fälligst, was hier los ist.«
Bitte, ergänzte Luka in Gedanken, aber laut sagen traute er sich das nicht.
Der Brennmeister wirkte zerknirscht wie ein Schüler, als er zu sprechen begann. Aber dann sprudelten die Worte nur so aus ihm heraus. »Ich bin in der Früh wie üblich zu meiner Schicht gekommen, und dann hab ich bemerkt, dass im Brennofen was verbrannt wurde, und wir glauben, es ist ein Mensch. Wegen der blutigen Scherben vom Pinocchio, und weil da was in der Asche war, das wie Knochen ausschaut.«
»Halt, halt, was für ein Pinocchio?«, fiel ihm Rita ins Wort.
»Pinocchio ist eine Stehaufvase«, erklärte die Geschäftsführerin von Augarten, die hinzugekommen war. »Warten Sie, ich hole Ihnen eine.« Sie ging in den Schauraum und kam mit einer bauchigen Vase mit einem langen Hals zurück.
»Hier, ich erkläre Ihnen, wie sie funktioniert. Sehen Sie dieses kugelförmige Unterteil? Es ist innen mit Blei ausgegossen. Wenn man versucht, die Vase hinzulegen oder in die Waagrechte zu drücken, richtet sie sich immer wieder von alleine auf wie ein Stehaufmännchen.«
Sie ging zu einem Tisch im Foyer, ließ die Vase ihr Kunststück vorführen und drückte sie dann Luka in die Hand. Die Vase war überraschend schwer. »Damit kannst schon wen erschlagen«, sagte Luka.
Rita warf ihm einen Blick zu, der schwer zu deuten war, aber dazu führte, dass Luka die Vase wieder abstellte. »Hans, komm mit. Wir schauen uns das aus der Nähe an. Luka, du bleibst mit den Leuten hier und verhalt dich ruhig. Stillbeschäftigung.«
Luka zuckte mit den Schultern. Das Letzte hätte sie sich sparen können, dachte er.
Der Brennofen war ein circa acht Kubikmeter großer Kubus, dessen Vorderseite sich komplett öffnen ließ, um Wägen mit ungebrannter Tonware hineinzuschieben. Er wurde mittels Display eingeschaltet. Ein Druck auf den Startknopf, und im Inneren des Ofens schossen aus sechs kreisrunden Löchern Flammen.
Hans zog seine Schutzkleidung an und widmete sich dem Inneren des Ofens. »Die Asche müssen wir ins Labor schicken, aber es sieht tatsächlich aus wie menschliche Zähne und Knochenreste. Ich ruf gleich die Kollegen an, dass wir einen Tatort haben.«
»Ist das alles, was von einem Menschen übrig bleibt?«, fragte Rita.
»Der Brennofen hier erreicht Temperaturen bis zu 1.300 Grad, das ist genauso heiß wie ein Krematorium. Das da hinten«, er deutete auf einen Klumpen, »das sieht mir aus wie Metall. Könnte ein künstliches Gelenk sein.«
Der Tatortexperte runzelte die Stirn. »Und das da auf den Scherben – wie nennen sie die Vase hier noch mal? Pinocchio? Also das Dunkelbraune ist mit ziemlicher Sicherheit getrocknetes Blut. Wir sperren hier alles ab, und ich rufe die Kollegen an.«
»Kann man da noch DNA feststellen?«, fragte Rita. »Wenn hier ein Mord begangen wurde, dann muss jemand vermisst werden.«
Die Geschäftsführerin von Augarten, die am Eingang des Brennraumes stehen geblieben war, meldete sich zu Wort. »Es wird tatsächlich jemand vermisst«, sagte sie. »Jacques Bernard, Zonenchef der Kosmetikfirma Très Loué. Er war Gast auf unserem Event am Samstag. Er ist nie in seinem Hotel angekommen.«
Kapitel 4 _ Berties Bart
Ein Mann, der sich täglich rasiert, verbraucht dafür 4,5 Monate oder 139 ganze Tage seiner Lebenszeit.
Suzy stand vor dem Küchenblock und beobachtete ihren Mann Bertie. Dieser stand barfuß mit krummem Rücken vor dem knusprigen Brot, welches das Kindermädchen Polina nach korrekter mehrtägiger Sauerteigführung gebacken und erst vor wenigen Minuten aus dem Ofen geholt hatte. Bertie pickte mit feuchten Fingerkuppen die Sonnenblumenkerne von der Kruste und führte diese zum Mund, wieder und wieder.
Suzy spürte die wohlbekannte Irritation, die sie in Gegenwart ihres Mannes immer öfter überkam. Ein Gefühlscocktail aus Verärgerung, Enttäuschung und Frustration, in den sich oft auch ein Hauch Ekel mischte. Sie wusste auch genau, wann sie die Irritation zum ersten Mal verspürt hatte. Es war der Tag gewesen, an dem Bertie nach einer mehrtägigen Dienstreise ins Pariser Headquarter des Kosmetikkonzerns Très Loué plötzlich mit Bart vor ihr gestanden war.
»Was wird das?«, hatte Suzy gefragt und nervös gelacht, als Bertie seine Brille ablegte und sie in die Arme nahm. Der Bart kratzte. Bertie roch unangenehm nach Essigchips, Bier und schaler Flugzeugluft.
Bertie zwirbelte sein Barthaar. »Das ist jetzt modern. Très Loué hat eine ganze Kollektion an Bartpflegeprodukten herausgebracht. Bartöl, Bartwachs, Bartshampoo, Bartconditioner, Bartwuchstonic …«
Suzy unterbrach Bertie. »Ja, aber warum machst du da mit?«
Bertie gab ihr keine Antwort.
Für Suzy war es der Beginn einer Entfremdung. Mit Bestürzung stellte sie fest, dass sein Gesicht mit Bart überhaupt nicht mehr das war, was sie begehrte. Bertie mit Bart war für sie komplett unerotisch. Die Gesichtsbehaarung hatte den Helden ihrer Jugend in einen Weihnachtsmann verwandelt. Der Tag, an dem Bertie beschlossen hatte, sich einen Bart stehen zu lassen, markierte den Beginn eines Risses in der Beziehung der beiden, der sich nach und nach zu einem Spalt und schlussendlich zu einer tiefen Kluft weitete. Für Suzy fühlte sich die Kluft oft an wie eine klaffende schmerzende Wunde. Sie hatte Bertie so begehrt, und jetzt empfand sie das Erkalten ihrer Gefühle als eine einzige Enttäuschung. Sie merkte, wie sich die Enttäuschung in Zorn verwandelte. Jähen, wilden Zorn.
Bertie fuhr herum, als er seine Frau im Türrahmen bemerkte. Sie brauchte seine Beschäftigung mit dem Brot gar nicht zu kommentieren. Ihr Blick genügte. »Entschuldige«, sagte Bertie, »aber das riecht so gut. Ich konnte nicht widerstehen.« Ein Sonnenblumenkern klebte in seinem Bart.
Suzy trat näher, Bertie pickte immer noch Kerne mit feuchten Fingerkuppen vom Brot.
Suzy nahm das Messer, das daneben lag, und stach zu.
Der Stich war so heftig, dass die Klinge des Messers im harten Akazienholz des Schneidbrettes stecken blieb. Genau an der Stelle, an der eben noch Berties Hand gewesen war, die dieser reflexartig und zu Tode erschrocken zurückgezogen hatte.
»Spinnst du jetzt komplett?«, brüllte er.
»ICH HASSE DAS!!!«, schrie Suzy. »Am Brot herumkletzeln. Das ist eklig. Du bist eklig, du widerst mich an.«
»Du bist ja nicht normal, das ist komplett irre. Du wolltest mir ein Messer in die Hand rammen, du Verrückte!«
Bertie trat einen Schritt auf Suzy zu und packte sie an den Armen, woraufhin Suzy gellend zu schreien begann.
»Lass mich los, du tust mir weh!«
»Ich tu dir weh? Du bist gerade mit einem Messer auf mich losgegangen!«
»Lass mich sofort los!«
»Nur wenn du mir versprichst, dass du dich wieder normal benimmst!«
Berties Stimme überschlug sich. Sie spürte, wie seine Angst, sein Entsetzen sich in Ärger verwandelte. Dominanz, die sie anmachte. Plötzlich war alles wieder wie früher. Sie zappelte unter seinem Griff, aber nicht mehr so stark. Und dann küsste sie ihn. Gierig, heftig. Bertie reagierte nicht gleich darauf. Sie merkte seine Verwirrung, seine Unsicherheit, sich auf sie einzulassen. Und dann küsste er sie zurück. Und sie ließ sich darauf ein, bis sie spürte, dass sein Bart kratzte. Sie biss ihn in die Lippe.
»Aua, was zum Teufel …« Bertie schreckte zurück. Er fuhr mit seiner Zunge über die Lippe, schmeckte Metall, schmeckte Blut. Er ließ von Suzy ab. Sein Blick drückte nichts als Fassungslosigkeit aus.
»Ist alles in Ordnung?« Eine gurrende Altstimme. Ein rollendes R.
Bertie drehte sich um. Polina, das Kindermädchen der Sprünglis, stand im Türrahmen. Er war sich nicht sicher, wie lange sie schon dort gestanden war. Suzy warf Polina einen Blick zu, den Bertie nicht deuten konnte.
»Alles in Ordnung, Polina«, sagte Suzy. »Ich bin nur mit dem Messer ausgerutscht und habe mich erschreckt.« Sie lächelte schmallippig und steckte das Messer zurück in den Messerblock.
Bertie merkte, dass er nach Schweiß stank. Dem Angstschweiß, der ausgebrochen war, als das Messer auf seine Hand niedergesaust war. Er fühlte sich verwirrt, verletzt, frustriert, angeturnt und verschmäht. Mit eingezogenem Kopf und einem halbsteifen Penis in der Hose entfernte er sich aus der Küche.
Suzy atmete durch und rieb sich die Schläfen.
»Alles in Ordnung? Hast du Kopfschmerzen, soll ich dir einen Tee mit Wacholder und Ingwer machen?« Polina sah die Hausherrin fragend an. Suzy schüttelte den Kopf. Polina legte das Brot, auf dem nur mehr die Abdrücke der verspeisten Sonnenblumenkerne zu sehen waren, in die Brotdose und berührte Suzy leicht an der Schulter. »Oder etwas Lavendelöl. Wenn man das auf den richtigen Druckpunkten einmassiert, geht es einem sofort besser. Wir könnten auch gemeinsam Yoga machen.« Polina warf einen Blick auf die Küchenuhr. »Ich hole in einer Stunde Roderick und Finnea vom Sport ab, aber eine Kurzsession geht sich aus.«
Suzys Augen glitzerten kurz, aber dann winkte sie ab. »Das geht heute nicht.«
Polina sah Suzy lange an. Gestresst sah sie aus. Eine tiefe Falte hatte sich zwischen den Brauen eingegraben.
»Dann lass mich dir wenigstens einen Oxymel-Drink machen.«
Das Kindermädchen griff zu einer Flasche mit selbst angesetztem Sauerhonig und zu einer Karaffe Wasser, auf deren Grund sich bunte Steine befanden. Sie nahm ein Glas und vermischte beides.
Suzy beobachtete sie und merkte, wie allein das ihre negativen Emotionen vertrieb und sie plötzlich eine tiefe Zuneigung verspürte. Dabei hatten sie ihre Freundinnen von der Expat-Gruppe Vienna Vagabonds vor Polina gewarnt. Ein Kindermädchen, das jung und schön ist. Das bringt nur Probleme. Die hatten ja keine Ahnung. Polina war weder an Luxus noch an einem Techtelmechtel mit einem reichen Mann interessiert. Suzys überteuerte Kosmetik von Très Loué ließ sie genauso kalt wie der Mann mit dem Bart, dessen Firma diese produzierte.
Suzy liebte es, die junge Frau zu beobachten. Ihre anmutigen Bewegungen, ihr offenes Lächeln, die großen veilchenblauen Augen, die immer zu strahlen schienen.
Suzys Leben war so viel besser, seit Polina bei ihnen lebte. Sie war ein Gottesgeschenk in dieser verrückten internationalen Familie, der es vor allem an Stabilität fehlte.
Suzy war Britin. Ihr Mann Bertie alias Doktor Bertram Sprüngli war Schweizer, internationaler Controller und Teil der Geschäftsführung beim Kosmetikkonzern Très Loué. Alle zwölf Monate durfte er seine Fähigkeiten an einem neuen Standort unter Beweis stellen. Die Familie zog mit. Alle zwölf Monate eine neue Stadt, ein neues Haus, ein neues Leben. Nun eben ein Leben in dieser Jugendstilvilla im Wiener Cottageviertel. Beste und teuerste Grünruhelage der Stadt. Das Wort »Cottage« wurde zu Suzys Überraschung zwar englisch geschrieben, aber nicht englisch ausgesprochen. Um das Vornehme dieser Wohngegend besonders hervorzustreichen, bedienten sich die Bewohner eines leicht französischen Akzents und sagten »Wiener Koteesch«. Am besten mit lang gezogenem »e« und leicht nasaler Betonung. Suzy fand das verwirrend und lächerlich zugleich.
Polina war Suzys einzige Konstante in einem unsteten Leben, und sie wurde immer mehr zu einer engen Vertrauten.
»Er war wieder bei meiner Schwester«, sagte Suzy auch prompt.
»Wie geht es ihr?«, fragte Polina.
Suzy zuckte mit den Schultern. »Den Umständen entsprechend. Ich verstehe nicht, warum sie nicht nach England zurückgeht. Was will sie hier?«
Während Suzy an ihrem Sauerhoniggetränk nippte, drang die Stimme ihres Mannes aus dem Nebenzimmer. Erst verhalten, dann immer lauter.
»Das gibt es doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Bist du sicher? Das ist ja verrückt. Wer um Himmels willen tut so etwas?«
Suzy runzelte die Stirn. Telefonierte Bertie? Dann plötzlich Stille.
Schritte näherten sich. Bertie kehrte in die Küche zurück. Er wirkte erregt. Er schwitzte stark. Auch auf den Fußsohlen. Wenn er auf eine der schwarzen Schieferkacheln trat, konnte man seinen Fußabdruck eine halbe Sekunde lang sehen, bevor sich dieser wieder in Luft auflöste. Ob die Innenarchitektin, die diesen Boden geplant hatte, sich dieses Phänomens bewusst gewesen war?
»Das ist … nein, das glaub ich jetzt nicht. Wie grausam ist das denn? Das ist ja wie aus einem Mafiafilm.« Bertie kam laut murmelnd auf die beiden Frauen zu.
»Klärst du uns bitte auf?« Suzy sah ihren Mann genervt an. Soeben hatte sie dank Polina ihren Seelenfrieden wiedergefunden, und jetzt musste er alles erneut kaputt machen mit seiner negativen Energie und seiner Aufgeregtheit.
Bertie stoppte abrupt, klaubte einen Sonnenblumenkern von seiner feuchten Fußsohle und warf ihn in die Abwasch. Er blickte auf und starrte seine Frau an. »Das ist so eine wilde Geschichte. Am Samstag war ja dieser Augarten Ball, auf dem wir auch kurz waren.«
»Wir waren dort, weil du es als berufliche Verpflichtung gesehen hast, dort eine Gesichtswäsche zu machen. Ich hatte von Anfang an keine Lust hinzugehen …« Suzy verdrehte die Augen.
Bertie ging auf das Gejammer seiner Frau gar nicht ein. »Sie haben heute eine Leiche im Brennofen gefunden.«
»Wie bitte?« Suzy sah erst zu Polina und dann zu Bertie.
»Ihr habt richtig gehört.« Er raufte sich den Bart. »Und es ist gut möglich, dass der Tote unser Zonenchef ist. Wie ihr wisst, war Jacques Bernard auch auf dem Event. Wir von Très Loué waren ja Hauptsponsor. Aber danach hat ihn niemand mehr gesehen.«
Er machte eine Pause, knetete seine Hände und ließ seine Knöchel knacksen. Auch so eine Angewohnheit, die Suzy extrem irritierte.
»Woher weißt du das von der Leiche?«, fragte Suzy.
Bertie ignorierte die Frage und fuhr mit seiner Geschichte fort. »Die meisten dachten, Jacques wäre, so wie auch wir, früh gegangen. Aber er kam nie im Hotel an. Seine Frau hat gleich am Sonntag in der Früh Alarm geschlagen, als er nicht im Hotel aufgetaucht ist. Sie hat gemeint, dass etwas nicht stimmt. Auch heute keine Spur von Jacques …«
Er blickte von Suzy zu Polina.
»Und heute Morgen haben sie bei Augarten menschliche Überreste im Brennofen gefunden. Also es deutet zumindest einiges darauf hin, dass da ein Mensch kremiert wurde. Und da Jacques verschwunden ist … Also wenn man zwei und zwei zusammenzählt …«
»Bone China«, sagte Suzie. »Früher hat man Porzellan mit Knochenmehl gebrannt, damit es härter wurde.« Sie zwirbelte eine Haarsträhne um einen Finger. »Ich weiß auch nicht, warum mir das gerade jetzt einfällt.«
Polina sah Suzy mit demselben Blick an, mit dem sie oft eines der Sprüngli-Kinder bedachte. Mitleidig und wohlwollend zugleich.
Suzy trat auf ihren Mann zu. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. Dann nahm sie die Hand genauso schnell wieder weg. Fast so, als hätte sie sich verbrannt. »Vielleicht ist es aber auch gar nicht er, der getötet wurde. Vielleicht hat er sich nur versoffen. Du weißt doch, wie manche Männer sind. Oder?« Ihre Stimme hatte einen bemüht enthusiastischen Klang.
Polina beschloss, das zu tun, was sie immer tat – ihr eigenes Karma pflegen. »Möchtest du etwas Schlüsselblumen-Oxymel?«, fragte sie Bertie sanft und lächelte dabei Suzy an.
Bertie ging gar nicht auf das Angebot ein. »Wenn ihr mich bitte entschuldigt. Ich muss ein paar Telefonate führen. Wenn Jacques Bernard etwas zugestoßen ist, das wäre eine Katastrophe. Der Mann ist Franzose. Ihr wisst, was das bedeutet. Der französische Botschafter wird uns die Hölle heißmachen.«
Kapitel 5 _ Giselle
Andere Sprache, andere Emotionen. In vielen Sprachen gibt es Wörter für Gefühle, die sich nur schwer in eine andere Sprache übersetzen lassen. So beschreibt der portugiesische Begriff »saudade« ein Gefühl der tiefen Melancholie, der Sehnsucht nach etwas Abwesendem oder verloren Geglaubtem.
Luka Vukovic gähnte. Er war dieser Tage meistens müde. Aber neben der ständigen Müdigkeit hatte sich auch eine emotionale Erschöpfung in ihm breitgemacht. Auch wenn Luka Zuschreibungen wie »emotionale Erschöpfung« fremd waren. Er war einfach gestrickt. Bei ihm hieß das schlicht »Scheiß drauf«.
Luka war nach dem Bundesheer zur Polizei gegangen, weil ihm nichts Besseres eingefallen war und seine Mutter und seine drei Schwestern immer betont hatten, dass das ein wichtiger und sicherer Job war. Luka hatte immer gedacht, dass jeder Depp ein Kieberer werden kann.
Aber das Aufnahmeverfahren der Polizei war in dem Jahr, in dem Luka antrat, ein Mix aus Assessment-Center und sportlicher Leistungsschau. Die Bewerber und Bewerberinnen mussten Rechtschreib- und Grammatikaufgaben lösen, einen Intelligenztest bestehen und einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen. Sie mussten ein Aufnahmegespräch führen, sich ärztlich untersuchen lassen, und wenn das alles geschafft war, ging es erst richtig los. Denn der sportmotorische Leistungstest trennte die Spreu vom Weizen. Geprüft wurde in den Disziplinen Schwimmen (100 Meter Freistil in unter zwei Minuten und 11,6 Sekunden), Geschicklichkeit und Kraft (Parcours und 15 Liegestütze) und Laufen (3.000 Meter in unter 17 Minuten und 45 Sekunden). Zum Abschluss musste man noch eine 70 Kilo schwere Puppe »retten«. Absolvierte man einen Bereich negativ, galt der gesamte Aufnahmetest als nicht bestanden.
Luka wäre um ein Haar durchgefallen. Er wäre fast am Schwimmtest gescheitert. Und das, obwohl Luka doch jeden Sommer seines bisherigen Lebens in Kroatien verbracht hatte und wie ein Fisch schwamm.
Die Vorgabe hörte sich zwar sportlich, aber durchaus machbar an. Aber dann beging Luka einen folgenschweren Fehler: Er streifte bei der Wende den Boden.
»Der hat den Boden berührt! Der ist raus!«, plärrte der Prüfer. Und dann, als sich Luka keuchend und prustend aus dem Wasser hievte: »Danke, das war’s für Sie.«
Paradoxerweise war das der Moment, in dem Luka, der sich nur halbherzig zum Eignungstest angemeldet hatte, zum ersten Mal wirklich den brennenden Wunsch hatte, Polizist zu werden. Es konnte doch nicht sein, dass eine Millisekunde, in der seine Haut eine Kachel kaum berührt hatte, über sein weiteres Leben entschied.
»Du, der hat die schnellste Zeit gehabt«, sagte der zweite Prüfer mit einem Blick auf die Stoppuhr. »Und ich hab nicht gesehen, dass er den Boden berührt hat. Bist du dir sicher?«
Der erste Prüfer war sich nicht sicher.
»Haben Sie den Boden berührt?«, fragte er Luka.
Luka schüttelte den Kopf.
»Sie sind weiter«, sagte der zweite Prüfer lächelnd, der wohl auch irgendwelche Machtspielchen mit dem ersten Prüfer laufen hatte.
Und eine Sekunde lang war Luka froh. Bevor das schlechte Gewissen einsetzte, das ihn bis heute begleitete. Er hatte seine Karriere bei der Wiener Polizei mit einer Lüge begonnen. Er konnte das nicht mehr ändern. Er konnte es nur wiedergutmachen, indem er ein richtig guter Polizist wurde. Und das versuchte er fortan. Auch wenn es mit einer Vorgesetzten wie Rita Baumgartner nicht leicht war.
Das Klingeln eines Telefons riss Luka aus seinen Gedanken. Es war Ritas Telefon. Sie hob ab, murmelte aber so leise, dass er nicht verstehen konnte, was sie sagte.
»G’schissener Depp«, fluchte Rita, als sie den Anruf beendet hatte.
»Wer war das?«, fragte Luka.
»Wer glaubst du, wer das war?«, fauchte Rita. »So ein Dodl aus dem Innenministerium war das. Wir sollen bei dem Fall im Augarten anzahn, als ob wir das nicht ohnehin immer tun würden. Alles Wappler.«
»Warum mischt sich das Innenministerium da ein?«
»Der französische Botschafter pudelt sich auf. Dieser verschwundene Franzose ist ein Wirtschaftsbonze. Der Dodl wollte wissen, ob wir schon Ergebnisse von der DNA-Untersuchung der sterblichen Überreste im Augarten haben. Ich habe ihnen gesagt, willkommen in der echten Welt. Mir san jo net CSI Miami, wo jeder Fall in 45 Minuten gelöst wird. Los, komm, beweg dich!«
»Wohin fahren wir?«