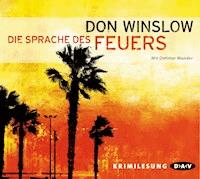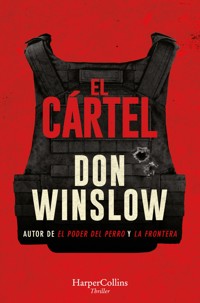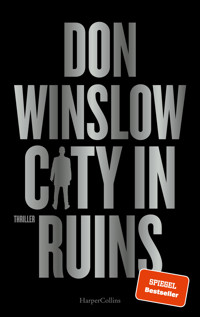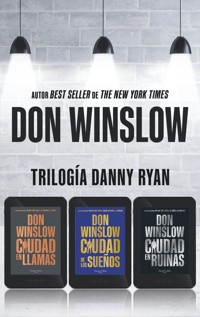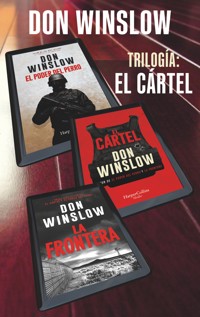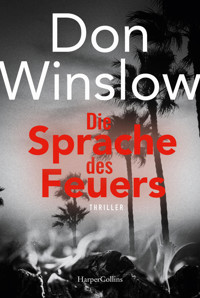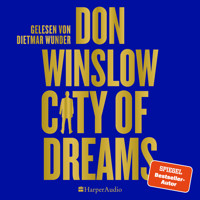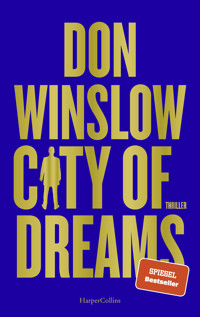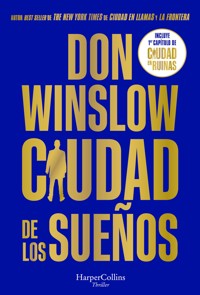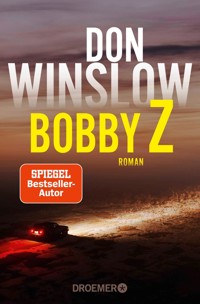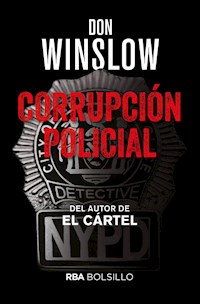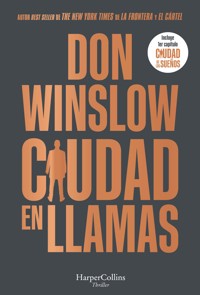9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Frank-Decker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Spiegel-Bestseller als Taschenbuch Die fünfjährige Hailey spielt im Garten, als das Telefon klingelt und ihre Mutter kurz ins Haus geht. Eine Minute später kommt sie zurück. Und ihre Tochter ist verschwunden. Zwei Wochen später verschwindet ein weiteres Mädchen – diesmal wird die Leiche gefunden, der Täter gefasst und auch mit dem Mord an Hailey belastet. Akte geschlossen. Aber Frank Decker, dessen Job es ist, Verschwundene aufzuspüren und zurückzuholen, hat Zweifel. Er glaubt, dass Hailey lebt, irgendwo versteckt – während die Uhr tickt. Ein vager Hinweis führt ihn nach New York. Sanft wenn möglich, hart wenn nötig, folgt er Schritt für Schritt der Spur, die ihn in die Hölle lotsen wird. »Der beste Thrillerautor unserer Tage.« Welt am Sonntag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Don Winslow
Missing. New York
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die siebenjährige Hailey spielt im Garten, als das Telefon klingelt und ihre Mutter kurz ins Haus geht. Eine Minute später kommt sie zurück. Und ihre Tochter ist verschwunden. Zwei Wochen später verschwindet ein weiteres Mädchen – diesmal wird die Leiche gefunden, der Täter gefasst und auch mit dem Mord an Hailey belastet. Akte geschlossen. Aber Frank Decker, dessen Job es ist, Verschwundene aufzuspüren und zurückzuholen, hat Zweifel. Er glaubt, dass Hailey lebt, irgendwo versteckt – während die Uhr tickt. Ein vager Hinweis führt ihn nach New York. Sanft wenn möglich, hart wenn nötig, folgt er Schritt für Schritt der Spur, die ihn in die Hölle lotsen wird.
Inhaltsübersicht
»Jedes vermisste Kind ist eins zu viel.«
John Walsh
Der Morgen in Manhattan kam mit dem Poltern und Zischen eines Müllautos, das die Sünden der Nacht bereinigte.
Oder es versuchte.
Die Sonne ließ sich noch nicht blicken, doch die Hitze war schon da, und selbst im sechsten Stock meines Billighotels roch ich den Müllgestank, der vom Hof aufstieg. Kein Wunder – ich hatte das Fenster geöffnet, um einen Hauch frische Luft zu erhaschen.
Die Hitze dieses endlosen Sommers sammelte sich in dem Betonkasten wie alte, aufgestaute Wut.
Es war Ende August und der Herbst nur eine ferne Verheißung.
Mein weißes Hemd klebte an mir, als ich es überzog. Es war nicht frisch, aber das sauberste, das ich hatte. Ich stieg in die Khakihose, zog Socken und Schuhe an, dann streifte ich die Schussweste über, steckte die 38er Smith & Wesson ins Hüftholster und zwängte mich in den blauen Blazer, um sie zu verbergen.
Es war Zeit, Hailey Hansen nach Hause zu holen.
Mein Name ist Frank Decker.
Ich spüre vermisste Personen auf.
Als ich Haileys Namen zum ersten Mal hörte, war ich noch Ermittler bei der Polizei in Lincoln, Nebraska. Es war gegen Dienstende, ich kam gerade von einer Zeugenvernehmung und war ziemlich geladen. Crystal Meth im Rockermilieu. Das einzig Gute an solchen Verfahren: Man hört ein paar nette Umschreibungen für das Wort »Drecksack«.
Ich fuhr also Richtung Zentrale und freute mich schon auf mein kühles Bierchen, als »Code 64« über Funk kam – eine Vermisstenmeldung.
Hansen, Hailey Marie.
Afroamerikanisch, weiblich.
Fünf Jahre alt.
Ein Meter sieben, siebzehn Kilo.
Schwarzes Haar, grüne Augen.
Ermittler, bitte übernehmen.
Da ich gerade in der Nähe war, meldete ich mich und steuerte den kleinen Bungalow in dem Viertel an, das Russian Bottoms heißt.
Die Mutter des Kindes stand auf dem Gehweg und sprach mit dem Cop, der ihren Anruf entgegengenommen hatte. Sie trug eine ärmellose Bluse in Pink, weiße Shorts und Sandalen. Ihr Gesicht war verheult, ihr mittelblondes Haar schwitzig und verklebt.
Wer nicht an die globale Erwärmung glaubt, sollte einmal im August nach Nebraska fahren und aus dem klimatisierten Auto steigen. Kein Regen seit Mai, in der gnadenlosen Sonne verdorrt der Mais, während dicke Gewitterwolken dräuen – vielversprechend, quälend, ohne auch nur einen Tropfen Feuchtigkeit zu bringen.
Nur die süße Folter der Hoffnung.
Andere Mütter fanden sich ein und standen auf dem Gehweg und dem Rasen herum, die Hände fest auf den Schultern ihrer eigenen Kinder, während sie von zwei Cops befragt wurden – im Gesicht eine Mischung aus Angst und der heimlichen Erleichterung, dass es nicht sie, sondern die andere Frau traf.
Die Fragen kannte ich auswendig. Standardfragen, das kleine Einmaleins der Grundausbildung.
Wann haben Sie Hailey zuletzt gesehen? Ist Ihnen hier in der Umgebung irgendetwas aufgefallen? Gibt es einen Verdächtigen?
Und dann die entscheidende Frage.
Haben Sie eine Vermutung, was mit Hailey passiert sein könnte?
Denn wenn Angehörige – oder ein Freund der Mutter – dem Kind etwas angetan haben, rücken die Nachbarn damit heraus. Erst zögernd, dann bereitwillig. Oder es zeigt sich, dass sie schon öfter beim Jugendamt angerufen haben. Oder es liegen dort schon mehrere Anzeigen wegen »häuslicher Gewalt« vor.
Trotz achtunddreißig Grad im Schatten behielt ich meinen Blazer an, um die Pistole zu verdecken. Wozu die Kinder ängstigen? Normalerweise bleiben sie ruhig, solange die Erwachsenen die Nerven bewahren.
Ich hoffte, dass Klein Hailey gleich aus dem nahen Park herausspaziert käme, von der Mutter ungestüm in die Arme geschlossen und mit einem sanften Klaps bedacht. Wir würden einen erleichterten Blick wechseln und uns verabschieden. Schon gut, Ma’m, wir freuen uns, dass sie wieder da ist. Dann ab nach Hause, unter die kalte Dusche, danach ein noch kälteres Bier, während die Bruthitze des Nachmittags in die Bruthitze des Abends übergeht.
Softball-Spiele.
Das Eisauto.
Entspanntes Plaudern auf der Veranda mit Fliegengitter.
Ein Sommerabend im mittleren Westen. Alles normal. Sogar eine Normal Street gibt es in dieser Stadt.
Hitzewellen und Gewaltwellen gehen Hand in Hand.
Meiner Erfahrung nach.
Die Sicherungen brennen schneller durch, die Fäuste sitzen lockerer. Betrunkenen vor der Bar reicht ein schiefer Blick, um loszuprügeln, Liebespärchen werden zu Hasspärchen, sobald ein falsches Wort fällt, Achtzigjährige, seit sechzig Jahren verheiratet, werfen Tassen, weil er eine andere Wiederholung sehen will als sie.
Kinder reißen von zu Hause aus.
Es passiert einfach. Eine lange Hitzeperiode zermürbt selbst die wachsamsten Eltern, und Kinder sind eben Kinder. Es reicht eine kleine Ablenkung im Supermarkt, und weg sind sie. Man bleibt nur kurz stehen, will einem Freund hallo sagen, schon sind sie um die nächste Ecke.
Dass Kinder ausreißen, ist ganz normal.
So etwa drückte sich auch Cheryl Hansen aus, während ich auf sie zusteuerte.
»Ich war nur kurz im Haus«, erklärte sie dem Cop, »und als ich wieder rauskam, war sie weg.«
»Verstehe«, sagte Cerny.
Cerny, ein bulliger Böhme (ausgesprochen »Tschörny«), stammte von einer Farm zwanzig Meilen nördlich der Stadt, ich kannte ihn ganz gut. Seine Riesenpranken waren wie geschaffen für den Traktor, doch Cerny hatte sich frühzeitig entschieden, lieber durch die Straßen als über die Felder zu fahren. Ein altgedienter Officer, der nicht alles falsch machte, was man falsch machen konnte.
Wird ein Kind vermisst gemeldet, kommt es auf den »Ersthelfer« an. Obwohl das Schlimmstmögliche, die Entführung durch einen Fremden, nur in einem von zehntausend Fällen eintritt, muss man von dieser Möglichkeit so lange ausgehen, bis sie ausgeschlossen werden kann. So herum ist es nicht schlimm, wenn sich die Vermutung als falsch erweist. Andersherum setzt man das Leben des Kindes aufs Spiel.
Anzunehmen war also, dass Cerny schon auf der Anfahrt die Videokamera eingeschaltet hatte, um alles festzuhalten, was später von Nutzen sein konnte. Außerdem hatte er einen Umkreis festgelegt, der auf der schnellen Schätzung beruhte, wie weit ein fünfjähriges Mädchen in der vorgegebenen Zeit laufen konnte, und andere Streifenwagen angewiesen, sich von außen nach innen vorzuarbeiten – denn sie sollten das Kind nicht jagen, sie sollten es aufhalten.
Haileys Personenbeschreibung hatte er schon durchgegeben – den Funkspruch, den ich gehört hatte. Gleich beim Zusammentreffen mit der Mutter dürfte er sie um ein aktuelles Foto gebeten haben. Einer der wenigen Vorzüge der Smartphone-Ära, die ich ansonsten verabscheue, besteht darin, dass die Leute immer Fotos ihrer Kinder parat haben. Es reichten also ein paar Knopfdrücke, und Haileys Foto erschien auf den Monitoren aller Streifenwagen der Stadt.
Auch den Hubschrauber hatte Cerny bestellt, denn der Bell 407 schwebte schon über uns, das hackende Geräusch der Rotoren erzeugte eine Kriegsatmosphäre, die mir nur zu vertraut war. Kriegsszenen mag ich überhaupt nicht, aber sie sind mir immer noch lieber als die Szenen, die entstehen, wenn ein Kind spurlos verschwindet.
Ich trat an Cheryl Hansen heran und stellte mich vor.
Sie sah aus wie Anfang zwanzig. Eine Frau vom Typ Highschool-Schwarm, doch ihre Highschool-Zeit schien lange vorbei. Man sah es an den Ringen unter ihren grünen Augen und dem bitteren Zug um die Mundwinkel. Jede Enttäuschung hinterlässt ihre Spuren, und Cheryl sah aus, als hätte sie mehr als reichlich davon erlebt. Sie war etwa einen Meter zweiundsiebzig groß und trug an die fünfzehn Pfund überflüssiges Gewicht mit sich herum. Ihr Blick war klar – keine Anzeichen von Dope oder dem Wodka, der einem über den Tag hilft.
Jetzt sah sie völlig verängstigt aus.
»Detective Sergeant Decker«, stellte ich mich vor.
Sie hörte »Detective« und rief: »O Gott!«
»Nur eine Vorsichtsmaßnahme«, sagte ich. »Meine Leute nennen mich Deck. Darf ich Cheryl zu Ihnen sagen?«
Ich reichte ihr die Hand, sie nahm sie, und ich warf einen Blick auf ihren Unterarm. Keine Verletzungsspuren an den Knöcheln. Keine Schwellungen, keine Bissmarken. Klinge ich wie ein Zyniker? Das bringt der Beruf so mit sich. Aber Kinder, besonders Mädchen, beißen, wenn sie sich wehren.
Auch wichtig: Sie trug keinen Ehering.
»Haben Sie ein Foto von Hailey dabei?«, fragte ich.
Sie hielt ihr Handy hoch, da sah ich Hailey Hansen zum ersten Mal.
Wirklich ein süßer Fratz.
Ihr Gesicht hatte die Farbe von Karamell, das schwarze Haar war zu festen Zöpfen geflochten.
Aber ihre Augen waren es, die einen packten.
Grün und katzenartig wie die der Mutter – und mit einem Ausdruck, der für ein Kind ungewöhnlich war. Sie schaute selbstbewusst in die Kamera und schien zu sagen: Das bin ich. Ob ihr wollt oder nicht.
Ich mochte sie auf Anhieb.
»Cheryl«, sagte ich. »Kann es sein, dass Hailey bei ihrem Vater ist?«
Die allermeisten Kindesentführungen gehen auf das Konto von »nicht sorgeberechtigten Elternteilen«. Ich hoffte, dass es auch hier so war. Solche Fälle hatte ich öfter, und gewöhnlich ist das Kind nach ein paar Stunden wieder da.
»Tyson hat sich aus dem Staub gemacht«, sagte Cheryl. »Fünf Sekunden nachdem er hörte, dass ich schwanger war. Auf Nimmerwiedersehen.«
Ich notierte seinen vollen Namen – Tyson Michael Garnett. »Haben Sie ihn auf Unterhalt verklagt?«
»Wozu?«
Mit dieser Antwort provozierte sie eine weitere Frage. »Cheryl, sind Sie sicher, dass er der Vater ist?«
Das war nicht besonders nett, aber ich musste ausschließen, dass irgendwo ein Tatverdächtiger herumlief, von dem wir nichts wussten. Irgendein Typ, der meinte, man hätte ihm sein eigen Fleisch und Blut genommen, und nun zur Tat geschritten war.
Mit dem bösen Blick, den ich verdient hatte, erwiderte sie: »Ich habe nur mit einem Schwarzen geschlafen, wenn Sie das meinen.«
Genau das meinte ich, und ich fühlte mich beschissen deswegen.
»Haben Sie im Auto nachgesehen?«, fragte ich.
»Nein«, sagte sie. »Das schließe ich immer ab, und Hailey würde nie die Schlüssel nehmen.«
Sie sagte es geradeheraus, ohne zu zögern oder sich über meine Frage zu wundern.
»Können wir mal nachsehen, für alle Fälle?«, fragte ich.
Es war durchaus möglich – Kinder sind fasziniert von den Autos ihrer Eltern. Ich habe Achtjährige erlebt, die sind eingestiegen, haben den Motor gestartet und die Familienkutsche auf die Straße rausgerollt. Und okay, ich hatte einen Hintergedanken. Ich wollte sehen, ob es Blutspuren in dem Auto gab und ob der Motor noch warm war.
Cheryl rannte ins Haus, kam Sekunden später zurück und hielt die Schlüssel in die Höhe.
»Haben Sie Ersatzschlüssel?«, fragte ich auf dem Weg zum Auto.
»Nein, nur diese.«
»Wann haben Sie das Auto zuletzt benutzt?«, fragte ich. »Vielleicht haben Sie es nicht abgeschlossen?«
»Gestern Abend«, sagte sie. »Ich habe es garantiert abgeschlossen.«
Der 2007er Camry parkte einen halben Block weiter auf der anderen Straßenseite. Er war abgeschlossen, und sie schaute durchs Fenster hinein, während sie aufschloss. Ich stützte die Hand auf die Motorhaube – sie war heiß von der Sonne, aber nicht vom Motor.
Dann öffnete ich die Beifahrertür.
Hailey war nicht zu sehen, und ich fand nichts Auffälliges – kein Blut, keine Anzeichen einer frischen Reinigung, keinen Putzmittelgeruch. Das Auto sah ordentlich und gepflegt aus, aber es war nicht gründlich gesäubert worden.
»Ich muss nur kurz mit Sergeant Cerny sprechen«, sagte ich. »Bin gleich wieder bei Ihnen.«
Sie nickte irritiert, was man verstehen konnte. Und ihr Kopf war ständig in Bewegung – sie hielt Ausschau nach ihrem verschwundenen Kind.
Ich nahm Cerny ein paar Schritt beiseite und holte mir die nötigen Informationen: Cheryl Hansen war auf die Toilette gegangen und hatte Hailey auf dem Rasen vor dem Haus zurückgelassen, wo sie mit ihrem Plastikpferd gespielt hatte. Als sie zurückkam, war Hailey verschwunden. Sie schaute im Haus nach, für den Fall, dass ihre Tochter hineingegangen war, dann lief sie die Straße hinab und rief ihren Namen. Um diese Zeit hielten sich auch andere Mütter draußen auf, aber Hailey war nicht zu Nachbarkindern spielen gegangen.
Jetzt bekam es Cheryl mit der Angst zu tun. Sie rannte auf die andere Straßenseite – obwohl Hailey genau wusste, dass sie nicht allein hinüberdurfte –, bis zu dem kleinen Park, der zwei Ecken weiter begann. Hailey ging gern in den Park. Mir fiel ein, dass es dort eine Schaukel und eine Rutsche gab.
Als sie Hailey auch auf dem Spielplatz nicht fand, wählte Cheryl die 911. Klein nahm den Notruf entgegen und war drei Minuten später bei ihr. Cheryl sagte aus, sie habe zwanzig Minuten nach Hailey gesucht und dann die Polizei gerufen.
Eine halbe Stunde war also schon vergangen, als wir den Fall übernahmen.
Es ist ein verständlicher Fehler, den viele Eltern in solchen Situationen begehen. Ob aus Verlegenheit oder Scham oder in der Erwartung, das Kind werde sich schon einfinden – oder weil sie niemandem zur Last fallen wollen: Meist zögern sie zu lange, bevor sie die Polizei anrufen.
Ich wollte, sie reagierten schneller.
Viel lieber mache ich mir unnötige Sorgen.
Weil ich die brutalen Fakten kenne. Fast fünfzig Prozent der Kinder, die von Entführern getötet werden, sterben in der ersten Stunde nach ihrem Verschwinden.
Die Zeit arbeitete nicht für uns.
Erst recht nicht für Hailey.
Als Erstes musste ich eine Befragung starten.
Die Befragung ist entscheidend – meist finden sich Leute, die wir als »ahnungslose Zeugen« bezeichnen. Die etwas gesehen haben, aber nicht wissen, dass es für den Fall von Bedeutung ist. Wir mussten losgehen und mit den Nachbarn reden.
»Wir machen eine Anwohnerbefragung«, sagte ich zu Cerny. »Erst die vier angrenzenden Straßen. Dann weiten wir aus.«
Die meisten Kindesentführer wohnen in der Nähe ihrer Opfer. Hailey konnte in einem dieser Häuser versteckt sein – im Keller, auf dem Dachboden, in einem Hinterzimmer.
»Keine Ausnahmen«, sagte ich. »Selbst wenn der Dalai Lama öffnet – ihr müsst ins Haus. Und keine Albernheiten. Wenn deine Leute Dope finden, stellen sie sich blind. Sie haben nur Augen für Hailey, verstanden?«
Ich wollte nicht, dass ehrgeizige Nachwuchs-Cops ihre Zeit mit dem Aufstöbern von Marihuana vergeudeten oder die Gelegenheit benutzten, die Zahl ihrer Festnahmen zu erhöhen.
»Es kriegen alle Bescheid«, sagte Cerny.
Darauf konnte ich mich bei ihm verlassen.
»Sie sollen sich an die Standardfragen halten und auf die rechtskräftige Einwilligung zur Durchsuchung achten«, ermahnte ich ihn. »Aber wenn einer protestiert und einen Durchsuchungsbefehl verlangt, hören deine Jungs ein Kind im Haus schreien, und sie gehen rein. Ich mache das dann mit dem Richter klar.«
Die meisten Richter in Lincoln kannte ich. Die waren ziemlich vernünftig, außerdem drückten sie das eine oder andere Auge zu, wenn es um Kinder ging. Trotzdem: Tauchte Hailey wieder auf, musste ich mich auf bergeweise Beschwerden über das rabiate Vorgehen der Polizei gefasst machen.
Eigentlich war es das, was ich erwartete – dass Hailey wieder auftauchte und die Nachbarn sauer auf uns waren. Mit diesem Resultat konnte ich leben.
Es macht mir nichts aus, dumm dazustehen.
Darin habe ich Übung.
Und ganz bestimmt wollte ich nicht zur Beerdigung eines Kindes gehen und mir sagen: Wenigstens stehe ich nicht dumm da.
»Schick eine Streife zum Güterbahnhof«, sagte ich, »die sollen dort die Penner fragen, ob sie was gesehen haben. Und Grüße von mir ausrichten.«
Als Cop war ich in der Gegend Streife gefahren und kannte viele von den Jungs. Ich hatte sie anständig behandelt, sie nicht schikaniert oder nur aus Langeweile aufgescheucht. Ein paar von denen habe ich zur Entgiftung gefahren, auch wenn das Auto tagelang nach ihnen stank.
»Und eine Hundestaffel brauchen wir«, sagte ich zu Cerny.
»Ist schon bestellt.«
»Dann beordere alle Einheiten zum Parkplatz der Prescott School.«
Was die Mutter eines vermissten Kindes zuallerletzt braucht, ist ein Zirkus vor dem Haus. Polizeistaffeln, Dienstfahrzeuge, Gaffer, vielleicht auch noch die Presse, wenn sich die Sache nicht schnell genug aufklärt. Besser, man verlegt das Ganze ein paar Straßen weiter und erspart der Mutter diese Belästigung.
»Wir müssen eine Adresse ermitteln«, sagte ich zu Cerny. »Tyson Michael Garnett. Männlich, schwarz, Ende zwanzig.«
»Der Vater?«
»Ja«, sagte ich. Dann: »Ich habe kein Spielzeugpferd vor dem Haus gesehen.«
Cerny schüttelte den Kopf.
Magic galoppiert über die Wiese.
Schnell wie der Blitz, leichter als der Wind.
Das kleine Mädchen klammert sich an die Mähne und flüstert: »Schneller, Magic, schneller!«
Nur Magic kann sie hören, sonst keiner.
Nur Magic.
Sie beide sprechen eine Sprache, die kein anderer versteht. Vor Magic hat sie kein Geheimnis und Magic nicht vor ihr.
Er ist der Hüter ihrer Geheimnisse.
Jetzt flüstert sie ihm eins zu.
Sie wird ihren Daddy besuchen. Sie weiß, dass Mom schimpfen wird.
Magic versteht sie.
»Bring mich zu meinem Daddy, Magic! Schneller! Schneller!«
Sie hält sich an der Mähne fest, aber ihr fallen die Augen zu.
Dann schläft sie ein.
Die Stunde war vorbei.
Ich musste meine Rechnung ändern.
Wenn fast die Hälfte aller entführten und ermordeten Kinder innerhalb der ersten Stunde ermordet werden, heißt das, dass mehr als die Hälfte diese erste Stunde überleben.
So sprachen die Zahlen noch für uns.
Und ich hoffte immer noch, dass Tyson Garnett sein Kind weggeholt hatte – in einem späten Anfall von Vaterliebe.
Meine neue Rechnung: Drei Viertel der ermordeten Entführungsopfer werden innerhalb der ersten drei Stunden ermordet. Wenn du das Mädchen nicht in den ersten drei Stunden findest, geht die Chance gegen null.
Drei Stunden.
Hundertachtzig Minuten.
Hundertzwanzig davon hatten wir noch.
Siebentausendzweihundert Sekunden, und sie tickten nur so weg. Die Durchsuchung des Parks und der Hubschraubereinsatz hatten nichts gebracht, die Anwohnerbefragung war bis jetzt ohne Ergebnis.
Am liebsten wollte ich los, auf eigene Faust nach Hailey suchen. Das hatte ich bei den Marines gemacht – Menschenjagd, aus völlig entgegengesetzten Gründen.
Ich war ziemlich gut darin gewesen. Aber jetzt ging das nicht. Eine Menge gut ausgebildeter Leute fahndete nach ihr, und mein Job verlangte von mir, vor Ort zu bleiben.
Es war noch ein Haus zu durchsuchen.
Das von Cheryl.
Es kommt vor.
Zu oft.
Jeden Tag werden in den USA fünf Kinder getötet. Das sind fünf Mal so viel wie in den fünfundzwanzig nächstgrößeren Industrienationen zusammengenommen, und ich frage mich, was das über unser Land sagt.
Selbst die ärmsten Völker schützen ihre Kinder.
Viele dieser Todesopfer gehen auf das Konto von Jugendbanden, aber bei weitem nicht alle.
Und was die jüngsten Opfer betrifft – Kinder unter sieben Jahren –, so kommen drei Viertel von ihnen durch Familienangehörige zu Tode.
Es passiert, und man muss damit rechnen.
Im Sommer eher als zu jeder anderen Jahreszeit. Das Kind ist den ganzen Tag zu Hause, es stört, es nervt. Es nörgelt und quengelt ohne Unterlass, und eine Single-Mom ist sowieso immer im Stress. Sie packt ihre Kleine und schüttelt sie. Vielleicht schlägt sie auch zu, das Kind fällt rückwärts und knallt mit dem Kopf auf einen harten Gegenstand.
Die Mutter in Panik. Sie rennt zu den Nachbarn und erzählt, ihr Kind sei verschwunden. Und du findest es hinter der Kellertreppe, unter dem Bett, manchmal in der Badewanne, weil die Mutter glaubt, ein Bad könne den Tod ungeschehen machen.
Die meisten Mütter sind keine Profis.
Sie wissen nicht, wie sie ihre Tat vor der Welt verbergen können.
»Cheryl«, sagte ich. »Ich muss Ihr Haus durchsuchen und brauche Ihre Einwilligung.«
»Hailey ist aber nicht im Haus!« Sie klang trotzig, gereizt. Der Mann, von dem sie verzweifelt Hilfe erwartete, wollte ihr Kind dort suchen, wo es ganz bestimmt nicht war.
Aber es musste sein.
Dass sie Hailey etwas angetan hatte, glaubte ich nicht. Sie blickte ständig umher, weil sie immer noch hoffte, Hailey würde plötzlich auftauchen. Es wäre zu schön gewesen, aber ich fragte: »Cheryl, habe ich Ihre Einwilligung?«
Sie nickte.
Der kleine Bungalow sah aus wie die meisten Häuser hier. Das Viertel lag südlich des Stadtzentrums, unweit der Polizeizentrale, und hatte schon bessere Tage gesehen.
Nicht dass man von einem Slum reden konnte – so etwas gab es in Lincoln nicht –, aber hier wohnte unterer Mittelstand in Einzel- oder neueren Mehrfamilienhäusern, die meisten zur Miete, doch es gab auch ältere Leute, die hier seit Jahrzehnten im eigenen Haus lebten. Die baumbestandenen Straßen wirkten gepflegt, die Fassaden waren gestrichen, die kleinen Rasenflächen gemäht. Und es wurde gerade schick hierherzuziehen. Junge Leute mit guten Jobs kauften sich billig ein, sanierten die Häuser, trieben die Immobilienpreise und die Mieten in die Höhe. Frauen wie Cheryl würden sich ihr Haus bald nicht mehr leisten können.
Ich folgte ihr hinein.
Cheryl besaß nicht viel, aber das, was sie hatte, behandelte sie gut.
Das wusste ich zu schätzen.
Ich war in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, in einem kleinen Haus und einer netten Gegend. Mein Dad arbeitete fast sein ganzes Leben im E-Werk, meine Mom als Grundschullehrerin. Meine zwei Schwestern und ich hatten alles, was wir brauchten, und einiges von dem, was wir wollten, aber was immer es war – wir hatten gelernt, es sorgsam zu behandeln und uns keine Gedanken um das zu machen, was wir nicht hatten.
Ich glaube, ich war zehn, als ich meinen Dad fragte, ob wir reich waren oder arm. Er drehte den Hahn in der Küche auf, und als das Wasser strömte, sagte er: »Reich.«
Der Grundriss von Cheryls Haus entsprach dem von Tausenden anderen Häusern der Stadt – und dem der meisten Häuser des mittleren Westens. Vorn das Wohnzimmer, das man über die schmale Veranda betrat, hinten die Küche, zwei Schlafzimmer und das Bad.
Ich ging durch das Wohnzimmer in die Küche und sah nichts Auffälliges. Der Fußboden sauber, aber nicht frisch gewischt. Es roch nicht nach Putz- oder Desinfektionsmitteln. Von der Küche führte eine Tür in den Keller.
»Ich schaue mal kurz hinunter«, sagte ich.
Cheryl sah mich an, als wäre ich verrückt.
»Manchmal spielen Kinder Verstecken«, erklärte ich ihr. »Dann merken sie, dass es deswegen Ärger gibt, und sie verstecken sich erst recht.«
Es war nur die halbe Wahrheit, und ich merkte ihr an, dass sie meinen Beschwichtigungsversuch durchschaute.
Sie führte mich in den Keller.
Er hatte einen Lehmboden wie viele dieser alten Häuser. Auch den Modergeruch. Kühl und ein bisschen feucht. Cheryl knipste die nackte Glühbirne an. »Hailey? Wenn du dich versteckst, Liebling, komm raus. Mommy ist dir nicht böse.«
Ihre Stimme zitterte.
Hier gab es wirklich kein Versteck. Ein paar alte Kartons stapelten sich in der Ecke, aber Hailey lag nicht darunter. Der alte Kohlenkasten war in die Wand eingelassen, aber Hailey steckte nicht drin.
»Andere Kontaktpersonen?«, fragte ich.
»Zum Beispiel?«
»Was weiß ich? Haben Sie einen Freund?«
Sexueller Missbrauch, Körperverletzung – oft sind es Stiefväter oder Freunde. Männer, die nicht mit dem Kind verwandt sind. Wenn es ihn gab, fuhr der Kerl wahrscheinlich gerade aufs Land und suchte eine einsame Gegend, um die Leiche zu entsorgen.
Wir waren in Nebraska. Verlässt man dort die Stadt, ist es praktisch überall einsam.
Und das gefällt mir an Nebraska.
Mein Dad hatte mir Jagen und Fischen beigebracht, und ich fuhr angeln, wann immer ich konnte. Schon länger war ich auf der Suche nach einer kleinen Jagdhütte irgendwo am Platte River. Dad hatte mir nach seinem Tod ein bisschen Geld hinterlassen – nicht viel, aber ich legte es auf die hohe Kante.
»Ich arbeite Vollzeit und habe eine fünfjährige Tochter«, antwortete Cheryl. »Für einen Freund bleibt da keine Zeit.«
Das war glaubwürdig, aber nachprüfen musste ich es trotzdem. Mir waren berufstätige Singlemütter begegnet, die sehr wohl Zeit für ihre aktuellen Lebenspartner fanden. Besonders in meinen Jahren als Streifenpolizist. Sie schlossen die Kinder ins Auto ein, wenn sie in die Bar gingen, oder gaben sie beim Nachbarn ab oder ließen sie einfach zu Hause sitzen, mit der Handynummer auf einem Zettel und dem Versprechen: »Mommy kommt gleich wieder.« Manchmal musste der Freund auf die Kinder aufpassen, während sie losgingen, um einen anderen zu treffen.
Es galt also zu prüfen, ob Cheryls Adresse polizeibekannt war, ob es Anzeigen gegeben hatte wegen häuslicher Gewalt. Ob das Jugendamt ihren Namen kannte. Das ist das Problem mit der Polizeiarbeit – du kommst an den Punkt, wo du keinem mehr traust, wo du alles hinterfragst. Laura, meine Frau, nannte das meine Berufskrankheit.
»Aber Sie waren heute nicht arbeiten«, sagte ich zu Cheryl.
»Ich hatte Spätschicht«, sagte sie. »Im Village Inn.«
»Wer passt auf Hailey auf, wenn Sie arbeiten?«
»Meine Mutter.«
»Wohnt sie in der Nähe?«
»Nein, oben in Havelock. Ich bringe Hailey hin, wenn ich zur Arbeit fahre, und hole sie danach ab. Meistens schläft sie dann schon.«
Ich sah es vor mir. Eine erschöpfte Mutter, die ihr verschlafenes Kind schultert und ins Auto trägt.
»Übernachtet sie auch manchmal bei der Grandma?«, fragte ich.
»Manchmal. Nicht sehr oft.«
Cheryl hatte ihre Mutter schon angerufen. Die war außer sich. Wollte sofort kommen, aber Cheryl bat sie, zu Hause zu bleiben, für den Fall, dass Hailey irgendwie bei ihr auftauchte oder anrief.
Ich ließ mir Haileys Zimmer zeigen.
Das typische Mädchenzimmer.
Hellrosa Wände, passende Tagesdecke, die Kissen mit Blumen bedruckt.
Pferdebilder an der Wand.
Ein kleiner Schreibtisch mit gerahmten Fotos. Hailey und ihre Mom, Hailey und ihre Grandma. Und eins mit ihrem Spielzeugpferd – ein Pinto, der den rechten Vorderfuß hob.
»Meine Mutter hat es ihr gekauft«, sagte Cheryl. »Sie liebt das Pferd.«
»War es das Pferd, mit dem sie draußen gespielt hat?«, fragte ich.
Cheryl nickte.
»Hat es einen Namen?«
»Magic«, sagte Cheryl. »Weil Hailey sagt, es ist ein Zauberpferd.«
Ich registrierte, dass sie im Präsens sprach – »Hailey sagt«.
Das Kinderzimmer wirkte gepflegt wie das übrige Haus.
Ich öffnete den kleinen Schrank in der vagen Hoffnung, dass Hailey drinsaß, aber fand nur einen Wäschekorb und ihre Sachen auf Kleiderbügeln.
»Ich brauche etwas, was Hailey vor kurzem getragen hat«, sagte ich. »Was nicht gewaschen ist.«
»Wozu?«
Den Spürhund verschwieg ich ihr. Sie behielt mit Mühe die Nerven – die Durchsuchung und meine Fragen hatten sie ein wenig abgelenkt, aber sie war hart am Rand des Zusammenbruchs.
Wer wäre das nicht? Laura und ich hatten keine Kinder, daher konnte ich kaum behaupten, ich wisse, wie ihr zumute sei. Daher sagte ich: »Das gehört zur Routine.«
Sie klappte den Wäschekorb auf, holte ein himmelblaues Kinder-T-Shirt heraus und gab es mir.
Wir gingen über den Flur ins Bad.
Eine Kinderzahnbürste im Keramikgestell, eine Haarbürste auf der Ablage über dem Waschbecken. An den Borsten sah ich schwarze Haare.
»Ich muss diesen Raum versiegeln lassen«, sagte ich.
Cheryl kam mir mit der Antwort zuvor.
»DNA«, sagte sie mit dünner, versagender Stimme.
Spuren ihrer Tochter mussten gesichert werden.
Um den Entführer – wenn es ihn gab – dingfest zu machen.
Das war der Punkt, an dem Cheryl die Nerven verlor.
Tiefe Schluchzer, die ihren ganzen Körper schüttelten. Und ich nahm sie in den Arm, obwohl das nicht in der Dienstordnung steht.
Aber was soll man machen?
Ich war erleichtert, als ich über ihre Schulter blickte und Willie Shaw kommen sah.
Der Erfinder des Spruchs »Black is beautiful« hatte bestimmt nicht an Willie Shaw gedacht.
Aber sie wäre das ideale Vorbild gewesen.
Willie – Wilhelmina vermutlich – war groß, schlank und bildschön. Jeder Zoll eine Königin. Es war die beste Strategie für eine afroamerikanische Polizistin, sich gegen die gewaltige Übermacht männlicher weißer Kollegen zu behaupten. Niemand wagte es, ihr dumm zu kommen, zumindest kein zweites Mal, und die meisten Kollegen mochten sie.
Ich mochte sie sehr.
Für einen Cop ist es leicht, hart zu sein, und es ist leicht, einfühlsam zu sein. Aber es ist schwer, beides zu vereinen.
Willie konnte das.
Wir hatten viele Fälle gemeinsam bearbeitet. Sie war großartig mit Zeugen, unnachgiebig beim Verhör und der reinste Killer im Zeugenstand. Ich war dabei, als ihr der Verteidiger in einem Vergewaltigungsprozess eine besonders widerwärtige Frage stellte, worauf sie ihn mit ihrem Blick durchbohrte und dann sagte: »Ich glaube, es hackt!«
Ein Blick in ihre Augen sagte mir jetzt, dass Hailey noch nicht gefunden war.
»Ms. Hansen?«, fragte sie.
Cheryl drehte sich zu ihr um.
»Ich bin Sergeant Shaw, zuständig für Opfer- und Zeugenschutz, und werde für Sie tun, was ich kann.«
Sie verschwieg Cheryl, in welcher Abteilung sie arbeitete: Straftaten und Gewaltverbrechen gegen Kinder.
»Danke«, sagte Cheryl.
Willie Shaw nahm sie in den Arm. »Gehen wir in die Küche und reden ein bisschen, ja?«
Ich wusste, dass Willie alles erfahren würde – Cheryls Lebenslauf, ihr Verhältnis zu Hailey, zu Garnett, zur Mutter, zu Freunden, Nachbarn, Kollegen. Und Willie war unentbehrlich für die Befragung der Nachbarkinder, die auch noch bevorstand. Sie konnten etwas gehört, gesehen haben. Sie konnten etwas wissen, was sie sich nicht zu sagen trauten. Und wenn sie es überhaupt jemandem sagten, dann Willie.
Daher ließ ich die beiden allein, ging zurück auf die Straße und sah auf die Uhr – was ich im Beisein der Betroffenen nie tun würde.
Eine Stunde, dreiundzwanzig Minuten waren vergangen.
Chris Timmons von der Hundestaffel traf ein.
Mit der schwarzen Schäferhündin Nikki. Schweißhunde sind besser für die Spurensuche, aber die Polizei hat ihre Prioritäten. Bei einem potenziell gefährlichen Täter wird ein Hund gebraucht, der groß und stark genug ist, den Mann niederzuwerfen oder zumindest einzuschüchtern.
Nikki war keine gewöhnliche Hündin. Ein tierischer Bewerber hat es bedeutend schwerer, bei der Polizei angestellt zu werden, als ein menschlicher – nur einer von fünfhundert speziell trainierten Hunden schafft die Hürde, und so ein Tier ist beileibe nicht billig. Beim Bier hatte mir Timmons mal verraten, dass Nikki siebentausend Dollar gekostet hatte.
Ich begrüßte Nikki und übergab Timmons das T-Shirt. Er hielt es ihr unter die Nase und ließ sie gründlich schnüffeln. Dann gab er ihr einen deutschen Befehl. Hundeführer trainieren ihre Tiere gewöhnlich in einer anderen Sprache, damit Täter sie nicht mit englischen Befehlen verwirren können.
Nicht, dass Nikki aussah, als ließe sie sich von irgendetwas verwirren. Jedenfalls sah sie bedeutend schlauer aus als ich. Und ich war mir sicher, dass sie beide Sprachen verstand.
Wenn Hailey weggelaufen war, in den Park oder nur die Straße hinunter – Nikki würde sie aufspüren.
Ich setzte mich ins Auto und schaltete mein Notebook ein.
Wir waren eine kleine, aber moderne Truppe. Bei nur einem Beamten auf etwa tausend Einwohner mussten wir jeden Fortschritt nutzen, und der Chef zählte sich zu den großen Verfechtern der neuesten Technologie. Mein Notebook war daher mit einem Programm ausgerüstet, das die Computerfreaks der Universität für uns entworfen hatten.
Ich loggte mich ein und lud das GPS-Kartenraster der Stadt. Dann klickte ich den Suchbefehl für alle registrierten Sexualstraftäter im Umfeld des Tatorts an.
Sekunden später zeigten mir rote Stecknadeln an, dass zwei Täter in der Nähe wohnten. Mit einem Tastendruck holte ich mir die kompletten Angaben – Personenbeschreibung, Straftaten, Haftzeiten, Bewährungsstatus, Name des Bewährungshelfers.
Einer hieß John Backstrom, er war achtzehn, hatte mit seiner siebzehnjährigen Freundin geschlafen und war wegen Unzucht mit Minderjährigen verurteilt – drei Jahre auf Bewährung. Damit hatte er sich das ganze Leben versaut – er würde nur schwer einen Job kriegen, das Militär würde ihn nicht nehmen, selbst eine Ausbildung würde schwierig. Ich behielt ihn auf der Liste, aber nur pro forma.
Der andere war ein Vierundsechzigjähriger, verurteilt wegen »unzüchtiger Handlungen« und »Entblößung«. Jeffrey Devers und seine Neigung, den Passanten im Cooper Park sein bestes Teil zu zeigen, kannte ich schon. Nach seinem letzten Vergehen (»Mein Reißverschluss hat geklemmt«) hatte ihn ein genervter Richter zu sechs Monaten Bezirksgefängnis verdonnert, aber jetzt war er wieder draußen. Auch er kam kaum für so etwas in Frage, trotzdem schickte ich die Daten an Cerny mit dem Vermerk: »Bitte überprüfen.«
Backstrom tat mir leid, aber es ging um ein verschwundenes Kind, da durfte nichts dem Zufall überlassen bleiben.
Dann tippte ich Cheryls Namen ein.
Sie hatte eine Akte.
Trunkenheit am Steuer.
Ungebührliches Benehmen.
Das Jugendamt hatte sie dreimal in ihrer früheren Wohnung aufgesucht.
Ich notierte mir die Namen der zuständigen Kollegen und beantragte Akteneinsicht. Wenn die Akten gesperrt waren, brauchte ich eine Richtervollmacht.
Dann ging ich zurück ins Haus.
Willie saß auf der Couch, den Arm um Cheryls Schulter.
Cheryl schaute mich erwartungsvoll an.
»Noch nichts«, sagte ich. »Können wir Sie ein paar Minuten allein lassen? Ich möchte mit Sergeant Shaw sprechen.«
»Kein Problem.«
Willie folgte mir auf die Veranda.
»Sie hat eine Akte«, sagte ich und zählte ihr die Sachen auf.
»Das hat sie mir erzählt.«
Natürlich hatte sie das. Willie erzählten die Leute alles.
»Auch, dass das Jugendamt dreimal da war?«
»Auch das.«
»Ist sie Alkoholikerin?«, fragte ich.
Denn wenn sie am Nachmittag getrunken hatte, vielleicht weggetreten war, konnten alle Zeitangaben falsch sein. Hailey konnte Stunden vorher verschwunden sein, und Cheryl hatte es erst gemerkt, als sie wieder zu sich kam.
»Sie ist trockene Alkoholikerin«, sagte Willie spitz. »Sie geht zur Therapie und hat seit fast drei Jahren keinen Tropfen getrunken.«
»Bist du jetzt ihre Anwältin, Willie?«, fragte ich.
»Du hast mich gefragt.«
»Du glaubst ihr?«
»Ich denke, schon«, sagte Willie. »Willst du ihr auf den Zahn fühlen?«
Ich überlegte kurz. »Nein. Noch nicht jedenfalls.«
Es war sinnlos, eine Frau unter Druck zu setzen, die sowieso schon unter Druck stand. Eine Frau mit einem vermissten Kind. Das Schlimmste, was ihr passieren konnte, noch zu verschlimmern.
»Was hast du sonst?«, fragte ich.
Cheryl hatte Tyson nach Abschluss der Highschool kennengelernt. Er war hübsch und unwiderstehlich, und sie wurde schwanger. Cheryl wollte keine Abtreibung. Sie hatte romantische Vorstellungen. Sie war sicher, sie würde es allein schaffen, außerdem gab es ja noch ihre Mutter.
Natürlich merkte sie bald, dass das Leben einer Single-Mom nicht so war, wie es im Fernsehen dargestellt wurde, und fühlte sich überfordert.
»Ich hole mir die Akte vom Jugendamt«, sagte Willie. Dann, nach kurzem Nachdenken: »Ich traue es ihr nicht zu, Deck.«
»Ich auch nicht. Ich tippe immer noch auf den Vater. Irgendwelche Fortschritte in dieser Richtung?«
»Noch nicht«, sagte sie. »Ich gehe lieber wieder rein.«
Eine Minute später kam Timmons mit Nikki zurück, die hechelnd und erschöpft die Zunge hängen ließ.
Sie hatten keine Spur gefunden.
»Haileys Witterung endet an der Grundstücksgrenze«, sagte Timmons.
»Kannst du Nikki ein bisschen ausruhen lassen und dann zum Güterbahnhof bringen?«, fragte ich.
Timmons sah aus, als brauchte er selbst Ruhe. Sein Hemd war durchgeschwitzt, sein Gesicht rot gefleckt und schweißnass.
»Sie kriegt ein bisschen Wasser«, sagte er. »Dann ist sie wieder fit.«
»Danke.«
»Kein Problem.«
Ich sah auf die Uhr.
Noch eine Stunde zwanzig Minuten, sagten mir die Goldziffern.
Es war wie das Warten auf Regen.
Dann sah ich den ersten Ü-Wagen anrollen.
Ich stieg aus und ging zu Kelly Martinson rüber.
Das Wort, das am besten auf sie zutraf, war »keck«. Eine von den helläugigen, langhaarigen Reporterinnen, die von den Lokalsendern bevorzugt werden, um die Einschaltquoten hochzujagen – der Theorie folgend, dass Männer, die sich nicht für Nachrichten interessieren, scharf auf schöne Frauen sind.
Ich fand sie gar nicht mal schlecht, aber Laura konnte sie nicht leiden.
Laura steht nicht auf »keck«.
Was ich an Kelly Martinson mochte, war ihre unverblümte Art. »Sie kommen wegen der Titten, und sie bleiben wegen dem Grips«, hatte sie einmal über ihre Bildschirmpräsenz gesagt, natürlich nicht vor laufender Kamera.
Jetzt sah sie mich kommen.
»Deck, haben Sie ein Statement für mich?«
Sie hatte immerhin so viel Grips, mir das Mikro nicht ungefragt unter die Nase zu halten. Normalerweise hätte ich sie an den Pressesprecher verwiesen, aber jetzt brauchte ich sie für einen strategischen Coup.
Cops zerfallen in zwei Gruppen, was die Medien betrifft.
Die meisten verfahren nach der Devise »Klappe dicht« und halten so viel wie möglich von den Reportern fern, damit sie einem nicht in die Ermittlungen pfuschen.
Meine Philosophie ist eine andere. Sie besagt, dass Presseleute Hunde sind. Entweder du fütterst sie, oder sie fressen dich. Meinen Kollegen versuchte ich klarzumachen, dass die Zeiten der Abschottung vorbei waren – seit der Erfindung von Smartphone, Twitter und all dem verrückten Zeug.
Heute ist jeder Reporter.
Die Medien, das sind wir.
Aber eine »symbiotische Beziehung« zur Presse, warum nicht?
Das ist, glaube ich, der nette Ausdruck für die Devise »Eine Hand wäscht die andere«.
Bei der Presse herrschte schon Alarmstimmung – sie wussten, dass ein Kind vermisst wurde, Cheryls Adresse hatten sie in Sekundenschnelle herausbekommen, und sowieso stand die ganze Nachbarschaft auf der Straße und redete.
Der Vogel war aus dem Käfig.
Und ich ging den anderen Weg.