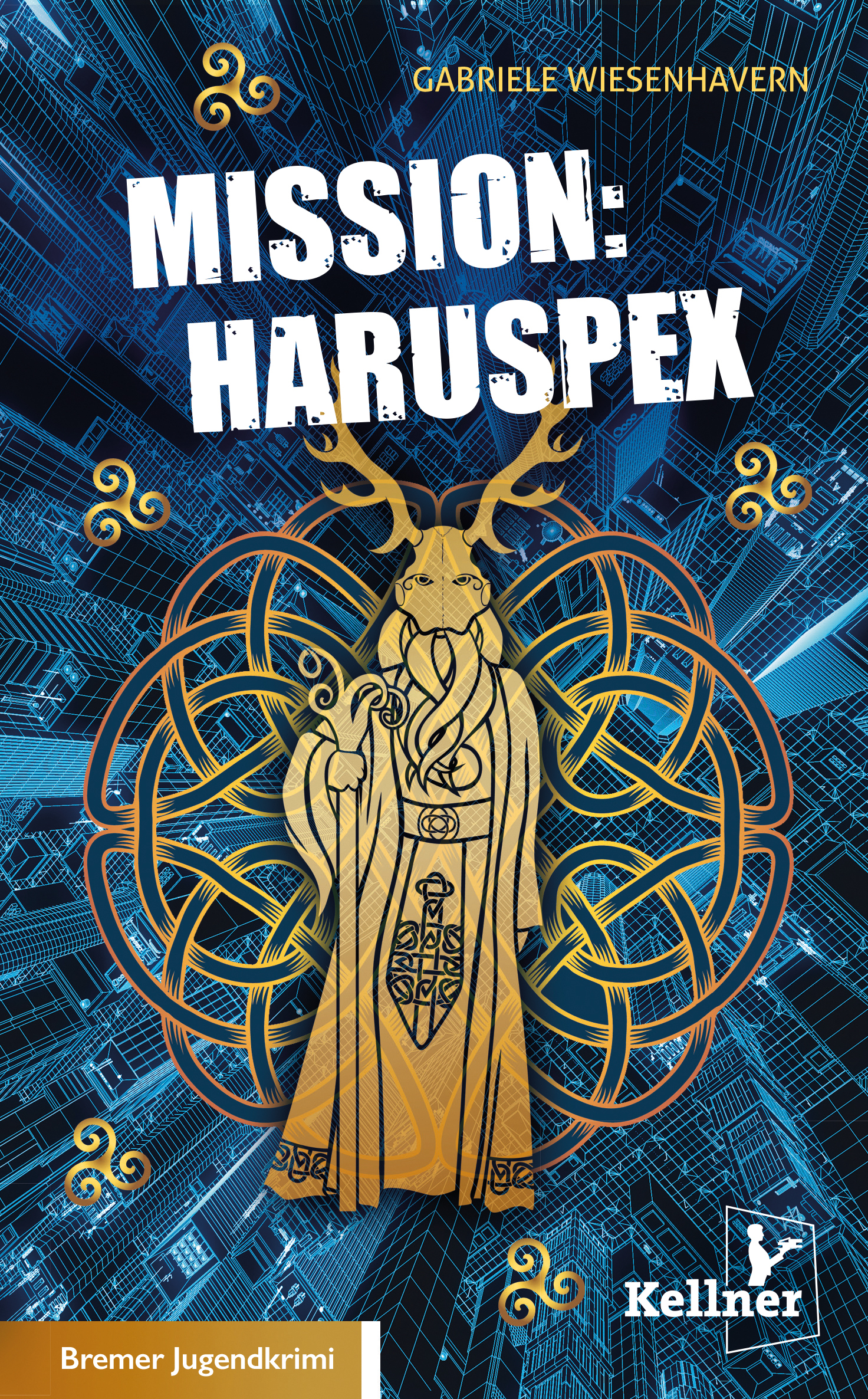
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kellner, Klaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sie wollten doch nur spielen – Computer spielen. Doch vier Jugendliche aus Bremen werden von ihrer Lieblingsbeschäftigung ungewollt in die Wirklichkeit katapultiert und in einen explosiven Kriminalfall verwickelt: Der mächtige, skrupellose Bauunternehmer van Bronk lässt archäologische Artefakte heimlich von seiner Baustelle in Huchting wegschaffen, damit seine großspurigen Pläne nicht ins Stocken geraten. Doch dieser Frevel bleibt nicht unbemerkt und vor allem nicht ungesühnt: Er ruft eine ganz andere, 2000 Jahre alte Macht auf den Plan. Denn auch heute noch gibt es die, die Wache halten ... Können Mark und seine Freunde es schaffen, van Bronk zu überführen und ihm das Handwerk zu legen, bevor es zu einer Katastrophe kommt? Und was hat es mit der Geschichte der Fundstücke und der damit verbundenen Existenz alter Wahrsager und Orakel auf sich? Es ist ein Lauf gegen die Zeit, denn van Bronk hat einen Plan, das Ganze ein für alle Mal unter den Tisch zu kehren. Freundschaft und Gerechtigkeit sind genauso wie Überheblichkeit und Gier Themen, die die Jahrtausende überdauern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Bremen-Krimi für junge Leserinnen und Leser
Gabriele Wiesenhavern
Mission: Haruspex
Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de
Sämtliche Charaktere dieses Romans sind frei erfunden, zufällige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind nicht beabsichtigt.
Kapitel 1: Spielstart
Rauschen. Riesige Brecher und schäumende Gischt. Gleißendes Sonnenlicht und Wassermassen, die über die Spieler hinwegschwappten. Sie schwammen um ihr Leben im tosenden Meer. Und dann hielt auch noch der Bug eines riesigen Schiffes direkt auf sie zu.
Tomke kreischte. »Hilfe, es überfährt uns! Abtauchen, oder was sollen wir machen?«
»Nee, entern!«, rief Michi in sein Headset.
»Mit welchen Tasten denn? Hier wird gar nichts erklärt …« Während man Tomke wie wild auf ihre Tastatur einhämmern hörte, drehte das Schiff leicht zur Seite ab. Etliche Ruder wurden aus dem Wasser gezogen, das große Segel wurde schlaff. Majestätisch wogte die hölzerne Bordwand vor ihnen auf und ab. Der Name »Argo« glänzte in großen goldenen Lettern auf dem Bug.
»Wow!«, hauchte Zack.
Während Tomke und Michi ehrfürchtig schwiegen, fiel plötzlich eine Strickleiter nach unten ins Wasser. Auf dem Bildschirm erschien: »Pfeiltaste nach oben, um zu klettern«.
»Yessss!« Michis Avatar war der erste, der die Leiter erklomm. »Auf zu neuen Abenteuern!«
Nicht im Bremer Steintorviertel, wo Zacharias Worthmann mit Tomke und Michi Hinrichs gerade die Testversion eines neuen Computerspiels ausprobierte, sondern im etwa acht Kilometer entfernten Huchting stand ein Mann auf einem Sandhaufen und ärgerte sich. Ansgar van Bronk hielt ein kleines dunkles Stäbchen in der Hand und betrachtete es eingehend. Er seufzte. Wenn das so weiterging mit diesem alten Plunder, der ständig in seinen Baugruben auftauchte, würde sein schönes Projekt niemals Gestalt annehmen. Immer wieder fanden diese Maulwürfe vom Landesamt für Archäologie einen Grund, die Bagger zum Stillstand zu zwingen. Die Bauarbeiten waren bereits drei Monate im Verzug. Alles würde viel länger dauern als gedacht, und der Zeitpunkt, an dem sich seine Investitionen endlich auszahlen würden, rückte in immer weitere Ferne. Wenn er jetzt ordnungsgemäß meldete, dass er weitere Gegenstände in dem zerfurchten Boden des Baugeländes gefunden hatte, würde erneut ein Schwarm blau-behelmter, völlig verrückter Bodenwühler über die Baustelle herfallen und jedes Sandkorn sieben. Jeder neue Fund war ein Rückschlag für van Bronk. Er sah sich um. Die Arbeiter waren mit anderen Dingen beschäftigt, niemand beachtete ihn. Das etwa zwei Zentimeter lange, kunstvoll verzierte Bronzestäbchen verschwand ganz einfach in seiner Hosentasche.
»MICHIIIII!« Der Schrei, der dem lauten Knall der Chipstütenexplosion folgte, hallte gellend durchs Haus. »Was soll das, bist du wahnsinnig?« Tomke raufte sich die langen, blonden Haare.
»Schon gut, schon gut, ich mach’s weg.« Michi robbte auf dem Boden herum und versuchte, die Chips schneller wieder einzusammeln, als der Kater sie erwischen konnte.Was nicht einfach war, denn der Stubentiger war ein erfahrener Jäger von Nahrungsresten, und Michi kam kaum vorwärts vor Lachen.
»Warum machst du immer so einen Mist?« Tomke beteiligte sich schimpfend an der Sammelaktion. »Manchmal denke ich, du bist ohne Hirn und mit doppeltem Magen auf die Welt gekommen.«
»Das würde für dich dann leider auch gelten, liebste Zwillingsschwester«, kicherte Michi und schob sich ein paar Chips in den Mund.
»Lass das, an denen hat Marty schon geleckt.« Tomke schlug ihrem Bruder die Chips aus der Hand.
»Hey, die sind noch gut, ich will die essen …« Das schrille Klingeln des Telefons unterbrach das Gerangel.
»Hallo? Hier die Johanniter-Katzenfürsorge, was kann ich für Sie tun?«
Tomke riss ihrem Bruder den Hörer aus der Hand und schubste ihn aufs Sofa. »Hier ist Tomke Hinrichs.«
»Hey, hier ist Zack! Was macht ihr gerade?«
»Frag lieber nicht. Michi dreht wieder mal durch. Hat eine Chipstüte in die Luft gejagt.«
»Ballpumpe und BUMM! Hab ich auf YouTube gesehen«, schrie Michi fröhlich aus dem Hintergrund.
»Ich habe gerade mit Mark telefoniert. Er fragt, ob wir mal wieder vorbeikommen wollen – also falls ihr Zeit habt bei euren seltsamen Chips-Experimenten«, kicherte Zack.
»Zu Mark? Klar, gerne! Wann denn?« Tomke klang erfreut.
»Morgen Nachmittag.«
»Wir bringen Kuchen mit!«, hörte Zack Michi noch brüllen, bevor er sich verabschiedete.
Zack freute sich ebenfalls, wieder einmal zu Mark zu fahren. Sie hatten sich seit Ende Dezember nicht mehr getroffen, als sie eine Weihnachtsparty bei Mark gefeiert hatten. Marks Mutter, Simone Richter, hatte sie alle eingeladen: Zack und seine Eltern, Tomke, Michi und ihre Mutter. Es wurde so laut in der kleinen Wohnung im Aalto-Hochhaus in der Bremer Vahr, dass der Nachbar aus dem Apartment nebenan irgendwann klingelte und sich nach dem Rechten erkundigte.
Viel Lärm war er nicht gewohnt, bei Mark und seiner Mutter hatte nämlich bis zum November des Jahres eine eher traurige Atmosphäre geherrscht. Was zum einen daran gelegen hatte, dass Mark und Simone Richter unschuldigerweise in eine schlimme Diebstahlsgeschichte verwickelt worden waren, die jedoch mithilfe von Zack, Tomke und Michi aufgeklärt werden konnte.
Zum anderen lag es an Mark. Der 16-Jährige war ein echter Einsiedler gewesen – seine Welt war das Internet. Seit einem Reitunfall vor sieben Jahren saß er im Rollstuhl, und bis auf seine Mutter ließ er andere Menschen kaum noch an sich heran. Doch vor nicht einmal zwei Monaten hatte sich alles verändert – der Diebstahl, der Simone Richter zur Last gelegt worden war, hatte Mark dazu getrieben, mit Zack Kontakt aufzunehmen und seine einsame Welt zu verlassen.
Zwar war Mark immer noch der geniale Intelligenzbolzen, der mit 16 an der Fernuniversität Informatik studierte. Aber seine selbstgewählte Isolation hatte er aufgegeben. Nicht nur, dass er regelmäßig mit Zack, Tomke und Michi in Kontakt war. Er ging außerdem zum Schwimmen, fuhr alleine spazieren und nahm sogar den Hund des Nachbarn mit, wenn er um den kleinen See neben dem Einkaufszentrum in der Bremer Vahr fuhr. Er war längst nicht mehr so blass und hatte ziemlich kräftige Oberarme bekommen, wie Zack auffiel, als Mark freudestrahlend die Tür aufmachte und ihn, Tomke und den mit Kuchen beladenen Michi in die Wohnung bat.
»Hey, da seid ihr ja – kommt rein! Michi, kommen noch mehr Leute? Das ist ja genug Kuchen für eine ganze Armee!«
»Nö, genug für mich«, antwortete Michi und hievte die Gebäckladung auf den Küchentisch.
Mark rollte zum Küchentresen und schaltete den Wasserkocher an. »Tee für alle?«
»Ähhh – was ich schon länger sagen wollte: Ich mag keinen Tee«, gab Zack zu. »Hast du Apfelschorle oder sowas?«
Mark guckte überrascht. Wenn er daran dachte, wie oft sie hier gesessen hatten und er für alle Tee gemacht hatte … Aber 13-Jährige tranken nicht unbedingt Tee oder Kaffee, das hatte er nicht bedacht. »Klar, Saft ist im Kühlschrank«, grinste er. Dass die drei jünger waren als er, vergaß er immer wieder. Spielte auch keine Rolle – Freunde waren Freunde.
»Und?«, fragte Mark. »Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Es ist nicht gerade Fortnite oder Overwatch … Wir durften keine Shooter entwerfen und keinen Player versus Player. Die Vorgabe von der Uni war Adventure, Survival oder ein Walk-through mit Story-Board. Wir – also meine Projektgruppe und ich – haben versucht, das Ganze zu kombinieren. Es gibt einen Einzel- und einen Mehrspielermodus. Und Rätsel kommen auch noch …«
Michi nickte. »Bis jetzt sieht es echt cool aus. Wann schickst du uns den nächsten Link? Und ein paar Tipps vielleicht, was wir auf der Argo machen sollen?«
»Ich werde euch doch nicht vorher verraten, was auf euch zukommt. Ihr seid die Tester und sollt unvoreingenommen drauflosspielen. Eigentlich müsste in ein paar Tagen der nächste Teil fertig sein, ich schicke euch dann eine Mail. Falls es Probleme gibt oder euch irgendetwas nicht gefällt, sagt einfach Bescheid!«
»Und sonst so? Irgendwelche tollen neuen Hacks?« Michi saß schon fast auf Marks Schoß.
»Michi, jetzt lass ihm doch mal Platz«, ermahnte Tomke ihren Bruder. »Er muss doch den Rechner erst mal hochfahren.«
»Quatsch, der ist bei Mark doch niemals aus, stimmt’s oder hab’ ich recht?«
Sie saßen zu viert in Marks Zimmer, was bei der enormen Menge an technischen Geräten, die hier untergebracht war, nicht ganz einfach war. Irgendwie sah es mehr aus wie ein Technik-Labor als alles andere. Nur, dass es ziemlich dunkel war. Mark bevorzugte nämlich geschlossene Vorhänge, damit auch ja kein einziger Lichtreflex die Sicht auf die Bildschirme seines riesigen PCs und seiner Notebooks trübte.
»Ich habe im Moment nur das Spiel programmiert. Ist aber, wie ihr vielleicht gemerkt habt, noch nicht ganz fertig. Die Grafik muss noch gepimpt werden. Macht meine Kommilitonin von der Uni. Wir müssen den ersten Teil bis Mitte Februar fertig haben, das zählt als Semesterarbeit. Wenn es gut läuft – und das wird es –, kriege ich dafür ziemlich viele Credits.«
»Echt? Wie cool ist das denn!« Zack war nicht zum ers-ten Mal neidisch. Zwar verstand er nicht viel von Semes-tern und Scheinen, aber dass Mark gute Noten dafür bekam, dass er am Rechner daddelte, das kapierte er schon. Irgendwie echt ungerecht … Während er, Tomke und Michi sich in der Schule mit der Französischen Revolution und Vokabeln herumschlagen mussten, beschäftigte Mark sich mit den wirklich wichtigen Dingen.
Der große Rechner erwachte zum Leben, als Zack die Maus anstupste. Statt einer coolen Spielegrafik erschien auf dem Bildschirm jedoch eine Luftaufnahme: Aufgewühlte Erde, Bagger, Dixie-Klos und Plastikplanen waren von oben aus luftiger Höhe zu erkennen.
»Das sieht aber gar nicht nach Computerspiel aus«, meinte Zack. »Oder programmierst du ein Fly ’n’ Run?«, witzelte er.
Hastig griff Mark nach der Maus und schloss die Datei. »Ähh, sorry, das ist was anderes.« Er klickte sich hektisch durch seine Ordner.
»Wieso, was war das denn? Spionierst du jemandem hinterher?« Michi grinste. »Wäre ja nicht das erste Mal, nicht wahr, großer Hacker?«
Mark räusperte sich. »Nee, das ist nichts, ehrlich. Nur so ein Projekt …«
Tomke wunderte sich, dass Mark plötzlich so zugeknöpft erschien. »Kannst du uns ruhig zeigen, wir finden alles spannend, was du ausbrütest«, sagte sie freundlich.
»Sorry – das ist geheim«, war alles, was Mark dazu sagte.
Raika hob die schmutzige Wäsche vom Boden auf und trug sie in den Wirtschaftsraum der eleganten Wohnung in der Bremer Überseestadt. Sie sagte sich immer wieder, dass es ihr gar nichts ausmachte, hinter dem feinen Herrn van Bronk herzuräumen, seine Wohnung und seine Wäsche sauber und seinen Kühlschrank voll zu halten.
»Denk ans Geld«, murmelte sie sich zu. Sie brauchte den zugegebenermaßen großzügigen Lohn, um ihr Studium zu finanzieren. Also putzte sie eben – es gab schlimmere Arbeiten. Außerdem konnte man auf der teuren Stereoanlage höllisch laut Musik hören und tanzend staubsaugen, denn die Nachbarn waren genauso zu ihren wichtigen Jobs ausgeflogen wie ihr Arbeitgeber auch. Dabei war ausgeflogen nicht richtig – ausgefahren war die bessere Formulierung. In dieser Wohnanlage im Schuppen Eins parkten die Autos der Eigentümer nämlich quasi in der Wohnung. Man stieg ein, fuhr die Straße zwischen den Apartments entlang in den riesigen Fahrstuhl und rollte dann unten aus dem Gebäude, ohne auch nur einmal an der Luft gewesen zu sein. Ob sie das jetzt praktisch oder einfach nur schräg fand, war sich Raika nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall war es teuer, so exklusiv zu wohnen.
Seit ungefähr einem Jahr arbeitete sie für Ansgar van Bronk. Viel wusste sie nicht über ihn, außer, dass er Bauunternehmer war, in diesem riesigen Apartment ganz alleine wohnte und gelegentlich Bekannte einlud. Dann musste sie Wein und Meeresfrüchte kaufen – kleine Kraken mit Minitentakeln, die aussahen wie Aliens. Zum Glück war alles vom Feinkostladen schon verzehrfertig vorbereitet. Beim Krakenkochen hätte sie nämlich gestreikt.
Was Raika neben der relativ stressfreien Arbeit am besten gefiel, war das Panorama: Die riesige Glasfront des Apartments bot einen tollen Ausblick auf den Europahafen, die Weser und die Gebäude der Bremer Überseestadt. Vor allem, wenn die Sonne schien, war es hier wirklich schön.
Ein leises Klackern riss sie aus ihren Gedanken. Etwas war aus van Bronks Hosentasche auf die Fliesen gefallen und unter den Schrank gerollt. Sie hockte sich hin und tastete mit der Hand unter dem Schrank herum. Was sie zutage beförderte, erschien ihr auf den ersten Blick wie ein Bolzen, ein Werkzeugteil – doch als sie das kleine, längliche Metallding mit der Kreuz-Einkerbung genauer in Augenschein nahm, kam ihr plötzlich ein ganz bestimmter Verdacht.
»Ich finde, Mark hat sich komisch benommen«, sagte Tomke zu Zack und Michi, als sie auf ihren Fahrrädern nach Hause fuhren.
»Er muss uns ja nicht alles erzählen, so lange kennen wir uns ja auch noch nicht«, antwortete Zack, klang dabei aber wenig überzeugt.
»Also ich bin deiner Meinung, Schwesterherz. Nach dem, was wir für ihn getan haben, muss er nicht so ein Geheimniskrämer sein«, pflichtete Michi seiner Schwester bei. »Es sei denn, er macht wieder etwas Illegales und will uns nicht mit reinziehen.«
»Aber er hat doch versprochen, mit dem Hacken aufzuhören«, sagte Zack. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Risiko noch mal eingeht.«
»Hm«, meinte Michi, »vielleicht kann man es gar nicht lassen, wenn es einem so leichtfällt. Zwei, drei Mausklicks, und schon ist man in irgendeinem System und kann fremde Mails lesen, Dinge umprogrammieren und so …«
Den Rest des Weges legten sie schweigend zurück. Aber jeder der drei fragte sich im Stillen, was Mark Richter zu verheimlichen hatte.
Vielleicht hätte ich es ihnen einfach sagen sollen, schließlich ist es ja nichts Schlimmes, dachte Mark bei sich, als die drei sich auf den Weg nach Hause gemacht hatten. Er hatte ihre Enttäuschung durchaus bemerkt und kam sich ziemlich blöd vor. Bestimmt hatten Zack, Tomke und Michi jetzt den völlig falschen Eindruck. Sie würden denken, dass er ihnen nicht vertraute. Oder dass er wieder einmal heimlich in Bereiche vordrang, die ihn nichts angingen. Aber das hier war nicht illegal, war kein Hacken – im Gegenteil: Er hatte den mehr oder weniger offiziellen Auftrag, diese von einer Drohne gemachten Luftbilder der Großbaustelle im Bremer Stadtteil Huchting zu bearbeiten und in eine Cloud hochzuladen. Aber Polizeirat Dietmar Meyer hatte ihn mehrfach gebeten, das Ganze vertraulich zu behandeln. Mark musste immer noch grinsen, wenn er an Meyers Anruf dachte.
»Hallo, hier ist EDV-Mey… – ähhh, Dietmar Meyer von der Polizei Bremen, IT-Abteilung. Erinnerst du dich an mich?«
Mark hätte am anderen Ende der Telefonleitung fast losgeprustet. Wie hätte er Meyer vergessen können? Mit diesem recht umständlichen, etwas spießigen Datenverarbeitungsexperten von der Polizei hatte sich Mark im November ein kleines Battle geliefert – und gewonnen. Man könnte sogar sagen, dass Mark den Beamten an der Nase herumgeführt hatte. Zum Glück hatte dieser es ihm nicht übelgenommen. Er war anscheinend sogar so beeindruckt von Marks Fähigkeiten am Computer, dass er ihm diesen Job zugeschanzt hatte.
»Hängen wir es nicht an die große Glocke«, hatte Meyer gesagt, nachdem er Mark erklärt hatte, was er für die Polizei tun sollte. »Wir schaffen es hier im Präsidium einfach nicht, bei der Arbeitslast, die wir haben. Und es ist nicht ungewöhnlich, jemanden von außerhalb als Experten hinzuzuziehen. Und dass du ein echter Profi am Rechner bist, hast du ja eindeutig unter Beweis gestellt.«
Meyer hatte gegrinst, das konnte Mark sogar übers Telefon hören. Natürlich wollte Mark den Job. Nicht nur, weil er der Polizei helfen wollte – das zwar auch, aber seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, war ihm wesentlich wichtiger. Selbst wenn das ein bisschen eitel war. Außerdem bekam er für den »IT-Support«, wie Meyer es nannte, eine Aufwandsentschädigung – Geld, das er gut für neues Equipment gebrauchen konnte.
Was Mark allerdings nicht wusste, war, warum er diesen Auftrag hatte. Er hatte keine Ahnung, weshalb die Polizei diese Baustelle so genau in Augenschein nahm. Mey-er wollte dazu leider auch nichts sagen.
»Du musst die Bilder nur hochauflösend bearbeiten, sodass wirklich jedes Detail zu erkennen ist. Den Kontrast erhöhen, mit dem Farbfilter spielen – einfach alles künstlich nachschärfen, um die Strukturen des Geländes besser sichtbar zu machen. Wir brauchen gestochen scharfe Aufnahmen. Dann kannst du sie in die Cloud stellen, sodass die Polizei darauf zugreifen kann. Das ist alles.«
Und so machte er es auch. Trotzdem hätte er zu gerne gewusst, wozu das Ganze gut sein sollte. Und wenn er ehrlich war, hatte er schon das ein oder andere Mal überlegt, ob er sich ins Polizeinetzwerk hacken sollte, um herauszufinden, wofür die Bilder gebraucht wurden. Aber da er seiner Mutter hoch und heilig versprochen hatte, keine unerlaubten Exkursionen im Netz zu veranstalten, hielt er sich daran. Noch.
Van Bronk stand vor dem Modell des BEC – des »Bronk Empire Center«. Es war ein Traum, eine moderne Erlebniswelt, ein allumfassendes Imperium. Exklusive Luxus-Wohnungen in den oberen drei Etagen, Shopping, Erlebnis-Gastronomie und Entertainment vom Feinsten in den drei Stockwerken darunter. Unterirdisch drei weitere Etagen mit einem Kino, einer Bowlingbahn und riesiger Parkgarage.
»Willkommen im BEC – Tempel der modernen Lebenswelten«, so etwa sollte der Werbeslogan zur Eröffnung lauten. Und er würde der König des Tempels sein. Oder hatten Tempel gar keine Könige? Egal, er würde als großer Retter dastehen, denn er war derjenige, der sich aufgeschwungen hatte, um diesem Stadtteil ein neues Leben zu schenken. Vorbei die piefige, kleinstädtische Atmosphäre. Vorbei das schlechte Image mit Brennpunktschulen und überholter Bausubstanz. Ansgar van Bronk hatte ganz Großes vor. Ein Paradebeispiel moderner Stadtarchitektur, geradezu hellseherisch zugeschnitten auf die Konsumwelt der Zukunft. Er würde das verschlafene Huchting ins nächste Jahrhundert katapultieren und dafür als großzügiger Gönner in der ganzen Stadt Anerkennung und Bewunderung ernten – und nicht zuletzt Millionen dabei verdienen. Er würde verehrt werden als … als … Visionär!
»Entschuldigung, Chef, Telefon für Sie.« Die Sekretärin machte die Tür schnell wieder zu, als sie ihren Chef mit weit ausgebreiteten Armen in Siegerpose vor dem maßstabsgetreuen Mini-Nachbau seines Lieblingsprojekts stehen sah.
Sie hatte schon seit geraumer Zeit den Eindruck, dass das BEC-Projekt merkwürdige Auswirkungen auf van Bronk hatte. Zwar hatte ihr Boss schon immer eine sehr leidenschaftliche Arbeitsauffassung gehabt, zum Leidwesen seiner Angestellten, die mit Wutanfällen und Überstunden überhäuft wurden. Aber so persönlich, wie er das hier nahm, war es bisher noch nie. Es war irgendwie beängstigend. Vor allem, weil seit einiger Zeit etwas schief- zulaufen schien. Van Bronk war noch gereizter und ungeduldiger als sonst.
Die Sekretärin stellte das Gespräch durch: »Herr Heinlein von der Sicherheitsfirma für Sie, Herr van Bronk.« Dann legte sie schnell auf.
»Van Bronk hier. Haben Sie’s hingekriegt?«
»Das, was ich finden konnte, habe ich entsorgt. Aber ich glaube nicht, dass das schon alles war«, antwortete Henning Heinlein, Chef von Heinlein Security Service. »Längst nicht alles. Das Gelände ist zu groß, es wird noch etwas dauern.«
Van Bronk fluchte. »So schnell wie möglich, hören Sie? Es muss weitergehen. Sonst gibt es eine Katastrophe!« Er knallte den Hörer auf die Gabel. Warum war dieser Wachschutz-Heini nur so langsam? Ausbaggern, wegfahren und in irgendeinen Graben kippen, das hatte er ihm schon hundertmal gesagt. »Das kann doch nicht so schwer sein!«, brüllte er so laut, dass die Sekretärin im Nebenzimmer erschrocken zusammenzuckte.
Zack war mit den Gedanken ganz woanders, deshalb hatte er auch nicht mitgekriegt, dass Frau Hellermann ihn etwas fragte. Auch das Kichern seiner Mitschülerinnen und Mitschüler nahm er nur am Rande wahr. Erst, als Tomke ihm ihren Ellenbogen in die Seite stieß, guckte er hoch.
»Hast du vor, die Frage heute noch zu beantworten, Zacharias?« Frau Hellermann saß auf ihrem Schreibtisch und wippte ungeduldig mit dem Fuß.
»Entschuldigung«, stammelte Zack. »Ich habe gerade nicht aufgepasst.«
»Das haben wir gemerkt. Also, noch mal: Der Sturm auf die Bastille war wann genau?«
Zacks Kopf war leer. Zumindest im Hinblick auf die Französische Revolution. Erst, als er aus dem Augenwinkel sah, dass Tomke »14.7.1789« auf ihren Collegeblock kritzelte, konnte er antworten.
Frau Hellermann schüttelte den Kopf und wandte sich wieder der Tafel zu.
»Danke, Tomke«, flüsterte Zack.
Tomke zwinkerte ihm zu. Dann schrieb sie »Was von Mark gehört?« auf den Block.
Zack schüttelte den Kopf. Auch er war enttäuscht von Marks Heimlichtuerei, aber nicht ganz so sehr wie Michi und Tomke. Die beiden waren regelrecht beleidigt. Zack war sich sicher, dass Mark einen guten Grund hatte, sie nicht einzuweihen.
»Spielen wir eine Runde Minecraft nach der Schule?«, schrieb er auf Tomkes Block.
Sie skizzierte einen erhobenen Daumen als Antwort.
Um 15:30 Uhr saßen sie – jeder im eigenen Zimmer – vor ihren Rechnern. Das war ein liebgewonnenes Ritual, das sie schon seit der fünften Klasse durchzogen: nach der Schule nach Hause gehen, essen und dann eine Runde zocken, bevor Hausaufgaben oder Sport auf dem Programm standen. Zack klappte sein Notebook auf und loggte sich ein. Eine neue E-Mail-Nachricht … Er klickte auf das Icon. Eine Nachricht von Mark!
Betreff: Neues Spiel Beta-Version Teil II
Nachricht: Hier der Link zur Probeversion des
nächsten Teils des Spiels. Testet mal schön aus!
http://www.markonaut.de/test.version4beta/2
Grüße von Mark – und bis bald, hoffentlich!
Zack ging auf Skype und rief Michi und Tomke an.
»Hey, habt ihr eure Mails gecheckt? Mark hat den Zugang zum nächsten Spielabschnitt geschickt. Wollen wir es ausprobieren?«
Logisch wollten sie. Zack öffnete das Spiel, las kurz das Menü, fand die »Party-Einstellung« und lud Tomke und Michi ein.
Kapitel 2:Charaktere
In der Universitätsbibliothek war es voll. Raika hatte mehrere Bücher und ihr Notebook im Arm und blickte sich suchend nach einem Platz um. Endlich stand jemand auf und verließ den Lesesaal. Raika setzte sich und legte ihre Sachen auf den Tisch. Bevor sie losgefahren war, hatte sie im Internet nach Informationen gesucht. Sie hatte tatsächlich Fotos von vergleichbaren Objekten gefunden, aber die Literaturhinweise bezogen sich fast ausschließlich auf alte, nicht-digitalisierte Wälzer. Im Netz kam sie nicht weiter, also hatte sie sich auf den Weg zur Uni gemacht und Veröffentlichungen herausgesucht, die ihr bei ihrer Recherche nützlich sein könnten. Als Studentin der Kulturwissenschaften hatte sie problemlos Zugang zur Uni-Bibliothek. Sie saß dort wie alle Studierenden – nur, dass es hier nicht um eine Hausarbeit ging, sondern um etwas ziemlich Persönliches …
»Orakelstäbchen des Typs C-a-5 nach Dickmann«, stand unter einem der vielen ähnlichen Objekte, die auf den Seiten des Buches abgebildet waren.
»Treffer«, murmelte Raika leise zu sich selbst. Sie blätterte weiter im Buch: »… diente in der Antike der schicksalsgeleiteten Entscheidungsfindung … Meistens kamen die Orakelstäbchen in den Niederlanden und Nordwestdeutschland zum Einsatz …«
Sie blickte auf ihren Rucksack, in dem das kleine Stäbchen, sorgsam in Papier gewickelt, verborgen war. Sie glaubte fast, einen gewissen Sog zu spüren, als wäre das Ding plötzlich magnetisch geworden. »Blödsinn«, schalt sie sich selbst, »ich glaube nicht an den ganzen Mist!« Dennoch würde sie sich auf den Weg machen müssen. Auf den Weg zu jemandem, den sie lange nicht gesehen hatte. Mit einem Objekt, dessen Existenz eine Ursache für das lange Schweigen zwischen ihr und diesem Jemand war.
Mark gähnte. Die neuen Luftaufnahmen, die Meyer ihm zum Bearbeiten zugeschickt hatte, waren genauso öde wie die vorherigen. Eigentlich tat sich auf der Baustelle gerade gar nichts. Ab und zu stand ein Fahrzeug mal anders, aber in den letzten drei Wochen sah eigentlich alles immer gleich aus. Zu Beginn seiner Bildbearbeitung waren große Bagger, LKW und Bauarbeiter zu sehen gewesen. Dann war plötzlich Schluss, und die ausgehobenen Gruben lagen brach. Ein paar Tage später waren dann Menschen zu sehen, die in kleinen Grüppchen über das Gelände streiften. Was die da genau machten, wusste Mark nicht, aber es sah aus, als suchten sie etwas. Jedenfalls waren auch diese Typen irgendwann weg, und nun passierte seit etwa einer Woche nichts mehr. Als wäre die Baustelle verlassen, das Projekt aufgegeben. Mark rieb sich die Augen, das Starren auf den Bildschirm war schon ganz schön anstrengend. Jetzt sah er schon Schatten, wo gar keine sein konnten …
»Merkwürdig«, sagte er zu sich selbst und rief ein Foto des Geländes auf, das vor drei Tagen gemacht worden war. Kein Schatten am rechten Bildrand. Er blickte erneut auf das Foto von heute, wo die magere Wintersonne definitiv dafür sorgte, dass ein dunkler Fleck zu sehen war. Ein Hügel ... Er holte sich weitere Aufnahmen auf den Bildschirm, um sicherzugehen, dass er ähnliche Lichtverhältnisse miteinander verglich. Kein Schatten – vor heute Morgen. Seltsam. Er bekam täglich zwei Aufnahmen, eine wurde vormittags von der Drohne gemacht, eine dann gegen Abend, bevor es dunkel wurde. Zwischen gestern Abend und heute Morgen hatte sich sehr wohl etwas verändert auf der Baustelle. »Arbeiten die da etwa nachts?«, fragte sich Mark. Unwahrscheinlich, überlegte er weiter. »Ich fresse einen Besen, wenn da alles mit rechten Dingen zugeht«, murmelte Mark und überlegte, ob er Polizeirat Dietmar Meyer informieren sollte. Einerseits war er ja ausschließlich zur Bildbearbeitung aufgefordert worden. Die Schlüsse, die Meyer und seine Polizeikollegen daraus zogen, gingen ihn eigentlich nichts an. Und es war ja nur ein Haufen Erde, kein geklauter Bagger oder so was … Andererseits war Mark nicht wohl dabei, seine Beobachtung für sich zu behalten. Meyer hatte ihn extra angeheuert, damit er die Bilder so genau und scharf wie möglich aufarbeitete. Wahrscheinlich doch deswegen, weil die Polizei irgendwelche krummen Dinge vermutete … Dann sollte er also auch Bescheid sagen, wenn ihm etwas auffiel. Mark griff zum Handy und wählte Meyers Nummer auf dem Revier.
»Polizei Bremen, EDV-Abteilung. Groth am Apparat«, hörte er einen Beamten sagen.
»Äh, hallo … Mark Richter ist mein Name. Könnte ich mal mit Herrn Meyer sprechen?«
»Herr Meyer hat sich ein paar Tage freigenommen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
»Ich weiß nicht … Es geht um die Luftaufnahmen der Baustelle in Huchting, wissen Sie? Ich wollte Herrn Meyer etwas berichten …«
Der Beamte am anderen Ende sagte erst mal nichts. Dann fragte er nach: »Wie ist Ihr Name noch mal? Und von welchen Luftaufnahmen sprechen Sie? Ich weiß von keiner Ermittlung in Huchting.«
Mark war verunsichert. War dieses Projekt so geheim, dass Meyer seinen Kollegen nichts davon erzählt hatte? Oder was ging hier vor?
»Hallo?«, hörte er den Beamten am anderen Ende fragen. »Sagen Sie mir bitte noch mal Ihren Namen?«
»Nein, schon gut, das ist wohl ein Missverständnis. Entschuldigen Sie, und schönen Tag noch.« Mark legte auf. Zum Glück hatte er die Rufnummer-Unterdrückung aktiviert.
Er lehnte sich zurück und fing an zu grübeln. Was war da los? Er konnte sich zwar vorstellen, dass nicht jeder Beamte über jede Ermittlung informiert war. Aber Kollegen in der gleichen Abteilung sollten doch eigentlich wissen, was lief. Hatte Meyer einen geheimen Auftrag? Quatsch, überlegte Mark, das war hier ja nicht das FBI, sondern die Polizei Bremen. Es gab eigentlich nur eine andere Möglichkeit: Meyer arbeitete auf eigene Faust. Das würde auch seine Aufforderung an Mark, alles vertraulich zu behandeln, erklären … Und wenn Mark ehrlich zu sich selber war, würde es seine Mitwirkung insgesamt erklären. Denn egal, was für ein Wizard er auch in der Computerwelt war, die Polizei würde sich nicht einen Minderjährigen als Unterstützung bei einer offiziellen Ermittlung dazuholen. Mark ärgerte sich über seine eigene Naivität.
»Okay, Meyer. Was machst du da also, und wieso? Und wieso fragst du mich um Hilfe?«, murmelte Mark. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieser überkorrekte Beamte, den er kennengelernt hatte, etwas Illegales tat. Vielleicht gab es eine einfache Erklärung für die ganze Sache … Mark rauchte der Kopf. Er wusste nicht, was er machen sollte. Er brauchte eine zweite Meinung. Und eine dritte und eine vierte. Er griff nach dem Handy und schrieb:
Hey, ich muss was mit euch besprechen.
Wann könnt ihr zu mir kommen?
Ansgar van Bronk telefonierte mit dem Bauleiter der Huchtinger Baustelle. Zum dritten Mal in dieser Woche hatte er ihn angerufen, um nachzufragen, wann es weitergehen würde. Und zum dritten Mal bekam er die gleiche unbefriedigende Antwort.
»Tut mir leid, Herr van Bronk. Ich weiß es nicht. Ich warte auf die Freigabe der Baubehörde.«
Van Bronk knurrte: »Worauf warten die denn, zum Teufel noch mal?«
Zum Glück konnte er nicht sehen, dass der Bauleiter mit den Augen rollte. Der Mann blieb freundlich, auch wenn sein genervter Gesichtsausdruck eine andere Sprache sprach: »Leider hat sich das Landesamt für Archäologie noch nicht geäußert, wann sie erneut auf die Baustelle kommen wollen. Sie haben an der Schlachte in der Innenstadt Reste einer alten Stadtmauer gefunden, die sie zuerst sichten wollen. Ich denke, das wird sicher noch eine Woche dauern.«
»Eine Woche? Das darf doch nicht wahr sein! Solange alles stillsteht, rinnt mir das Geld durch die Finger. Können Sie nicht in einigen Abschnitten weiterarbeiten?«
»Das geht nicht, Herr van Bronk, das wissen Sie doch. Es tut mir leid, das Gelände muss erst von der Behörde freigegeben werden. Und das passiert erst, wenn die Archäologen fertig sind. Da kann man nichts machen …«
Van Bronk schnaubte wütend und legte auf. Kann man nichts machen? Von wegen! Er würde demnächst beim Empfang im Rathaus, zu dem er als großer Investor und Gönner der Stadt Bremen natürlich eingeladen war, Dampf machen. Die richtigen Leute würden anwesend sein. Diejenigen, die im Bauressort das Sagen hatten, würden sicher zuhören, wenn er ihnen klarmachte, dass das großartige Vorhaben auf der Kippe stand, wenn es nicht bald weiterginge. Da sich die Politiker immer gerne im Erfolg sonnten und so taten, als wären große Projekte wie das BEC auf ihrem Mist gewachsen, hatten sie auch Interesse daran, das Ganze so schnell wie möglich umzusetzen. Dynamisch vorangetriebene Stadtentwicklung war immer ein gutes Argument, wenn Wahlen anstanden. Und wenn die ganze Sache platzte, würde nicht nur van Bronk selbst, sondern auch die Politik dumm dastehen.
Während er noch darüber nachdachte, wie und bei wem er seine Kontakte am besten spielen lassen konnte, fiel ihm ein, dass er unbedingt bei Heinlein anrufen musste. Der einzige Vorteil an der ganzen Warterei war, dass der Wachschutz-Heini mehr Zeit hatte, die Baustelle zu »säubern«, wie er es nannte. Nur wenn die Archäologen nichts mehr fänden, würde es endlich weitergehen. Wenn der Bauleiter mit seiner Prognose recht hatte, dass die Archäologen in etwa einer Woche zurückkehrten, musste bis dahin alles verschwunden sein. Heinlein würde sich mit dem Umgraben und Wegschaffen also ganz schön beeilen müssen. Van Bronk griff zum Telefon. »Dem werde ich mal ordentlich einheizen«, grummelte er, während er die Nummer tippte.
Raika hatte schon mehrmals Anlauf genommen, aber dann ihr Handy doch wieder weggesteckt. Es fiel ihr unglaublich schwer, ihre Großtante anzurufen, denn sie wusste, dass alle Diskussionen von vorne beginnen würden – jetzt sogar mit noch mehr Zündstoff, denn das Stäbchen würde allem, was Tante Jol von ihr erwartete, noch mehr Dringlichkeit verleihen. Sie stöhnte. Diesmal legte sie nicht wieder auf und wartete, bis ihre Tante dranging.
»Raika! Wie schön, dass du dich meldest. Ich hatte schon so ein Gefühl …«
»Hallo, Tante Jol, wie geht es dir?«
»Danke, ganz gut. Aber um mich das zu fragen, hast du doch nicht angerufen, oder? Gibt es was zu besprechen?«
Raika schluckte. Ihre Tante war immer so direkt. Kein Geplauder, keine Höflichkeitsfloskeln, immer gleich zur Sache. Na ja, manchmal machte das die Dinge auch einfacher.
»Ja«, antwortete sie. »Ich habe etwas gefunden, was ich dir gerne zeigen möchte. Hast du am Wochenende Zeit? Ich komme nach Schortens, wenn du da bist?«
Sie hörte ihre Tante kichern. »Wo soll ich denn sonst sein? Komm nur, ich freue mich schon auf dich.«
Damit war das Gespräch beendet. Nicht mal tschüs hatte Tante Jol gesagt. Und auch nicht gefragt, wann genau Raika denn kommen würde. Trotzdem würde sie mit ihrem sechsten Sinn den Kaffee exakt dann auf den Tisch stellen, wenn sie mit ihrem klapprigen Wagen auf den Hof rollte, da war sich Raika sicher.
»Mark hat geschrieben«, sagte Zack zu Tomke und Michi, als er sein Handy beim Verlassen des Schulgebäudes an der Hamburger Straße wieder anschaltete. »Er will, dass wir ihn besuchen, um etwas zu besprechen, und fragt, wann wir können.«
»Ich kann sofort«, sagte Michi fröhlich und holte eine Banane aus seinem Rucksack. »Nur erst was essen.«













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















