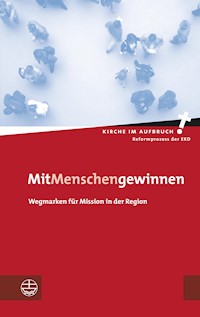
MitMenschen gewinnen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Kirche im Aufbruch
- Sprache: Deutsch
Mission in der Region ist in der evangelischen Kirche und Theologie eine bisher kaum ausgelotete Option. Wo Kirche beginnt, in Nachbarschaften, Quartieren oder Regionen zu denken, können neue Zielgruppen für das Evangelium erreicht werden: Kooperation, Ergänzung und Beschränkung sind Schlüsselaufgaben für eine kleine und ärmer werdende Kirche, die ihre Mission ernst nimmt. Die Mitarbeitenden des EKD-Zentrums "Mission in der Region" legen hierzu eine grundlegende Orientierung vor. Eingeführt wird u. a. in Kooperation und Konkurrenz, Mitgliederorientierung, milieusensibles Arbeiten, Mission im ländlichen Raum, Gestaltung von Veränderungsprozessen, Raumverständnis, Entwicklung missionarischer Einstellungen sowie Schrumpfen und Wachsen. Ein hilfreiches Werkzeug für alle, denen die Zukunftsfähigkeit von Kirche in der Region wichtig ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vom Kirchenamt der EKD
Band2
MitMenschengewinnen
Wegmarken für Mission in der Region
Im Auftrag des
Zentrums für Mission in der Region
herausgegeben
von Hans-Hermann Pompe und Thomas Schlegel
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2011 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Umschlagfoto: stm/Quelle: Photocase
Gesamtgestaltung: Kai-Michael Gustmann, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-374-04979-0
www.eva-leipzig.de
Geleitwort
Die Menschen in Deutschland werden immer weniger und immer älter. Ganze Regionen leeren sich, hier und da kommen sogar schon die Wölfe wieder zurück. Christinnen und Christen gehen nicht mehr einfach ins Nachbarhaus, um sich zu verabreden, sondern müssen telefonieren und dann das Auto nehmen. Viele Kirchen bleiben sonntags zum Gottesdienst halb, dreiviertel leer und manche werden noch nicht einmal aufgeschlossen. Nichts ist mehr selbstverständlich, sondern muss aufwändig organisiert werden. Da fragen wir uns: Was sollen wir tun? Wie soll es weitergehen? Sollen wir in deprimiertes Schweigen verfallen?
Doch vielleicht schauen wir auch dorthin, wo Schrumpfen längst drastische Realität ist. Wie es funktionieren kann, phantasievoll darauf zu reagieren, zeigt beispielhaft das Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes „shrinkingcities“, schrumpfende Städte: Architekten, Wissenschaftler und Künstler untersuchten die jüngere Entwicklung schrumpfender Städte und machten konstruktive Vorschläge für einen Umbau. Dort, wo immer weniger ist, wo es kein Wachstum mehr gibt, sondern in erster Linie leer stehende Räume, Häuser, ganze Stadtteile, wo ganze Industriezweige zusammengebrochen sind und die demographische Entwicklung ihr Übriges tut, kommt es zu hochinteressanten und neuen Entwicklungen: Kunstprojekte, Stadtgärten oder intergenerationelles Zusammen-Wohnen sind entstanden, die allesamt die Lebendigkeit einer schrumpfenden Stadt aufzeigen.
Das Beispiel zeigt: Weniger zu werden ist zwar möglicherweise deprimierend, aber gerade eben kein Grund, deprimiert zu bleiben. Menschen zu begeistern, zu überzeugen, gerade daraus etwas zu machen, neu anzufangen, ist nicht immer nur beschwerlich, sondern kann gerade auch entlastend sein, von Lasten befreien.
Wir als Kirche müssen nicht einmal lange überlegen, wovon wir reden und wofür wir begeistern wollen: Wir haben die befreiende Botschaft des Evangeliums, besitzen „Leuchttürme“ vorbildlicher kirchlicher Arbeit. Mission ist dabei mehr als ein Reden über Altbekanntes – sie ist Neuwerden, noch einmal Anfangen, und das ist sie sicherlich in anderen Strukturen: zentraler und dezentral zugleich.
Schon jetzt ist erkennbar, dass die kirchliche Arbeit in der Zukunft insbesondere in der Region einen anderen Blick braucht: Nicht jede Gemeinde muss und kann mehr alles tun, und einiges kann gemeinsam besser getan werden. Gemeinde auf Zeit und Zeiten für die Gemeinde werden wir sein und haben. Der Weg dorthin ist nicht leicht. Überforderung und Finanzprobleme, Enttäuschungen und Rückfälle wird es geben. Und doch: Nach mehr als 2000 Jahren dürfen wir wohl sagen: „Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen.“ (Eph 3,20f.)
In den hier vorgelegten Beiträgen aus dem „Zentrum Mission in der Region“ wird deutlich, dass Region nicht für Verlust, Sparen oder Rückwärtsbewegung steht, sondern in ihr das Potential für „Neues Land“, für einen missionarischen Aufbruch liegt.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern spannende Entdeckungen!
Katrin Göring-Eckardt
Die Präses der EKD-Synode
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Geleitwort
Hans-Hermann Pompe und Thomas Schlegel
Zur Einführung
Hans-Hermann Pompe
Fragwürdig leben. Was missionarische Haltungen fördert
Heinzpeter Hempelmann
Gott im Milieu. Vom Vorbild Gottes, der seine Welt verlässt, um bei uns in unserer Welt zu sein
Daniel Hörsch
Wie „ticken“ die Menschen in einer Region? Einführung in die Kirchendemographie
Heinzpeter Hempelmann
Wenn die „Mükke“ dreimal zusticht. Milieuübergreifendes kirchliches Handeln, basiert auf kirchendemographischen Erhebungen als Projekt des EKD-Zentrums Mission in der Region
Christhard Ebert
Mensch, wer bist du? Gründe für eine Mitgliederorientierung in der Kirche
Martin Alex
Weites Land – ein weites Feld. Kleine Ideen für Mission in ländlichen Räumen
Christhard Ebert
Und wenn der Nachbar nicht will? Konkurrenz und Kooperation in der Kirche
Juliane Kleemann
Mit Erfolg daneben. Anmerkungen zur Prozessdidaktik
Thomas Schlegel
„Weniger ist Zukunft“. Kirchliches Wachstum in Zeiten des Schrumpfens?
Liste der Autorinnen und Autoren
Weitere Bücher
Fußnoten
Hans-Hermann Pompe und Thomas Schlegel
Zur Einführung
Die evangelische Kirche lebt in Regionen, die das Leben von Menschen bestimmen. Sie ist selbst regional strukturiert – und sie arbeitet in regionalen Bezügen. Wo Kirche in Nachbarschaften, Quartieren, Regionen oder Räumen denkt, können neue Zielgruppen für das Evangelium erreicht werden: Kooperation, Ergänzung und Beschränkung sind Schlüsselaufgaben für eine kleiner und ärmer werdende Kirche, die ihre Mission ernst nimmt.
Mission ist auf der Agenda der Evangelischen Kirche in Deutschland weit nach oben gerückt. Spätestens seit der EKD-Synode 1999 steht fest: „Die evangelische Kirche setzt das Glaubensthema und den missionarischen Auftrag an die erste Stelle, sie gibt dabei einer Vielfalt von Wegen und Konzepten Raum, ihr ist an der Kooperation und gegenseitigen Ergänzung dieser unterschiedlichen Wege und Konzepte gelegen“ (Kundgebung der Synode). Die meisten Landeskirchen haben damit begonnen, sich ein gemeindenahes und theologisch verantwortetes Missionsverständnis zu erarbeiten. Sie brechen auf – hin zu Menschen, die mit Evangelium, Gott, Kirche oder Glaube nichts anfangen können. Und das macht Hoffnung.
Mission in der Region kann so etwas sein wie ein noch nicht ausgepacktes Geschenk: ein Mehrwert für Mission – entstehend aus einer Kooperation für Menschen, dem Wahrnehmen von Menschen, einem Aufbruch hin zu Menschen und einer Neuausrichtung an Menschen, die von Gemeinde und Kirche noch nicht oder nicht mehr erreicht werden. Im Zuge des EKD-Reformprozesses hat das „Zentrum Mission in der Region“ die besondere Aufgabe, diesen Mehrwert zu durchdenken, Hilfen zu entwickeln, sie in der Praxis zu erproben und für Landeskirchen und Gemeinden verfügbar zu machen.
Mit diesem ersten Band aus dem „Zentrum Mission in der Region“ legen die Mitarbeitenden der drei Standorte Dortmund, Stuttgart und Greifswald grundlegende und einführende Überlegungen zu Schlüsselthemen von Reform und Aufbruch vor.
In dem eröffnenden Beitrag führt Hans-Hermann Pompe aus, dass Mission nicht nur bedeutet, seinen Glauben ansteckend zu leben, sondern auch, frag-würdig Christ zu sein: „… sich selbst durch das Evangelium so infrage stellen zu lassen, dass die Antwort der Gnade das eigene Leben heilt und trägt; und für andere frag-würdig zu werden, von ihnen so mit Interesse beschenkt zu werden, dass sie uns der Nachfrage würdig halten.“ Zentral für eine solche Existenz sind missionarische Grundhaltungen, die das „Raum“-Klima der Begegnungen in Alltag und Gemeinde prägen und in zwei komplementäre Bewegungen münden: den attraktionalen Modus von Kirche, der auf das Kommen ausgerichtet ist, und den inkarnationalen Modus, der aus dem Hin-Gehen besteht.
In dieser Richtung bietet Heinzpeter Hempelmann in seinem Aufsatz „Gott im Milieu“ die theologische Fundierung: den Weg Gottes in die Tiefe – seine Menschwerdung. Im Anschluss an den Hymnus aus dem Philipperbrief rekonstruiert er drei Haltungen, die heutige Kirche von Gottes Selbstentäußerung lernen kann: Liebe macht Grenzüberschreitung erforderlich; sie verlangt die Beweglichkeit, Menschen in ihren Lebenswelten ähnlich zu werden; schließlich kann man sich von Jesus eine barmherzige, „urteilsfreie Zuwendung“ zum anderen abgucken.
Diese Lernpotentiale greift Daniel Hörsch auf, indem er eindringlich daran erinnert, genau hinzuschauen, wie die Menschen in einer Region „ticken“. Der erwünschte Wandel in der Kirche setzt einen Blickwechsel voraus, oder man könnte auch sagen: Mission beginnt mit dem Sehen! Sodann stellt Hörsch das Werkzeug Kirchendemographie vor, eine innovative „Sehhilfe“, die vom Zentrum Mission in der Region entwickelt wurde. Sie bietet einen internen „Elchtest“ und zielt auf den „Bartimäuseffekt“: Den Gemeinden einer Region werden die Augen geöffnet für „milieuspezifische, soziodemographisch bedingte Charakteristika einer Region“.
Metaphorisch geht es weiter mit dem dreifachen Stich der „Mükke“, der zu „Neuem reizen soll“. Heinzpeter Hempelmann führt hier in einem Überblick in die Milieutheorie ein und fragt nach ihrem dreifachen Potential für die Gemeindearbeit und -analyse. Er lässt diese Gedanken in konkrete Vorschläge münden, wie Gemeinde die Grenzen zwischen den Lebenswelten überschreiten kann.
Dass es bei der Mitgliederorientierung auch um eine urmissionarische Bewegung geht, nämlich dass „Gott bei den Menschen ankommt“, erörtert Christhard Ebert in seinem Beitrag „Mensch, wer bist du?“. Mitgliederorientierung könnte auch ganz knapp Beziehungspflege genannt werden: Es geht um den Aufbau und die Intensivierung von Kontakten zwischen Mensch und Gemeinde bzw. Mensch und Gott. Die einzelnen Bausteine dazu werden überblicksartig beschrieben und graphisch dargestellt.
Martin Alex macht noch einmal von anderer Seite aus deutlich, wie wichtig ein geschärfter Blick für die Mission der Kirche ist. Denn nicht nur verschiedene Milieus verdienen je eigene Aufmerksamkeit, sondern auch die unterschiedlichen Regionen: Selbst „das Land“ ist heutzutage so disparat, dass es nicht die Lösung für alle Regionen gibt. Verschiedene Typen von „Land“ werden exemplarisch vorgestellt, und es wird genau durchdacht, mit welchen Ideen man der je eigenen Situation begegnen kann.
Was allerdings viele – nicht nur ländliche – Kirchengemeinden inzwischen eint, ist das gemeinsame Arbeiten in einer Region. Darauf fokussiert Christhard Ebert in „Und wenn der Nachbar nicht will? – Konkurrenz und Kooperation in der Kirche“. Obwohl rational vieles für die Zusammenarbeit verschiedener Gemeinden spricht, sieht die Realität oft anders aus: Neid und Konkurrenz sind ein „verborgenes, aber wirksames Hintergrundthema kirchlichen Tuns“. Ebert zeigt Regeln für Kooperationen auf, macht deutlich, welche Haltungen sie befördern und wie wichtig Transparenz für ihren Mehr-Wert ist. Überraschenderweise führt er dann den Konkurrenzbegriff aus „dem schroffen Gegensatz zur Kooperation“ heraus, indem er jenen wertfrei zu betrachten versucht. Oft seien es nur die Folgen des Fehlverhaltens, die einen Wettbewerb destruktiv wirken lassen. Indem auch die Schwächen einer Zusammenarbeit benannt werden, erhält man ein System, in dem Konkurrenz und Kooperation „in einem ausgewogenen Spannungsverhältnis“ zueinander stehen.
Wie komplexe Systeme – z.B. Kirchenkreise oder Regionen – lernen und sich in geregelten Verfahren für die Zukunft qualifizieren, beleuchtet Juliane Kleemann in ihrem Beitrag „Mit Erfolg daneben – Anmerkungen zur Prozessdidaktik“. Dabei geht sie konkret auf solche Prozesse ein, die einer Gemeinde oder einer Region mehr missionarische Außenwirkung verleihen können. Die verschiedenen Phasen werden benannt, die zentrale Bedeutung der „Hypothesenbildung“, in der Unkonventionelles gedacht werden soll, wird unterstrichen. Gemeinden tun sich damit erfahrungsgemäß schwer, so auch mit der letzten Phase, der Evaluation – obwohl gerade in dem Erkennen eines Fehlers der nachhaltigste Lerneffekt für eine Organisation liegt.
Thomas Schlegel diskutiert abschließend die Frage, wie sich der reformorientierte Wille zu wachsen mit der Erfahrung des akuten Schrumpfens, dem die Kirche ausgesetzt ist, zusammen denken lässt. Eine Auswertung der Mitgliedschaftsentwicklung in den EKD-Gliedkirchen der Neuen Bundesländer macht klar, dass vieles, aber nicht alles demographisch bedingt ist. Entgegen beliebten Verdrängungsmechanismen plädiert Schlegel für eine offene theologische Diskussion des Themas „Schrumpfen“. Ausgehend vom biblischen Befund liefert er dazu einen ersten Beitrag. Mission, so das Fazit, orientiert sich immer an qualitativem und quantitativem Wachstum, kann aber auf dem Boden einer ecclesiologia crucis auch bedeuten: Shrink positive! Shrink intelligent!
Weitere Aspekte von Raum und Region, von Mission und Kooperation sowie Bausteine für ein zukunftsfähiges Regionen-Verständnis sind für die Folgebände vorgesehen.
Hans-Hermann Pompe
Fragwürdig leben
Was missionarische Haltungen fördert
„Mission ist Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes. Ich teile mit anderen, was ich schön finde.“ (Fulbert Steffensky)
Im Jahr 2001 gehörte ich einer Arbeitsgruppe an, die die Ergebnisse der Leipziger Missionssynode der EKD auf die Gegebenheiten der Evangelischen Kirche im Rheinland übertragen sollte. Wie findet man einen hilfreichen Missionsbegriff für eine plurale, große Landeskirche, die mit Mission mehrheitlich eher Schwierigkeiten hat? Die Gruppe entschied sich, mit einer einfachen Frage zu beginnen: „Wessen Mission hat dich gewonnen?“ Wir gingen davon aus, dass für die meisten Menschen auf ihrem Weg zum Glauben andere Menschen wichtig waren.
„Da denkt man über Mission nach – und dann ist es die eigene Mutter!“, kommentierte überrascht Martin Dutzmann, ein beteiligter Superintendent. Die einfache Frage nach den Menschen an unserem Weg des Glaubens hat überall, wo sie gestellt wurde, zu einem regen Austausch geführt. Jemand aus einer örtlichen Gemeindeleitung sagte überrascht: „Wir sitzen seit 20 Jahren zusammen und haben uns heute zum ersten Mal von unserem Glauben erzählt“ – auch hier erlebten alle Beteiligten diesen Austausch als enorm bereichernd.
Die Freude an der Weitergabe des eigenen Glaubens lässt sich nun weder durch Papiere verordnen noch per Mehrheit beschließen, sondern sie entsteht aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jesus hat seinen Jüngern gesagt: „Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass es schon brennte!“ (Lk 12,49) Feuer verbreitet sich durch Ansteckung. Es werden ansteckende Menschen gebraucht, um das Feuer des Evangeliums auf andere zu übertragen. Dieser Prozess bleibt ein Geschehen des Geistes Gottes, er ist weder regelbar noch zu instrumentalisieren. Aber es gibt Faktoren, die solches Anstecken unterstützen oder es verhindern. Wer wird schon in einer abweisenden Atmosphäre das mitteilen, was er schön findet? Umgekehrt: Wer kann für sich behalten, was ihn trägt, wenn andere offen danach fragen? Missionarische Haltungen brauchen einen unterstützenden und fördernden Raum, einen ‚Raum im Herzen‘. In einer Auseinandersetzung mit einer schwierigen Gemeinde bittet Paulus um diesen Raum des Vertrauens, ohne den sich nichts verändern kann: „Unser Mund hat sich für euch aufgetan, Korinther, unser Herz ist weit geworden. In uns ist es nicht zu eng für euch; eng ist es in eurem Herzen. Lasst doch als Antwort darauf […] auch euer Herz weit aufgehen! […] Gebt uns doch Raum in euren Herzen!“ (2Kor 6,11–13; 7,2).
Jesus: Gottes Weg – und die Antwort der Menschen
„Menschen suchen letztlich nicht die freundliche Begrüßung an der Tür, sondern bleibende Beziehungen.“ (Steven Croft)
„Welche Art von Kirche wird im 21. Jahrhundert blühen?“ Nach Meinung des Bischofs von Sheffield, Steven Croft, eines Vordenkers der Erneuerung in der anglikanischen Kirche, hängt die Antwort nicht von ihren Gebäuden ab, auch nicht davon, ob sie traditionelle oder zeitgenössische Musik benutzt, auch nicht von liturgischen Gewändern oder den neuesten Gemeindeaufbau-Moden. Es geht um Charakter: Was passiert innerhalb eurer Gemeinschaft? Wenn es die Wesenszüge Jesu sind, die sich in einer Gemeinde abbilden, dann ist sie attraktiv. Genauso bekamen die Christen auch ihren Namen: christus-ähnliche Leute, Christen.1 Neugierige, Suchende und Skeptiker spüren sehr schnell, ob sie willkommen sind. Und sie spüren sehr schnell, ob Menschen in der Kirche ehrlich und offen miteinander umgehen.
Im Neuen Testament wird von innen nach außen gedacht: Jesus hält das Herz, die Personmitte für das Schlüsselorgan, aus ihm kommt Gutes und Böses (Mk 7,15). Der Mund – als Beispiel für das Wahrnehmbare – kann nur ausdrücken, was ein Mensch wirklich denkt (Mt 12,34f.), das Auge nur so blicken, wie jemand im Inneren sein will (Mt 6,22f.). Biblische Haltungen, überzeugende Werte, offene Einstellungen prägen das Klima und tragen jede Begegnung. Veranstaltungen und ihre Formate setzen einen Rahmen, den Christinnen und Christen mit ihrem Wesen ausfüllen, damit diese Angebote oder Veranstaltungen wirken können.
Unsere Haltungen, Überzeugungen, Werte und Einstellungen werden in einem lebenslangen Lernprozess geformt, werden durch die Herzensbildung des Heiligen Geistes in der Persönlichkeit verankert. Der Schlüsselfaktor dafür ist die Begegnung mit dem Evangelium, ist eine gelebte Nachfolge Jesu. Jesus selbst lehrt, beeindruckt, fordert und prägt die, die sich nach ihm richten wollen.
Die Evangelien schildern uns Jesus als Menschen, der auf andere neugierig, liebevoll, offen und herausfordernd zuging. Matthäus berichtet die Reaktion nach der Bergpredigt: „Die Menge war sehr betroffen von seiner Lehre; denn er lehret sie wie einer, der göttliche Vollmacht hatte, und nicht wie ihre Schriftgelehrten“ (Mt 7,28f.). Jesus unterhielt sich mit einer Frau. Nach dem langen und sehr persönlichen Gespräch machte sie sich auf zu ihren Nachbarn mit der Erfahrung: „Kommt her, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe; ist er vielleicht der Messias?“ (Joh 4,29). Jesus ging auf Ausgeschlossene zu, aß mit Zöllnern, berührte Aussätzige, heilte Kranke, befreite Besessene und investierte einen beachtlichen Teil der drei Jahre, die er in der Öffentlichkeit auftrat, in den Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger – in zwölf junge Männer (Mk 3,13ff.), in den größeren Kreis der 72 (Lk 10,1 ff.17), in die Frauen, die zeitweilig mitwanderten (Lk 8,1–3).
Offene Türen und offene Herzen: Missionarische Grundhaltungen
„Als Stückeschreiber hielte ich meine Aufgabe für durchaus erfüllt, wenn es einem Stück jemals gelänge, eine Frage dermaßen zu stellen, dass die Zuschauer von dieser Stunde an ohne eine Antwort nicht mehr leben können – ohne ihre Antwort, ihre eigene, die sie nur mit dem Leben selber geben können.“ (Max Frisch)
Wahrnehmungsfähig und interessiert. Am Anfang jeder Begegnung steht das offene Wahrnehmen: Wer bist du? Wo kommst du her, wohin bist du unterwegs? Was hat dich geprägt? So wie Jesus sich Menschen zugewandt hat, braucht Mission Zuwendung und Interesse für die anderen. Wieder ist die Haltung entscheidend, nicht die Methode oder Technik: „Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr“ (Spr 20,12). Menschen spüren sehr genau, ob sie Objekte einer Bemühung oder Gegenüber eines ehrlichen Interesses sind – keine Beziehung ist möglich ohne dieses grundlegende Interesse. Und sie wird nicht weitergehen ohne das intensive Wahrnehmen der Realität der anderen: Wahrnehmen und Verstehen ist eine grundlegende Form der Liebe.
Auskunftsfähig und mitteilungsbereit. Ein Schlüsselvers der kommunikativen Mission ist der Rat aus 1. Petr 3,15: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“. Um in der Fragesituation auskunftsfähig zu sein, muss die Gemeinde gelernt haben, über ihren Glauben und ihre Hoffnung zu reden. Um dies verständlich zu tun, muss sie ihrerseits im Kontakt mit den Nöten, Problemen und Hoffnungen ihrer Umgebung sein; ohne diesen Austausch mit der Welt wird christliche Sprache schnell zu einem Ghetto. Auch kann die Gemeinde über ihr Leben Interesse wecken: „Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst“. Diese Sentenz von Paul Claudel wird da gefährlich, wo sie gegen die Predigt des Evangeliums ausgespielt wird. Lebenszeugnis ist immer überzeugend, und in der Situation des Gegenwindes, der die Gemeinden des 1. Petrusbriefes ausgesetzt waren, war es zeitweilig die einzige missionarische Option. Lebenszeugnis setzt aber gelingende Beziehungen voraus und ist keine Alternative zur einladenden Information über das Evangelium. Hätten sich die urchristlichen Missionare nur auf sprachlose Situationen des Lebenszeugnisses beschränkt, wäre das Evangelium nie über einen kleinen Winkel am Rande des römischen Imperiums hinausgelangt. Glaubwürdiges Leben und Handeln, Bildung und Lehre sowie Evangelisation und Verkündigung sind sich unterstützende Teile des einen Auftrages Jesu.
Beziehungsfähig und gastfreundlich. Aus Untersuchungen über Wege zum Glauben wissen wir, dass mehr als 80% aller Befragten angeben, über persönliche Beziehungen zum Glauben gefunden zu haben. Familie, Freundinnen, Nachbarn, Kolleginnen, Religionslehrer oder Jugendleiterin haben die Türen zu einem eigenen Glauben geöffnet.2 Gelingende Beziehungen sind der nicht zu ersetzende Schlüssel zur Weitergabe des Evangeliums. Jede Art von einladender Verkündigung setzt eine Unterfütterung durch vorhandene Beziehungen voraus: Menschen fassen Vertrauen und öffnen sich, wo sie von anderen Menschen begleitet werden, denen sie vertrauen. Die Urform gelingender Beziehung ist die Gastfreundschaft: das eigene Haus öffnen, anderen den Tisch decken und miteinander essen, sich einladen lassen und an einen fremden Tisch setzen – das wird in jeder Kultur als gelebte Beziehung verstanden. Wieder ist es Jesus, der seinen Gesandten ins Stammbuch schreibt: Lasst euch gerne einladen! Bleibt bei denen, die euch aufnehmen, und segnet sie dadurch! (Mt 10,11–13) Deshalb rufen die Briefe des Neuen Testaments ständig zur aktiven Gastfreundschaft auf (z.B. Röm 12,13 oder Hebr 13,2). „Heimat, die wir nur für uns selbst besitzen, macht uns eng und muffig. Jeder Gast bringt etwas ins Haus, das wir selber nicht haben“, hat Dorothee Sölle einmal geäußert.
Kontaktbereit und nah. Wenn die Gemeinde ihre Berufung als Salz der Erde (Mt 5,13) ernst nimmt, wird sie teilhaben an der Not und den Herausforderungen der Gesellschaft, in der sie lebt, und sich darein verwickeln lassen. Sie tut das vor allem an dem Ort, wo sie lebt – das ist eine potentielle Stärke des Ortsgemeinde-Systems. Parochie kann sich verwurzeln in und bei den Menschen, die an einem konkreten Ort, in einer bestimmten Region leben und arbeiten. Den Gemeinden vor Ort müssen die sozialen und wirtschaftlichen Notfälle bewusst sein und damit auf den Nägeln brennen – es sein denn, sie haben sich ins Ghetto der Selbstgenügsamkeit und Selbsterhaltung zurückgezogen. Die Berufung zum Licht der Welt (Mt 5,14–16) meint die erkennbare und wirkungsvolle Präsenz der Gemeinde Jesu, eine Orientierung für Menschen, die nur entsteht, wo der Gemeinde die raue Wirklichkeit dieser Welt nahekommen darf. Licht meint nicht die sektiererische Winkelexistenz oder den pflegeleichten Schutzraum des Abseitsexistierens.
Reaktionsfähig und ‚gelegentlich‘. Die Sprache des Neuen Testamentes, das Griechische, unterscheidet zwischen messbarer Zeit (chronos) und offener Zeit (kairos). Der Kairos ist die Gelegenheit: Etwas ist in diesem Augenblick einfach dran, plötzlich ist eine Tür offen, ein Moment der Nähe oder des Gelingens erscheint. Alles kommt darauf an, in diesem Moment zu reagieren. Die Weitergabe des Evangeliums setzt auf den Kairos, die Momente der Offenheit, in denen alles zusammenpasst: die Frage und die Beziehung, die Lebenssituation und die daran Beteiligten, Gottes Vorbereitung und des Menschen Reaktion. Die Missionsgeschichten des Neuen Testaments spiegeln immer wieder, dass diese „gelegentliche“, also die Gelegenheit ernst nehmende Reaktion der Zeuginnen und Zeugen sowie die vom Geist geschenkte Situation zusammengehören (Vgl. z.B. Apg 8,26ff. oder 16,14f.). „Evangelisieren heißt […]: Mit Hilfe des Wortes etwas sehen lassen, […] was gesehen zu haben sich zeitlich und ewig lohnt.“3
Nüchtern und zurückhaltend. Eine Grundregel der Kommunikation sagt, dass erst eine gelingende Beziehung mir das Recht auf Gehör verschafft: „Winning the right to be heard.“ Deshalb gehört Zuhören-Können zu den elementarsten Fähigkeiten der Mission: nüchtern die eigenen Grenzen kennen, um das Vertrauen eines anderen Menschen werben, das eigene Leben meinerseits nicht verstecken und den eingeräumten Kredit nicht überziehen. ‚Kredit‘ kommt übrigens vom lateinischen Wort für Glauben: Jemand vertraut mir, weil unsere Beziehung sich als tragfähig erweist. Der Kabarettist Hans Dieter Hüsch sagte: „Das ist übrigens das Wichtigste: Zuhören können. Ich lasse mir oft von Leuten ihren Beruf haarklein erklären, obwohl ich gar nichts davon verstehe. Aber der andere erzählt mir dabei sein ganzes Leben. Und ich sehe, wie er immer leidenschaftlicher wird. […] Dann sind sie nicht mehr zu bremsen und sie erzählen und erklären und beschreiben und machen und tun, bloß weil jemand gesagt hat: ‚Wie geht’s Ihnen?‘ und ‚Was machen Sie? Erzählen Sie doch mal!‘.“
Die Gemeinde: Ort für Begegnung und Wachstum
„Ein Missions-Audit ist keine Trickkiste. Es geht nur darum, die richtigen Fragen zu stellen und zu versuchen, die richtigen Antworten zu geben.“ (John Finney, The Well Church)
Wenn die Gemeinde Jesu als sein Leib so etwas wie Jesu irdischer Hauptwohnsitz zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft ist, dann hat sie eine Schlüsselaufgabe in der Einladung zum Glauben und in der Begleitung von Menschen, die den Weg des Glaubens betreten wollen. Aber wie macht sie das am besten? Am Anfang steht immer eine ehrliche Bestandsaufnahme. Die englische Kirche hat dazu die Instrument der „mission audits“ entwickelt: Ein Audit – ein ursprünglich in der Wirtschaft beheimatetes Instrument der Qualitätsentwicklung – wird so entworfen, dass es die Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes einer Gemeinde sowie die Initiierung bzw. Vertiefung der missionarischen Gemeindeentwicklung ermöglicht. Es beinhaltet meist Analysen des Kontextes, eine moderierte Evaluation anhand von Qualitäten, eine Projektphase der Verbesserung sowie eine Ausrichtung auf ein vorhandenes oder in dem Zusammenhang zu entwickelndes Leitbild.
Eines der interessantesten Modelle ist das Projekt „Vitale Gemeinde“ (Healthy Churches Handbook)4. Robert Warren, der Autor, entdeckte mit seiner Kollegin Janet Hogson in der Diözese Durham zwei auffallende statistische Zahlen: Zwischen 1990 und 1995 war die Gottesdienstteilnahme überall um 16% gesunken, aber unter den 260 Gemeinden der Diözese hatten zur gleichen Zeit 25 Gemeinden ein Teilnahme-Wachstum von über 16%. Warum wuchs hier die Beteiligung? Die üblichen, zu erwartenden Faktoren, z.B. bestimmte Arbeitsformen, griffen nicht; auffällig war eher die große Verschiedenheit. Die Gemeinden stammten aus allen Regionen der Diözese, umfassten alle sozialen Schichtungen sowie die verschiedenen kirchlichen Traditionen, der Klerus war ebenso unterschiedlich. Weder Umgebung noch Gemeindegröße, weder die theologische Prägung noch der Leitungsstil erklärten dieses Wachstum. Was also war dessen Geheimnis?
Hogson und Warren luden diese Gemeinden zu einem Auswertungstreffen ein. Das Ergebnis war: Keine dieser Gemeinden wollte dezidiert wachsen, zählbare Ergebnisse waren uninteressant, typischer war die geistliche Sehnsucht, besser Gemeinde zu sein, es ging um Qualität statt um Quantität. Die Kennzeichen solch einer vitalen, im biblischen Sinne gesunden Gemeinde wurden nicht durch Zahlen erfasst, sondern durch Ziele, Charakteristiken, Werte und Wünsche: Nicht bestimmte Arbeitsformen fördern die Lebendigkeit, sondern Werte und Ziele fördern eine Vielfalt von Ausdrucksformen. Alle hatten allerdings eine gemeinsame Themenliste, die sich in anderen Diözesen dann bestätigte. Diese sieben gemeinsamen Einstellungen – Warren nennt sie „marks of church“ – prägten durchgängig ihr Verhalten:
(1)Sie beziehen ihre Energie aus dem Glauben,
(2)haben eine nach außen gerichtete Sicht,
(3)fragen immer wieder, was Gott will,
(4)stellen sich den Kosten von Veränderung und Wachstum,
(5)handeln als Gemeinschaft,
(6)schaffen Raum für alle und
(7)tun nur einiges, aber das gut.
Diese gründlich ausdifferenzierten Merkmale werden nun interessierten Gemeinden zur Verfügung gestellt, damit diese ihrerseits daran arbeiten können, wo und wie sie besser Gemeinde sein können. Darin spiegelt sich so etwas eine ekklesiologische Grundregel. Es gibt zwei missionarische Grundbewegungen der Gemeinde Jesu, die jede Form von Gemeinde auf jeder Ebene miteinander im Gleichgewicht halten muss: die anziehende, attraktionale Bewegung und die hingehende, inkarnationale Bewegung, oder einfacher gesagt: Einladung und Hinausgehen, Sammlung und Sendung.
Der attraktionale Modus meint die offenen Türen, meint alles, wozu eine Gemeinde einlädt und was sie veranstaltet. Sie bietet Gottesdienste an – und macht die Erfahrung, dass immer wieder Neugierige und Suchende dazustoßen. Sie verbreitet das Evangelium auf möglichst vielen Wegen und erreicht über die messbaren Reaktionen hinaus ein Umfeld, das sehr wohl wahrnimmt, was die Gemeinde Jesu anbietet. Sie lädt Menschen zu ihren Gruppen, Kreisen, Veranstaltungen und Aktionen ein und will dort eine offene und einladende Gastgeberin sein. Gelegentlich allerdings reduziert sich eine Gemeinde auf ihren Attraktions-Modus – nur wer kommt, kommt auch in den Blick, nur wer an irgendetwas teilnimmt, ist beteiligt, nur wer sich auf-macht, wird als offen empfunden. Und unmerklich wird aus dieser Versammlung des lebendigen Gottes der Club der Gleichgesinnten.





























