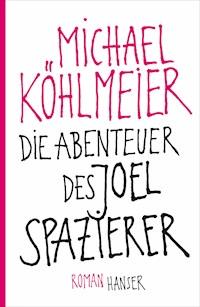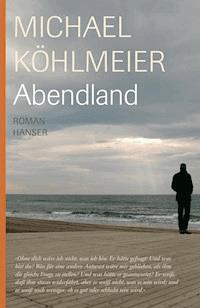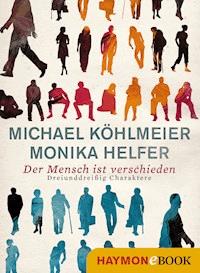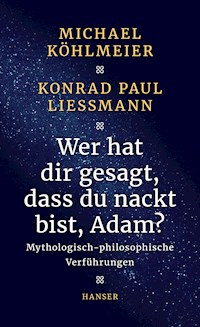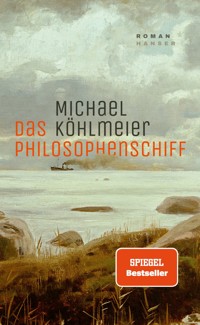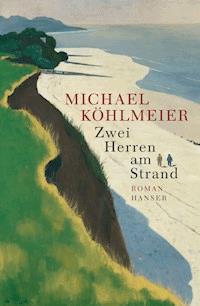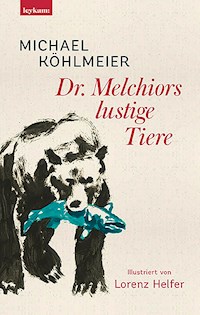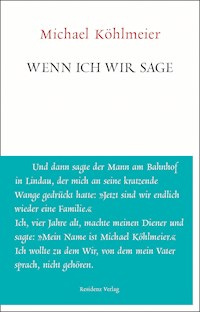Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael Köhlmeiers Erzählungen beginnen oft mit einem schlichten, ganz einfachen Satz, und doch ist man sofort mittendrin: "Ich hatte einen Fehler begangen, einen empfindlichen." Es geht in diesen Geschichten nicht um die ganz großen Themen, es geht um das, was nebenbei und zwischendurch passiert. Die Erzählung "Auf Bücher schießen und andere Kleinigkeiten" handelt von einem Traum, "Mut am Nachmittag" von einem Mann, der traurig ist. "Ein freier Nachmittag", "Unterhaltungen in der Küche" - davon erzählt der Autor meisterhaft, und irgendwann kommt dem Leser der Verdacht, dass es hier vielleicht doch um das ganze Leben geht. Sein großer Roman "Abendland" hat Kritiker wie Leser begeistert; in diesem Band, in dem auch sechs neue Erzählungen enthalten sind, kann man sich überzeugen, dass Michael Köhlmeier immer schon eines war: der Meister der kleinen Form.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke E-Book
Michael Köhlmeier
Mitten auf der Straße
Die Erzählungen
Deuticke
ISBN 978-3-552-06318-1
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2009/2015
Schutzumschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, München-Zürich, Christian Otto
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Bevor Max kam
Rita im bleichschwarzen Pullover
Caligula, der voll Tränen ist
Amsel Müller Heidelberg
Medi Winter
Das Öl des Südens
Die traurigste Geschichte
Die allertraurigste Geschichte
Muchti, der Retter
Muchti, der Atheist
Das Haus am Fluss
Jetti Lenobels Oma
A. P. aus Polen
Herr Alfred, leicht betrunken
Wolken bis auf Schulterhöhe
Am Abend eines heißen Tages
Die entfernte Verwandten des Terroristen
Arme Charlotte
Der Mai war mir gewogen
Wernhofers Traum
Ostern ’63
Jacobs letztes Wort
Muchti und die Geister
Drehbuch vom ewigen Leben
Birgittas Geburtstag
Der letzte Tag im August
Die Libelle
Caligulas Blitzableiter
Harte Schalen
Muchtis Bekehrung
Ein freier Nachmittag
Liebe, die erste
Trost von Beckett
Die Beichte
Die Augen und die Sonne
Ich, ein Detektiv
Chemische Träume
Muchti, der Zeuge
Fast eine Millionärin
Letzte Fragen
Die Geschichte einer Eisenstange
Grüne Nacht
Wenig Schlaf
Auf Bücher schießen und andere Kleinigkeiten
Caligula kehrt zurück
Herrn Alfreds Ziehsohn
Das gute und das böse Haus
Mut am Nachmittag
Muchti und der Birnenstiel
Ade, Wernhofer!
Das Bett
Der Wegbereiter
Der Termin
Der Joghurtdrink
Ruhe
Der nackte Mann
Der traurige Blick in die Weite
Unterhaltungen in der Küche: Über das Singen und das Messen
Sochiti Loch und Kogolkin Pach
Der Mund
Daidalos
Rotz-Risto
Der Dieb
Rosenkranz und Radio
Königsschach
Auf nach Jerusalem!
May You Never Be Alone Like Me
Schuhe aus Brandenburg, Litauen und noch weiter her
Der Mond
Messer im Kopf
Der Mantel
Der Song
Kafkas Prozeß, das Manuskript
Old Nick
Der traurige Blick in die Weite
Unterhaltungen in der Küche: Über fränkischen Sauerbraten
Roman von Montag bis Freitag
An der Kasse
Angriff am Nachmittag
Der Eisenmann
Pit Clausen
Die Kriegsbraut
Der verlorene Sohn
Die geeignete Würde
Der Ungar
Die Fenkarts
Walkner
Vom elektrischen Strom
Es ist alles still
Michael
Die Bichslers
Der Bundespräsident
Von alten Fotografien
Das Feuerwerk
Pia
Liebesgeschichte aus einem Mund
Menschenskind
Der Ameisenesser
Der Talisman
Reinhold Jack Juen
Tante Dodo
Und was heißt das jetzt?
Der Jäger und die Frau im Paradies
Nacht im Hotel
Von Kindern, Baggern und Schmerzen
Die Katze
Maro und Chucky
Über Verträge
Zwei Fremde im Zug
Heimkehr
Zoogeschichten
Herr Gabriel
Alles wird gut
Da kannst du gar nichts machen
Mein Leben in der Zeit ohne Plattenspieler
Nachts um eins am Telefon
Der Gedanke, dass du es nicht merkst
Wo soll ich morgen mein Brot kaufen?
Würden Sie bitte auf mich aufpassen!
Die Republik der Schlaflosen
Die Hälfte der Gedanken
Die schöne Jetti
Der Mann, der ich mit dreizehn war
Sprich ruhig weiter!
Unsere Hymne
Hundert
Ich habe heute einen guten Tag gehabt
Das Unvorhergesehene
Unter dem Waggon
Der Abend verlief ruhig und gesprächig
Die Existenzialisten
Wir müssen es anders angehen
Als der Daumen meines Vaters abbrach
Liste eins: Sieben Freunde
Der Garten Eden
Auch Richards Schwester hat ein Pferd
Theorie des Randschattens
Liste zwei: In einer Illustrierten sah ich ein Bild
Jetti hat einen Mann
Vom Mann, der Heimweh hatte
Die Schweinehirtin
Der Schutzpatron
Vom Mann, der Heimweh hatte
Der Sieger
Die Starke und ihr Bruder
Rumpelstilzchen
Der Aufsteiger
Die Seherin
Die Mama im Winter ’63
Der Fremde
Mitten auf der Straße
Alabama
Der Silberlöffel
Mitten auf der Straße
Unter Dieben
Von einem bemerkenswerten Gespräch zwischen Henry A. Kissinger und Tschou En-lai
Der Skorpion
Für Monika
für Oliver
für Undine
für Lorenz
für Paula
Bevor Max kam
Rita im bleichschwarzen Pullover
Sie lachte so laut, dass jeder im Kaffeehaus die Kapazität ihrer Lungen spüren konnte – und da wusste ich: Das ist Rita, die ich vor fünfzehn Jahren verloren hatte, die Schwimmerin, breit in den Schultern. Sie trug einen bleichschwarzen Pullover, was soll ich sagen, so einen hatte sie damals schon getragen, und der hatte mir immer gut an ihr gefallen, aber nun fand ich ihn unvorteilhaft, weil ihr Hals darin so verzweifelt durchtrainiert wirkte.
So, dachte ich, die setzt sich jetzt zu mir. Auch recht, dachte ich, bin ohnehin viel zu früh dran. Wenn Max kommt, wird sie gehen, alle gehen, wenn Max kommt.
»Was war denn damals?«, fragte ich.
»Wie viel weißt du?«, fragte sie und setzte sich und bestellte ein Bier.
»Dass ihr nach London gefahren seid«, sagte ich, »du und dein Mann. Mehr weiß ich nicht. Bist du noch mit ihm zusammen?«
Sie ruckte mit dem Kopf, was wohl eine Verneinung sein sollte. Aber es fiel ihr schwer, den Blick auf mich scharfzustellen, und ich dachte, vielleicht ist sie doch noch mit ihm zusammen, und er kommt gleich zur Tür herein, der Mann, der ein eifersüchtiges Arschloch war, der sich Zigaretten auf der Hand ausdrückte, wenn er seine Frau mit jemandem reden sah.
»Auf der Fähre über den Kanal«, begann sie, »haben wir drei Leute kennengelernt, ein Ehepaar und den Liebhaber der Frau, hat sich herausgestellt. An die Frau erinnere ich mich sogar noch. Die hatte so eine amazonenhafte Kompaktheit und Kraft im Kinn und einen dunklen Schimmer auf der Oberlippe, das hat mir gefallen. Wie die drei miteinander geschmust haben, das hat mir auch gefallen. Gleichzeitig, zu dritt. Ich lehnte auf Ellbogenberührung neben der Frau an der Reling.
Schau, sagte ich zu meinem Mann, die machen es doch gut.
Mhm, sagte er.
Vielleicht treiben sie es auch zu dritt im Bett, sagte ich. Und sagte: Du weißt, dass ich diesbezüglich keine Ambitionen habe, mein Lieber, aber doch nur deswegen, weil ich bisher dachte, das kann nur Streit und Wahnsinn geben.
So habe ich zu meinem Mann geredet. Weißt du, er war ja nur das Arschloch, wenn wir beide allein waren. Wenn irgendwelche Leute in der Nähe waren, die zuhörten, dann war er der Liberale, der Tolerante. Ich habe absichtlich so laut gesprochen, dass die drei zuhören konnten. Und prompt haben sie uns ihre Dreiereinheit bis ins Kleinste auseinandergesetzt.
Und mein Mann sagte: Gut, Rita! Ha, Rita! Großartig, Rita, ha?
Und ich sagte: Ja, wirklich, wirklich großartig.
Und er, der Oberliberale: He, ihr drei, können wir zwei da nicht mitmachen?
Nur dem Gelächter zuliebe und dem Image zuliebe. Und zu mir sagte er: Sei nicht so tantig, Rita! Warum haben wir uns denn stundenlang auf Vietnamdemonstrationen die Füße plattgetreten, wenn dann nicht einmal ein fahrtwinddurchbrauster Fünfer rausschaut!
So hat er sich ausgedrückt. Das hat bei dem Trio eingeschlagen. Wir beide haben eingeschlagen, wir haben ja auch wirklich schön ausgesehen, wir beide, mit unseren fahrtwinddurchbrausten Haaren. Mein Mann ließ sich die Adresse von ihrem Hotel in London geben und küsste den Fetzen Papier und den Kugelschreiber.
Und dann waren wir also in London und saßen in unserem Sparhotel. Er und ich. Allein. Er so ein Gesicht.
Sage ich zu ihm: Lassen wir das doch!
Aber er: Nein, du hast es eingefädelt, jetzt wird es ausgelöffelt.
Ich: Wie kann der Mensch auslöffeln, was er eingefädelt hat?
Um acht war die Verabredung. Wir nehmen den Bus.
Ich sage noch: Siehst du, es ist dir nicht ernst, zu so einer Sache fährt man mit dem Taxi!
Weißt du, ich glaube, dass es in jeder Beziehung vielleicht wirklich nur ein einziges Mal großes Glück oder großes Pech gibt. Bei uns war es Pech, und unser großes Pech war, dass wir die einzigen Fahrgäste in dem Bus waren. Soll einer noch sagen, dass das ein Zufall ist! Ein leerer Bus mitten in London um acht Uhr abends! Mein Mann zündete sich mit großer Flamme eine Zigarette an.
Du weißt, was jetzt kommt, sagte er.
Und ich beneidete ihn. Ja, das tat ich. Ich wusste ja, dass er sich kein Loch in die Hand brennen wird. Aber ich wusste auch, dass er in diesem Augenblick daran glaubte. Sieh ihn an, dachte ich: Welche Leidenschaft, welche Überzeugung, welche Hingabe, welche blöde Raserei! Mein Leben kam mir dagegen vor wie eine Wärmflasche morgens um halb fünf, unten bei den Füßen.
Und da hielt der Bus und Leute stiegen ein, und ich dachte, das war eigentlich ein schönes Theater von meinem Mann, jetzt mache ich das auch. Ich bin ausgestiegen und davongerannt.
Noch im Rennen dachte ich, gleich bleibe ich stehen, ein paar Meter laufe ich noch, dann bleibe ich stehen. Aber ich hatte so eine wunderbare Kondition damals, ich belegte gerade einen Karatekurs, weißt du. Ich rannte über Gleise und an Menschen vorbei, die mir zuriefen und zuwinkten, und ich rief zurück und winkte zurück, ich rannte, bis mir einfiel, dass ich ja gar nicht Englisch konnte. Was habe ich denen denn zurückgerufen, dachte ich und blieb stehen. Und es war so, dass ich nicht wusste, wie unser Hotel hieß, weil ich das alles meinem Mann überlassen hatte, und nicht wusste, wo ich war, und eigentlich überhaupt nichts wusste, und außerdem hatte ich weder meinen Pass noch einen einzigen Schein Geld bei mir, und meine Jacke hatte ich im Bus ausgezogen. Und meinen Mann hatte ich abgehängt.
Und weißt du was? Ich habe Englisch gelernt, mir einen Pass ausstellen lassen und Geld verdient. Wir haben uns via Fernbedienung scheiden lassen. Ich habe wieder geheiratet, habe eine Tochter, die heißt Janis, und ich bin schon wieder geschieden.«
Das war Rita.
»So, wie du dasitzt«, sagte sie, »sitzt du öfter da, schätze ich.«
»Mittwochs immer«, sagte ich.
»Komme ich wieder einmal vorbei«, sagte sie, bat mich, ihr Bier zu bezahlen, und ging.
Bevor Max kam, aß ich noch eine Kleinigkeit.
Caligula, der voll Tränen ist
Der Mann war alles andere als ein Stiefelchen. Er wog hundertsechzig Kilo. Sein Gewicht war bekannter als sein Spitzname und noch viel bekannter als sein Name. Er arbeitete in der Werbung, aber wofür er warb, weiß ich bis heute nicht.
»Warum sagt man Caligula zu dir?«, fragte ich ihn.
»Weil ich früher eher dünn war«, sagte er. »Lass mich eine Stunde bei dir an deinem Tisch sitzen«, sagte er, »und hör mir zu. Ich muss mein Maul bewegen, und der Arzt sagt, Reden ist besser als Fressen. Ich bin ein klassischer Fall. Ich merke, dass ich stinke, und muss denken: Schon wieder beleidigt mich die Natur. Und weil ich grundsätzlich nichts hergeben will, weil ich der Meinung bin, dass mir immer alles weggenommen wird, darum weine ich nicht, obwohl mir zum Weinen ist, sondern ich fresse.
Ich bin ein klassischer Fall. Anderes Beispiel: Meine Frau betrügt mich. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass betrügen immer noch heißt, einer tut etwas und sagt dem anderen, er tue etwas anderes, dann betrügt sie mich gar nicht. Gestern Morgen hat sie mir alles gesagt. Sie hat zwei Liebhaber, einen alten und einen jungen. Hat sie gesagt. Der alte macht gut, was ihr Vater bei ihr angerichtet hat, weil er sie die Matura nicht hat machen lassen, der junge schläft einfach nur mit ihr.
Schau mich an, wie ich hier sitze! Schau her, mein Bauch ist so groß, dass, wenn ich aufrecht sitze, von meinem Oberschenkel nur noch drei Zentimeter zu sehen sind. Wenn ich mich auch nur ein wenig vorbeuge, um mein Mineralwässerchen zu schlürfen, dann habe ich gar keinen Oberschenkel mehr. Während ich hier ohne nennenswerte Oberschenkel sitze, ist meine Frau beschäftigt. Ich bin ein klassischer Fall von Wahnwitz. Ich weiß, womit sie beschäftigt ist. Aber ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin nur eifersüchtig auf die Vergangenheit. Dass sie mich jetzt betrügt, kann ich verstehen. Ich bin ja kein Unmensch, obwohl ich ein Unmensch bin.
Als ich noch Caligula war, das Stiefelchen, zweiundsiebzig Kilo schwer, jung verheiratet, an den Schläfen eine königlich blaue Ader, die inzwischen verschwunden ist, ich weiß nicht, wohin. Damals hat mich meine Frau zum ersten Mal betrogen. Schau mich an! Was ich bin, das bin ich nicht. In mir steckt Caligula, der zweiundsiebzig Kilo wiegt. Der bin ich. Ich bin ein klassischer Fall, ein Objekt der Willkür der Natur. Meine Frau neigt zu schwarzen Lederhosen und schwarzen Lederjacken, und sie besitzt auch eine schwarze Lederkappe. Ich, an sich, bin ein Naturbursche. Ich liebe die Natur. Warum hasst sie mich so! Warum lässt mich die Natur stinken? Warum macht sie mich so fett? Darunter leide ich. Und am meisten leide ich an einer längst verjährten Erinnerung …
Vor fünfzehn Jahren war das. Ich öffnete das Nachtkästchen auf der Bettseite meiner Frau, und da lag ein Gedichtband von Leonhard Cohen. Ich schlug das Buch auf, und da war eine Zeile unterstrichen, die lautete: Ich bin der Mann, der tötet. Und gestern Morgen fällt mir das Buch in die Hand, und ich sage zu meiner Frau: Ah, ja, das wollte ich dich schon vor fünfzehn Jahren fragen.
Was denn, Caligula, sagt sie, was wolltest du mich schon vor fünfzehn Jahren fragen?
Was das bedeutet, dass dieser Satz rot unterstrichen ist. Zeig her, sagt sie. Ah, das, sagt sie, das hat der Dings gemacht, wie heißt er gleich.
Was hat der gemacht, frage ich.
Ach, das ist doch vorbei, Caligula, sagt sie. Er – wie heißt er denn nur – hat sich überlegt, dich zu töten.
Um Gottes willen, sage ich, wer wollte mich töten?
Und warum?
Weil er eifersüchtig auf dich war. Du hattest damals zweiundsiebzig Kilo, Caligula. Alle sagten Caligula zu dir. Ich weiß schon, dass du diesen Namen für dich selber erfunden hast, aber alle fanden ihn zutreffend. Und er – wenn mir nur einfiele, wie er heißt –, er war so grässlich dick, und das hat ihn fertiggemacht.
Hast du etwas mit ihm gehabt?, fragte ich. – So blöd war ich gestern Morgen noch!
Aber ja, sagte sie.
Mit ihm, der so grässlich dick war? Gegen mich, der ich noch nicht so grässlich dick war? Das verstehe ich nicht! Warum hast du mich damals betrogen und betrügst mich heute nicht?
Aber, sagte sie und schob mit ihrem spitzen Zeigefinger die Lederschildkappe lässig über der Stirn zurecht, aber ich betrüge dich doch, Caligula!
Sie betrügt mich. Sie meint, sie betrügt mich. Aber das kann sie gar nicht. Wer bin ich denn? Sie kann mich ja nicht einmal mehr sehen. Ich bin einer, der zweiundsiebzig Kilo wiegt, und der in einen Fetttümpel gefallen ist. Mich sieht niemand. Ich bin eigentlich tot. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich kann ja meine Frau nicht zu einer keuschen Witwenschaft zwingen. Aber damals – damals war ich der, der ich war. Und damals hat sie mich mit einem betrogen, der die moralische Verderbtheit besaß, einen Satz zu unterstreichen, der da lautet: Ich bin der Mann, der tötet. – Verstehst du meinen Kummer?«
»Ja«, sagte ich. »Willst du jetzt etwas essen?«
»Will ich«, sagte Caligula, »will ich, will ich. Aber besser ist, ich rede.«
»Dann rede!«
Und dann erzählte mir Caligula die Geschichte noch einmal. Und dann sagte er: »Jetzt bin ich dermaßen voll von Tränen, dass ich dem Rat meines Arztes nicht mehr Folge leisten kann. Gewiss komme ich den ästhetischen Kriterien, die dein Leben bestimmen, entgegen, wenn ich mich an einen anderen Tisch setze, um dort zwei große Gulasche in mich hineinzustürzen. Ade!«
»Bis zu irgendeinem Mittwoch!«, sagte ich.
Bevor Max kam, notierte ich mir noch den Einkaufszettel für morgen, denn ich war dran, und ich hatte ein paar ausgefallene Wünsche.
AmselMüller Heidelberg
Ich rief den Ober, weil ich ein Paar Frankfurter wollte, da ertönte wie ein Aufschrei von hinten aus dem Café mein Name. Es war Jochen aus Braunschweig, mit beiden Armen fuchtelte er, ich hatte ihn sehr lange nicht mehr gesehen. Und er hatte mich überhaupt noch nie gesehen. Er war nämlich blind, und zwar von Geburt an, eine schwarze Brille hatte er auch früher nie getragen.
Ich hatte ihn über seine damalige Freundin kennengelernt. Das war vor über zwanzig Jahren. Ich hatte in einer Kneipe mit Kommilitonen getrunken und war übermütig gewesen und zum Lügen aufgelegt.
»Ich werde«, hatte ich gewettet, »in der nächsten halben Stunde eine Lügengeschichte erzählen.«
Da hörte ich hinter mir eine Stimme, und obwohl es eine Frauenstimme war, erinnerte sie mich an meine eigene Stimme, und ich sagte: »Darf ich euch meine Schwester vorstellen?«
Später erst erfuhr ich ihren Namen: Amsel Müller Heidelberg. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter und deutete auf meine Freunde: »Kannst du denen bestätigen …« – »… dass ich deine Schwester bin?«, fragte sie. Sie hatte nämlich zugehört.
Sie setzte sich an unseren Tisch, neben mich, sie roch nach Haschisch. Sie war klein, hatte schwarze Haare und trug eine schmale, tropfenförmige Brille. Sie hatte einen weichen, weit vorgewölbten, sehr roten Mund, den sie manchmal zu einer Knospe zusammenzog.
»So«, sagten die Freunde, »jetzt ist die halbe Stunde vorbei. Wo ist deine Lügengeschichte?«
»Sie ist nicht meine Schwester«, sagte ich.
»Was redest du da«, sagte sie, »natürlich bin ich deine Schwester.«
Ich musste zahlen. Für alle hatte ich die Wette verloren. Und dann saßen wir bis früh um vier in der Kneipe, und Amsel und ich erzählten von unserer Kindheit. Sie wusste so viele Geschichten, und sie wusste sie so bunt und lebendig zu schildern, und dann erzählte sie, wie sie mich, als wir sechs und sieben Jahre alt gewesen waren, in der Nacht geweckt habe, wie sie mit mir an der Hand zum Elternschlafzimmer geschlichen sei.
»Die Tür war offen«, sagte sie, »nur einen Spalt weit, aber wir konnten hineinsehen. Und da haben wir den Papa in Anzug und Mantel und Handschuhen am Bett der schlafenden Mama sitzen sehen, am Fußende, und den Kopf hatte er in die Hände gestützt, und das war das Traurigste, was ich je gesehen habe …«
Und dabei schaute uns Amsel durch ihre Brille an, einen nach dem anderen, und ihre Augen waren wie Murmeln. »Und wenn ich ihn«, geschickt vermied sie es, mich beim Namen zu nennen, sie wusste ja nicht, wie ich hieß, »wenn ich den Kleinen nicht bei mir gehabt hätte«, sagte sie, »dann wäre ich in dieser Nacht von zu Hause weggelaufen.«
Dann ging sie mit mir.
Sie war mit Brille schön, und ohne Brille war sie auch schön. Eine Brust zeigte sie mir. Aber sie wollte nicht mit mir schlafen.
»Weil wir Brüderchen und Schwesterchen sind?«, fragte ich.
Sie sagte: »Weil ich noch einen Freund habe.«
»Was heißt noch?«
»Ich muss schauen, ob ich ihn noch mag«, sagte sie.
»Komm morgen zu uns. Wenn ich euch nebeneinander sehe, dann kenne ich mich wieder aus.«
Ihr Freund war ebendieser Jochen, der mich nach über zwanzig Jahren an den beiden Worten Herr und Ober wiedererkannt hatte. Als ich ihn damals in der Küche sitzen sah, die Augäpfel nach oben gedreht, den Kopf in Achterbewegungen hin und her schwenkend, dachte ich: Die Sache ist für mich so gut wie gewonnen.
Amsel war in der Küche, und er fragte mich: »Wie heißt du?«
Sie blieb bei ihm. Nach den Spaghetti tat sie uns ihren Entschluss kund.
Das war die Geschichte, ich habe die beiden seither nicht wiedergesehen.
Ich setzte mich zu Jochen und fragte: »Bist du noch mit Amsel zusammen?«
»Nein«, sagte er, »sie lebt nicht mehr. Wir sind nach dem Studium nach Wien gezogen, ich bin Lehrer geworden, heute übersetze ich Bücher in Blindenschrift. Aus Amsel ist nichts geworden. Und da hat sie sich unter die U-Bahn geworfen.«
»Was heißt, aus ihr ist nichts geworden?«, fragte ich. Sein Mund war brutal offen und breit, und die Lippen walkten sich im Rhythmus seines Kopfes, an den Zähnen konnte man die Jahre sehen.
»Es ist einfach nichts aus ihr geworden«, sagte er. »Weißt du, die Geschichte damals hatte großen Eindruck auf sie gemacht.«
»Welche Geschichte?«, fragte ich, tat arglos.
»Oh, das wäre schrecklich, wenn du die Sache vergessen hättest«, sagte er. »Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und wolltest sie mir wegnehmen, und sie ist bei mir geblieben. Aber dann hat es ihr leid getan.«
»Das glaube ich doch nicht«, sagte ich, »sie hat mich ja höchstens zehn Stunden in ihrem Leben gesehen!«
»Sie hat mich gebeten, ich soll ihr deinen Namen sagen. Habe ich nicht getan. Habe ich nicht getan, nein, nicht ums Verrecken!«
»Also«, sagte ich, »also, Jochen, es ist schon sonderbar genug, dass wir uns duzen, und dass wir beide unsere Namen noch wissen, ist noch sonderbarer, aber wenn du mir jetzt erzählen willst, die Amsel sei wegen mir vor die U-Bahn gesprungen …«
»Sie war von jenem Tag an traurig. Was soll ich da anderes denken? Was habt ihr eigentlich gemacht? Sie war in der Nacht in deinem Zimmer, das hat sie erzählt …«
»Mein Gott, Jochen«, rief ich, »das ist über zwanzig Jahre her!«
»Spielt das eine Rolle«, brauste er auf. In seinen Augen war nur Weißes. »Sie hat seit damals nicht mehr mit mir geschlafen! Ich habe gesagt: Du tust es nicht, weil ich blind bin. Sie hat gesagt, ich sei ein Idiot, wenn ich das glaube. Ich wusste nicht, dass du hier in diesem Café bist. Wie sollte ich das wissen! Sei so gut und hau ab! Lass mich in Frieden!«
Das tat ich. Ich ging zu meinem Tisch zurück. Die Frankfurter waren kalt.
Medi Winter
»Ich war drei Wochen in den USA«, sagte Medi Winter. »Ich muss dir etwas Merkwürdiges erzählen.«
»Lass dich auf einen Schnaps einladen, Medi«, sagte ich.
»War Max schon hier?«
»In einer halben Stunde wird er kommen.«
»Ich will euch nicht stören«, sagte sie und setzte sich auf eine Pobacke.
Sie trug eine schwarze Stretchhose, die ihr knapp bis zur Mitte der Waden reichte. Ich schätzte sie um die sechzig. Sie wirkte jünger. Feine Bündel von Fältchen schoben sich an ihren Wangen zusammen, wenn sie lachte. Ihr Haar war grau und von weißen Strähnen durchzogen und drahtig. Vielleicht wirkte sie deshalb jünger, weil sie ein Leben lang Medi gerufen worden war.
Bis fünfzig hatte sie als Assistentin bei einem Zahnarzt gearbeitet, von dem ich nur weiß, dass er Walter hieß. Als er starb, hat er ihr etwas hinterlassen, davon konnte sie bescheiden leben und reisen. Und das tat sie. Sie war seine Geliebte gewesen. Das hat Medi nie abgestritten, und die Witwe des Arztes hatte Medis Erbanspruch nie in Frage gestellt.
»Ich war mit dem Bus von Los Angeles nach New York unterwegs«, erzählte Medi, »und in einem Motel irgendwo in Ohio lernte ich Staken kennen, und wir haben etwas getan, was eigentlich nur junge Menschen tun, was ich aber als junger Mensch nicht getan habe.
Unsere Zimmer lagen nebeneinander, und es war so, dass wir beide zufällig im selben Augenblick unsere Schlüssel ins Schloss steckten, und das war so komisch und gleichzeitig so eindeutig, dass jedes Abwenden blanke, kindische Idiotie gewesen wäre und wir, weil wir nun einmal sehr erwachsen waren, nichts anderes tun konnten, als miteinander in eines der Zimmer zu gehen.
Du weißt, dass ich viel gelernt habe, seit Walter tot ist, und dass ich vorher von Walter auch viel gelernt habe, aber es fällt mir immer noch schwer, über manche Dinge zu sprechen, sogar vor dir.
Wir umarmten uns und schlossen in der Umarmung die Tür ab, das heißt, ich tat es, ich tat es hinter dem Rücken und war selber überrascht, wie geschickt ich dabei war.
Also, wir legten uns aufs Bett. Ja. Ich wusste nicht einmal, was für einer Nationalität er angehörte, natürlich wusste ich seinen Namen nicht, dass er Staken hieß, sagte er mir erst spät in der Nacht.
Ich wollte ihn haben, aber nichts von ihm wissen, und er auch nicht von mir. Es war nichts Verrücktes, was du jetzt vielleicht denkst, keine l’Amour fou mit Verrenkungen und viel Schweiß. In unserem Alter schwitzt man nur wenig. Weil man auch nur noch wenig trinkt. Ganz leise und sanft haben wir miteinander geschlafen.
Er war schlohweiß, Walter hatte bis zum Schluss seine vollen schwarzen Haare gehabt, und auch sonst gab es nicht die geringsten Ähnlichkeiten zwischen den beiden.
Es war früher Abend, und die Sonne schien flach durch das Fenster und traf die Wand über dem Bett und war ein verschobenes, gelbes Viereck. Wir lagen darunter im Schatten.
Er neigte sein Gesicht über mich und küsste mich auf die Augenbraue, dorthin, wo der Knochen bei mir so vorsteht. Und aus der Nähe, aus dieser extremen Nähe, haben seine Mundwinkel ausgesehen, wie Walters Mundwinkel ausgesehen haben, da waren die zwei feinen Kerben rechts und links, die so schwer zu rasieren waren, und auch die Nase hat ausgesehen wie Walters Nase, sogar noch schmaler.
Und ich sagte: Walter, das ist schön. Zur Probe sagte ich das und ganz gefasst.
Er wollte sich aufstützen, aber ich hielt ihn fest. Es war noch zu hell, und ich wünschte nicht, von ihm betrachtet zu werden, wenn ich das Licht auf meinem Körper hatte und er den Schatten im Gesicht. Außerdem, das wusste ich, würde alle Illusion dahin sein, wenn er aus der extremen Nahaufnahme herausträte – ja, ich muss es so ausdrücken.
Und nun redete er auch. Ich weiß nicht, was für eine Sprache es war, aber es hat geklungen wie Walters Kauderwelsch, wenn er mit einem Patienten beschäftigt war und mir Anweisungen gab, da hat er keine Worte gesagt, sondern einfach nur so Laute ausgestoßen. Er sei dann so konzentriert, dass er sich nicht auch noch um die Sprache kümmern könne, sagte er. Und es war ja auch nicht nötig, wir beide waren gut aufeinander eingespielt gewesen.
Ich sagte: Walter, bitte, bitte, sei so gut, und erschreck mich nicht, ich habe wahnsinnige Angst, wenn du ein Geist bist, der mir bis Ohio gefolgt ist.
Ein bisschen gespielt war das noch, aber nicht ganz, nur ein bisschen noch. Und er antwortete wieder in seinem Kauderwelsch.
Da bildete ich mir ein, ich hätte etwas verstanden, nämlich einen Namen, nämlich Maria.
Ich hielt ihn am Nacken fest und sagte: Was, Walter, was hast du mit einer Maria?
Und er redete weiter, seine Augen, von denen ich auch nur die Winkel sah, wurden feucht, und ich sagte: Was weinst du, Walter? Weinst du, weil du drüben bist und ich hier bin – so drückte ich mich aus.
Weißt du, ich wollte, dass es sentimental klingt, weil ich dann, so dachte ich, nicht ganz den Verstand verliere.
Und er nickte. Nickte so heftig, dass er mir beinahe entglitten wäre.
Aber, sagte ich, ich bin doch bei dir.
Ich roch seinen Atem. Man würde wohl allgemein sagen, dass der nicht so gut gerochen hat. Als Zahnarzthelferin weiß ich, wenn der Mensch Brücken im Mund hat, dann kann er die Zähne pflegen, wie er will, ein wenig wird er immer riechen. Aber ich mochte diesen Geruch. Und ich sagte es zu ihm.
Jetzt kann ich dir das Wichtigste endlich sagen, sagte ich. Und ich sagte es ihm …
Ach, ich will dich nicht weiter stören. Max wird wohl auch gleich kommen …«
»Nein, Medi«, sagte ich, »du störst mich doch nicht! Erzähl doch, was war das Wichtigste?«
»Nein, das möchte ich nicht. Vielleicht später, wenn es nicht mehr so frisch in mir ist.«
Sie warf sich die Jacke über und lächelte und winkte mit den Fingern wie ein junges Ding.
Bevor Max kam, fühlte ich ein philosophisches Ziehen in der Herzgegend und war glücklich darüber.
Das Öl des Südens
Das war ein einzigartiger Abend! Unvergleichlich! Erst ertönte eine Glocke. Sie wurde geschlagen vom Herrn Ober, eine zarte, vierköpfige Bronzeschelle, wie wir sie von unseren Ministrantenjahren her kennen.
»Meine Damen und Herren«, rief er ins Kaffeehaus hinein, »es könnte sein, dass es in den nächsten Minuten anfängt, nach Öl zu riechen. Bitte, seien Sie nicht beunruhigt, es wird lediglich unsere Heizung repariert. Morgen wird alles sein, wie es immer war. Wenn Sie gehen wollen, verstehen wir Sie. Wer dennoch bleibt, dessen Konsumtion wird nur zu fünfzig Prozent berechnet.«
Ich war der Einzige, der blieb. Es stank sehr nach Öl. Es stank nach Öl, als wäre das Café ein frisch entleertes Ölfass. Der Herr Ober träufelte Kölnisch Wasser in sein Taschentuch und hielt es sich an die Nase.
»Wollen Sie auch ein paar Tropfen?«, fragte er mich.
»Ist nicht nötig«, sagte ich.
Ich blieb. Nicht, weil ich nur fünfzig Prozent von meinem großen Schwarzen, meinem Mineralwasser und meinen Frankfurtern mit Kren bezahlen wollte, blieb ich. Ich blieb, weil mir der Ölgeruch eine Geschichte in Erinnerung brachte, die mich für eine kleine Stunde aus der Zeit hob und mir ans Herz griff, und ich fürchtete, die Atmosphäre der Geschichte würde verduften wie der Ölgeruch, wenn ich das Café verließ.
Ich war fünfzehn oder sechzehn gewesen, hatte auf dem Land gelebt. Es war in den Sommerferien, ich arbeitete bei der Post als Briefträger. Mir war ein schlechter Bezirk zugeteilt worden, das heißt ein armer Bezirk, mit viel Trinkgeld konnte nicht gerechnet werden, Arbeitersiedlungen, die aus Zweifamilienhäuschen bestanden und von dichtgestopften Gemüsegärten umgeben waren. Später bauten die Söhne ihre Häuser in die Gärten. Verantwortung lastete auf mir. Ich hatte nicht nur die Renten auszutragen, sondern auch RSA-Gerichtsbriefe.
Da war ein finsteres Haus mit einem finsteren Hof, auf dem fette Kohle gelagert wurde. In unserer Gemeinde gab es zwei Kohlen- und Ölhändler, einen erfolgreichen und einen weniger erfolgreichen. Letzterer war meiner.
Und in seinem Haus sah ich die schlimmste Armut, die ich bis dahin mit eigenen Augen gesehen hatte. Im Keller des Hauses lebte eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern in einem Raum, dessen Boden aus gestampftem Lehm war. Ein Fensterchen gab es, das war kleiner als meine Postlertasche.
Ich erinnere mich nur noch an wenig. Die Frau war dunkel, hatte dunkle, große Augen, dunkle Haare und lachte nicht. Sie war höchstens zwanzig. Sie verstand unsere Sprache nicht.
Wenn ich ihr die Post gab, durchströmte mich ein Gefühl, das ich bis dahin nicht in mir gefunden hatte, eine Gefühlssymphonie. Mitleid war natürlich dabei, aber zuvorderst waren Ekel und Neugier auf Verderbtheit und warme, körperwarme Verlockung.
Ich war zum ersten Mal in einer Weise verliebt, die weder hehr noch beflügelnd, weder glückvoll noch sehnsüchtig, sondern nur süchtig und leiderfüllt war.
Ihr Mann sitze im Gefängnis, wurde in der Post gesagt.
Daher die RSA-Briefe, die Anwaltbriefe, alles unangenehme Post und täglich.
Ich legte die Briefe nicht einfach auf ihre Schwelle, ich klopfte, und sie öffnete.
Die hellen, sonnigen Schwimmbadnachmittage, wenn meine Arbeit getan war, kamen mir sinnlos und auf ewig verloren vor. Ich saß im Schatten der Bäume und wartete auf den nächsten Tag. Ihre Wohnung roch nach Öl, das ganze Haus roch nach Öl, nach Öl und muffiger Wäsche, nach Bohnerwachs und Kinderpisse. Für immer wird mich dieser Geruch an die erste Sucht meines Lebens erinnern. Und Frauen, um deren Oberlippe ein feiner Flaum liegt, die gefallen mir.
Und dann war Monatsende, und uns Postlern wurden Stahlruten und Rentengelder ausgehändigt. Erstere, damit wir Letztere verteidigen. Wir zerschnitten uns die Finger, kerbten uns die feine Haut neben den Fingernägeln blutig, die Geldscheine waren nämlich neu und scharf – und es konnte vorkommen, dass zwei aneinanderhingen.
Bei mir kam es vor. Mir wurde ein Tausender zu viel ausgegeben. Das war ungefähr ein Drittel dessen, was ich in einem Monat verdiente. Ich bemerkte das Versehen sofort, und sofort kam mir der Gedanke, ihn zu behalten und ihn mit meiner Geliebten, die gar nicht wusste, dass sie meine Geliebte war, zu teilen.
An diesem Tag war keine Post für sie dabei. Ich klopfte trotzdem, und als sie öffnete, hielt ich ihr einen Fünfhunderter vors Gesicht. Sie blickte mich an, ich konnte in ihrem Gesicht nicht lesen, ich hatte es in den Wochen zuvor nicht gekonnt und konnte es nun auch nicht.
Lange blickte sie mir in die Augen. Ich hielt stand. Sie nahm den Schein. Dann griff sie nach meiner Hand. Ich dachte, lieber Gott, wenn sie jetzt meine Hand auf ihren Busen legt, dann werde ich bis an mein Lebensende nicht eine Sekunde deine Existenz bezweifeln.
Ebenso lange, wie sie mich angesehen hatte, hielt sie meine Hand. Ich weiß, sie überlegte, ob sie mir diesen Gottesbeweis liefern sollte, ich weiß es. Aber es gehörte wohl nicht zu ihrem Geschäft auf Erden, Gott zu beweisen.
Was für ein herrlicher Abend! Was für ein wunderbarer Geruch! Damit Durchzug im Kaffeehaus entstehe, öffnete der Herr Ober die Fenster und die Türen in den Toiletten, und aus der Küche roch es nach feuchten, muffigen Tischtüchern, und vom Stiegenhaus mischte sich noch Bohnerwachs dazu.
Ich liebe mein Kaffeehaus! Der Herr Ober setzte sich zu mir und sagte: »Sie müssen unser Kaffeehaus wirklich sehr lieben.«
Und dann erlaubte er mir, ihn Alfred zu nennen.
Bevor Max kam, bezahlte ich die fünfzig Prozent von einem großen Schwarzen, einem Paar Frankfurtern mit Kren und einem Mineralwasser. Es war sehr unwahrscheinlich, dass Max aus dem herrschenden Geruchsgemisch ähnliche Erinnerungen ziehen konnte wie ich. Würden wir unseren Mittwochabend eben in einem anderen Café hinter uns bringen …
Die traurigste Geschichte
»Ich habe heute Inventur in meinem unnützen Kopf gemacht, und da ist mir die traurigste Geschichte meines Lebens eingefallen«, sagte Herr Pietzsch, der noch nie etwas zu mir gesagt hatte. »Wollen Sie sie hören?«
Natürlich wollte ich sie hören – allein deshalb schon, weil mich Herr Pietzsch interessierte.
Immer wenn ich im Kaffeehaus war, war er auch hier. Er habe ungefähr dieselben Zeiten wie ich, steckte mir der Herr Ober, den ich inzwischen Herr Alfred nennen durfte.
»Was ist er denn von Beruf?«, fragte ich.
»Pensionist. Früher war er Chemiker bei einer Behörde, die die Milch kontrolliert. Er ist Witwer und ein überzeugter Freund von Nachschlagewerken.«
Das war ja schon sehr viel – außerdem trug Herr Pietzsch graue Anzüge, die in ihrer Unauffälligkeit unbeschreiblich waren. Er hatte einen Blick, als durchschaue er einen und biete sich als Komplize an, und hatte die kältesten, blauen Augen, in die ich je geschaut habe.
»Gern möchte ich Ihre Geschichte hören«, sagte ich und bot ihm Platz an meinem Tisch an.
»Im Jahr 1957«, begann er, »entdeckte man auf einer der vielen indonesischen Inseln ein Dschungelvolk, das noch in der Steinzeit lebte – ich setze der Einfachheit halber voraus, dass solche menschheitsgeschichtliche Zeiteinteilung sinnvoll ist. Aber offensichtlich hat man sich weiter nicht sehr viel um dieses Volk gekümmert, das heißt, man hat mit einem Tonband ein paar Sprachaufnahmen gemacht, und man hat die Mitglieder dieses Volkes gezählt.
Es waren vierundachtzig.
Die Forscher – ich weiß nichts über sie, es müssen jedenfalls prächtige Nullen gewesen sein – meinten, diese vierundachtzig Menschen seien lediglich eine Großfamilie, das Volk als Ganzes zähle viel mehr Menschen. Sie haben in ihrem Bericht aus der Luft gegriffene Hochrechnungen angestellt.
In Wahrheit zählte das Volk als Ganzes nicht mehr Menschen. Auch die Tonbandaufnahmen der Sprachproben haben sich diese sauberen Wissenschaftler nicht richtig angehört, sie hielten die Sprache für irgendeinen Inseldialekt.
Jedenfalls – zwanzig Jahre später wurde ein französisches Forscherehepaar auf das mangelhafte Dossier aufmerksam und ging der Sache nach. Als Erstes stellten die beiden fest, dass dieses Volk nicht irgendeinen Inseldialekt sprach – was sollte das bitte auch sein? –, sondern eine eigene, mit keiner Stimme der Welt vergleichbare Sprache.
Zweitens fanden sie eine Katastrophe vor: Von dem Volk waren nämlich 1975 nur noch acht Menschen übrig, ganze acht Menschen, vier Männer und vier Frauen. Drei der Frauen waren über das Alter hinaus, in dem sie Kinder kriegen konnten. Die vierte Frau schätzten sie auf etwa achtzehn Jahre. Das Schicksal ihres Volkes lag in ihrem Schoß.
Es gibt eine Fotografie dieser jungen Frau. Sie steht vor einem weit auswurzelnden Baum, sie ist nackt, dunkelhäutig, und sie lacht, sie lacht, wie ein Mädchen in einem amerikanischen Spielfilm aus dieser Zeit hätte lachen können. Keine Spur von Fremdheit kann ich in ihrem Gesicht finden.
Wissen Sie, was ich meine? Ich meine, so ein Mensch, so ein letzter Mensch, der muss sich doch fremd auf der Welt vorkommen. Wie kann so ein Mensch noch lachen? Sie blickt in die Kamera, als wüsste sie, was ein Fotoapparat ist.
Es tut mir weh, sie anzusehen. Es muss einem wehtun!
Sie hält einen Gegenstand in der Hand, man kann nicht genau erkennen, was es ist. Es könnte ein Buch sein. Es ist eckig und ungefähr von der Größe eines Buches. Aber was sollte sie damit anfangen?
Darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen! Vielleicht, dachte ich, vielleicht hat der französische Forscher oder seine Frau das Mädchen gebeten, das Buch zu halten, während sie oder er die Kamera bediente. Warum sollte dieser Gegenstand rätselhaft sein, nur weil er uns Überlebenden rätselhaft erscheint?
Nun, ich weiß nicht, was das französische Forscherehepaar anstellte, um die junge Frau schwanger werden zu lassen, ich weiß auch nicht, ob die beiden überhaupt etwas anstellten, es interessiert mich nicht, und auch dass sie sich bald darauf scheiden ließen und ob ihre Scheidung mit ihrer Entdeckung etwas zu tun hatte oder nicht – mein Gott, es ist viel geredet worden, der Mann habe sich in die junge Eingeborene verliebt, hieß es in einer Gazette, eine Liebe über Zehntausende Kilometer und Zehntausende Jahre hinweg, die Liebe des Menschen schlechthin, die reine Liebe, gereinigt von Raum und Zeit sozusagen – und was sonst noch alles geredet und geschrieben wurde. Das alles interessiert mich nicht. Ich weiß nur, weitere zehn Jahre später war von diesem Volk niemand mehr übrig.
Und wissen Sie, was das Traurigste ist? Ich werde es Ihnen sagen: Das Volk war ausgestorben, aber seine Sprache lebte in einigen Worten und Sätzen noch eine Zeitlang im Urwald weiter.
Wie das, werden Sie fragen. Ja. Wie das!
Die Papageien. Die Papageien, diese bunten Archive der Natur, jeder von ihnen ein warmes, gefiedertes Lexikon, sie hatten sich die Worte gemerkt und sprachen sie in den Wald hinein, sinnlos, ohne sie zu verstehen. Es war niemand da, der sie verstehen konnte. Es war nicht einmal jemand da, der darunter litt, dass er nichts verstand!
Ich könnte weinen über so viel Gottverlassenheit – und nun lasse ich Sie in Ruhe. Ich trinke um diese Zeit gern ein Glas Whisky, ich hoffe, Sie auch. Ich lass den Herrn Alfred ein Glas auf meine Rechnung an Ihren Tisch bringen.«
Dann ging Herr Pietzsch in seiner gebeugten Haltung, die rechte Hand flach auf den rechten Oberschenkel gelegt, zu seinem Tisch zurück.
Die allertraurigste Geschichte
»Ich habe gesehen, dass Herr Pietzsch letzten Mittwoch mit Ihnen gesprochen hat«, sagte Herr Alfred. »Ich bin natürlich neugierig. Es hat keinen Sinn, das zu leugnen, außerdem gibt es keinen Grund dazu, im Gegenteil: Neugierde ist meines Erachtens das einzig sichere Indiz für Intelligenz.«
»Sie wollen wissen, was er mir erzählt hat?«
»Ich würde es sehr gerne wissen.«
Herr Alfred sah aus, wie unser Lateinlehrer ausgesehen hatte, und der hatte ausgesehen, wie ich mir damals einen englischen Landadeligen vorstellte: eine ums Kinn ins Olive schimmernde, wundervoll sauber rasierte Haut, ondulierte Haare, die Schläfenansätze grau, im Mittelteil brünett, an den Spitzen blond. Und Hände hatte Herr Alfred ganz besonders bemerkenswerte, flinke, sehnige und, wie es schien, durch nichts zu beschmutzende.
»Eine traurige Geschichte hat mir Herr Pietzsch erzählt«, sagte ich. »Sie handelte vom Untergang eines Volkes.«
»Oh«, machte Herr Alfred, blickte sich rasch im Kaffeehaus um, »diese Geschichte also, na ja …«
Dann eilte er zur Theke, schenkte Kognak in zwei Schwenker und kam zurück an meinen Tisch.
»Dann will ich Ihnen seine allertraurigste Geschichte erzählen. Trinken wir! Auf das Wohl unseres grauen Herrn Pietzsch!«
Wir tranken.
»Herr Pietzsch hatte eine Frau, und nichts an ihr war grau. Ich habe sie noch gekannt, sie war klein, trug immer adrette Kostüme, meist anthrazit, saß aufrecht auf der Kante des Sessels und wirkte streng. Aber wenn sie lachte, war sie lieblich und weich, und es war, als neigte sich das ganze Kaffeehaus ihr zu, und mancher musste sich beeilen, das Bild zu korrigieren, das er sich von ihr im Kopf gemacht hatte. Manchmal kam sie allein hierher, manchmal gemeinsam mit ihrem Mann. Sie hielt seine Hand, gern tat sie das.
Sie waren beide schon an die fünfzig. Ich dachte damals, er schäme sich für diese Teenagergeste. Heute weiß ich, er war stolz darauf. Er wollte, dass man sah, wie sie ihm die Hand hielt. Er war stolz, sehr stolz sogar und dachte bei sich, das darf ich nicht sein, ich stoße die anderen Menschen vor den Kopf, wenn ich zeige, wie stolz ich auf meine Frau bin, das muss als erniedrigend empfunden werden von jedem, der es nicht ähnlich gut getroffen hat. Und deshalb hat er so getan, als ob er sich schämte.
So einer war Herr Pietzsch, so einer ist Herr Pietzsch. Wenn ich ihn ansehe, staune ich, weil er so kalte, so – verzeihen Sie –, so böse Augen hat.
Und dann sagte eines Tages seine Frau zu ihm: Ich habe etwas im Hals.
Was hast du denn im Hals?, fragte er sie.
Ich weiß nicht, sagte sie, vielleicht habe ich ein Haar im Hals stecken.
Wie spürst du es denn?, fragte er.
Wenn ich lache, spüre ich es, sagte sie.
Trink ein Glas Wasser, sagte er.
Das habe ich schon getan, sagte sie.
Sie hüstelte. Eine Woche, zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen lang hüstelte sie und räusperte sich in einem fort und hatte das Gefühl, ein Haar stecke ihr im Hals.
Dann kam noch etwas dazu, zu ihrem Lachen kam etwas dazu, meine ich. Wenn man lacht, stößt man mehr Luft aus als sonst, und man stößt die Luft mit Ton aus. Das nennt man Lachen. Das brauche ich Ihnen nicht darzulegen, das wissen Sie, das weiß jeder. Normalerweise atmet der Mensch beim Lachen mit Ton aus, aber nicht mit Ton ein. Frau Pietzsch konnte auf einmal nicht mehr anders einatmen als mit Ton. Verstehen Sie?
Es war eine traurige Wahrheit, und sie lautete: Der Tod kündigte sich bei ihr an, und er hatte ihr liebes Lachen gewählt, um sich anzukündigen. Eine seltsame Nervenkrankheit zwang sie nieder. Nach einem guten halben Jahr bereits saß sie im Rollstuhl.
Herr Pietzsch kam zu mir und sagte: Herr Alfred, ich werde immer kräftiger, und sie schwindet dahin. Es muss ihr wehtun, mich zu sehen.
Und ich, ich sagte: Dann, Herr Pietzsch, tun Sie doch vor ihr so, als seien Sie selbst auch nicht ganz gesund.
Und wissen Sie, was er sich einfallen ließ? Er spielte den Alkoholiker, der sich die Leber zu Schwamm säuft. Und ob Sie es glauben oder nicht, es tat ihr gut. Sie lachte wieder, sie lachte viel, beide lachten viel, und am meisten lachten sie, wenn er ihr von seiner kaputten Leber erzählte, die in Wahrheit gar nicht kaputt war.
Bitte, sagte sie, bitte, und sie konnte kaum noch richtig reden, niemand außer ihrem Mann konnte sie verstehen, bitte, geh zum Arzt, sagte sie, lass deine Leber untersuchen.
Jawohl, rief er, tat wie ein Betrunkener, ich geh zum Herrn Doktor, zum Herrn über Leber und Tod.
Und sie lachte über diesen Scherz, lachte toneinwärts und tonauswärts und konnte bald nichts weiter mehr bewegen als die Finger und die Lippen. Die Finger brauchte sie, um seine Hand zu halten, was ihn so stolz machte und wofür er sich auch schämte, und die Lippen brauchte sie, um zu lachen.
Zu mir sagte er im glücklichsten Ton und nagelte mich dabei mit seinen blauen, harten, bösen Augen in die Luft: Herr Alfred, Herr Alfred, sie fürchtet sogar, ich sterbe vor ihr! Ich soll es mir genau einteilen mit dem Leben, und damit meint sie, ich soll zusehen, dass ich nicht früher als sie sterbe. Herr Alfred, Herr Alfred, ich betrüge sie!
Und ich sagte: Aber, mein lieber Herr Pietzsch, sie wird es nie erfahren, dass Sie sie betrügen!
Dann starb sie. So. Aus. Fertig. Das ist die allertraurigste Geschichte, die ich kenne. Meinetwegen können ganze Völker aussterben, aber die kleine Frau Pietzsch mit ihrem Lachen, die würde ich gern herausholen aus dem Loch im Boden, in dem sie steckt.«
»Ja«, sagte ich.
Bevor Max kam, ging ich noch hinüber zu den Billardtischen. Wernhofer spielte gegen sich selber, und ich fragte ihn, wie dieser obszöne Song von den Rolling Stones heiße, den es nur als Raubpressung gibt. Über die Rolling Stones weiß Wernhofer nämlich alles.
Muchti, der Retter
Und dann las ich auf Seite acht in meiner Zeitung, die in meinem Café aufliegt, dass ein gewisser Bruno Feldkircher unter Einsatz seines Lebens einem verschütteten Touristenehepaar aus Essen in den Bergen zu Hilfe gekommen sei.
Mir war, als falle eine schmale Lichtspur auf mich. Denn: Diesen Bruno Feldkircher kannte ich! Er konnte das F nicht aussprechen und stellte sich als Cheldkircher vor und konnte auch seinen Spitznamen nicht richtig aussprechen und wurde deshalb Muchti genannt.
Muchti war gelernter Elektroinstallateur. Mit seinen bärenhaft behaarten, immer etwas einwärts gekrümmten, groben Händen reparierte er die Märklinlokomotivchen aller Buben. Das waren warme und trockene Hände, und es tat wohl, wenn sie sich einem auf die Schultern legten oder wenn sie einen am Oberarm fassten.
Muchti hatte ein Vollmondgesicht und einen zerfetzten Bart, der alle möglichen Farben aufwies von Schwarz zu Rotblond und Grau.
Er war mit einer herzensungebildeten Person verheiratet. Sie lieh ihren Mann her. Zu allen möglichen Verwendungen lieh sie ihn her, zum Beispiel, um Flöhe zu vertreiben.
Jawohl, Muchti konnte Flöhe vertreiben! Auf diesem Gebiet war er priesterlich. Ich habe es selbst gesehen. Es war vor zehn Jahren, wir hatten drei Katzen, und alle drei hatten Flöhe wie die Arche Noah, und wir waren so ungeschickt, ihnen in der Wohnung Flohbänder überzuziehen, was zur Folge hatte, dass die Flöhe die Katzen verließen und zu uns überwechselten.
Eines Nachmittags sagte ich zu meiner Frau: »Schau her, einer hat im Wohnzimmer Tusche auf den Boden gespritzt, da sind lauter schwarze Punkte.«
Es waren aber keine schwarzen Tuschepunkte, sondern Flöhe.
Da sagte meine Frau: »In diesem Fall kann nur Muchti helfen.«
Sie telefonierte mit Muchtis Frau, Muchti wurde verliehen, und Muchti kam.
»Geht schon«, sagte er.
Auf ewig unvergessen bleibt mir die folgende halbe Stunde! Muchti machte Liegestütze und Kniebeugen, bis er schweißnass war, dann zog er sich nackt aus und ging breiten, langsamen, eben priesterlichen Schrittes durch unsere Wohnung.
»Die kleinen Chiecher sind cherrückt nach meinem Schweiß«, sagte er mit einer Stimme, die aus tief unten zwischen den Schlüsselbeinen zu kommen schien.
Die schwarzen Tuschepunkte flogen vom Boden ab auf Muchtis Waden.
»Lasst Wasser in die Wanne lauchen«, sagte er.
Muchtis nackter Körper war eine Sensation. Er hatte einen Hodensack von schafsbockartigen Ausmaßen, mit krummen, harten Haaren beworfen. Als gewaltige Doppelschelle schwang er zwischen seinen Beinen, war so schwergewichtig, dass er das Glied fast ganz in sich hineinzog.
Andächtig blickten meine Frau, meine Kinder und ich auf den herrlichen Muchti. Mit schwarzgepunkteten Beinen stieg er in die Badewanne und brachte die Sintflut über die kleinen Tiere.
Muchti hatte drei eheliche und drei außereheliche Kinder. Für alle wollte er sorgen, und er schaffte es nicht. Er schaffte es einfach nicht. Sogar an Weihnachten schaffte er es nicht. Mit Tieren konnte Muchti umgehen, mit den kleinen wie mit den großen – mit Geld nicht, weder mit dem kleinen und schon gar nicht mit dem großen.
Und immer wieder verliebte er sich. Und immer verliebte er sich in Frauen, die in Not waren. Er leckte Wunden, die von fremden Ehemännern geschlagen worden waren, und er reparierte Betten, in denen andere geliebt wurden.
Und eines Tages verliebte er sich in Sylvia. Sie war kaum zwanzig, ein verstörtes Mädchen aus einem Touristendorf. Sie war von zu Hause abgehauen, und nach drei Monaten Großstadt war sie heroinsüchtig.
Muchti liebte sie und wollte sie retten. Er verließ Frau und Kinder und folgte ihr nach. Sie lebten zuerst in einer Wohngemeinschaft, dann über einem Lagerhaus, zuletzt in einem Neubau ohne Fenster.
Muchti besorgte für Sylvia das Gift. »Geht schon«, sagte er.
Sie küsste seinen Hodensack und sagte: »Danke, Muchti.«
Er sagte: »Geht schon.«
Aber dann ging es eines Tages nicht mehr, das heißt, Muchti konnte nicht mehr zusehen, wie sich Sylvia kaputtmachte.
Er sagte: »Sylvia, entweder du hörst auch mit dem Gicht, oder ich chang damit an.«
Sie sagte: »Ich kann nicht damit aufhören, Muchti.«
»Gut«, sagte er, »dann mach ich dir chon jetzt an alles nach.«
Er hatte an diesem Tag von einem heruntergekommenen Kleindealer ein paar Gramm Heroin gekauft. Er sagte: »So, Sylvia, zeig mir, wie chiel du nimmst.«
»Wenn du beim ersten Mal so viel nimmst wie ich«, sagte sie, »dann stirbst du.«
»Chon mir aus«, sagte er. »Das ist mir scheißegal.«
Und ihr war es wohl auch scheißegal.
Sie machte sich eine Spritze, und er machte sich auch eine. Sie fiel ins Koma, und er spürte gar nichts. Er brachte Sylvia ins Krankenhaus und legte dem Arzt beide Spritzen hin.
»Ich bin gegen das Gicht immun«, sagte er.
Die Wahrheit lautete: Der heruntergekommene Kleindealer hatte den Stoff mit Milchzucker gestreckt, aber vergessen, ihn richtig durchzumischen. Muchti hatte den Milchzucker abbekommen, Sylvia das hochprozentige Heroin. Sie überlebte.
Dann verschwand Muchti. Manche sagten, er sei nach Afrika ausgewandert. Afrika sei von allen Kontinenten am meisten gefährdet. Dort sei für Muchti der richtige Platz, dort werde Muchti gebraucht.
Immer wieder, wenn ich mit Freunden zusammensaß, kam einer auf Muchti zu sprechen. Viele Geschichten gab es von ihm! Wir erzählten uns diese Geschichten, als wäre er selbst nicht mehr am Leben. Und dann las ich auf Seite acht in meiner Zeitung, die in meinem Café aufliegt, ein gewisser Bruno Feldkircher habe einem Touristenehepaar aus Essen in den Bergen das Leben gerettet …
Aufgeschlagen auf Seite acht legte ich die Zeitung zurück auf den Zeitungstisch.
Muchti, der Atheist
»Erzähl uns noch eine Geschichte von Muchti«, sagte Rita, die wieder ihren bleichschwarzen Pullover trug.
Und Wernhofer, der Spezialist in allen Fragen der Rolling Stones, kam vom Billardtisch herüber und sagte: »Ich möchte auch mithören, was gibt’s?«
»Er erzählt von Muchti«, sagte Rita.
»Du bist mir auch noch eine Geschichte schuldig«, sagte ich zu Rita.
»Ja, ja«, sagte sie, »aber erst du.«
»Also gut«, sagte ich.
Es war nicht viel los im Kaffeehaus. Darum setzte sich nun auch noch Herr Alfred zu uns an den Tisch. Er brachte eine Flasche Grappa und vier Gläser mit.
»Aber nur bis Max kommt, dürfen wir ihn stören«, sagte er und schenkte exakt ein.
»Also gut«, sagte ich. »Muchtis herzensungebildete Frau las irgendwann, dass die Kirche neun Millionen Hexen umbringen hatte lassen, da trat sie einem Atheistenverband bei, und weil Muchti sie liebte, trat auch er bei.
Der mächtige Muchti mit seinen Prankenhänden legte sich mächtig ins Zeug, denn er wollte seiner Frau imponieren, und er wollte, dass sie stolz auf ihn ist und sich nicht für ihn schämen musste vor den anderen Atheisten.
Er ergriff sogar aktiv die Initiative und erkundigte sich bei seinen vielen Freunden, die ihm alle etwas schuldig waren, nach einschlägigen Flüchen. Er dachte, Flüche wie Gott soll deine Mutter in den Arsch ficken! oder Die drei besten Engel sollen verrecken! heben sein Ansehen im Verein. Ihm selbst war dabei gar nichts an Ansehen gelegen, weder im Atheistenverband noch sonst irgendwo. Er lebte wie ein gesegneter Stein Gottes in den sonnigen Tag hinein. Er wollte lediglich seiner Frau dienlich sein.
Ach, ich konnte sie nicht leiden, ich geb’s zu. Sie hatte eine wunderbare Figur, das schon, Brüste, die einem entgegensprangen, das ja, und eine blühende Taille hatte sie auch, und dass ihr oben links ein Zahn fehlte, war ein interessant verruchter Aspekt. Aber sie aß zu viel Gemüse, sie stank, ja, sie furzte ganz offen und ungeniert und wann immer ihr danach war.
Mit ihren Augen konnte sie den mächtigen Muchti aufspießen. Wenn sie ihn ins Visier nahm, sanken ihm die tätowierten Arme herab und mit ihnen die Mundwinkel, und er sagte: Geht schon.
Manchmal sagte Muchti einen halben Tag lang nichts anderes als: Geht schon. Mich hat das nicht gestört.
Jedenfalls machten die Oberatheisten den beiden gleich zu Anfang ihrer Mitgliedschaft mit scharfen Worten klar, dass der Atheistenverband eine durch und durch moralische Angelegenheit und dass Fluchen nicht nur nicht gut, sondern nachgerade schlecht sei.
Muchti entschuldigte sich, erklärte, nur er fluche, seine Frau habe noch nie geflucht, und er meldete sich freiwillig, die monatliche Broschüre des Verbandes auf der Straße zu verteilen.
Und so stand Muchti, der aufrechte Löwe, der Elektroinstallateur, der Karl Marx und Sartre in weiten Ansätzen gelesen hatte, vor der größten Kirche der Stadt und verteilte die Gazette des Atheistenverbandes und rief dabei: Gott ist tot! Nieder mit Chinsternis und Chron! Der Mensch ist chrei!
Das machte Muchti zwei oder drei Tage. Dann sprach ihn ein Geistlicher an.
Er sagte: Sie glauben mehr nicht an Gott, als ich an ihn glaube. Wie lebt es sich mit so viel Überzeugung im Herzen?
Geht schon, sagte Muchti.
Der Geistliche lud Muchti zum Essen ein.
Ich bin voll Zweifel, sagte er mitten im Schnitzel, ich zweifle, ob ich in Gott eine Person sehen darf, die gütig und gerecht ist.
Was spricht dagegen?, fragte Muchti.
Er hatte sich nur Gemüsebeilagen bestellt und mampfte großflächig.
Manchmal denke ich, Gott ist überall, sagte der Geistliche, in den Sternen, in den Tannenzapfen, in Messer und Gabel und im Schnitzel.
Im Schnitzel kann ich Gott nicht chinden, sagte Muchti und hob das panierte Stück, das vor dem Geistlichen auf dem Teller lag.
Natürlich können Sie das nicht, sagte der Geistliche, Sie glauben ja, dass es ihn gar nicht gibt.
Irgendetwas Höheres gibt es sicher, sagte Muchti.
Aha, sagte der Geistliche. Aha! Und was soll das sein, und wie soll es sein?
Ich nehme an, dass es gütig und gerecht ist, sagte Muchti, und süß, irgendwie süß. Süßigkeiten, philosophierte Muchti weiter, Süßigkeiten sind irgendwie allumchassend. Chiel mehr jedenchalls als Kartocheln.
Er hatte sich ein großes Himbeereis bestellt. Heiße Liebe.
Ja, ja, die süßen Wunden Christi, zitierte der Geistliche wehmütig und wischte sich über sein farbloses, formloses Haar. Wissen Sie, wenn Gott alles umfasst, die Berge, die Tannenzapfen, das Besteck und das Schnitzel, dann ist er genauso viel wie gar nichts.
Nichts ist er, glaub ich, nicht, sagte Muchti, chür mich ist er doch eher alles.
Ich dachte, Sie sind Atheist, sagte der Geistliche.
Nicht unbedingt in allem, sagte Muchti.
In was denn zum Beispiel nicht?
Also, sagte Muchti, wenn mich einer direkt chragt, ob ich an Gott glaube …
Was sagen Sie dann?
Dann sage ich …
Was sagen Sie dann?
Dann sage ich … also, dann sage ich: Wenn mein Schluckauch jetzt in einer Minute auchhört, dann glaube ich an ihn.
Der Geistliche und Muchti warteten eine Minute schweigend. Der Schluckauf meldete sich nicht mehr, und geläutert gingen sie beide ihrer Wege – natürlich nachdem der Geistliche zu seinem Schnitzel auch noch Muchtis Gemüsebeilagen, seine drei großen Biere und sein Himbeereis bezahlt hatte.«
Rita im bleichschwarzen Pullover zahlte meinen großen Schwarzen, Wernhofer meinen Topfenstrudel, Herr Alfred ließ den Schnaps auf Rechnung des Hauses gehen. Und dann war ich wieder allein an meinem Tisch.
Bevor Max kam, dachte ich noch ein wenig über das Weltall nach und dass man schon ziemlich abgebrüht sein musste, um in sternenklarer Nacht nicht auf die Knie zu fallen.
Das Haus am Fluss
Oft passiert es mir, dass ich von Wernhofer rede, und einer fragt, wer ist das, und ich sage, aber ich habe doch schon von Wernhofer erzählt, und ich bekomme zu hören, nein, von dem hast du noch nie erzählt.
Man vergisst ihn leicht, man übergeht ihn leicht, man merkt sich ihn nicht. An seinem Äußeren kann es nicht liegen. Er ist ein schönes Stück größer als die meisten. Schlank und wohlgebaut ist er, hat eine gerade Haltung, breite Schultern und einen interessanten, sehnigen Hals, der überaus männlich wirkt. Die Haare sind ihm schon früh ausgegangen, bis zur Hälfte des Kopfes ist er kahl.
Seine Lippen kräuseln sich bei jedem Wort, so dass man meinen muss, Wernhofer sei ein ironischer Mensch – was er eigentlich nicht ist. Er ist ein Zuhörer, ein aufmerksamer, nahezu nervend aufmerksamer Zuhörer. Er formt mit seinen Lippen die Worte des Sprechers nach. Das ist, als blicke man in einen sich kräuselnden Spiegel. Das nervt mitunter, zugegeben.
Wernhofer hat ein Hobby, er sammelt alles, was mit den Rolling Stones zu tun hat. Nicht nur alte Schallplatten und illegale Konzertmitschnitte sammelt er, sondern auch Zeitungsartikel, T-Shirts, benützte Gitarrenseiten, Mikrofonkabel. Von allen Mitgliedern der Gruppe besitzt er mindestens ein Autogramm, vom verstorbenen Brian Jones ebenso wie von den aus der Band ausgetretenen Mick Taylor und Bill Wyman.
Als Bub hat er zu sammeln begonnen. Inzwischen leidet er unter seiner Sammlung. Er will längst schon nicht mehr weitersammeln. Er ist Ende vierzig. Er kann nicht aufhören zu sammeln, das Gewissen würde ihn fertigmachen. Mir hat er einmal gestanden, er wünsche sich nichts sehnlicher, als dass die Gruppe The Rolling Stones offiziell aufgelöst würde.
»Meinetwegen«, sagte er, »meinetwegen soll sich Keith Richards die Gicht in die Griffhand ziehen, oder Mick Jagger soll von einer Stimmbandlähmung heimgesucht werden.«
Wernhofer drückt sich gern relativ ungewöhnlich aus. Er wählt mit verzweifelter Absicht Worte, die man von einem Rolling-Stones-Fan nie und nimmer erwarten würde.
Wernhofer spielt in meinem Café Billard, fast jeden Abend spielt er hier, ich weiß nicht, ob er Anhang hat, davon erzählt er nicht. Niemand fragt ihn irgendetwas. Er spielt immer nur gegen sich selbst oder mit sich selbst, ich weiß nicht, wie er es sieht. Manchmal setzt er sich zu mir an den Tisch, und wir plaudern.
Einmal, bevor Max kam, erzählte er mir eine kleine, zarte Geschichte aus seiner Kindheit.
»Ich war ein sehr ruhiges Kind«, sagte er, und ich zweifelte nicht daran, »ich konnte mich stundenlang selbst beschäftigen. Nicht einmal Spielzeug brauchte ich dazu. Alles, was ich brauchte, waren ein weißes Blatt Papier und ein Bleistift und ein Spitzer. Ich zeichnete.
Und eines Tags zeichnete ich einen Fluss, der an hügeligen Feldern vorbeizog. Vorne links grenzte ein Wald an sein Ufer, da ließ ich eine gelbe Stelle, das sollte ein Stück Strand sein. Ich zeichnete das Gras, das bis an den Waldrand reichte, und ich zeichnete es schräg, denn ich wollte, dass der Wind in das Gras fuhr. Und das wollte ich nur, um zu zeigen, dass der Wind vom Wald abgehalten wurde, und dass es auf meinem gelben Strand windstill war.
Ich mochte nämlich Wind nicht und mag ihn bis heute nicht, denn ich bekomme Ohrenschmerzen davon.
Nach jedem Zentimeter, den ich zeichnete, musste ich den Bleistift nachspitzen, was ich zeichnete, war winzig. Ich zeichnete eine Taschenlampe, denn ich ahnte, dass es auch auf einem Bild Nacht werden könnte, und da wollte ich gewappnet sein. Ich zeichnete eine winzig kleine Zündholzschachtel und eine winzig kleine Kerze, für den Fall, dass die Batterien in der Taschenlampe leer würden. Einen Schirm zeichnete ich – es hätte ja regnen können. Schokolade zeichnete ich und ein Wurstbrot und eine winzige Flasche Coca Cola.
Schließlich war von meinem gelben Strand – den ich mir, wenn ich genau sein will, ja nur gelb vorstellte – nichts mehr zu sehen, so voll war er mit winzigen Gegenständen, die ich zum Leben unbedingt brauchte.
Da beschloss ich, ein Haus zu bauen.
Ich zeichnete das Haus über die Taschenlampe, über die Zündhölzer und die Kerze, über Wurstbrot, Schokolade und Coca Cola. Ich wollte ja all diese Dinge im Haus haben. Es wurde ein dunkles Haus – klar: Die Dinge mussten übermalt werden.
Von Anfang an hatte ich Sorgen. Es schien mir verwegen, ein Haus zu bauen. Ich dachte, dazu bist du wirklich noch zu klein. Ich dachte: Du hast dich übernommen. Mein Haus am Fluss war eine Herausforderung an das Schicksal.
Und aus irgendeinem Antrieb heraus – frag mich nicht – zeichnete ich Wolken an den Himmel. Ich spitzte den Bleistift nicht nach, es war ein weicher Bleistift. Die Wolken wurden fett, bauchig, geladen, sie glänzten gefährlich.
Ein Gewitter zog auf in meinem Bild.
Gut, dachte ich, ich werde mein Haus schützen, und ich zeichnete einen Blitzableiter auf das Dach. Ich wusste nicht, wie so ein Blitzableiter funktioniert. Ich setzte ihn mitten auf das Dach.
Was aber, dachte ich nun, wenn der Blitz nicht genau mitten auf das Dach schlägt? Während ich die Wolken immer dichter schraffierte, zeichnet ich flugs rechts und links auf den Giebel je einen weiteren Blitzableiter.
Aber wieso sollte ein Blitz nur auf den Giebel eines Hauses schlagen dürfen? Wo steht denn das geschrieben? Auf den Dachflächen ist ja noch Platz genug.
Ich zeichnete, zeichnete Blitzableiter, das ganze Dach übersäte ich damit.
Und die Wände? Kann es nicht einen Blitz geben, der von der Seite kommt? Ich dachte, ja. Also schnell: Blitzableiter an die Wände.
Am Ende sah mein Haus am Fluss aus wie ein Igel. Und noch immer hatte ich Sorgen. Dicht an dicht standen die Blitzableiter, aber noch immer hatte ich Sorgen …«