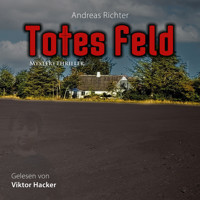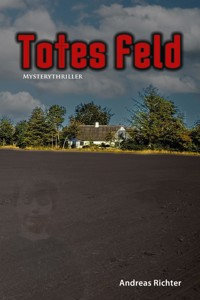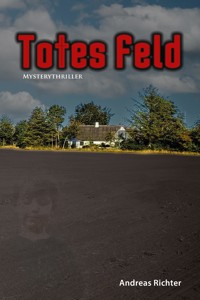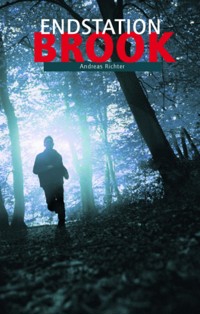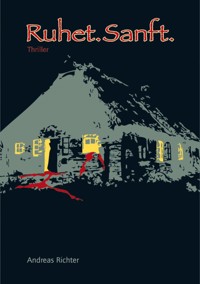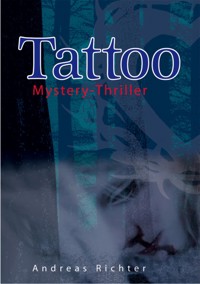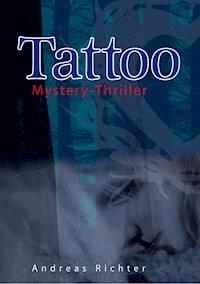1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anmutig tanzen die bunten Holzfiguren über dem Kinderbett. Mit großen Augen verfolgt der kleine Daniel das Spiel des Mobiles, das ihn in immer quälendere Albträume treibt. Da macht sein Vater Joachim eine unheimliche Entdeckung: Die Bemalung einer Holzfigur verblasst - und er begreift, dass mit den Farben der Figur auch Daniels Leben entschwindet.
Zwischen dem Mobile und dem Kind steht eine Beziehung, die sich nicht mehr trennen lässt. Um seinen Sohn zu retten, muss Joachim das dunkle Geheimnis des Mobiles lösen. Ihm bleibt nicht viel Zeit ... .
»Latent nervöse Spannung und stetes Unbehagen, ein Gruselerlebnis.«
Hamburger Abendblatt
»Ein Thriller, den man nicht mehr aus der Hand legt. Dauerspannung pur!«
Kieler Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Mobile
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRoman
Mobile
Mystery-Thriller
Andreas Richter
Erweitertes Impressum
Copyright © Andreas Richter, Ahrensburg.
Vollständig überarbeitete Ausgabe 2013.
Die ursprüngliche Fassung des Romans erschien 2003
unter dem Titel "Mobile" als Taschenbuch bei
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München.
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit
schriftlicher Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Gestaltung Cover: edition.noack, Hemmoor.
Über den Autor:
Foto: Andreas Milanese, Hamburg
Andreas Richter wurde 1966 in Hamburg geboren. Er lebt und arbeitet als Autor und Texter Richter in Ahrensburg bei Hamburg. Informationen zu Richters weiteren Romanen finden Sie am Ende des E-Books
www.andreasrichter.info
Alle Personen, Orte und Begebenheiten dieser Geschichte könnten frei erfunden sein – doch wer weiß das schon mit Sicherheit.
Dienstag, 15. Januar
Mit einem dankenden Nicken nahmen die beiden Cops die Kaffeebecher entgegen, die ihnen die untersetzte Frau mit dem südamerikanischen Ureinwohnergesicht reichte.
»Das ist jetzt genau das Richtige«, sagte der Stämmige und umfasste den Becher mit beiden Händen. Schlürfend trank er einen Schluck und beobachtete die Frau beim Verlassen des Raumes.
»Ja, das tut gut«, stimmte sein Partner zu, ein junger Kerl mit durchdringendem Blick. »Hält wach und wärmt. Jesus, das ist heute Nacht aber auch wieder lausig kalt.«
Der Stämmige wischte sich über den Mund und sagte: »Die harten Winter hier oben in Illinois sind das reinste Gift für meinen ramponierten Rücken. Verdammt, manchmal weiß ich vor Schmerzen nicht mal mehr, wie ich sitzen soll, vor allem nicht in diesen ausgelutschten Sitzen der Einsatzwagen. Ach, was soll's – knapp drei Jahre noch, dann geht's in Pension und ich verlasse bei weniger als fünfzig Fahrenheit meine vier Wände nicht mehr, soviel steht fest.«
Nun wandte er sich dem breitschultrigen Mann in Jogginghosen zu, der mit leerem Gesicht auf dem großen Sofa saß. »Mel, soll ich Ihnen sagen, was ich machen würde, wenn ich an Ihrer Stelle wäre? Ich würde für einen der Vereine der Western Divison in der National League spielen und auch während der spielfreien Zeit dort bleiben. In San Diego oder Los Angeles heißen die Winter zwar auch Winter, aber es sind keine Winter, höchstens verlängerte Spätsommer. Wissen Sie, was ich meine? Oder im Süden, vielleicht in der Eastern Divison bei den Miami Marlins, da friert man auch nie. Verdammt, ich sollte dort hin ziehen, damit es meinem Rücken im Dezember genauso gut geht wie im August. Wäre ich Sie, Mel, hätte ich längst den Abflug gemacht, aber verdammt, Mel: Ich bewundere Ihre Treue. Die Sox sind schließlich nicht Irgendwas, sondern eine Religion. Eine Armee. Das Sox-Shirt zieht man nicht einfach so aus wie eine schmutzige Unterhose.«
Mel O’Stout, einer der populärsten und bestbezahltesten Baseballspieler des ganzen Landes, reagierte nicht. Er sah nicht mal hoch. Einige Schritte entfernt, am wuchtigen Esstisch, saß seine Frau. Sie trug einen Morgenmantel und hatte das Gesicht in den Händen vergraben.
Der stämmige Cop räusperte sich und sagte: »Mrs. O'Stout, Mel: Sie werden sehen, alles wird gut enden, es endet fast immer gut. Meine Erfahrung und mein Gefühl sagen mir, dass Sie spätestens in wenigen Stunden Ihren Sohn wieder bei sich haben werden.«
Sein Partner nickte und ergänzte: »Sehe ich genauso. Spätestens morgen wird er vor Ihnen stehen und hoffen, dass sich Ihr Ärger in Grenzen hält. So etwas passiert täglich. Kinder laufen für einige Stunden weg, vor allem Jungen.«
»Ja, die wollen ein Abenteuer erleben, sich wie Huckleberry Finn und Tom Sawyer fühlen, mit Becky Thatcher und Indianer Joe und so, und plötzlich - peng! - merken sie, dass die Dinge anders laufen als in den Geschichten von Mark Twain, und dann sind sie wieder da. Unversehrt.«
»Pearcy ist sechs, Officer!«, entgegnete Mel barsch und stand auf. Er war eine imposante Erscheinung, groß und durchtrainiert, eine menschliche Wand. Sein stechender Blick tat ein Übriges. »Zeigen Sie mir einen einzigen halbwegs normal denkenden Sechsjährigen, der mitten in einer scheißkalten Januarnacht abhaut, nur im Schlafanzug und ohne Schuhe. Zeigen Sie mir diesen Jungen und ich werde ihm persönlich die Leviten lesen, auch wenn es nicht mein Sohn ist.«
Der junge Cop räusperte sich und sagte: »Mel ..., Sir, ich fasse noch einmal zusammen: Sie sagten, die Alarmanlage war eingeschaltet und alle Hauszugangstüren waren abgeschlossen und gesichert, so wie immer, wenn Sie wissen, dass Sie das Haus abends nicht mehr verlassen. Die Fenster waren geschlossen und verriegelt. Ihr Sohn und Ihre Frau haben bereits geschlafen, Ihre Bedienstete ebenfalls, während Sie alleine bis etwa ein Uhr Fernsehen geschaut haben. Auf dem Weg ins Schlafzimmer haben Sie noch einmal nach Ihrem Sohn sehen wollen, aber sein Bett war leer.«
Mel schloß die Augen und presste die Lippen aufeinander.
»Was ich nicht verstehe, Sir, ist Folgendes: Wenn alles war wie zuvor, die verriegelten Fenster und Türen und die eingeschaltete Alarmanlage ..., wenn also Ihr Sohn das Haus nicht verlassen hat, aber auch nicht mehr im Haus ist ... - wo ist er dann?«
»Verdammt, ich weiß es nicht«, brüllte Mel wie aus heiterem Himmel. »Meinen Sie, wir hätten Sie gerufen, wenn wir es verdammt noch mal wüssten? Wir haben das ganze Haus durchsucht, in jeden Scheißschrank haben wir geschaut und unter jedes Sofa geguckt, sogar unter der Schmutzwäsche im Waschraum – und weiß Gott, wo sonst noch. Pearcy ist nicht im Haus, Officer, aber er hat das Haus nicht verlassen.«
»Erklären Sie mir bitte, wie das funktionieren soll, Sir.«
»Erklären Sie es! Sie sind der Cop, es ist Ihr verdammter Job. Mein Job ist es, schwer zu berechnende Bälle zu werfen.« O'Stouts Augen funkelten angriffslustig.
Der stämmige Polizist sagte in beschwichtigendem Tonfall: »Okay, Leute, versuchen wir alle, ruhig zu bleiben, okay? Mel, also ... wir werden auf jeden Fall eine Fahndung rausgeben. Das Foto Ihres Sohnes wird sicher hilfreich sein, danke dafür. Rufen Sie uns sofort an, sobald Pearcy wieder auftaucht, und das wird er schon bald. Garantiert hat er hier im Haus ein Versteck, von dem Sie nicht mal ahnen, dass es das gibt. He, Mel, ich wette, dass Ihr Junge in seinem Versteck hockt und die Hosen gestrichen voll hat, weil er weiß, dass er es mit dem Verstecken übertrieben und Ihnen einen gottverdammten Schrecken eingejagt hat.«
»Pearcy hat sich nicht versteckt«, sagte plötzlich Mels Frau. Es waren ihre ersten Worte in Gegenwart der Polizisten. Sie nahm die Hände von ihrem verweinten Gesicht und sah zu den Männern rüber.
»Er hätte Donni mit ins Versteck mitgenommen.«
»Bitte wen, M'am?«
»Seine dämliche Holzente«, übernahm Mel die Antwort. »Er schleppt sie überall mit hin, das hässliche Ding klebt geradezu in seiner Hand.«
»Er hat sie vor einiger Zeit auf einem Benefiz-Flohmarkt gekauft«, ergänzte sie. »Von seinem eigenem Geld. Ich weiß nicht, was er an diesem alten Holzspielzeug findet, aber er liebt es abgöttisch und macht ohne es im Haus keinen Schritt. Am liebsten würde er es mit zur Schule nehmen. Wenn Pearcy sich hier irgendwo versteckt hätte, hätte er die Holzente mitgenommen, aber sie liegt neben seinem Bett.«
Die beiden Polizisten warfen sich einen kurzen Blick zu, dann sagte der Stämmige: »Also dann, wir müssen wieder los. Danke für den Kaffee. Wir hören sehr bald voneinander.«
»Lucía«, rief Mel.
Die Frau mit dem südamerikanischen Ureinwohnergesicht betrat den Raum.
»Bring' die Gentlemen bitte zur Tür.« Er reichte den Beamten die Hand und sagte: »Danke für Ihre Unterstützung. Und ... hey, es tut mir leid, dass ich eben die Beherrschung verloren habe, aber ich bin ... ich habe eine Scheißangst. Und meine Frau auch. Verstehen Sie, Officer?«
Der junge Polizist nickte nachsichtig.
»Wir verstehen das«, sagte der andere Cop. Er klopfte Mel aufmunternd und bewundernd zugleich auf die Schulter. Dann, an Mels Frau gewandt: »Misses O'Stout ... gute Nacht, M'am.«
Sie nickte knapp.
Die beiden Beamten sprachen erst wieder miteinander, als sie kurz darauf im Auto saßen.
»Komische Geschichte«, sagte der Jüngere, der hinter dem Steuer saß. »Was sagst du dazu?«
»Was ich dazu sage? Dass ich es verdammt noch mal kaum glauben kann. Ich meine, Mel O'Stout ..., verstehst du? Gott, Scheiße, der Kerl spielt nicht für irgendein Team, sondern für die White Sox. Die Sox, Mann. Frage mich nach Tradition und Herz im Baseball, nach Leidenschaft und Blut, und ich antworte dir: White Sox – und zwar noch vor den verdammten Yankees aus New York. Mein Pa hat mich zum ersten Mal mit zu den Sox genommen, da warst du noch nicht mal geplant gewesen, mein Junge. Die Spieler der Sox sind meine ersten Helden gewesen, und sie sind's in gewisser Weise immer noch, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Na klar verstehe ich.«
»Ich hatte wegen der Sox fast mal einen Schulverweis bekommen, das gab mächtig Ärger.«
»Ist nicht wahr«, meinte der junge Cop, ohne dass es ihn wirklich interessierte. Er betrachtete das Haus der O'Stouts, das matt beleuchtet hinter dem Vorhang aus herabfallendem Schnee lag.
»Ich hatte einem Klassenkameraden was auf's Maul gegeben, hat ihn einen Zahn gekostet. Scheiße, er hatte behauptet, die Sox spielten deshalb eine miese Saison, weil die meisten Spieler von der Wettmafia gekauft seien und die eigenen Spiele verschoben, so ähnlich wie beim Skandal damals in 1919.«
»War sein ernst gewesen? So etwas sagt man nicht, wenn man es nicht beweisen kann. Schon gar nicht über ein Team wie die Sox.«
»Verdammt, nein.«
Eine Sekunde lang herrschte Stille, dann sagte der junge Cop: »Guck dir das Haus an. Und wie es drinnen aussieht, alles nur vom Feinsten. Hast du den Flachbildschirm gesehen? Der ist doppelt so groß wie ein verfluchter Billardtisch. Und die Indio-Squaw wohnt bei denen, hat ein eigenes Zimmer mit Bad, Wahnsinn, das ist ... – Mann, überleg' doch mal, du hast deine Leibeigene rund um die Uhr bei dir, du brauchst dich um nichts zu kümmern, nicht mal um ein neues Bier abends vor der Glotze. Was für ein großartiges Leben ist das, bitte?«
»Alles nur Schein, Partner. Hinter jeder Hauswand gibt es dunkle Seiten und finstere Geheimnisse. Auch bei einem von der ganzen Stadt verehrten Baseball-Star, das siehst du ja.« Er schnippte mit den Fingern und sagte: »Weg, der Junge, einfach weg. Als ob sich jemand plötzlich in Luft auflösen könnte … – so ein verdammter Schwachsinn, für wie dämlich hält er uns eigentlich?«
Der junge Cop sagte unsicher: »Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie O'Stout sagt. Was, wenn der Kleine sich nicht versteckt hat, sondern wirklich verschwunden ist?«
Sein Partner warf ihm einen herablassenden Blick zu. »Ich sage dir jetzt mal was, mein Junge: Ich habe mein ganzes Leben in dieser Kloake von Stadt verbracht, und während der bald mehr als vierzig Jahre als Cop habe ich meine Nase tiefer in Chicagos Scheiße gesteckt als die meisten anderen Menschen. Ich weiß genau, wann eine Sache faul ist und wann nicht, und ich sage dir, dass O'Stout seinem Jungen erst das Lebenslicht ausgeknipst und ihn anschließend weggeschafft hat.«
»Aber weshalb hätte er das tun sollen?«
»Was weiß ich denn? Aber er hat es getan, darauf wette ich meine Eier.«
»Und seine Frau? Meinst du, die hängt da mit drin?«
»Nein, glaub' nicht. Sie hatte dieses Gesicht, das Mütter haben, die in echter Angst um ihre Kinder sind. Diese Art von Angst kann man nicht vortäuschen, zumindest nicht einem alten Hasen wie mir. Vielleicht ist die dumme Alte noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass ihr Mann irgendeine Sauerei mit dem Kleinen angestellt haben könnte.«
»Sie macht keinen dummen Eindruck, im Gegenteil. Und sie sieht ziemlich gut aus, selbst mit verheultem Gesicht.«
»Sie ist die Frau eines Baseball-Stars, selbstverständlich sieht sie gut aus. Was glaubst du denn, weshalb jemand wie O'Stout ein solches Mädchen heiratet? Weil sie Atomphysikerin ist und nebenbei Shakespeare liest? Nein, weil sie hübsch ist und im Bett 'ne Menge drauf hat, darum. Mein Junge, du musst über Menschen und ihre Beziehungsrollen noch eine ganze Menge lernen. So, und nun lass uns endlich von hier verschwinden, bevor ich vor Ekel kotzen muss.«
Der junge Cop startete den Motor und fuhr los. Er steuerte den Wagen die lange Auffahrt hinunter, durch das offene Tor hindurch, auf die schmale Straße.
»Dieser verdammte irischstämmige Mistkerl«, murmelte der andere. »Gott, O'Stout ist ein Wahnsinns-Pitcher, wahrscheinlich der Beste in der gesamten Central Division. Kannst du dir vorstellen, dass ich noch vorhin kurz davor war, mir ein Autogramm von ihm zu holen? Ich hätte ihn beinahe gefragt, ob er einen Ball übrig hat und ihn mir signiert, so richtig mit Widmung. Für meinen Freund Matt! oder so, verstehst du?«
»Klar.«
»Und nun diese Scheiße. Ein Baseball-Star der Sox. Verdammt, das ist nicht zu fassen! Die Sox sind wie ein Teil von mir, das sind alles so etwas wie Helden für mich. Wenn du feststellst, dass deine Helden nichts mehr taugen, geht etwas in dir kaputt, ganz tief in deinem Inneren.«
Der junge Cop entgegnete nichts und steuerte den Wagen auf den John-F.-Kennedy-Expressway in Richtung Chicagoer Innenstadt.
»Mich kotzt das an, verdammt«, murmelte der andere und schlug leicht gegen das Seitenfenster. »Ich sag' dir was, mein Junge: Wenn selbst deine Helden im Dreck versinken, ist die Welt wirklich zum beschissenen Müllhaufen verkommen.«
Dienstag, 12. März
Joachim Netzners Mutter war neunundsiebzig Jahre alt – ein Alter, in dem man jederzeit damit rechnen muss, dass es zu Ende geht. Bis zuletzt war sie rüstig gewesen und hatte viel unternommen. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass ihr Herz plötzlich zu schlagen aufhören würde. Doch das hatte es, als sie in ihrem kleinen Garten Primeln und Stiefmütterchen für den sich ankündigenden Frühling setzte, und sie war umgefallen wie vom Blitz getroffen.
Seitdem ihr Mann vor neun Jahren einem Krebsleiden erlegen war, hatte sie allein in dem kleinen Reihenhaus am Westrand von Hannover gewohnt, in dem Joachim aufgewachsen war. Joachim war ihr einziges Kind gewesen. Sie hatte die Hoffnung auf ein Kind fast schon aufgegeben, als sie mit Vierzig doch noch schwanger wurde. Ihr Frauenarzt hatte es als Risikoschwangerschaft bewertet, doch alles war problemlos verlaufen. Als Jugendlicher waren seine Eltern Joachim oft als zu alt und zu autoritär erschienen. Erst später hatte er ihre eher strenge, aber stets liebevollen Art, die ihm viel Orientierung und Struktur gegeben hatte, schätzen gelernt.
Joachim wollte den Hausstand seiner Mutter so schnell wie möglich auflösen. Während er am Vormittag nach ihrem Tod bei dem Bestattungsunternehmen war, rief seine Frau Carola eine Firma für Wohnungsauflösungen an und vereinbarte einen Termin für den morgigen Mittag. Anschließend rief sie in der Schule an und gab Bescheid, dass ihr Sohn Niklas morgen nicht am Unterricht teilnehmen würde. Sie hatte vor, den Zehnjährigen und seinen fünf Monate alten Bruder Daniel gleich früh zu ihren Eltern zu bringen, damit Joachim und sie den Tag über den Rücken frei hatten.
Die Wohnungsauflöser hatten sich für zwölf Uhr angesagt. Joachim und Carola waren bereits seit zwei Stunden in dem Haus. Sie waren gemeinsam durch die verwohnten Räume gegangen und hatten gelbe Klebezettel an die wenigen Dinge geheftet, die sie behalten wollten. Nun hatten sie begonnen, in die Schubladen und Fächer der Schränke zu schauen.
»Ihr Sparbuch«, sagte Carola überrascht, als sie das rote Heftchen aus einem unbeschriebenen Briefumschlag zog. Sie schlug es auf, sah den letzten Eintrag und stieß staunend die Luft aus.
»Zweiundvierzigtausend«, sagte sie. »Joachim, deine Mutter hatte zweiundvierzigtausend Euro auf einem stinknormalen Sparbuch rumliegen. Im Wohnzimmerschrank. Gibt's das denn?«
Er reagierte nicht, sondern blätterte mit schnellen Fingern einen Ablageordner durch.
»Hast du mir zugehört?«, fragte sie nach.
»Ja.«
»Und?«
»Was und?«
»Das ist viel Geld. Wusstest du davon?«
»Nein. Mir war wichtig, dass sie auf ihre alten Tage finanziell zurecht kam – und das kam sie. Wie viel sie zur Seite gelegt hatte, hat mich nie interessiert.«
»Was meinst du: Wir könnten es in die Tilgung stecken, das verschafft uns etwas Luft.«
Er sah sie hitzig an und sagte: »Klasse, die Alte ist endlich tot, her mit der Kohle! Findest du das jetzt passend, Caro?«
Sie musste sich beherrschen, um ihrer Empörung nicht laut Luft zu machen. »Nun mach aber mal einen Punkt! Du weißt ganz genau, wie ich es meine. Du erbst das Geld doch sowieso, ich habe nur meinen Gedanken ausgesprochen, wie wir es verwenden sollten. Das hat mit endlich ist sie tot nicht das Geringste zu tun. Ich bin auch traurig, dass deine Mutter nicht mehr da ist, also schieb mir nichts unter!« Sie knallte die Schublade zu. »Nicht zu fassen!«
Mit fünfunddreißig Jahren war Carola knapp vier Jahre jünger als er. Sie war hoch gewachsen, schmal und hatte schulterlanges rotblondes Haar, das sie heute zu einem achtlosen Zopf gebunden hatte. Ihr Teint war hell und sie hatte gletscherblaue Augen; es gab eine Menge Menschen, die sie anziehend fanden, gerade weil sie nicht den klassischen Attraktivitätsmerkmalen entsprach.
Er legte den Ordner weg, ging zu ihr und nahm sie in den Arm. »Tut mir leid«, sagte er und küsste sie auf die Stirn.
»Mir auch.« Sie drückte ihn fest an sich.
Er sagte: »Ist schon richtig, was du sagst. Wenn wir den Erbschein haben, bekommen die Jungs was auf ihre Sparkonten. Den Rest von dem, was das Finanzamt uns übrig lässt, nehmen wir. Und vielleicht finden wir für den alten Schuppen hier ja noch einen Käufer.«
»Da wird nicht viel bei rumkommen. Man muss eine Menge in das Haus reinstecken, um es auf einen modernen Stand zu bekommen, da lässt sich kein hoher Preis herausholen.«
»Ja, vermutlich hast du Recht.«
Carola löste sich von ihm und sagte: »Lass uns weitermachen. Die Leute von der Entrümpelungsfirma kommen bald, und wir sind noch nicht besonders weit gekommen.«
Sie küssten sich flüchtig, dann sagte Joachim: »Ich gehe nach oben, auf den Dachboden. Da war ich seit ... ich weiß nicht, seit wann nicht mehr gewesen. Mal gucken, was da so alles rumsteht.«
Er ging die schmale Treppe hinauf ins Obergeschoss. Neben dem kleinen Badezimmer war das Schlafzimmer seiner Eltern gewesen, und gleich daneben sein Kinderzimmer. Obgleich er wusste, dass der Raum seit Jahren leer stand, öffnete er die Tür und warf einen Blick hinein. Sofort kehrten die Erinnerungen zurück. Dort hinten, neben dem Fenster, hatte sein Bett gestanden, daneben der Schreibtisch mit dem Klappstuhl, an der Wand gegenüber der Kleiderschrank und das schmale Bücherbord. Es lag lange zurück, eine kleine Ewigkeit. Leichter Wehmut überkam Joachim, als er die Tür wieder zuzog. Vermutlich würde er diesen Raum niemals wieder betreten.
Mit seinen knapp ein Meter neunzig war Joachim groß genug, um die Luke zum Dachboden ohne den dafür vorgesehenen Haken aufzuziehen. Er zog die Treppe aus und stieg auf den knarrenden Stufen nach oben. Muffige und kühle Luft schlug ihm entgegen, der Dachboden war nicht gedämmt. Oben war es eng und dunkel, nur durch ein verschmutztes kleines Fenster fiel etwas Tageslicht. Joachim erinnerte sich, wo der Lichtschalter war, und drückte ihn. Die nackte, vom Balken herabhängende Glühbirne flackerte schwach. Überall hingen Spinnweben, hier und da waren alte, nichtaktive Wespennester. Joachim entdeckte die alte Stehlampe mit dem grün-weißen Lampenschirm, die einst im Wohnzimmer neben dem Fernseher stand. Dahinter, halb verborgen, der gedrechselte Hut- und Kleiderständer aus braunem Bugholz, der die halbe Diele eingenommen hatte und bereits Joachims Großeltern gehört hatte. In der Ecke standen zwei alte Lautsprecher, darauf ein Plattenspieler. Joachim erinnerte sich dunkel daran, dass er einst im Wohnzimmer stand, aber kaum zum Einsatz gekommen war, seine Eltern hatten sich nicht viel aus Musik gemacht. Darüber hinaus war der Dachboden leer - bis auf eine leicht verbeulte Blechkiste, auf der ein abgestoßener Koffer lag.
Joachim ging hin und pustete die Staubschicht vom Koffer, dann klappte er den Deckel auf. Kleine Päckchen aus Briefen, Postkarten und Fotos hatten seine Eltern hier über Jahrzehnte sorgfältig aufbewahrt. Nichts, was Joachim weiter interessierte. Er klappte den Koffer wieder zu und hob ihn von der Blechkiste herunter, stellte ihn auf den Boden.
Auf dem Deckel der Blechkiste klebte eine im Laufe der Jahre brüchig gewordene Klarsichthülle, darin steckte ein karierter DIN-A4-Bogen. In schwarzer Filzfarbe und mit der geschwungenen Handschrift seiner Mutter stand sein Vorname auf dem Papier geschrieben. Joachim wunderte sich. Er hatte die Kiste nie zuvor gesehen. Einen Augenblick lang hockte er unschlüssig davor, dann schob er den kleinen Sicherheitsriegel zur Seite und klappte sie auf. Er war gespannt.
Die Kiste war etwa zur Hälfte gefüllt. Mit Schätzen seiner Kindheit. Ganz obenauf lag ein Buch, eine Art Fotoalbum, jedoch deutlich kleiner. Joachim nahm es heraus und klappte es auf. Poesiealbum von Joachim Netzner. Wer sich trägt in dieses Büchlein ein, mag schreiben lieb und fein!, hatte seine Mutter irgendwann mal in ihrer ordentlichsten Handschrift auf die erste Seite geschrieben. Joachim musste schmunzeln. Er las einige der Gedichte und Reime, die auf den ersten Seiten standen, einige in wackeligen Kinderschriften, andere offensichtlich von Erwachsenen geschrieben. Joachim rechnete die Jahreszahl zurück, die unter den längst vergessenen Namen standen. Grundschule, zweite Klasse. Er legte das Poesiealbum beiseite, um es später mit nach Hause zu nehmen. Dann holte er zwei Plastiktüten hervor, die mit Kleidungsstücken gefüllt waren, die er als Kind getragen hatte. Weshalb seine Mutter sie aufbewahrt hatte, war ihm ein Rätsel. Als Nächstes entdeckte er seinen ersten Sony-Walkman, auf den er so lange gespart hatte. Joachim nickte in Erinnerungen vor sich hin und wog den Walkman in der Hand. Es war kaum zu glauben, dass es gerade mal dreiundzwanzig oder fünfundzwanzig Jahre her war, dass er ihn von Stolz beseelt bei Karstadt in der Innenstadt gekauft hatte, und damals war dieses kassettenabspielende Gerät ein kleines technisches Wunderwerk gewesen, zudem eine Art Statussymbol unter den Jugendlichen. Joachim legte ihn in die Kiste zurück, dann zog er einen Gefrierbeutel heraus. Darin befanden sich fünf bespielte Leerkassetten. Hits of the year hatte er einst auf ein Kassettenetikett geschrieben, welches Jahr auch immer es gewesen war. Best of Journey stand auf einer anderen Kassette. Frankie Goes To Hollywood - Hits. Foreigner: Agent Provocateur. Best of ZZ Top. Joachim schüttelte amüsiert den Kopf und legte den Beutel zurück.
Sein Briefmarkenalbum. Auch daran erinnerte er sich. Er hatte sich eine kurze Zeit lang als Sammler versucht. Wie alt war er damals gewesen? Er überlegte, doch er wusste es nicht mehr. Nun kam ein schmales Päckchen zum Vorschein. Eine bunte Plastiktüte, die mit dünnem Paketband und zusätzlichem Klebeband fest verschnürt worden war. Darauf klebte ein beschriftetes Etikett für Einmachgläser. Finger weg!! Top-Geheim!! Joachim erkannte seine eigene Kinderhandschrift.
Was ist da drin?, fragte er sich. Er war im Begriff, das Päckchen aufzureißen, als er Carola von unten rufen hörte: »Joachim, die Leute von der Wohnungsauflösung sind da! Kommst du bitte runter?«
»Bin sofort unten!«, rief er. Er warf einen abschließenden Blick in die Kiste, doch entdeckte nichts mehr, was ihn sonderlich interessierte. Er schloss die Kiste und schob den Riegel zu, schnappte sich das Poesiealbum und das verschnürte Päckchen und stieg die Treppen hinunter. Als er die Dachluke schließen wollte, rutschte ihm der kleine Griff aus den Fingern und die Luke schloss sich mit einem lauten Knall.
»Alles in Ordnung?«, rief Carola hoch. Sie war schnell ängstlich und geriet häufig wegen Kleinigkeiten in Sorge - eine Eigenschaft, die Joachim gelegentlich nervte.
»Ja, alles okay, nichts passiert«, rief er zurück und ging nach unten.
*
Joachim hob den Umzugskarton aus dem Kofferraum des Kombis. Carola schlug die Tür zu und schloss den Mittelklassewagen ab. Kurz darauf betraten sie das Jugendstiletagenhaus und gingen hoch ins erste Obergeschoss. Carola schloss die Wohnungstür auf und ließ Joachim an sich vorbei. Er ging geradewegs in die Küche, stellte den Karton auf die Arbeitsplatte neben der Spüle und hörte, wie Carola die Wohnungstür zudrückte und ihre Jacke in den Garderobenschrank hängte. Unmittelbar danach kam auch sie in die Küche. Sie trat hinter ihn und legte ihre Arme um seine Hüften.
»Wie geht es dir?«, fragte sie sanft. »Es muss weh tun, hinter einen wichtigen Teil des eigenen Lebens den letzten Haken zu machen.«
»Ja, es schmerzt. Aber es war klar, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin dankbar, dass meine Mutter gesund alt werden durfte und dass der Tod sie so erwischt hat, wie wir alle es uns wünschen: Unangekündigt, in einer Sekunde auf die andere, schmerzfrei. Es war das gute Ende eines guten Lebens. Nun noch die Beisetzung Ende nächster Woche und die alte Hütte verscherbeln, und das war es dann.« Er seufzte. »Ein Mensch stirbt, und alles läuft weiter und Erde dreht sich, als sei nichts geschehen. Wie unwichtig jeder von uns im gewaltigen Ganzen ist, niemand ist mehr als bloß ein winziges Stück im gigantischen Puzzle.«
Carola gab ihm einen Kuss auf die Wange und ließ ihn los. Sie sagte: »Heute Abend müssen wir Nicki endlich erzählen, was passiert ist und dass er seine geliebte Oma niemals wiedersehen wird. Davor graut mir.«
Er nickte. Dann sagte er: »Ich weiß, dass es dafür eigentlich zu früh ist, und es ist auch nicht meine Art, aber ich genehmige mir jetzt 'nen Drink.«
»Um vier Uhr Nachmittags?«
»Nur einen. Ich muss runterkommen.«
Carola fasste ihn an den Händen und sagte: »Da habe ich eine viel bessere Idee. Ob es mit runterkommen im wörtlichen Sinn klappt, bleibt jedoch abzuwarten.«
Noch bevor er verstand, zog sie ihn aus der Küche. Als sie das Schlafzimmer ansteuerten, begriff er endlich.
»Caro ... .«
»Sag' jetzt nichts!« Sie legte den Zeigefinger auf die Lippen. Dann, mit sanfter Stimme: »Wir ziehen uns aus und legen uns ins Bett, nehmen uns in den Arm und lassen alles Weitere auf uns zukommen, okay? Vielleicht halten wir uns nur fest, vielleicht streicheln wir einander, vielleicht schlafen wir miteinander. Lass' uns einfach sehen, was passiert.«
Joachim holte tief Luft, dann nickte er. Er hatte schon weit schlechtere Vorschläge gehört.
*
Irgendwann gewann Joachim den Kampf gegen den Halbschlaf. Er benötigte einen Moment, um sich zu orientieren. Er lag allein im Bett. Der Digitalwecker auf dem Nachttisch zeigte wenige Minuten nach achtzehn Uhr an.
Sie waren ins Bett gegangen und Carola hatte sich an ihn geschmiegt. Er hatte es genossen, ihre Haut auf seiner zu spüren, dieses Gefühl von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. Sie hatte seine Brust gesreichelt und er ihre Schulter, und schweigend hatten beide ihren eigenen Gedanken hinterhergehangen. Später hatte sie ihn befriedigt, und sie hatte es nicht auf schnelles Erledigen angelegt, sondern sich Zeit gelassen, damit es für ihn entspannend war.
Joachim stand auf. Seine Kleidungsstücke, die er auf den Fußboden hatte fallen lassen, waren fort, vermutlich hatte Carola sie zum Waschen mitgenommen. Auf dem Weg zu dem Kleiderschrank blieb er vor dem Wandspiegel stehen. Er betrachtete sich. Müde sah er aus, die braunen Augen waren matt, und er musste sich morgen unbedingt wieder rasieren, der Zweitagebart ließ ihn einige Jahre älter wirken. Was sein Äußeres betraf, war Joachim durchaus eitel. Dass die schwarzen Haare von ersten grauen Strähnen durchzogen waren und bereits ausdünnten, störte ihn weniger, denn schließlich konnte er dagegen nichts unternehmen. Anders verhielt es sich bei seiner Figur. Mit regelmäßigem Sport und maßvollem Essen sorgte er dafür, dass er in Form und schlank blieb.
Joachim nahm Unterwäsche, Sweatshirt und Jeans aus dem Schrank, zog sich an und verließ das Schlafzimmer. Er fand Carola in der Küche.
»Du kommst gerade richtig«, sagte sie und hielt ihm den Mund für einen Kuss hin. Er nahm das Angebot an.
»Frischer Kaffee. Möchtest du auch?«
Er nickte.
Sie nahm zwei Becher aus dem Schrank, schenkte Milch ein und füllte mit Kaffee auf.
»Danke«, murmelte Joachim, nahm einen Becher und setzte sich an den schmalen Tisch. Carola drückte sich ihm gegenüber auf die Arbeitsplatte hoch, trank einen Schluck und sagte: »Ich respektiere selbstverständlich Staatsgeheimnisse, sonst hätte ich es längst aufgemacht.«
Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er ihr nicht folgen konnte.
»Ich war so frei, die Kiste leerzuräumen, die wir vom Haus deiner Mutter mitgenommen haben. Finger weg und Top-Geheim steht auf einem Paket. Hattest du es auf dem Dachboden gefunden?«
»Ach, das ..., ja, auf dem Dachboden. Da stand eine Kiste, meine Mutter hatte alten Kram von mir reingepackt. Ich wusste nicht mal, dass es diese Kiste überhaupt gab.«
Carola zeigte neben die Spüle, wo das Päckchen lag.
»Und was ist da drin?«
»Keine Ahnung, ich weiß es nicht.«
»Wahrscheinlich Spionagegut aus der Zeit des Kalten Krieges, ganz brisantes Material.«
Joachim schmunzelte. Er stand auf, zog die Küchenschublade auf und holte eine Schere heraus. Dann nahm er das Päckchen, setzte er sich wieder und schnitt vorsichtig in die Plastiktüte.
»Es ist zusätzlich in Zeitung eingewickelt«, sagte er. »Von ... warte mal ... vom vierzehnten ... ber ... . Hmm, könnte von September bis Dezember alles sein, über dem Monat ist ein Klebestreifen. Das Jahr ist 1985.«
Er schüttelte das Päckchen vorsichtig. Es klapperte leicht.
»Nun mach endlich auf«, drängte Carola.
Joachim schnitt das Papier mit vielen kurzen Schnitten auf. Eine schmale Kiste aus unbehandeltem Holz kam zum Vorschein, etwa dreißig Zentimeter lang und zehn Zentimeter tief. Er öffnete sie vorsichtig.
»Was ist es?«, fragte Carola und machte einen langen Hals.
»Ich weiß es nicht, keine Ahnung«, antwortete er und blickte auf ein Wirrwarr aus Fäden, dünnen Stäben, sechs kleinen Holzfiguren und einer Holzkugel. Carola rutschte von der Arbeitsplatte und trat an den Tisch. Sie warf einen kurzen Blick auf das Durcheinander und griff dann nach der Holzkugel.
»Ein Mobile«, sagte sie verwundert. »Kann es sein, dass es ein Mobile ist?«
Joachim lehnte sich zurück. Angestrengt dachte er nach.
»Hattest du früher ein Mobile aus Holz über deinem Kinderbett hängen?«
Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf. »Oh nein, das glaube ich einfach nicht …!«
»Was denn? Erzähl!«
»Die Geschichte hatte ich längst vergessen.«
Carola zog sich den zweiten Stuhl heran und setzte sich. »Nun spann mich nicht länger auf die Folter.«
Joachim schmunzelte und sagte geheimnisvoll: »Tut mir leid, aber das darf ich nicht erzählen. Wirklich nicht!«
»Weshalb denn das nicht?«
»Weil ich ein Versprechen brechen würde.«
»Ein Versprechen? Aus dem Jahre 1985?«
Er nickte.
»Das ist längst verjährt, es sind bald dreißig Jahre vergangen.«
Joachim wiegte den Kopf, tat so, als sei er schwer hin- und hergerissen. Schließlich sagte er: »Ich denke, du hast Recht. Ja, ich werde es dir wohl erzählen dürfen.«
»Na dann, schieß los!«, sagte Carola, schlug die Beine übereinander und sah ihn erwartungsvoll an.
*
»Joachim?«, rief seine Mutter energisch durchs Haus. »Joachim, hörst du? Der Michael ist da. Kommst du bitte runter?«
»Ja, komme gleich!«
Joachims Mutter wandte sich kurz Michael zu, der ein enges T-Shirt und Shorts trug. Seine Füße steckten in Socken und Sandalen.
»Wie geht es der Mama?«, fragte sie und fuhr fort, die Herdplatten zu schrubben.
»Gut.«
»Dem Papa auch?«
»Ja.« Michael sah verstohlen zur Treppe und fragte sich, wo Joachim so lange blieb.
»Und deinem Bruder? Geht es dem Ulrich auch gut?«
»Ja.«
»Das höre ich gern«, sagte Joachims Mutter und warf einen letzten kritischen Blick auf den Herd. »Was wollt ihr denn machen, der Joachim und du?«
»Mal gucken.«
»Das Wetter ist herrlich.«
»Ja.«
Endlich erschien Joachim. Michael atmete erleichtert auf. Auch Joachim trug kurze sommerliche Kleidung. Anders als der schlanke Michael hatte er ein rundes Gesicht und war leicht untersetzt.
»Nun geht schon endlich raus, ihr zwei Verrückten«, sagte Joachims Mutter lächelnd.
Die beiden Jungen verließen das Haus.
»Fahrrad?«, fragte Michael.
»Klar.«
»Meins ist schwarz mit weißen Füßen und heißt Donner.«
»Pferde haben keine Füße, du Spasti, sondern Hufe.«
»Weiß ich, hatte nur nicht dran gedacht. Meins heißt trotzdem Donner.«
Joachim zuckte lässig die Schultern. »Mir egal! Meins heißt Dynamit und ist schneeweiß, mit einer langer Mähne. Die Weißen sind immer schneller.«
»Die Weißen sind alle kastriert.«
»Was sind die?«
»Du weißt schon: Die können nicht mehr ficki-ficki.« Er grinste breit.
»Ach das, klar«, beeilte Joachim sich zu sagen. Dann, um das Thema zu wechseln: »Brauchen wir Proviant?«
»Nö. Meine Mutter hat mir für uns zwei Mark für Eis oder so mitgegeben.«
»Perfekt!«
Sie schwangen sich auf ihre Fahrräder und radelten mit hohem Tempo los. Joachim hatte erst kürzlich einige Spielkarten eines Rennwagen-Quartetts zwischen den Speichen von Vorder- und Hinterrad festgesteckt, und je kräftiger er in die Pedale trat, desto lauter und schneller knatterten sie wie ein Maschinengewehr. Das war cool, dennoch beneidete er Michael um die Radlaufglocke am Fahrrad, die einen penetranten und lauten Dauerton erzeugte, sobald beim schnellen Fahren der Bowdenzug betätigt wurde, doch Joachim wusste nur zu genau, dass er seinen Eltern mit einer Sturmklingel gar nicht erst zu kommen brauchte - keine Chance, dass sie es ihm erlaubten.
Joachim und Michael fuhren halsbrecherisch schnell und scherten sich einen Teufel um andere Verkehrsteilnehmer, vor allem Fußgänger brüllten ihnen immer wieder Mahnungen und Zurechtweisungen hinterher. Ho, Donner, ho! rief Michael immer wieder, Schneller, Dynamit, schneller!, hielt Joachim dagegen, und beide legten sich tief über das Lenkrad, waren in ihren Vorstellungen dicht am Hals ihres Pferdes, das sie im harten Galopp durch die Wildnis trug.