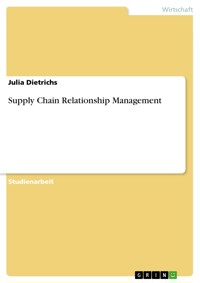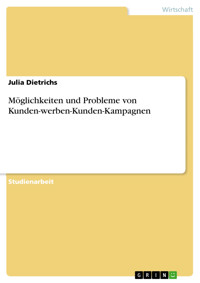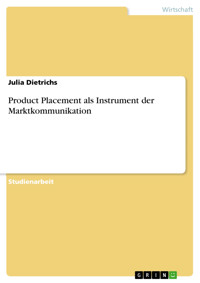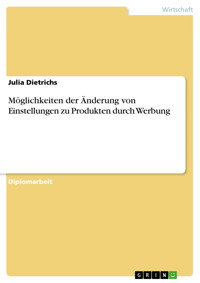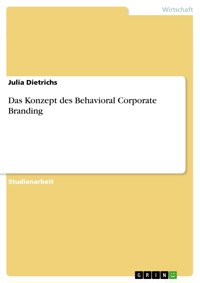36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Pädagogik - Hochschulwesen, Note: 1,0, Universität Kassel, Veranstaltung: Wirtschaftswissenschaften, Sprache: Deutsch, Abstract: Mobiltelefone, Smartphones, PDAs und andere mobile Endgeräte wie beispielweise Netbooks oder Smartpads sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Durch die steigende Verbreitung sowie den gesellschaftlichen Wandel ändert sich auch das Nutzungs- und Anspruchsverhalten der Individuen. [...] Einen großen Einfluss auf diesen Wandel hat neben den technologischen Entwicklungen bei den Endgeräten auch die steigende Internetnutzung. [...] Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Veränderungen des studentischen Lernens wider. So verwundert es niemanden mehr, dass sowohl in Literatur als auch in Praxis immer häufiger über Mobile Learning und seine Anwendungsmöglichkeiten an Universitäten und in Unternehmen diskutiert wird. Besonders seit der Markteinführung des iPads von Apple wird Mobile Learning verstärkt in der Fachpresse erwähnt. Der Ansatz des Mobile Learnings fokussiert sich dabei auf die Mobilität des Lernortes. Mobile Learning soll nicht die klassischen Lernmedien oder Electronic Learning-Plattformen ersetzen, sondern als eine Erweiterung gesehen werden, als Möglichkeit zwischendurch und spontan kurze Lernphasen zu nutzen. Da mobile Endgeräte über ein immer größer werdendes Leistungsspektrum verfügen, ergeben sich neue Potentiale, die es zu ergründen gilt. Inwieweit Mobilfunkgeräte zum mobilen Lernen geeignet sind, ist derzeit noch nicht in vollem Maße geklärt und soll in dieser Arbeit genauso untersucht werden wie die Bereitschaft von Studierenden, die jeweiligen Medien zum mobilen Lernen zu nutzen. Demzufolge soll im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, wie Studenten zurzeit lernen und wie ihre Einstellung bezüglich mobiler Medien und dem Mobile Learning ist. Dies geschieht anhand einer empirischen Untersuchung an deutschen Universitäten. Aufgrund der Ergebnisse sowie einer ausführlichen Literaturrecherche soll die aktuelle Lernsituation dargestellt werden, um abschließend eine Handlungsempfehlung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen in der Lernübermittlung an deutschen Hochschulen zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Mobile Learning an deutschen Universitäten - Eine empirische Analyse von Einstellung und Akzeptanz zu mobilem Lernen bei Studierenden
Page 4
Page 5
Abkürzungsverzeichnis IV
III. Abkürzungsverzeichnis
Personal Digital AssistantPDA
Wireless Local Area NetworkWLAN
Page 6
Einleitung 1
1 Einleitung
1.1. Aufgabenstellung und Zielsetzung
Mobiltelefone, Smartphones, PDAs und andere mobile Endgeräte wie beispielweise Netbooks oder Smartpads sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Durch die steigende Verbreitung sowie den gesellschaftlichen Wandel ändert sich auch das Nutzungs- und Anspruchsverhalten der Individuen. Diese Veränderung lässt sich auch auf das Arbeits- sowie Lernverhalten übertragen, wodurch sich die Frage stellt, wie Lernen zukünftig aussehen kann und soll.
Einen großen Einfluss auf diesen Wandel hat neben den technologischen Entwicklungen bei den Endgeräten auch die steigende Internetnutzung. Sie hat in den letzten Jahren eine immer bedeutendere Stellung eingenommen und ist zu einem unverzichtbaren Teil in unserem Leben geworden. Das Statistische Bundesamt gab an, dass 77 % der Bundesbürger mittlerweile über
einen Internetzugang verfügen.1Zudem nutzen 16 % der Internetnutzer laut einer Pressemitteilung vom 14.02.2011 das mobile Internet, was einem Anstieg von 78 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei sind die Altersgruppen von 16-24 und 25-34 Jahren besonders ak-
tiv.2
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Veränderungen des studentischen Lernens wider. So verwundert es niemanden mehr, dass sowohl in Literatur als auch in Praxis immer häufiger über Mobile Learning und seine Anwendungsmöglichkeiten an Universitäten und in Unternehmen diskutiert wird. Besonders seit der Markteinführung des iPads von Apple wird Mobile Learning verstärkt in der Fachpresse erwähnt.
Der Ansatz des Mobile Learnings fokussiert sich dabei auf die Mobilität des Lernortes. Mobile Learning soll nicht die klassischen Lernmedien oder Electronic Learning-Plattformen ersetzen, sondern als eine Erweiterung gesehen werden, als Möglichkeit zwischendurch und spontan kurze Lernphasen zu nutzen. (vgl. Kapitel 3.2)
1vgl. Statistisches Bundesamt 2011
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Grafiken/WirtschaftsrechnungenZeitbudget
s/Diagramme/KommunikationPrivateHaushalte,templateId=renderPrint.psml [02.06.2011]
2vgl. Statistisches Bundesamt 2011
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2011/02/PD11__060__63931,te
mplateId=renderPrint.psml [02.06.2011]
Page 7
Einleitung 2
Da mobile Endgeräte über ein immer größer werdendes Leistungsspektrum verfügen, ergeben sich neue Potentiale, die es zu ergründen gilt.
Inwieweit Mobilfunkgeräte zum mobilen Lernen geeignet sind, ist derzeit noch nicht in vollem Maße geklärt und soll in dieser Arbeit genauso untersucht werden wie die Bereitschaft von Studierenden, die jeweiligen Medien zum mobilen Lernen zu nutzen.
Demzufolge soll im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, wie Studenten zurzeit lernen und wie ihre Einstellung bezüglich mobiler Medien und dem Mobile Learning ist. Dies geschieht anhand einer empirischen Untersuchung an deutschen Universitäten. Aufgrund der Ergebnisse sowie einer ausführlichen Literaturrecherche soll die aktuelle Lernsituation dargestellt werden, um abschließend eine Handlungsempfehlung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen in der Lernübermittlung an deutschen Hochschulen zu geben.
1.2. Aufbau der Arbeit
InKapitel 2werden die definitorischen Grundlagen gelegt, die für das Verständnis der weiteren Arbeit wichtig sind. Zunächst einmal wird in Kapitel 2.1 der Begriff der Einstellung definiert. Kapitel 2.2 erläutert das Lernen, während Kapitel 2.3 auf die Mobilität eingeht. Gerade die Begriffe Lernen und Mobilität bilden mitunter den Ausgangspunkt für die spätere Definition von Mobile Learning. In Kapitel 2.4 werden abschließend noch einige technische Grundlagen erläutert. Dabei wird zwischen stationären, portablen und mobilen Endgeräten unterschieden.
Kapitel 3widmet sich im Anschluss daran den Begriffen Electronic Learning und Mobile Learning. Die Definition von Electronic Learning ist insbesondere im Hinblick auf die Definition von Mobile Learning bedeutsam, da Mobile Learning als eine Art Weiterentwicklung gesehen werden kann. Nachdem diese beiden Begriffe in Kapitel 3.1 und 3.2 definiert werden, werden in Kapitel 3.3 die Vor- und Nachteile des mobilen Lernens aufgezeigt. Kapitel 3.4 stellt einige Praxisbeispiele vor. Neben einem Praxisbeispiel aus dem wirtschaftlichen Kontext beinhaltet das Kapitel auch zwei Beispiele von amerikanischen Universitäten sowie ein deutsches Pilotprojekt.
Die empirische Untersuchung wird inKapitel 4behandelt. Zunächst wird inKapitel 4.1der idealtypische Marktforschungsprozess beschrieben, der die Grundlage für die Befragung inKapitel 4.2bildet. Daher wird der Prozess der Befragung auch in die Unterpunkte Problem-
Page 8
Einleitung 3
stellung, Auswahl der Erhebungsmethode, Fragebogendesign, Untersuchungserhebung sowie Analyse und Dokumentation untergliedert.
Kapitel 5folgt mit einer Interpretation der Ergebnisse, die die verschiedenen Auswertungen zusammenfasst und in Relation zueinander setzt. InKapitel 6wird versucht, eine Handlungsempfehlung zu geben, wie an deutschen Universitäten mobiles Lernen in Zukunft ausgestaltet werden könnte und welche Möglichkeiten jeweils bestehen.
Abschließend werden inKapitel 7die Ergebnisse zusammengefasst und ein kurzer Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Page 9
Definitorische Grundlagen 4
2 Definitorische Grundlagen
2.1 Einstellung
Einstellungen sind ein wichtiger Bestandteil des Marketings sowie der Marktforschung und geben die Meinung zu einem bestimmten Objekt wieder. Sie sind „individuelle Besonderheiten in der Bewertung spezifischer Objekte der Wahrnehmung oder Vorstellung wie CDU vs. SPD oder Pulverkaffee vs. Bohnenkaffee.“ (Asendorpf 2007, 249)
Sie sind zudem auch ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens und stellen eine bedeutende Einflussgröße auf das menschliche Verhalten dar. Man kann sogar so weit gehen, dass sie zusammen mit Emotionen und Motivationen die entscheidende Größe für unser Verhalten (vgl. Homburg/Krohmer 2003, 39) und somit auch einen „central part of human individuality“ (Bohner/Wänke 2002, 3) darstellen.
Perloff (vgl. 2003, 38) sieht in einer Einstellung ein psychologisches Konstrukt, durch das Individuen charakterisiert werden können. Einstellungen sind demnach nicht beobachtbar, sondern können nur aus den Handlungen der Individuen abgeleitet werden.
Fishbein und Ajzen (vgl. 1975, 6) beschreiben eine Einstellung als erlernte Prädisposition, durch die auf ein Objekt gleichbleibend reagiert wird.
Bourne und Ekstrand (vgl. 1992, 404) betonen bei ihrer Definition von Einstellungen besonders die Bewertungskomponente. Eine Einstellung ist ein Konstrukt, das sich durch eine Bewertung auszeichnet. Auch Jonas et al. (vgl. 2007, 189) sehen eine Einstellung durch ein bewertendes Urteil definiert. Zu bewertende Objekte lassen sich in vielfältiger Form finden. Neben abstrakten Begriffen, wie dem Kommunismus, kann es sich dabei auch um konkrete Objekte, wie beispielsweise anderen Personen oder sozialen Gruppen, handeln.
Zusammenfassend kann man eine Einstellung als eine innere und erlernte Denkhaltung beschreiben, die ein Individuum gegenüber einer Person, Idee oder Sache entwickelt. Eine Einstellung ist immer mit einer Wertung oder Erwartung verbunden, sie kann als eine psychische Tendenz beschrieben werden, durch die die positive wie auch negative Bewertung zu einem bestimmten Objekt zum Ausdruck kommt und durch die Gedanken und Handlungen von In- dividuen beeinflusst werden. (vgl. Eagly/Chaiken 1993, 1; Aronson et al. 2004, 230; Hanno-
Page 10
Definitorische Grundlagen 5
ver et al. 2004, 190; Homburg/Krohmer 2003, 39; Six et al. 2007, 91; Schweiger/Schrattenecker 2005, 23; Krech et al. 1962, 139; Fazio 1989, 155)
Individuen sind keine neutralen Beobachter ihrer Umwelt und entwickeln aus Lernprozessen heraus Einstellungen. Dieser Prozess findet in der Regel unbewusst statt. Liest ein Individuum beispielsweise einen Artikel über Solarenergie, entwickelt es ein Schema über die Thematik und bewertet die enthaltenen Informationen positiv, neutral oder negativ. (vgl. Bour-ne/Ekstrand 1992, 404f.; Aronson et al. 2004, 230)
Einstellungen werden in der Einstellungsforschung noch einmal in explizite und implizite Einstellungen unterschieden. Explizite Einstellungen spielten vor allem in der Vergangenheit eine wichtige Rolle und wurden besonders betrachtet. Dies fand vor dem Hintergrund statt, dass Wissenschaftler davon ausgingen, dass explizite Einstellungen direkt abfragbar sind, da sich die Einstellung zu einem Objekt aus einzelnen Merkmalen zusammensetzt und die Bewertung dessen bewusstseinsnah abläuft. Befürworter dieser Einstellungsrichtung gehen demnach davon aus, dass Individuen sich ihrer Einstellungen bewusst sind und diese daher klar kommunizieren können. (vgl. Petty et al. 2002, 158; Asendorpf 2007, 255; Aronson et al. 2004, 252f.)
Während die klassische Einstellungsforschung von bewussten Einstellungen ausgeht, haben sich durch die neuere Einstellungsforschung einige Änderungen ergeben. Neben expliziten Einstellungen werden in dieser Disziplin auch implizite Einstellungen betrachtet und untersucht. Unter impliziten Einstellungen sind jene Einstellungen zu verstehen, deren sich die Individuen nicht bewusst sind. Implizite Einstellungen lassen sich im Gegensatz zu expliziten Einstellungen nicht durch direkte Befragungen ermitteln, sondern nur durch Priming- oder Assoziationstests. (vgl. Petty et al. 2002, 158; Asendorpf 2007, 257; Wittenbrink/Schwarz 2007, 17)
Implizite Einstellungen sowie die Verfahren zur Untersuchung dieser Einstellungen werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet und wurden nur zur Vollständigkeit angesprochen. Die Konzentration wird auf den expliziten Einstellungen liegen, die in der durchge- führten empirischen Untersuchung abgefragt wurden.
Page 11
Definitorische Grundlagen 6
2.2 Lernen
Der Begriff des Lernens stellt eine wichtige Determinante dar, um Mobile Learning in seiner ganzen Facette zu verstehen. Daher soll er im Folgenden kurz erläutert werden. Dies spielt insbesondere vor dem Hintergrund eine Rolle, dass Mobile Learning Lernen nicht neu erfinden will, sondern versucht, bestehende Lerntheorien an die neuen technologischen Möglichkeiten anzupassen.
Lernen kann in unterschiedlichster Weise und Form erklärt werden. Viele Autoren stützen sich auf den Ansatz des Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, andere auf den Ansatz des Teachers und Learners Centered Paradigm.
In derbehavioristischen Sichtweisenimmt der Lehrende eine zentrale Stellung ein, da er derjenige ist, der das Wissen besitzt und an die Lernenden vermittelt. Diese nehmen den Lerninhalt auf, lernen ihn auswendig und können ihn wiedergeben. Es findet jedoch keine ausreichende Auseinandersetzung und Verarbeitung statt. Der Lernerfolg wird zudem ausschließlich über Wissensabfragen ermittelt, bei denen es nur ein richtig oder falsch gibt. (vgl. Naismith et al. 2005, 12f.)
Innere Vorgänge werden hierbei nicht berücksichtigt, positives Feedback soll das gezeigte Lernverhalten bestärken, negatives Feedback soll zur Unterlassung beziehungsweise Änderung führen. Der Ansatz wird jedoch langfristig nicht dazu beitragen, dass Verhaltensmuster geändert werden. (vgl. Naismith et al. 2005, 12f.)
In Hinblick auf das Mobile Learning lässt sich dieser Ansatz jedoch nur bei der Vermittlung von Faktenwissen umsetzen, wenn die Wissensvermittlung zum Beispiel im Vorfeld stattge-funden hat und es nur noch um die reine Abfrage von Wissen geht, wie dies beispielsweise bei Vokabeln der Fall ist. Auch Auswahlaufgaben wären in diesem Zusammenhang sinnvoll. (vgl. Ernst 2008, 63f)
Diese Art der Lernvermittlung lässt sich gut mit einem kommunikativen Prozess vergleichen, bei dem Informationen nur übermittelt werden, was einer einseitigen Kommunikation entspricht. Wie anhand von Abbildung 1 zu erkennen ist, übermittelt der Kommunikator die In-formationen ungefiltert an den Rezipienten, der die Informationen aufnimmt, jedoch nicht hinterfragt oder Feedback gibt. Im Vergleich dazu übermittelt der Lehrende Lerninhalte an den Lernenden, ohne dass dieser Rückmeldungen gibt. (vgl. Six et al. 2007, 21; Kloss 2007, 3)
Page 12
Definitorische Grundlagen 7
Abbildung 1 Vergleich einer einseitigen Kommunikation von Informationen und Lerninhalten Eigene Darstellung in Anlehnung an: Six et al. 2007, 21
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang vermehrt auftritt, ist das Microlearning. Es beschreibt das Lernen in kleinen und kurzen Lerneinheiten, die auf mobilen Medien ablaufen und zu jeder Zeit und an jedem Ort durchgeführt werden können. Dies spielt vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Technologisierung und dem Aspekt des lebenslangen Lernens eine große Rolle. Microlearning umfasst in der Regel einfache Tests, wie zum Beispiel Multiple-Choice-Tests oder Anwendungen auf Basis von Web 2.0-Technologien. (vgl. Ernst 2008, 66ff.)
Eine zweite Sichtweise zum Lernen vertritt derKognitivismus,der die doch recht eng gefasste Sicht des Behaviorismus auflockert und erweitert. Hier beginnt das Individuum sich mit den gegebenen Informationen auseinanderzusetzen und Informationsnetzwerke zu entwickeln. Lernen wird bei dieser Sichtweise eher als Verarbeitungsprozess verstanden. Die Informationsaufnahme und -speicherung hängt von der Aufbereitung und Darbietung der Lerninhalte ab und somit auch von den kognitiven Aktivitäten des Lernenden. Zu beobachten ist das entdeckende Lernen, in dem der Studierende seinen Lernweg selbst aktiv steuert und Probleme eigenständig löst. (vgl. Ernst 2008. 64)
Der kommunikative Prozess verläuft hier nicht nur in eine Richtung, sondern bietet die Möglichkeit von Feedback seitens der Rezipienten, wie man anhand folgender Abbildung sehen kann.
Page 13
Definitorische Grundlagen 8
Abbildung 2 Wechselseitige Kommunikation bei der Vermittlung von Lerninhalten
Eigene Darstellung in Anlehnung an: Six et al. 2007, 21
Eine Weiterentwicklung des Kognitivismus ist derKonstruktivismus,der den Lernenden in eine aktive Rolle versetzt. Der Lernende nimmt nicht nur das Gelehrte des Dozenten auf, sondern wendet die gegebenen Informationen aktiv an, reflektiert und hinterfragt sie und setzt sie in Beziehung zu dem bereits vorhandenem Wissen. In dieser Sichtweise ist der Dozent eher ein Lernbegleiter, der dem Lernenden Denkanstöße gibt. Die individuelle Wahrnehmung nimmt für den Studierenden eine entscheidende Rolle im Denkprozess ein. (vgl. Jank/Meyer 2003, 286ff.; Naismith et al 2005, 15; Ernst 2008, 65)