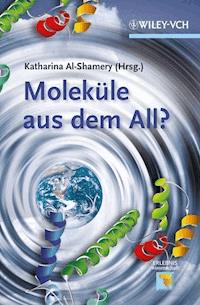
Moleküle aus dem All? E-Book
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Erlebnis Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach dem Ursprung des Lebens ist und bleibt eine der spannendsten, gerade fernab wilder Spekulationen und fragwürdiger Behauptungen: faktengestützt und unterhaltsam legen die Autoren dar, wie es auf der anfangs ungemütlichen Erde zur Ausbreitung von Leben kommen konnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
Autorenliste
Danksagung der Herausgeberin
I Der Urknall
1 Kosmischer Staub und die Geschichte der Welt mit ihren Bausteinen
II Moleküle aus dem All
2 Der urzeitliche Molekülbaukasten
Ursprung und Quelle der ersten komplexen Moleküle zum Aufbau biologischer Strukturen
Was könnten die unverzichtbaren molekularen Ur-Bausteine sein?
Anorganische Moleküle als Ur-Moleküle (Cairns-Smith)
Organische kleine Moleküle als Bausteine des Lebens
Polymere/Makromoleküle als Bausteine (Polypeptide, Polynucleinsäuren u.a.)
Verschiedene Szenarien für die frühe Evolution der Biosphäre
Chemische Evolution in der Präbiologie in einer Eisen-Schwefel-Welt
Leben – ein Netzwerk verschiedener Mechanismen und Szenarien statt eines Sammelsuriums einzelner Moleküle im Entstehen und Verschwinden
3 Im Weltall: RNA-Vorläufer in Kometen
4 Von wegen Science Fiction: Leben im All
Biochemische Evolution? Es geht um’s nackte Leben!
III Kochtopf Vulkan
5 Auf Vulkaninseln: Von anorganischen Gasen zum Ur-Stoffwechsel
Erde oder Mars?
Wann entstand das Leben?
Eine fantastische Reise
Chemische Evolution und die Strategien zu ihrer experimentellen Erforschung
Die präbiotische Chemie urzeitlicher Vulkaninseln
Nucleinsäuren und Eiweiße: Problemfalle der chemischen Evolution
Begann der Ur-Stoffwechsel als Netzwerk kleiner Moleküle?
6 Spuren im Meer
Chemische Evolution – ein Prozess der Gegenwart?
Das gelöste organische Material der Meere – eines der größten Rätsel in den Meereswissenschaften
Warum ist selbst nach über hundert Jahren Forschung so wenig über das gelöste organische Material im Meer bekannt?
Der Nachweis einer erstaunlichen Substanzklasse in der Tiefsee
Abschlussgedanken
Danksagung
IV Evolution und Selektion
7 LUCA – letzter gemeinsamer Vorfahre allen Lebens
Einführung: Darwins Stammbaum des Lebens
Crashkurs in Biologie
Wie bestimmt man die Verwandtschaft zwischen Organismen?
Die drei Domänen des Lebens
Was hat die Wissenschaft bisher über LUCA gelernt?
Welche Bedingungen herrschten auf der Ur-Erde?
Wo lebte und gedieh der LUCA?
Schlussfolgerungen
Anhang A: Geschichte der modernen Biologie
Anhang B: Evolution des Ribosoms – das älteste bis heute überlebende Urzeitrelikt des LUCAS
Danksagung
8 Mutationen haben ihren Wert und ihren Preis: Metastabile DNA-Strukturen und die Konsequenzen
Der Stoff, aus dem die Gene sind
Die Barberton-Funde zeigen die Bedeutung des Erdmagnetfeldes für die Entstehung des Lebens
Ein Baum des Lebens? Wo sind seine Wurzeln?
DNA kann viel mehr, als die genetische Information zu speichern
Vererbbare menschliche Leiden entstehen durch Faltungsfehler der DNA
Ein Blick auf den genetischen Code der menschlichen Mitochrondrien
Profile der Wechselwirkungsenthalpie können Gensequenzen charakterisieren
DNA-Sequenzen lassen sich als Energieprofile darstellen
9 »Survival of the Fittest«: Das wichtigste Wort
10 Natürliche Auslese – eine physikalische Gesetzmäßigkeit in der Evolution des Lebens
11 Die Evolutionsmaschine als Quelle für selektive Biokatalysatoren
Einführung
Beispiele für gerichtete Evolution als Methode zur Erhöhung der Enzymstabilität
Erste Beispiele für gerichtete Evolution enantioselektiver Enzymen
Lektionen aus der gerichteten Evolution
Weitere Beispiele für die gelenkte Evolution enantioselektiver Biokatalysatoren
Die Suche nach Methoden zur Effizienzsteigerung der gerichteten Evolution
Schlussfolgerung und Perspektiven
Danksagung
V Bild und Spiegelbild
12 Die Asymmetrie des Lebens und die Symmetrieverletzungen der Physik: Molekulare Paritätsverletzung und Chiralität*
Einleitung: Merkwürdige Asymmetrien von Raum, Zeit und Materie in einer fast symmetrischen Natur
Literatur
Index
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Bergmann, H.
Wasser, das Wunderelement?
Wahrheit oder Hokuspokus
2011
ISBN: 978-3-527-32959-5
Schwedt, G.
Die Chemie des Lebens
2011
ISBN: 978-3-527-32973-1
Schwedt, G.
Lava, Magma, Sternenstaub
Chemie im Inneren von Erde, Mond und Sonne
2011
ISBN: 978-3-527-32853-6
Groß, M.
9 Millionen Fahrräder am Rande des Universums
Obskures aus Forschung und Wissenschaft
2011
ISBN: 978-3-527-32917-5
Gross, M.
Der Kuss des Schnabeltiers
und 60 weitere irrwitzige Geschichten aus Natur und Wissenschaft
2011
ISBN: 978-3-527-32738-6
Köhler, M.
Vom Urknall zum Cyberspace
Fast alles über Mensch, Natur und Universum
2011
ISBN: 978-3-527-32739-3
Synwoldt, C.
Alles über Strom
So funktioniert Alltagselektronik
2011
ISBN: 978-3-527-32741-6
Roloff, E.
Göttliche Geistesblitze
Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker
2010
ISBN: 978-3-527-32578-8
Zankl, H.
Kampfhähne der Wissenschaft
Kontroversen und Feindschaften
2010
ISBN: 978-3-527-32579-5
Ganteför, G.
Klima – Der Weltuntergang findet nicht statt
2010
ISBN: 978-3-527-32671-6
Hüfner, J., Löhken, R.
Physik ohne Ende
Eine geführte Tour von Kopernikus bis Hawking
2010
ISBN: 978-3-527-40890-0
Herausgeber
Katharina Al-Shamery
Universität Oldenburg
Fakultät V, IRAC
Ammerländer Heerstraße 114–118
26129 Oldenburg
Satz Mitterweger & Partner, Plankstadt
Umschlaggestaltung Bluesea Design, McLeese Lake, Canada
Print ISBN: 978-3-527-32877-2
ePDF ISBN: 978-3-527-63708-9
ePub ISBN: 978-3-527-63707-2
Mobi ISBN: 978-3-527-63709-6
1. Auflage 2011
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Für Nora, Noah und Zaem
Vorwort
Katharina Al-Shamery
Wir schreiben 4,5 Mrd. Jahre vor unserer Zeit in einem Sonnensystem am Rande der Galaxie, eines Spiralnebels namens Milchstraße. Ein schnell rotierender Planet namens Erde hat sich mit seinem Mond aus der Kollision der Protoerde mit dem marsgroßen Protoplaneten Theia gebildet. Die Erdoberfläche ist ein kochender, langsam erstarrender Lavasee, in dem sich die leichteren Elemente anreichern, die während des Urknalls, wie von Jessberger beschrieben, gebildet wurden ...
Die Atmosphäre dieser jungen Erde war dramatisch anders als heute und bestand aus Wasserdampf, Methan, Kohlendioxid, Stickstoff und anderen Gasen. Weitere 300 Mio. Jahre vergingen, bis die Erde kalt genug war, dass Wasser in den großen Basaltpfannen kondensieren und den Urozean bilden konnte. Damals kochte der Ozean bei wesentlich höheren Temperaturen als heute, da der Atmosphärendruck viel größer war. Gewaltige Tiden überrollten die Uferzonen, denn der Mond war der Erde noch sehr nahe. Ungehindert, da es noch keine Ozonschicht gab, bestrahlte kurzwelliges UV- und Röntgenlicht der jungen, schnell rotierenden Sonne Meere und Land. Sonnenwinde mit ihren ionisierten, energiereichen Teilchen konnten auf die schutzlose Erdoberfläche gelangen, da sich das ableitende Erdmagnetfeld noch nicht ausgebildet hatte. Meteoriten prasselten unablässig herab, denn die Einschläge ließen erst 500 Mio. Jahre später nach, als Jupiter entstand und die Asteroiden in seinem Gravitationsfeld an sich band. Unter diesen Hexenküchenbedingungen traten die ersten organischen Moleküle auf, die die Grundbausteine der Biomoleküle bildeten. Ist es der erbarmungslosen Umwelt zu verdanken, dass unser Leben auf nur 20 aus der Vielzahl der unterschiedlichen Aminosäuren basiert, nämlich den unter diesen Bedingungen stabilsten? Der wichtigste Schritt auf dem Weg zum Leben war die Ausbildung von längeren Ketten aus Aminosäuren, die sich selber replizieren konnten. Dazu musste Energie aufgewendet werden, vermutlich photochemischer Natur. Leider sind die geologischen Bedingungen zu harsch, als dass diese ersten Zeugen der Entstehung des Lebens hätten konserviert werden können. Wo und wie traten sie in die Welt? Thiemann mutmaßt, es habe möglicherweise eine siliciumbasierte Vorläuferform gegeben, die als eine Art Geburtshelfer den kohlenstoffbasierten Biosystemen den Weg ebnete. Neuesten Entdeckungen der Astrobiologin Felisa Wolfe-Simon (nicht in diesem Buch vertreten) und ihrer Kollegen im Jahr 2010 – während der Entstehung dieses Buches – zufolge können Lebensformen auch auf der Erde durchaus das toxische Arsen anstelle von Phosphor verwenden. Dies zeigt, dass wir ganz anders denken müssen, um andersartige Lebensformen im All identifizieren zu können. Wurden die Urformen der Biomoleküle unter kosmischen Bedingungen gebildet und von Meteoriten auf die Erde gebracht? Um diese These zu prüfen, wird 2014 eine Sonde auf dem Kometen Tschurjumow-Gerasimenko landen, da Kometen die Bedingungen des frühen Erdzeitalters quasi »eingefroren« haben. Meierhenrich berichtet über seinen Beitrag zu dieser Mission. Da Mars anfänglich sehr ähnliche Bedingungen aufwies und ein Austausch zwischen den Planeten stattgefunden haben kann, sucht man auf dem Mars nach Spuren des Lebens. Dieses und mehr über Marsmissionen diskutiert NASA-Direktor v. Puttkamer.
Strasdeit dagegen verfolgt die Idee, in wassergefüllten Vulkanspalten am Rande von Ozeanen nach primitiven Vorformen von Zellen zu suchen. Man muss sich diese Vorformen wie Seifenblasen vorstellen, in denen die miteinander reagierenden Moleküle angesammelt waren und die sich bei Überschreiten einer kritischen Größe aufteilten. Vielleicht findet die Evolution noch immer vor unserer Nase statt. Dittmar weist darauf hin, dass unsere Erde geschätzte 15 Trilliarden Tonnen organischen Kohlenstoff enthält, wovon nur 0,005% lebender Biomasse zuzuschreiben sind. 700 Mrd. Tonnen organischer Kohlenstoff sind allein im Meerwasser gelöst.
Unser erster Vorfahr wird in der Wissenschaft LUCA (last universal cellular ancestor, letzter universeller Zellvorfahre) genannt, so Mulkidjanian und Lankenau. Immerhin wies er bereits 60 Gene auf, davon sieben für die Replikation, die alle Lebewesen (auch der Mensch) gemeinsam haben. Wir tragen also immer wieder replizierte Erbinformationen in uns, die vor 3,8 bis 4 Mrd. Jahren entstanden sind!
Die Erde hat sich seit dieser Zeit dramatisch verändert. Damit das Leben diesem Wandel folgen konnte, musste Evolution möglich sein. Dies ist aber nur durch ganz bestimmte Sequenzen von Aminosäuren gewährleistet, die einerseits stabil sein mussten, andererseits aber nicht zu stabil sein durften, wie Klump ausführt. Die Anpassung eines einzelnen Lebewesens reichte dabei nicht. Es musste sich auch schnell genug vermehren können, so Runge, damit eine Spezies in geänderten Lebensumständen überleben konnte. Nobelpreisträger Eigen geht noch weiter und beschreibt die Evolution anhand komplexer nichtlinear-dynamischer Prozesse. Eine Veränderung der Randbedingungen bewirkte dabei eine fast gleichzeitige Anpassung vieler Individuen. Man kann sich dies wie beim plötzlichen Phasenübergang von Eis zu flüssigem Wasser vorstellen, wozu sich die Umgebungstemperatur nur um ein Grad ändern muss.
Was nutzen uns die Erkenntnisse über die chemische Evolution? Eigen entwickelte daraus die Evolutionsmaschine, die von Forschern wie Reetz umgesetzt wurde, um neue, effizientere Biokatalysatoren zu finden, mit deren Hilfe z.B. Medikamente hergestellt werden. Am Ende des Buches wird von Quack eines der großen Rätsel der Forschung diskutiert: Warum gibt es fast nur Materie, aber keine Antimaterie, und warum wird in biologischen Organismen eine Aminosäurensorte bevorzugt, obwohl dies mit einem großen Energieaufwand über einen aktiven Stoffwechsel verbunden ist? Aminosäuren können in zwei molekularen Formen auftreten, die sich zueinander verhalten wie Bild und Spiegelbild (oder rechte und linke Hand). Eine bevorzugte Geometrie ist aber die Grundlage der Replikation. Erst im Tod entwickelt sich das System hin zur thermodynamisch günstigeren Gleichverteilung beider Molekülsorten. Chemische Evolution, ein faszinierendes Thema, das noch lange nicht umfassend erforscht ist…
Autorenliste
Katharina Al-Shamery
Universität Oldenburg
Fakultät V, IRAC
Ammerländer Heerstraße 114-118
26129 Oldenburg
Deutschland
Thorsten Dittmar
Max-Planck-Institut für Marine
Mikrobiologie
Celsiusstrasse 1
28359 Bremen
Deutschland
Manfred Eigen
Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie
Am Faßberg 11
37077 Göttingen
Deutschland
Elmar K. Jessberger
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Institut für Planetologie
Wilhelm-Klemm-Str. 10
48149 Münster
Deutschland
Horst H. Klump
University of Cape Town
Department of Molecular and Cell Biology
Private Bag
Rondebosch, 7701
Südafrika
Dirk-Henner Lankenau
Hinterer Rindweg 21
68526 Ladenburg
Deutschland
Uwe Meierhenrich
Université Nice Sophia Antipolis
Laboratoire de Chimie des Molécules Bioactives et des Arômes
Faculté des Sciences
Parc Valrose
06108 NICE Cedex 02
Frankreich
Armen Y. Mulkidjanian
Universität Osnabrück
Fachbereich Physik
Barbarastr. 7
49076 Osnabrück
Deutschland
Jesco Frhr. v. Puttkamer
1108 Westmoreland Road
Alexandria, Virginia 22308
USA
Martin Quack
ETH Zürich
Laboratorium für Physikalische Chemie
Wolfgang-Pauli-Str. 10
8093 Zürich
Schweiz
Manfred T. Reetz
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
45470 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Erich Runge
Technische Universität Ilmenau
FG Theoretische Physik I
Weimarer Str. 25 (Curie-Bau)
98693 Ilmenau
Deutschland
Henry Strasdeit
Universität Hohenheim
Institut für Chemie (130)
Garbenstr. 30
70599 Stuttgart
Deutschland
Wolfram H.P. Thiemann
Universität Bremen
FB 02 – Fachbereich 02:
Physikalische und Umweltchemie
Leobener Str., NW2
28359 Bremen
Deutschland
Danksagung der Herausgeberin
Die Idee zu diesem Buch entstand im Rahmen der Tagung »Manfred Eigen Nachwuchswissenschaftlergespräche der Deutschen Bunsen-Gesellschaft« vom 4. bis 6. Februar 2009 am Hanse Wissenschaftskolleg in Delmenhorst, die als interdisziplinärer Dialog zwischen berühmten Forschern und jungen Nachwuchswissenschaftlern vom Center of Interface Science der Universitäten Oldenburg, Osnabrück und Bremen gemeinsam mit der Deutschen Bunsen-Gesellschaft durchgeführt wurde. Finanziell wurde die Tagung freundlicherweise unterstützt vom Hanse Wissenschaftskolleg und dem Fonds der Chemischen Industrie. Danken möchte ich nicht nur den Teilnehmern Dittmar, Jessberger, Meierhenrich, Mulkidjanian, v. Puttkamer, Quack, Reetz und Strasdeit, sondern insbesondere auch Nobelpreisträger Eigen, der nicht nur an der Tagung aktiv mitgewirkt, sondern auch trotz einer selbst heute noch enormen Arbeitsbelastung zu diesem Buch beigetragen hat. Ergänzend konnten später die Autoren Klump, Lankenau, Runge und Thiemann gewonnen werden. Ihnen allen danke ich für die spannenden und bereichernden Beiträge. In der Entstehungsphase wirkte Wissenschaftsjournalistin Uta Neubauer an der Idee und an den ersten Vorbereitungen maßgeblich mit. Ich habe es sehr bedauert, dass sie sich später aus Zeitgründen am Werden des Buches nicht weiter beteiligen konnte. Ihr gilt sehr großer Dank. Mein besonderer Dank gilt Frau Susanne Bartel, die in der Endphase das Manuskript bearbeitet und meine holprigen Formulierungen erheblich verbessert hat. Zum Schluss danke ich Herrn Dr. Martin Preuss und Frau Dr. Waltraud Wüst vom Verlag Wiley-VCH, die mich während der ganzen Zeit mental sehr unterstützt und das Werden des Buches begleitet haben.
Die Herausgeberin
Frau Professor Dr. Katharina Al-Shamery; Jahrgang 1958, studierte Chemie in Göttingen und Paris. Nach der Promotion an der ETH Zürich bei Professor Dr. Martin Quack 1989 arbeitete sie zwei Jahre an der Universität Oxford, UK. Anschließend habilitierte sie sich 1996 an der Ruhr-Universität Bochum und wechselte danach an das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Sie folgte 1998 einem Ruf auf eine Professur an die Universität Ulm und 1999 auf einen Lehrstuhl an der Carl-v.-Ossietzky-Universität Oldenburg. Derzeitig ist sie Gründungsdirektorin des Center of Interface Science der Universitäten Oldenburg, Osnabrück und Bremen. Ausgezeichnet wurde sie 1997 mit dem Nernst-Haber-Bodenstein-Preis der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie. 2009 erhielt sie ein Radcliff Fellowship der Universität Harvard, Cambridge, USA. Al-Shamery arbeitet im Bereich nanostrukturierter Oberflächen, zeitaufgelöster Nanophotonik, Oberflächen(photo)chemie und Modellkatalyse.
I
Der Urknall
1
Kosmischer Staub und die Geschichte der Welt mit ihren Bausteinen
Elmar K. Jessberger
Die Geschichte der materiellen Welt ist einfach zu erzählen: Sie begann vor 13,7 Mrd. Jahren mit dem Big Bang, der gemeinsamen Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer »Singularität« – einem Prozess, der hier als gegeben angesehen wird. Das in nur 10−43 Sekunden – also wahrlich instantan – entstandene System expandierte, kühlte dabei ab und bildete unsere Materie: Innerhalb der ersten 100 Sekunden entstanden alle Kernbausteine, die Protonen und Neutronen; nach der ersten Million Jahre bestand die Welt bereits aus Wasserstoff – der gesamte Wasserstoff unserer Welt entstand im Big Bang! – mit Deuterium und Helium und ein wenig Lithium und Beryllium, hatte aber noch die unvorstellbare Temperatur von einer Milliarde Grad. Nach der ersten Milliarde Jahren – das System war bereits »kalt« – begann die Bildung der Galaxien und Sterne. Die Expansion der Welt dauert bis heute an und es ist fraglich, ob sie je enden wird. Sie ist verbunden mit der ständigen »Geburt« und dem ständigen »Tod« von Galaxien und Sternen.
Eine Galaxie ist eine astronomische Struktur, die aus vielen Milliarden Sternen und Gas sowie aus bis zu 30% Staub besteht (Abbildung 1). All dies bewegt sich gravitativ gebunden um ein Zentrum, in dem sich ein Schwarzes Loch befindet. Es gibt sehr unterschiedliche Galaxienformen; am bekanntesten sind Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße, wobei sich unser Stern, die Sonne, relativ weit außen in einem Spiralarm befindet. Fast alle Galaxien sind wiederum in großräumigen Strukturen (fraktalen Clustern) gebunden, die möglicherweise Strukturen der Materieverteilung während des Big Bang reflektieren.
Ein Stern ist ein Masseball, eine riesige Kugel ionisierter Materie, deren Gravitation, welche nach innen wirkt (attraktiv), für lange Zeit im Gleichgewicht steht mit der Wärmeentwicklung durch Kernverschmelzungen, welche nach außen wirkt (expansiv). In einer Kernverschmelzung (Fusion) vereinigen sich leichtere Atomkerne zu schwereren Atomkernen. Da die Summe der Massen der leichten Kerne geringer ist als die Masse des gebildeten schweren Kerns (sog. Massendefekt Δm), wird dabei nach der Einstein’schen Formel die Energie ΔE frei, also Wärme erzeugt. (Auf der Erde will man diesen Effekt in Fusionsreaktoren zur Energiegewinnung nutzen.) Allerdings liefert die Kernverschmelzung aufgrund des Massendefekts nur Energie bis zum Element Nickel; von da an ist der Massendefekt negativ, und es wird Energie nur durch die Kernspaltung geliefert. Die Elemente von Nickel bis Uran müssen also in anderen Prozessen entstehen; weiter unter mehr dazu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























