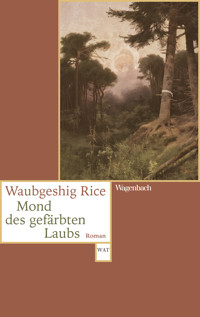
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kleine indigene Gemeinschaft der Anishinaabe hatte die Zivilisation (beziehungsweise das, was von ihr übrig war) verlassen, um im Outback ihr Überleben zu sichern. Zwölf Jahre später entscheidet sie aufgrund von Versorgungsproblemen, eine kleine Gruppe auf eine viermonatige Mission Richtung Süden zu schicken. Auf dieser Expedition suchen sie nach Erklärungen, warum es zur Katastrophe in ihrem Herkunftsland kam. In verwaisten Städten und leeren Landschaften versuchen sie die zurückgelassenen Zeichen zu entschlüsseln und andere Überlebende aufzuspüren. Aber wem können sie vertrauen? Und wer vertraut ihnen? Die mutige und eigensinnige Nangoon tritt auf dieser beschwerlichen Reise voller überraschender Wendungen in die Fußstapfen ihres Vaters, des charismatischen Anführers. Sie übernimmt Traditionen und Rituale ihrer Ahnen und geht doch ihren eigenen Weg – bis zum unvorhersehbaren Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Nummer-1-Bestseller aus Kanada vom Autor des Erfolgsromans Mond des verharrschten Schnees
Ihr besonderer Umgang mit der Natur und dem Tod und ihre Gemeinschaft, in der alle aufeinander zählen können, hat das Überleben der Anishinaabe ermöglicht. Aber um eine Zukunft zu haben, müssen sie ihren sicheren Rückzugsort verlassen. Die mutige und eigensinnige Nangohns tritt auf dieser beschwerlichen Reise voller überraschender Wendungen in die Fußstapfen ihres Vaters, des charismatischen Anführers. Sie übernimmt Traditionen und Rituale ihrer Ahnen und geht doch ihren eigenen Weg – bis zum unvorhersehbaren Ende.
Waubgeshig Rice
Mond des gefärbten Laubs
Aus dem kanadischen Englisch von Thomas Brückner
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Für meinen Sohn Ayaabe, der uns aus der Dunkelheit führte, als sich die Welt veränderte.
Prolog
Ein kehliges Heulen drang durch die gedämpfte Atmosphäre in der Hütte und prallte gegen die Wände aus Birkenrinde. Die jüngeren Frauen hielten den Atem an. Mit jedem gemessenen Ausatmen der jungen Frau wurde die Luft in dem kleinen Kuppelbau dicker. Sie saß aufrecht gegen einen Deckenstapel gelehnt, der in weiches Kaninchenfell gehüllt war. Ihr vorgewölbter Bauch gebot über die Aufmerksamkeit der Hebammen, ihrer Kusinen und Tanten. Das Feuer in der Mitte des Geburtshauses zeichnete ein flackerndes Orange auf ihr junges, angespanntes Gesicht. Ihr Partner, der einzige Mann in der Hütte, wiegte sich nervös auf den Fußsohlen. Seine Mutter und Großmutter beobachteten unter hochgezogenen Augenbrauen das Geschehen.
Auf einem verrußten Rost in der Mitte kochte ein großer Topf mit Wasser und Zedernzweigen; Dampf, Funken und das heilende Aroma der Tinktur schwebten hinauf und verschwanden durch das Loch im Rindendach. Die langen, dicken schwarzen Zöpfe der Gebärenden hingen auf das abgetragene hellblaue Männerhemd herunter, das alles außer ihrem Bauch verhüllte, der sich mit ihrem Atem hob und senkte, während sie sich von der Presswehe erholte. Der junge Mann kniete sich neben sie, strich über ihren Rücken, nahm ihre Hand und flüsterte ihr beruhigende Worte ins Ohr.
Zwei Hebammen – eine ältere und eine jüngere Schülerin – knieten vor ihr und hielten Ausschau nach dem schwarzen Scheitelhaar. Die ältere Frau kniff die Augen zusammen und blinzelte durch eine zerkratzte Brille. Die andere wies die Gebärende – ihre jüngere Kusine – sanft an, sich auf die nächste Presswehe vorzubereiten. Durch die Nase sog sie einen langen, Antrieb gebenden Atemzug ein und durch die gespitzten Lippen wieder aus. Dabei blähten sich ihre Wangen. Ihr Atem beschleunigte sich und verengte den Raum rund um die zehn Menschen, die sich aneinanderdrängten und diesen Geburtsritus beobachteten.
Die Mutter des jungen Mannes trat von ihrem Sitzplatz am Feuer an ihn heran und gab ihm eine Handtrommel. Um die Unruhe nicht preiszugeben, die sich während dieser langen Nacht der Wehen in ihr aufgebaut hatte, nickte sie ihm lediglich zu. Sie hatte ihren Sohn vor fast zwei Jahrzehnten zur Welt gebracht, in einem lauten, hellen, weißen Raum eines Krankenhauses in der Stadt, Hunderte Kilometer weiter südlich. Als sie das Geburtshaus betrat, um ihr Enkelkind zu empfangen, durchlebte sie diesen Moment noch einmal vor ihrem geistigen Auge, und fragte sich, ob es dieses Krankenhaus noch gab.
Der werdende Vater stand auf, überragte die versammelten Frauen und schlug viermal die Trommel. Die Stimme brach ihm, als er versuchte, die ersten Töne des Begrüßungslieds anzustimmen, und er räusperte sich laut, um Melodie und Takt zusammen zu bringen. Der Schatten seines Kopfes tanzte auf den zusammengebundenen Ästen und der Birkenrinde, aus denen das Geburtshaus bestand. Es war hoch genug, dass der junge Mann bequem aufrecht stehen konnte. Die Setzlinge des Gerüsts, die sich an jeder Wand entlangzogen, ruhten tief in der Erde und waren fest miteinander verflochten, damit sie über Jahre hielten. Der pulsierende Rhythmus der Trommel beschwor die Zahl der acht Babys, die an diesem zeremoniellen Ort zur Welt gekommen waren, seit sie die Setzlinge vor zehn Jahren verflochten hatten. Doch nur fünf hatten Geburt und Säuglingsalter überlebt.
Sacht redete die jüngere Hebamme auf die werdende Mutter ein, so leise, dass nur sie beide und die ältere Hebamme es hören konnten. Die junge Frau presste die Lippen zusammen und blähte die Nasenflügel. Unterdessen brachten zwei ihrer Kusinen zwei Plastikbottiche voll Wasser. Die ältere Hebamme nahm eine Prise Zedernnadeln aus einer Holzschale neben der Feuerstelle und warf sie in die Flammen. Die winzigen grünen Nadeln knallten und knackten und verströmten einen scharfen Duft.
Die junge Frau drückte das Kinn an die Brust und presste. Schweiß rann ihr über die gerunzelten Brauen und die geröteten Wangen. Die nächste Schmerzwelle ließ sie aufschreien, und ihr Partner beschleunigte seinen Trommelrhythmus. Er wurde schneller als das Tempo seiner Stimme. Vor dem Feuer hüpften seine Mutter und Großmutter im Takt, während an den Holzwänden die Schatten tanzten.
Die Hebamme forderte ihre Kusine auf, noch einmal kräftig zu pressen. Ihr gellender Schrei brachte die Schatten und das Lied ihres Partners einen Augenblick lang ins Stocken. Der Kopf des Babys wurde sichtbar, sein schwarzes Haar glänzte im orangefarbenen Feuerschein. Das Kind gab, mit dem Gesicht nach unten, keinen Laut von sich. Die Mutter schrie und presste erneut, aber das Baby bewegte sich nicht und blieb stumm. Diese Verzögerung, wenn auch verschwindend kurz, reichte aus, alle in Panik zu versetzen. Schnell trat die ältere Hebamme vor und kniete sich neben die andere.
»Wiikbinaa-daa«, drängte die Ältere und wiederholte: »Pressen!« Sie legte die dünnen Finger um den glitschigen Kopf des Säuglings, stützte dessen Kinn und Hinterkopf. Die Schülerin legte die Hände auf die der Hebamme. Auch die Trommel verstummte nun im Ernst des Augenblicks.
Derweil sie zogen, schwiegen sie. In einem letzten großen Atemholen warf die junge Mutter den Kopf zurück. Es folgte ein schmerzgetriebenes Heulen. In diesem Augenblick kam die Schulter des Babys frei, und Arme, Rumpf und Beine glitten heraus in den sorgfältigen Griff der Hebamme. Mit einer fließenden Bewegung zog sie den glänzenden, blutverschmierten Körper in ihre Armbeuge, und während sie das kleine Mädchen wiegte, wischte sie ihm den Schleim vom Mund. Ein kleiner, aber durchdringender erster Schrei hallte durch die Hütte.
Erleichtert lagen sich die jungen Eltern, erschöpft weinend, halb in den Armen. Am Feuer strahlten die frischgebackene Großmutter und Urgroßmutter mit tränenbedeckten Wangen. Die jüngere Hebamme wischte das Baby ihrer Kusine mit einem weichen, weißen Kaninchenfell ab, das sich immer stärker rosa färbte. Noch in den Armen der älteren Frau schrie das Baby mit jedem Atemzug lauter, dehnte sich seine Lunge aus.
Als Erstes wurde das Mädchen in einer Wanne mit abgekochtem, lauwarmem Wasser gewaschen. Aus dem Topf, der auf dem Rost köchelte, wurde Zedernwasser in den zweiten Bottich gegossen, und eine helle heilsame Mischung entstand. Die ältere Hebamme tauchte ihre Hand in die warme Flüssigkeit und träufelte sie auf die Haut des Neugeborenen. In Rinnsalen lief die blassgrüne Essenz über den Körper und bildete Perlen in den rundlichen Falten seiner Arme und Beine. Mit jedem Schlag des jungen Herzens nahm die Haut des Babys Farbe an. Die Mutter nippte an einer Kupfertasse voll Wasser und sah der rituellen Reinigung zu.
Als Körper und Kopf des Babys mit einem verblichenen und durchlöcherten blauen Handtuch abgetrocknet worden waren, trug es die jüngere Hebamme zu den erwartungsvollen und unruhigen jungen Eltern hinüber. Sie legte das Kind auf die bloße Brust seiner Mutter, das Baby schmiegte sich an sie, und Freudenschreie klangen durch die Hütte. Die Eltern dankten ihrer Tochter, dass sie zu ihnen gekommen war, und lächelten glücklich, während sie das neue Leben bewunderten, das sie in die Welt gesetzt hatten – so zart und schon voller Wunder.
Der junge Vater blickte von seiner Tochter zu seiner Mutter am Feuer. Ihr langes, dunkles Haar umrahmte ihr schmales Gesicht. Sie lächelte und nickte ihm zu, gab ihm damit zu verstehen, dass es an der Zeit war. Die frischgebackene Mutter küsste noch einmal den Scheitel des Babys, umfing die kleine Gestalt mit beiden Händen und hob das Kind seiner Großmutter entgegen. Die nahm ihre Enkeltochter in die Arme und streichelte den Rumpf des Mädchens vorsichtig mit ihren schwieligen Fingern, bevor sie ihm die Hand auflegte und den ersten Herzschlägen außerhalb des Mutterleibs nachspürte. Sie sah ihre Schwiegertochter an und lächelte erneut, dann räusperte sie sich und begann die Zeremonie der Namensgebung.
»Boozhoo.« Ihre Stimme unterbrach die aufgekratzte Stimmung in der Hütte. »Niimkiikwe ndizhnikaaz, mkwa ndodem. Bjiinak ngii-ooshenh«, stellte sie sich als neue Großmutter in Anishinaabemowin vor, der traditionellen Sprache ihres Volkes, und die anderen würdigten sie mit feierlichem Jubel. Dann wechselte sie ins Englische, damit alle die Geschichte verstehen konnten, wie sie den Namen des Mädchens gefunden hatte.
Sie berichtete von einem Traum mit einem Lichtstrahl, der für einen flüchtigen Augenblick vom Himmel fiel. Sie erzählte, wie ihr derselbe Traum in den folgenden Wochen zwei weitere Male erschien und immer länger dauerte. In ihrer Vision schien Frühherbst zu sein, wenn die Blätter sich gerade zu färben beginnen, aber in einem Land, das ganz anders aussah als ihr gegenwärtiges Zuhause.
Sie lief durch einen Wald, in dem die Bäume hoch aufragten, erzählte sie ihnen: große Kiefern zu ihrer Rechten, verstreut angeordnete Ahorne und Eichen. Am deutlichsten erinnerte sie sich an die weißen Birken, deren Blätter sich ebenfalls gerade färbten. Sie fühlte, wie eine warme Brise sie von hinten streifte, und hörte Wellenschlagen, konnte aber kein Wasser sehen.
Dann erschien das Licht wieder, dieser Strahl von oben, der sich langsam herabsenkte und schließlich den Waldboden berührte. Sie wusste nicht, wie weit sie von der Stelle entfernt war, an der es auf den Boden traf, hatte aber das Gefühl, ihm folgen zu sollen. In ihrem Traum hörte sie keine Stimmen, berichtete sie den Zuhörern, und doch schien das Licht im Wald sie zu rufen.
Dann erzählte sie ihnen, wie sie über einen Hügel lief und eine Lichtung mit einer winzigen Blume im Gras betrat, auf die der Schein herunterfiel.
»Sie hatte runzlige lila Blütenblätter mit Gelb und Weiß in der Mitte«, beschrieb sie. »Ich glaube, ich hatte noch nie eine solche Blume gesehen, zumindest nicht hier in der Gegend. Ich wollte noch einmal nach oben schauen, woher das Licht kam, aber da wachte ich auf.«
Das Gesicht der frischgebackenen Mutter quoll über vor Gefühlen. Sie unterdrückte ein Schluchzen und lächelte gleichzeitig, ihre tränenerfüllten Augen leuchteten im Widerschein des Feuers.
»Ich musste über diesen Traum nicht lange nachdenken«, sagte die Großmutter und kam zum Ende ihrer Geschichte. »Die Blume, die ich gesehen habe, sie ist der Name für das Baby. Wie diese Blume ist das Kind etwas Besonderes. Es ist hübsch und ein Licht, das helfen wird, den Weg aus dieser Finsternis zu finden. Sie heißt Waawaaskone. Eine Blume, in der Sprache unseres Volkes.«
»Waawaaskone«, wiederholten die jungen Eltern. Scharf zischten weitere Zedernnadeln und Tabakblätter, die in das Feuer geworfen wurden.
Alle umringten die junge Mutter im geheiligten Schutz des Geburtsraumes. Die Großmutter trat heran, um erneut das Baby zu nehmen, dem sie gerade den Namen gegeben hatte, und streckte den kleinen, molligen Körper nach vorn. Dabei wandte sie das Gesicht dem Eingang der Hütte zu, der nach Osten zeigte. Das Baby, immer noch in das verblichene blaue Handtuch gewickelt, schlief jetzt fest. Die starken Arme seiner Großmutter hoben es auf Augenhöhe und präsentierten es der Himmelsrichtung, in der der Tag beginnt.
»Waawaaskone«, verkündete sie erneut.
»Waawaaskone«, wiederholten die anderen.
Die Großmutter wandte sich zu den übrigen drei Himmelsrichtungen und sprach den Namen des Mädchens. Die Anwesenden folgten der Bewegung und ihrer Stimme und wiederholten den Namen, damit die gesamte Schöpfung ihn vernahm. Der Chor verklang in den Rindenwänden und dem Boden, und sie hob das Baby gen Himmel, um ein letztes Mal seinen Namen herzusagen, gefolgt von dem Echo der Anwesenden. Die Zeremonie war abgeschlossen.
Eins
Wasser schwappte gegen den niedrigen Bootsrumpf beim Einholen der Schwimmer. Die kleinen weißen Plastikkapseln, die das Netz hielten, pochten gegen das glänzende Metall über die Dollbordleiste des Boots. Hand um Hand zog die fünfzehnjährige Nangohns über die Dollbordleiste das weiße Nylonnetz mit den grünen und grauen Fischen, die auf das gewölbte Deck klatschten. Das kräuselnde Wasser um das kleine Boot warf Lichtperlen in den Himmel zurück. Nangohns beugte ihren langen Oberkörper nach vorn, um den morgendlichen Fang zu begutachten: bislang drei Forellenbarsche, drei weitere Hechte und ein paar kleinere Zander. Sie sah von ihren tiefgebräunten Händen zum Behälter auf dem Bootsboden und schätzte, dass sie bereits das halbe Netz eingeholt hatte, hoffte aber noch auf etwas mehr Fisch.
Zwei Tage waren vergangen, seit Waawaaskone auf die Welt gekommen war. Stolz hatte Nangohns die Aufgabe übernommen, das Essen für die Feier zur Geburt ihrer Nichte herbeizuschaffen. So kurzfristig schien es ihr das Beste, das Netz im See auszuwerfen. Seit dem letzten Mal waren aber erst wenige Wochen vergangen, und sie sorgte sich, weil der Bestand zurückging. Viele Fische, die sie in dieser Saison gefangen hatte, waren ihr zu klein vorgekommen, und von anderen Fischern hatte sie ähnliche Klagen gehört.
Das 13-Fuß-Blechboot, mit dem sie hinausgerudert war, schwankte, wenn sie das Netz einholte. Sie blieb in den Hüften locker, um nicht umzukippen. Nangohns hatte praktisch auf diesem See gelebt, seit sie fünf war, am Ufer mit ihrem Bruder Maiingan und anderen Kindern gespielt und war zu Seitenarmen hinausgerudert, um sie zu erkunden. Im Winter war sie über das Eis gegangen und hatte Löcher hineingeschlagen, um angeln zu können. Der breite und tiefe See war nur Schritte von ihrer Siedlung entfernt, die sie Shkidnakiiwin – Neues Dorf – nannten. Die Ihren hatten entschieden, an diesem See zu siedeln, weil er so fischreich war. Sie nannten ihn einfach Zaag’igan – See – in ihrer Sprache. Aus der Mitte des Wasserbeckens konnte man in allen Richtungen felsige und sandige Ufer sehen, von der Sonne beleuchtet, die über die Baumlinie im Osten aufgestiegen war.
Nangohns schaute nach Norden, zurück auf die Siedlung. Als sie und ihre Familie dieses Gebiet, einen Halbtagsmarsch von den zerfallenden Wohnhäusern und Gebäuden des ehemaligen Reservats entfernt, zu ihrem Zuhause gemacht hatten, hatten sie die neue Gemeinde in einem lockeren Kreis angelegt. Der offene Platz in der Mitte wurde für Zeremonien, Feiern und spielende Kinder freigehalten. Aus der Ferne drang das Geschnatter der Kleinen über das Wasser zu ihr herüber. Unmittelbar hinter dem Ufer erwachte die Gemeinschaft. In den Hütten, die diesen zentralen Platz säumten, wohnten die fünf Großfamilien, die, von Nangohns’ Vater Evan Whitesky angeführt, als Erste nach Shki-dnakiiwin gekommen waren. Mit einem Rahmen aus zusammengebundenen Setzlingen errichtet und mit Leinen- und Plastikplanen abgedeckt, standen die gewölbten Unterkünfte ihrer Familie dem Ufer am nächsten, am Rande einer festeren Siedlung aus zehn Holzhäusern, die sich um den Versammlungspunkt anordneten.
Die Zeremonienhütte war das größte Gebäude. Es ragte ungefähr einen Meter höher auf als die übrigen Häuser, und Nangohns konnte es unschwer von ihrem Aussichtspunkt auf dem See erkennen. Wie die meisten anderen Gebäude dieser Gemeinde war sie ein Kuppelbau, ihr Grundriss ein langgezogenes Oval. Walter, der älteste Überlebende, hatte Evan und die anderen jungen Erwachsenen gelehrt, sie in dieser Form zu errichten, im Stil der alten Medizinhäuser der Anishinaabek.
Shki-dnakiiwin trennte in Nangohns’ Augen eine Zeit des Davor – die sie Jibwaa nannten – von der Welt, die sie kannte und die meisten ihrer Erinnerungen speiste. Als ihre Eltern und die anderen dieses Dorf gründeten, bauten sie am Dorfrand zwei zusätzliche Gebäude. Das sollte vorsorgen für den Fall, dass jemand von den Verweigerern, die mit der Hoffnung im alten Reservat geblieben waren (das nach den vielen Weißfichten Gawaandagoong hieß), dass die Lichter wieder angingen, zu guter Letzt den Weg hierher fand und Obdach benötigte. Zu diesen gehörte ihr Onkel Chuck, der Cousin ihrer Mutter, der sich anfangs geweigert hatte, im Wald zu leben. Und auch Dave, der Neffe von Walter, hatte, solange es möglich war, dort in der Gemeindewerkstatt ausgehalten und sich an den Gedanken geklammert, dass die Maschinen, Netztransformatoren und Lastwagen eines Tages wieder funktionieren würden. Nangohns konnte sich an die zwei unter einer Handvoll anderer erinnern, die mit mageren Wangen und blutunterlaufenen Augen durch den Schnee gezogen waren, um sich ihnen doch noch anzuschließen, nachdem die meisten Verweigerer inzwischen gestorben waren.
Die letzten Schwimmer, die das Netz hielten, schlugen dumpf gegen das Dollbord, als Nangohns den Rest einholte. Noch einmal fünf Fische, allesamt deutlich kleiner als sonst zu dieser Zeit. Insgesamt lagen nun dreizehn in dem schweren grünen Behälter. Einige wanden sich noch in letzten nervösen Zuckungen des Überlebenskampfes, die meisten aber waren gestorben, kurz nachdem sie sich im weißen Geflecht des Netzes verfangen hatten, unfähig, sich zu bewegen und Wasser durch die Kiemen zu drücken.
Nangohns seufzte und sah zum Ufer hinüber. Auf der Lichtung und am Ufer liefen Erwachsene geschäftig hin und her, sammelten im nahen Wald Feuerholz oder ließen Eimer in den See. Sie beobachtete, wie andere die Plastikplanen und Leinwandabdeckungen der Unterkünfte festzurrten oder austauschten, um für die kommende Sommerhitze gewappnet zu sein. Während diese Menschen den täglichen Verrichtungen nachgingen, nutzte sie die Gelegenheit, die Teilnehmer der abendlichen Feier durchzurechnen. Nachdem alle vom heutigen Fang gegessen hatten, würde der Rest höchstens noch eine Woche für ihre Familie reichen.
Ein Seetaucher zog flügelschlagend und knapp über dem Wasser durch ihr Gesichtsfeld. Sie langte nach den Griffen der langen, leichten Aluminiumruder, die Ruderschlösser ächzten und klapperten, als sie sich zurechtsetzte, um nach Hause zu rudern. Mit ihrer rechten Hand drückte sie das Ruderblatt durch das Wasser und richtete den Bug auf das Ufer. In gleichmäßigem Rhythmus traten ihre Armmuskeln hervor, mühelos bewegte sie das Boot Richtung Land.
Der Bug stoppte am schlammigen Ufer im üppig grünen Schilf, der Kiel kratzte laut über die Felsen darunter. Nangohns stand auf und kletterte über den Sitz in den Bug. Die Metallbänke hatten die Hitze der Morgensonne aufgenommen und wärmten ihre nackten Sohlen. Sie sprang über die Bordwand und platschte in das kalte, flache Wasser, das ihr bis an die Waden reichte. Die Sommersonnenwende stand bevor, aber der See würde bis zum Höhepunkt der Hitzeperiode ziemlich kühl bleiben. Nangohns ging zum Bug und zog das Boot ans Ufer.
»Brauchst du Hilfe?«, murmelte eine vertraute Stimme hinter ihr. Sie drehte sich um und sah ihren Vater den grasbewachsenen Hang hinunter ans Ufer kommen. Evan Whitesky hatte sein Haar frisch zu einem Zopf geflochten, und die Sonne reflektierte den Glanz seines schwarzen Schopfes. Er hob die Hand, um die Augen gegen den blendenden Schein abzuschirmen, den das Wasser warf.
»Kaawiin«, lehnte Nangohns dankend ab. »Ist heute Morgen nicht so schwer, leider.«
Sie zog das Boot auf das Gras, Evan trat neben sie, und sie schauten, Schulter an Schulter, in den Behälter mit den Fischen.
»Wenn ich die mit der Angel gefangen hätte, hätt’ ich sie wieder reingeworfen«, sagte Nangohns. »Aber im Netz waren die meisten eh schon tot.«
»Wir werden schon Verwendung für sie haben«, meinte Evan beruhigend.
»Könnte sein, dass wir nach besseren Fischgründen suchen müssen«, gab sie nach einer kurzen Pause zu bedenken.
»Nehmen wir erst einmal die hier aus«, erwiderte ihr Vater, hob den Behälter aus dem Blechboot und wandte sich um, um den Hang wieder hinaufzugehen. Nangohns folgte ihm mit dem zweiten, leeren Behälter und dem zerrissenen Nylonnetz.
Langsam gingen sie zu der Ebene hinauf, auf der die beiden Kuppelhütten ihrer Familie standen. Die Eingänge zeigten jeweils auf die große zentrale Feuerstelle. Der westliche, größere Bau war mit grünen Leinenplanen gedeckt, die vom Sonnenlicht ausgeblichen, aber zum größten Teil noch intakt waren. Die etwas kleinere Hütte war umhüllt von einer zerknitterten, leuchtend blauen Plastikplane, die bei jeder Bewegung raschelte. Das grüne Haus war so groß, dass Erwachsene aufrecht und mit ausreichend Kopffreiheit darin umhergehen konnten, das blaue Haus war niedriger und in erster Linie ein Ort zum Schlafen. Es war die Unterkunft für Nangohns’ Bruder Maiingan, Pichi, seine Partnerin, und jetzt auch für Waawaaskone, ihr Neugeborenes.
Vor der Feuerstelle setzte Evan die Ausbeute vorsichtig ins Gras. Nangohns stellte den großen Plastikbehälter mit dem weißen Netz zur Seite. Beide setzten sich auf einen der Hocker, die um die Feuerstelle angeordnet waren. Die Morgensonne stieg höher, und die sanfte Feuchtigkeit, die vom See heranzog, legte sich allmählich auf ihren gebräunten Stirnen und Schultern ab.
»Aapiish Ngashi?«, fragte Nangohns, weil sie nirgendwo ihre Mutter sah.
»Sie wollte vorhin in den Garten und ein paar Sachen holen, die sie mit diesen Giigoonyik kochen will. Danach wollte sie, glaube ich, kurz mal zu deinen Tanten«, meinte Evan. »Ich schätze, ein paar von ihnen werden später vorbeischauen. Sie wollen alle deine kleine Shimis sehen.«
»Wo sind denn die anderen?«, wollte Nangohns wissen.
»Drin, sie schlafen noch. Sind noch ziemlich kaputt von dem Ganzen.«
Sie wünschte sich, das kleine Mädchen zu sehen, wollte aber die frischgebackenen Eltern nicht stören.
Sie saßen in der angenehmen Stille des Spätfrühlings. Die Sonne stieg höher und hob die nach mehreren regenlosen Tagen trockene Umgebung hervor. Bald würden Fliegen über ihre nackten Arme und Beine herfallen. Sie konnten sie nur mit langen Ärmeln oder Hosen abwehren oder sie wegschlagen, bis der Rauch der abendlichen Holzfeuer einen Schutzschild bot.
Evan machte sich daran, die Fische auszunehmen, und Nangohns flickte das Netz. Es konnte eine Reparatur vertragen, da waren sie sich einig. Sie nahm eine Handvoll des feinen Netzes aus dem Behälter und betrachtete es. Die Nylonfasern, die das Netz zusammenhielten, waren noch kräftig genug, um damit zu fischen, doch bei eingehender Prüfung bemerkte sie einige ziemlich große Löcher. Es war das letzte Netz dieser Art, das sie besaßen.
»Lederbinder funktionieren bei einem Netz nicht«, warnte Evan sie. »Sie saugen sich voll, lockern sich und fallen ab. Vielleicht geht es mit Fichtenwurzeln.«
In der kurzen Spanne, die sie auf der Welt war, hatte sie noch eine Zeit erlebt, in der Menschen in den Dörfern und Städten im Süden neue Netze aus dünnen, robusten Nylonfasern kaufen konnten. Nahrung und Werkzeug gelangten damals auf dem Luftweg zu ihnen. Und im Winter rollten die Vorräte auf Lastwagen heran, die über das Eis fuhren.
Ihr Vater ging nur selten auf ihre Fragen nach Dingen wie Flugzeugen, Lastwagenmotoren und Satelliten ein, sodass Nangohns es kaum noch versuchte. Die Inschriften und Markierungen auf ihren alten Kleidern und Werkzeugen – die sie nicht selbst herstellten – sagten ihr nichts. Inzwischen schien es, als ob nahezu alles, das aus Zhaawnong stammte – der anderen Welt da unten – verfiel und zerbrach.
Sie war drei, als der Strom ausfiel, und erst fünf, als ihr Vater ihre Leute aus dem alten Rez hinaus in den Wald führte. Nangohns hielt dennoch an den verblassenden Erinnerungen an helle Lichter, weiche Möbel und an rumpelnde Autos und Laster fest, die sie einst von einem Ort zum anderen befördert hatten.
»Ich könnte vielleicht an der Seite etwas vom Netz abschneiden und damit einige Löcher flicken«, schlug sie vor.
Evan brummte zustimmend, rückte Eimer zurecht und bereitete sich vor, die Fische auszunehmen. Er nahm einen Stubben, der am Feuer als Hocker diente, und stellte ihn neben einen niedrigeren. Darauf lag, in der Originalscheide, sein langes, geschwungenes Reinigungsmesser mit der stehenden Klinge. Es war, wie das Netz, ein Werkzeug, das man nicht mehr kaufen, aber auch nicht selbst herstellen konnte, und deshalb wurde die Klinge mit großer Sorgfalt behandelt, gründlich gereinigt, geschliffen und nie überbeansprucht.
Nangohns wartete darauf, dass ihr Vater mehr von sich gab als die schroffe Zustimmung.
»Ich wette, irgendwo liegt noch Netz rum«, sagte sie betont gleichmütig in der Hoffnung, dass sie sich pragmatisch anhörte. »Wir müssen uns nur auf die Suche machen. Ein paar Tage unten in Zhaawnong verbringen und ein paar Seen abklappern.«
Evan hielt mit dem Reinigungsmesser in der Hand inne.
»Wir sind über die Jahre ein paarmal dort gewesen«, sagte er und wandte sich wieder den Eimern zu, »und brachten ziemlich alles her, was wir finden konnten. Damals waren du und dein Bruder noch ziemlich klein.«
»Ich weiß«, gab Nangohns scharf zurück. Tatsächlich erinnerte sie sich: an Verwandte, die fortgegangen und nie zurückgekommen waren, und daran, Gerüchte über erfolglose Expeditionen gehört zu haben. Ihre heftige Erwiderung hing zwischen ihnen, bis das Baby in der Hütte ihres Bruders zu schreien anfing. Nangohns zuckte die Achseln und wandte ihre Aufmerksamkeit erneut den weißen Fasern in ihren Händen zu.
Evan schaute auf die Fische hinunter, strich sich Strähnen seines langen, dunklen Haars aus dem Gesicht und klemmte sie hinters Ohr. Die Weißfischfilets schichteten sich übereinander, und die Zickzacklinien ihrer Muskeln zeichneten bizarre Muster im Eimer. Drei Viertel des Fangs würden heute Abend gekocht und gegessen werden. Den Rest würden sie räuchern und aufheben. Im Verlauf des Sommers rechnete Evan mit größeren Mengen Fisch aus dem See. Für die Winterration brauchten sie auch mehr.
In den vergangenen Jahren war es ihnen gelungen, sich durchgehend ausreichend zu ernähren. Sie hatten im Herbst Elche und Hirsche gejagt, und Gänse und Enten im Frühjahr, zumeist mit Pfeil und Bogen, ab und zu auch mit dem schwindenden Vorrat an Patronen und Schrotmunition. Im Winter stellten sie Fallen für Kaninchen und Eichhörnchen auf und angelten in Eislöchern, wenn der See so zugefroren war, dass sie nicht vom Ufer oder vom Boot aus fischen konnten. Vor Winteranbruch wurde in alten Kühlschränken ohne Boden, die sie über Feuerstellen aufhängten, Fleisch geräuchert und getrocknet. Sie gärtnerten und bauten Kürbisse und Bohnen an und sammelten Beeren im Wald. Und es wuchs Manoomin – Wildreis – an den seichteren Stellen des großen Sees. Einige der Älteren wie Walter und Evans Eltern wussten noch, wie man ihn anbaute und erntete. Es erforderte beständige Anstrengung, alle zu ernähren, aber diese Mühen hatten ihnen die eine oder andere Feier erlaubt, wie die, die für den kommenden Abend angesetzt war.
*
Als die Dämmerung sich senkte, wurde das Feuer in der Mitte der Siedlung größer und heißer. Von einem Stubben am Rande des Versammlungsplatzes beobachtete Evan die kleine geschäftige Menge am Feuer, anfangs nur ein paar Dutzend Leute, zumeist Kinder, dann doppelt so viele – beinahe die gesamte Bevölkerung von Shki-dnakiiwin. Die angeregte Unterhaltung der Erwachsenen wurde vom gelegentlichen Knacken und Zusammenfallen des brennenden Holzes im großen Feuerloch untermalt. Kinder rannten um die ovalen Häuser herum, spielten Fangen und lachten. Auf dem Rost über dem Feuer köchelte ein großer schwarzer Topf voll Manoomin.
Maiingan briet in einer schweren gusseisernen Bratpfanne geschäftig Fisch in blubberndem Entenfett aus. Etwas abseits des Feuers schlief Evans Enkeltochter in Pichis Armen. Sie wurden von zahlreichen Gratulanten umringt. Das Baby war in eine braun und weiß gescheckte Decke aus Kaninchenfell gewickelt, und die älteren Frauen und Männer zupften daran, um einen besseren Blick auf ihr schlafendes Gesicht zu haben. Nicole, die Großmutter des Babys, hatte der jungen Mutter von hinten ihre Hand auf die Schulter gelegt und strahlte, wenn jemand vergnügt den Namen des Mädchens aussprach, den sie ihm zwei Nächte zuvor gegeben hatte. Sie sah auf und ertappte Evan dabei, wie er sie anschaute und ihrer beider Stolz als frischgebackene Großeltern aufs Neue entfachte.
In der Gruppe bemerkte Evan auch seinen Freund Tyler, der sich hingehockt hatte, das Mädchen betrachtete und über das ganze Gesicht strahlte. Seine Beine stachen unterhalb des verblichenen schwarzen T-Shirts aus den abgeschnittenen Jeans heraus. Ihm fiel auf, dass Evan in seine Richtung sah, verabschiedete sich mit ein paar Worten von der jungen Mutter und den anderen Gratulanten, stand auf und ging zu Evan, der gerade die letzten Grätenreste von den vorbereiteten Fischstücken pickte.
Er sprach Evan mit Mishoomis, Großvater, an und setzte sich auf den Hocker daneben. Mit Blick auf die glückliche Szenerie vor sich zog er ein Lederband aus seinem schwarzen Haar und ließ es ungebunden über Schultern und Rücken fallen. »Siehst du das?«, fragte er Evan und schüttelte sacht den Kopf. »Immer noch so schwarz wie die Nacht, in der ich geboren wurde. Gute Sache, dass du jetzt Opa bist. Da hast du eine Ausrede für deine rauchigen Strähnen!«
»Pffft«, machte Evan, freundlich, aber deutlich neidisch, und schob seine grauen Strähnen von den Schläfen hinter die Ohren.
»Hei-li-ger, ist die hübsch, Bud. Kannst stolz sein.«
»Miigwech, niijii. Als ich, lang ist’s her, in dem Alter war, wie die da«, sagte er und wies mit dem Kopf auf einige ältere Jungen, die sich am Feuer rauften, »dachte ich nicht im Traum daran, dass ich mal so alt werden würde. Und hier bin ich nun und bin Mishoomis.«
Evan schaute von seiner Enkeltochter hoch über den Rest der Menge. Die Menschengruppen am Feuer bestanden aus den Angehörigen der fünf Hauptfamilien, die den Zusammenbruch überlebt hatten und nun hier wohnten. In den früheren Zeiten hatten sie Whitesky, McCloud, Meegis, North und Birch geheißen.
Der Fisch zischte in der Pfanne. Maiingan drehte die Stücke mit einem Metallspatel um, der mit Kiefernharz an einem dicken Ast befestigt war, der einen längst zerbrochenen Plastikgriff ersetzte. Evan fragte Tyler, ob ihm aufgefallen sei, wie wenig Fisch sich im Kübel befand.
Beunruhigt hob Tyler den Blick und sah seinen Freund an.
»Nicht viel«, nahm Evan ihm die Antwort ab und erwiderte Tylers Blick. »Nang hat vergangene Nacht das Netz ausgelegt, heute Morgen eingeholt und nur ungefähr die Hälfte von dem gefangen, was sonst in dieser Jahreszeit ins Netz geht. Und alle sind klein. Ich habe regelrecht Angst davor, es noch einmal auszulegen.«
»Vielleicht sollten wir langsam zu einem der kleineren Seen gehen. Und vielleicht die alten Angeln etwas öfter benutzen«, meinte Tyler.
»Du meinst, wenn wir Angelschnur hätten?«, erwiderte Evan schroffer als beabsichtigt.
Tyler hielt inne und wartete darauf, dass sein alter Freund ihm mehr erzählte. Evan beruhigte sich. »Du hörst dich an wie meine Tochter«, sagte er. Nangohns setzte sich gerade mit ein paar jüngeren Erwachsenen auf die gegenüberliegende Seite des Feuers, mit dem Rücken zu den Gemeinschaftsbauten. Amber, die Hebamme, die dabei geholfen hatte, Baby Waawaaskone auf die Welt zu bringen, war darunter und auch ihr Partner Cal. »Aber ich wiederhole noch mal, was ich auch ihr gesagt habe. Unsere Netze halten kaum noch. Du redest von Angeln …«
»Jaaa, und du hast schon vor Jahren all die tollen Köder verloren, was?« Tyler pochte Evan spielerisch auf die Brust.
Evan knurrte versöhnt.
»Sieh’s mal so«, sagte Tyler. »Wir haben einiges zu tun, bevor der Winter kommt. Keine Frage. Aber wir haben noch jede Menge Elchgedörrtes aus dem Frühling übrig. Und bis dahin werden wir noch mehr Elch haben. Deine Tochter ist die reinste Scharfschützin mit ihrem Bogen.«
»Stimmt«, gab Evan zu. »Scheint an kaum was anderem Interesse zu haben, als sich im Wald rumzutreiben. Sie ist zwar mit Pichi und den anderen in ihrem Alter befreundet, hängt aber mehr mit den Älteren wie Cal und Amber ab. Ist das bei Jugendlichen normal?«
Tyler zog die Brauen hoch und zuckte die Achseln. »Was Jugendliche angeht, hat es so was wie normal noch nie gegeben.«
»Weil wir gerade über die Behuften reden«, fuhr Evan fort und kam wieder auf Nahrung zu sprechen, »sie tauchen hier nicht mehr so oft auf. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen jedes Mal weiter und weiter, um sie aufzuspüren. Auch die Kaninchen scheinen nicht mehr so leicht in die Falle zu gehen. Und keiner weiß, wie lange der Draht noch reicht.«
»Du bist jetzt Opa, Mann«, meinte Tyler nach einer Pause. »Du hast die neue Generation vor dir. Sieh hin. Direkt vor dir. Du machst dir zu viele Sorgen. Wir haben immer einen Weg gefunden. Und das werden wir jetzt auch. Sie werden das auch.«
Gelächter ertönte aus der Gruppe, die sich um Pichi und das Baby versammelt hatte. Gloria, die ältere Hebamme, versetzte Nicole spielerisch einen Stups. Langsam löste sich die Menge auf und ging vom Baby zum Essen hinüber, weil Maiingan gerade die erste Runde Fisch fertig hatte. Evan nahm alles um ihn herum im orangefarbenen Schein des Feuers wahr. Etwas weiter hinten sah er den Umriss eines kleinen Kindes, das auf ein anderes losging.
»Wir sollten uns morgen mit Walter zusammensetzen und darüber sprechen«, sagte Evan, aber leichthin, um seinem Freund zu zeigen, dass er ihm zugehört hatte und seinen Rat zu schätzen wusste.
»Ich sag ihm heute noch Bescheid«, erwiderte Tyler. »Aber vergiss das Ganze jetzt mal für einen Augenblick. Wir haben jede Menge zu essen. Es ist ein Fest!«
Tyler hob die Hände zu einer Siegesgeste, bevor er sie schwer, doch liebevoll, auf Evans bloße Schulter fallen ließ. Der Schlag war so laut, dass Maiingan sich zu ihnen umdrehte.
»Au, verdammt!«, jaulte Evan auf, halb vor Schmerz, halb vor Lachen, während er Tyler einen kräftigen Stoß versetzte und ihn von seinem Hocker stieß. Im Fallen lachte auch Tyler. Sie erhoben sich und gingen zu den Feiernden auf der anderen Seite des Feuers, wo das Fest für Waawaaskone langsam in Gang kam.
Nangohns beobachte von der anderen Seite, wie ihr Vater und sein Freund auf die Versammlung zusteuerten. Cal und Amber, ihre Gefährten, hatten sich davongestohlen, um nach einem langen Arbeitstag einen Augenblick für sich sein zu können, wie sie vermutete. Die beiden waren seit ihrer Jugend, seit sie sich hier niedergelassen hatte, unzertrennlich und in den letzten Jahren vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft geworden. Als Mittzwanziger gehörten sie zu den jüngeren Paaren. Nangohns schätzte, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie eigene Kinder bekamen, war aber zu schüchtern, sie zu so etwas Intimem zu befragen. Neben ihr war Cal einer der besten Jäger von Shki-dnakiiwin. Während ihre Treffsicherheit und Tarnung unübertroffen waren, beneidete sie ihn um seine Kraft und Geschwindigkeit. Amber hingegen entwickelte sich schnell zur erfahrensten Hebamme der Gemeinschaft und trat in Glorias Fußstapfen. Nangohns’ Mutter Nicole hatte, als ihr klar geworden war, dass ihre Tochter lieber jagte, Amber unter ihre Fittiche genommen und sie alles über Heilpflanzen gelehrt.
Nangohns schaute zu Pichi. Ihre runden Wangen traten mit dem breiten Lächeln hervor, mit dem sie auf Waawaaskone herabsah. Trotz der Unruhe um sie herum schlief das Baby tief und fest. Nangohns lauschte den spielerischen Schreien der anderen Kinder und überlegte, wie ihr Leben aussehen würde, wenn Cal und Amber ein Kind bekommen würden und sie Zeit mit den jüngeren Kindern zubringen müsste. Vielleicht würde sie noch mehr Zeit im Wald verbringen. Dort fühlte sie sich schließlich am wohlsten, und dort konnte sie außerdem das Beste für ihre Leute tun.
Die Freude über das kleine Baby und die Sorgen um die dürftige Fischbeute brachten sie dazu, über die Zukunft nachzudenken. Sie stellte sich vor, was ihr Vater und Tyler beredet hatten und was sich daraus ergeben könnte.
Zwei
Dicke Regentropfen fielen in beständigem Rhythmus auf das Planendach der Hütte. Dann, innerhalb weniger Augenblicke, kam ein solcher Guss herunter, dass das Geräusch der einzelnen Wassertropfen nicht mehr zu unterscheiden war. Nach zehn regenlosen Tagen war das Brüllen dieser Sintflut willkommen.
Mitten im Haupthaus brannte ein Feuer. Der Widerschein der Flammen tanzte in den Augen der zwölf Menschen, die sich im langen, ovalen Raum versammelt hatten. Walter und Gloria, die Ältesten der Gemeinschaft, hatten Evan und den anderen beigebracht, wie man ein Haus nach alter Bauart mit der östlichen Türöffnung als Haupteingang errichtete. Die Öffnung im Westen wurde nur benutzt, um wichtige Zeremonien wie Beerdigungen abzuschließen. Die Bewegung im Haus wurde durch das Feuer bestimmt: Man konnte drinnen nur im Uhrzeigersinn den Platz wechseln, es betreten oder verlassen, wie bei den alten Medizinhäusern der Anishinaabek üblich, so hatte Walter es ihnen erklärt.
Neben Evan, Nicole und Tyler – der, wie gewohnt, über das Feuer wachte – hatten sich an diesem Abend auch Evans Eltern Dan und Patricia eingefunden. Sie standen in ihren Mokassins da und hatten lange Lederriemen durch die Bundschlaufen ihrer alten, lose sitzenden Hosen gezogen, damit sie nicht rutschten. Dan trug ein verschlissenes, ärmelloses, weißes T-Shirt und Patricia ein zu großes, ausgeblichenes lila Sporttanktop. Sie waren nur wenig jünger als Walter, gehörten inzwischen zu den Ältesten. J. C., Walters Neffe, und seine Partnerin Amanda, die zu den letzten Ratsmitgliedern des Rez gehörte, standen am Eingang und unterhielten sich mit Tylers Partner Nick. Sie waren wiederum etwas älter als Evan und gehörten zu denen, die mit ihm und seiner Frau vor zehn Jahren die Überlebenden in den Wald geführt hatten.
Auch Candace, ein weiteres ehemaliges Ratsmitglied, zählte zu den Anführern dieser Auswanderung. Sie saß mit ihrem Sohn Cal und dessen Partnerin Amber am Feuer. Hinter ihnen unterhielt sich Meghan, das einzige Mitglied der Gemeinschaft, das später dazugestoßen war, mit Nicole. Die weiße Frau war im Winter des Blackouts zusammen mit einigen anderen auf Schneemobilen aus dem Süden gekommen, aber nun eine der Ihren. Sie unterhielt Nicole mit einer Geschichte über ihren Sohn Makwa, den sie vor sieben Jahren mit Evans Cousin Jeff bekommen hatte. In den zwölf Jahren seit ihrer Ankunft war sie für Nicole von einer mysteriösen Fremden zum Familienmitglied geworden.
Dan erhob seine Stimme über den donnernden Regen. Seine Stirn war von Falten durchzogen, als er den Blick zur Decke hob. »Gchi-gmiwan nongo naagshig«, sprach er im Dank für den schweren Abendguss.
»Hoffentlich geht es jetzt mit den Erdbeeren vorwärts«, gab Evan zurück.
Als die Trockenzeit vor einigen Tagen ihren Höhepunkt erreichte, waren Nicole und Maiingan zusammen mit Amber und Cal Heilkräuter sammeln gegangen. Sie waren mit spärlicher Ausbeute zurückgekehrt und berichteten, dass die Beeren spät dran waren und die Büsche nicht die für diese Jahreszeit übliche Farbe hatten. Evan lauschte dem Regen und hoffte darauf, dass er das Rot der Erdbeeren und das Weiß der Schafgarbe zum Vorschein bringen würde.
Sie hatten verabredet, sich bei Sonnenuntergang zu treffen, wenn die kleineren Kinder im Bett waren und die älteren in der Lage, sich mit den alten, zerkratzten Schachbrettern und steinernen Spielfiguren zu beschäftigen oder die zerschlissenen Bücher im Licht der Kerzen aus Elch- und Hirschtalg zu lesen.
Tyler schichtete mit einem verrosteten Schürhaken stumm die Scheite im Feuer um. Er hatte das Segeltuch und die Nylonplanen vom Boden des Gebäudes hochgezogen, damit von draußen kühlere Luft hereinkam. Die anderen sprachen leise miteinander und warteten auf den formalen Beginn der Versammlung.
Es wurde still, als die Gestalt eines groß gewachsenen Mannes in einem Oberteil aus grobem Elchleder und locker sitzenden, blauen Basketball-Shorts im Eingang erschien. Sein nackter Bauch ragte ein wenig unter dem Revers hervor. Im linken Arm barg er sein Medizinbündel: Pfeife, Tabak, Salbei und eine Adlerfeder, sowie andere Zeremoniengegenstände und Heilmittel, die in einen platten und vom jahrelangen Gebrauch fleckigen Lederstreifen gewickelt waren. Sein langes, graues Haar hatte er zu einem festen Pferdeschwanz zusammengebunden, sodass seine blinzelnden Augen nicht verborgen waren, als er den dämmerigen, nur vom Feuer erleuchteten Raum betrat. Er ging langsam, aber geschmeidig und entschlossen.
»Heilige Scheiße, warum sind alle so still?«, sagte Walter. »Ist das meine Beerdigung, oder was? Bin ich draußen vom Blitz erschlagen worden?«
Ein herzliches Lachen erfüllte die Gruppe. »Wer hütet da das Feuer? Ist das Tyler? Ich kann es von hier nicht erkennen.« Er verengte die Augen noch weiter, fast schloss er sie. »Jesus, ihr langhaarigen Indianer seht im Dunkeln alle gleich aus. Lasst euch die Haare schneiden und sucht euch ’ne richtige Arbeit!«
Zum Spaß hob er die Faust und schüttelte sie. Dann legte er sein Bündel auf einer Webdecke vor dem Feuer ab. Evan konnte sich daran erinnern, wie der stellvertretende Minister für Indigenous Affairs der alten Regierung diese Decke dem ehemaligen Chief und seinem Rat als Geschenk übergeben hatte.
Walter schritt durch die Versammelten, umarmte und begrüßte jeden einzeln. Schon über siebzig, überragte er immer noch die meisten. Um die Begrüßungen abzuschließen, ging er im Uhrzeigersinn um das Feuer, dann bückte er sich und nahm aus einer Schale neben dem Feuer eine Prise Tabak. Er schloss die Augen und flüsterte ein Gebet, hob die Faust mit dem Semaa, seinem Tabakopfer, nahe an sein Herz. Nach dem Gebet öffnete er die Augen und senkte sacht die Hand, um die Medizin dem Feuer zu übergeben. Tyler tat es ihm gleich und warf einige Zedernnadeln auf die brennenden Scheite. Walter schritt den Steinkreis ab, der das Feuer begrenzte, und setzte sich, Tyler gegenüber, unter Stöhnen auf eine Decke auf der Westseite des Hauses. »Nmadabik«, befahl er den anderen freundlich, und sie ließen sich ebenfalls auf die Decken am Feuer nieder, so nahe beieinander, dass sie sich gegenseitig im Flammenschein ins Gesicht sehen konnten.
Jetzt, da er in das Feuer schaute, mussten sich Walters Augen nicht mehr anstrengen. Er legte die Unterarme auf die nackten Knie und schob die Mokassins unter die übereinandergeschlagenen Beine. Das Prasseln über ihnen wurde ruhiger; der schlimmste Sturzregen war vorüber.
»Mii zhgo wii-niibing«, rief er aus. »Es ist fast Sommer.«
Mehrere brummten ihre Zustimmung und nickten.
»Der Regen ist richtig schön, ne? Es war in der letzten Zeit ziemlich trocken. Möglicherweise würden wir feststellen, wenn wir die Tage zählten, dass es fast einen Monat her ist, dass wir solch einen schönen Regen hatten. Deshalb hängen die Beeren hinterher. In den Gärten wächst es auch nicht besonders gut. Ich habe sogar gehört, dass einige Heilkräuter nicht mehr so leicht zu finden sind.« Er warf einen kurzen Blick zu Nicole.
Nicole richtete sich auf und berichtete der Gruppe über ihren Kräutergang mit Maiingan, Cal und Amber drei Tage zuvor. Anlässlich der Geburt Waawaaskones hatte sie darauf gehofft, eine Blume speziell für Babys zu finden, von der Auntie Aileen ihnen erzählt hatte. Aileen hatte ihr gezeigt, wo die Pflanze wuchs und wie man die Wurzeln kochte. Mit deren Sud konnte man Gaumen und Kiefer einreiben, um Schmerzen beim Zahnen zu lindern. Ihre erst einige Tage alte Enkelin würde das noch nicht benötigen, aber Nicole wollte dennoch schon einiges davon einsammeln, um es während der bevorstehenden schlaflosen Nächte zur Hand zu haben. Die Büsche trugen jedoch noch nicht einmal Knospen. Sie hatten ein wenig Schafgarbe gefunden und Zedernnadeln gesammelt, nicht viel mehr. Das Land war trocken.
»Wir hatten früher schon trockene Sommer«, mischte Walter sich ein. »Normalerweise renkt sich alles wieder ein. Aber wenn der restliche Sommer trocken bleibt und der nächste ebenfalls trocken wird, dann wird es schwierig durchzuhalten.«
Er hielt inne, um wieder in das Feuer zu sehen.
»Das Wetter hat sich verändert seit der Zeit, da wir hier rausgezogen sind«, setzte Walter wieder an. »Ein noch größeres Problem liegt allerdings vor uns, für das wir selbst verantwortlich sind, fürchte ich.«
Evan blickte Tyler an, der die Lippen zusammenpresste.
»Jedes Mal, wenn wir hinausmüssen, um einen Elch oder Hirsch zu erlegen«, fuhr Walter fort, »müssen wir weiter und weiter hinaus, um einen aufzuspüren. Manchmal müssen wir sogar über Nacht draußen im Wald bleiben. Die Vierbeiner sind klug genug, sich hier nicht mehr rumzutreiben. Über zehn Winter sind wir jetzt hier. Wir sind nicht weitergezogen. Es hat seinen Grund, dass unsere Vorfahren stets zusammengepackt haben und fortgezogen sind, wann immer die Jahreszeiten ihnen das auftrugen. Die Anishinaabek waren dazu berufen.«
Walters Stimme klang mit einem Mal heiser, und ein Grollen stieg tief aus seiner Kehle auf, als er versuchte, sich zu räuspern.
»Nbi«, sagte er und streckte die Hand aus. J. C. reichte ihm eine braune Metallwasserflasche. Walter schraubte den glänzenden Verschluss ab, nahm einen großzügigen Schluck und gab seinem Neffen die Flasche zurück. »Chi-miigwech«, sagte er. Tyler warf noch eine Prise Zedernnadeln ins Feuer.
Während Evans gesamtem Leben vor dem Stromausfall war die Gemeinschaft an einem Ort festgehalten worden. Mehreren Generationen war es nicht mehr erlaubt, umherzuziehen und auf althergebrachte Weise zu leben. In seiner Kindheit wurde ihnen der Großteil der Lebensmittel und Vorräte geliefert. Es war nicht viel, aber sie überlebten. Selbst damals zogen sie weiter in den Wald und besorgten, was sie sonst noch benötigten. Seit zehn Jahren versorgten sie sich nun allein durch Jagen und Sammeln mit sämtlicher Nahrung.
»Das zweite große Problem besteht bei den Giigoonyik«, fuhr Walter fort. »Wir haben zu oft mit dem Netz gefischt, und dieser große See kann einfach nicht mithalten. Wir sind nicht die Einzigen, die Fische brauchen. Die Vögel benötigen sie ebenfalls, ebenso wie den Manoomin. Wenn wir zu viel für uns herausholen, kann alles andere darunter leiden. Es braucht ein Gleichgewicht mit all dem Leben im Wasser um uns herum. Im Augenblick zerstören wir dieses Gleichgewicht.«
Evan spürte, wie mehrere Körper nervös auf ihren Plätzen hin und her rutschten. Tylers Blick war zu Boden gerichtet.
»Wir sind allesamt zu jung, um so etwas erfahren zu haben, aber es ist schon mal passiert«, fuhr Walter fort. »Unsere Vorfahren haben es erlebt, als sie noch an den großen Wassern im Süden wohnten, bevor sie hierher in den Norden vertrieben wurden. Die Zhaagnaashak kamen mit großen Booten und Netzen und nahmen den Seen fast alle Fische. Dann fällten sie sämtliche Bäume. Das geschah zu anderer Zeit, in einer anderen Welt, aber es ist noch nicht so lange her. Das war Jibwaa, damals. Und als das Licht ausging und wir alles verloren, was wir aus der Welt der Zhaagnaashak besaßen, bekamen wir die Chance, auf andere Weise zu leben. Wir gingen von dort fort und kamen hierher. Und so schwer das auch war, und so viele wir verloren haben, es gehört zu unserer Geschichte.«
Im Feuer zerfiel ein Scheit in einem Funkenregen zu Glut.
»Ich erzähle euch das heute Abend«, sagte Walter, »weil ich glaube, dass wir bald eine Entscheidung treffen müssen. Es geht wieder einmal um Leben und Tod für unser Volk.«
Ein sanftes, erwartungsvolles Gemurmel erfasste die Gruppe. Walter hielt inne, damit sich die kurze Verwirrung legen konnte.
Dann sagte er: »Wir müssen zurück nach Hause.«
Evan spürte, wie es in seiner Brust pochte. Er sah zu Tyler hinüber, der diesmal seinen Blick stoisch erwiderte. Dann schaute er seine Eltern an, die ihre Hände auf den Knien seiner Mutter verschränkt hatten. Meghan und die anderen blickten unverwandt zu Walter und warteten auf eine Erklärung.
»Wir sind schon so lange hier oben, dass einige vergessen haben, woher wir ursprünglich kommen«, fuhr er fort. »Und ich glaube nicht, dass die jungen Leute genug über unsere ursprüngliche Heimat erfahren, in der die Birken am großen Wasser wachsen. Dieses Land ist das, was uns ausmacht. Es ist an der Zeit, rückgängig zu machen, was uns angetan worden ist. Es ist an der Zeit, nach Hause zurückzukehren.«
Nicole und Evan sahen einander an. Sie wussten nicht, was sie darauf antworten sollten. Schließlich erhob Cal, der Jüngste der Gruppe, die Stimme.
»Also packen wir zusammen und ziehen in den Süden«, versicherte er sich.
»Noch nicht«, entgegnete der Älteste, ohne zu zögern. Die Krähenfüße in seinen Augenwinkeln und die Falten auf seinen Wangen sprachen von einem Leben voll Kummer und Heilung. »Nach allem, was in diesem ersten Winter geschehen ist, als im alten Rez das Böse über uns kam und alles bedrohte, was wir besaßen und was wir waren, hatten wir keinen Kontakt mehr zu der Welt da unten.«
Meghan senkte den Kopf, wandte den Blick von Walter ab. Sie hatte von allen, die hier versammelt waren, die jüngste Erinnerung an die Welt, wie sie vorher war: eine Stadt im Aufruhr, die nach einem weitreichenden Blackout gewaltsam im Verderben versunken war. Sie hatte allen hier berichtet, was sie gesehen hatte. Systeme wie das Gesundheitswesen, die Stromversorgung und die Kommunikationskanäle versagten, gefolgt von Einbrüchen, Gewalt und zunehmendem Chaos. Auch Nick hatte das erlebt. Damals war er Student in derselben Stadt gewesen, aber Wochen vor Meghan geflüchtet. Beide erwähnten diese Geschichten jedoch nicht mehr, und keiner hatte die Stadt namens Gibson seither jemals mehr betreten.
»Wir müssen zuerst herausbekommen, was da unten vor sich geht«, erklärte Walter, »bevor wir entscheiden, ob ein großer Umzug für uns infrage kommt. Es sind Neugeborene unter uns. Wir können sie oder auch jemand anderen nicht einfach irgendwelchen Gefahren aussetzen.«
»Wir müssen das auskundschaften«, stimmte Evan zu und dachte unwillkürlich an seine Enkeltochter Waawaaskone.
»Haben wir das nicht schon versucht?« Candaces heisere Stimme tönte von der anderen Seite des Kreises herüber. »Nie finden wir etwas heraus.« Amanda legte ihrer Freundin den Arm um die Schultern. »Wir verlieren dabei nur Leute«, ergänzte Candace, ihre Gefühle unterdrückend.
Es stimmte. An diesem Abend fehlten zwei in ihrem Kreis. Isaiah, einer von Candaces Söhnen und Cals älterer Bruder; und Kevin, Tylers jüngerer Bruder. Vor vier Jahren waren sie zu einer ähnlichen Expedition nach Zhaawnong aufgebrochen, hatten Vorräte und Antworten zum Blackout suchen wollen. Sie kamen nie zurück. Ihr Aufbruch hatte für die Zurückbleibenden die Leere vergrößert.
Evan dachte daran, wie er Isaiah am Abend vor dem Aufbruch geholfen hatte zu packen. Sie hatten entschieden, dass die zwei Männer nur leichtes Gepäck mitnehmen sollten, damit sie schnell vorankämen. Sie hatten kein festes Ziel im Sinn beim Planen ihrer einmonatigen Unternehmung: Zwei Wochen wollten sie hinunter in den Süden vordringen oder bis zu dem Punkt, an dem sie etwas fanden, und noch mal zwei Wochen zurückgehen. Was sie brauchten, würden sie im Wald finden. Sie kannten sich aus.
Evan hatte sich Sorgen gemacht, dass Isaiah nicht genug schnelltrocknende Sachen einpackte, und ihm etwas von seinen gegeben. Er hatte seinen Freund aufgezogen, weil der unbedingt sein altes Handy mitnehmen wollte, das seit der ersten Nacht des Stromausfalls so viel wert war wie ein Ziegelstein. Auf Evans Nachfrage hatte Isaiah gescherzt, dass er sich eine Pizza bestellen wolle, sobald er Netz habe. Dann hatte er das Gerät in der blauen Gummihülle mit dem Logo der Toronto Maple Leafs in seinem Rucksack verstaut.
Cals Stimme schreckte Evan aus seiner Erinnerung.
»Ich gehe«, verkündete der junge Mann, drückte seinen Rücken durch und hob seinen kantigen Kiefer.
Amber stieß einen unterdrückten Schrei aus: »Was?« Sie war geschockt.
Cal fasste sie sanft an den Schultern. »Wir reden bereits seit Jahren davon«, sagte er und sah ihr in die Augen. »Du weißt, dass Walter recht hat. Und ich will herausfinden, was da unten ist.«
Amber erwiderte nichts und sah ihn nur unverwandt an. Candace, seine Mutter, atmete zitternd aus, beugte sich vor und starrte auf ihre verschränkten Hände.
Cal wandte sich an die Gruppe. »Ich will tun, was gut für unser Volk ist. Das ist die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren.« Er wandte sich an Amber. »Ich will meine Vorfahren ehren. Und meinen Bruder. Und du solltest mitkommen.«
Walter unterbrach ihn, weil es jetzt noch nicht darum ging, Freiwillige zu finden, aber sie sollten lieber früher als später losziehen.
»Wenn ein Team zu Sommeranfang aufbricht, kann es im Herbst zurück sein, wenn sich die Blätter färben.«
»Den ganzen Weg zu Fuß?«, fragte Cal.
»Solange du noch nicht gelernt hast, wie du mit den Armen wedeln musst«, warf J. C. trocken ein. »Ja, natürlich zu Fuß.«
Nervöses Lachen mischte sich in das Geräusch des fortdauernden Regens. Cal fiel ein wenig in sich zusammen.
Ein Treck über die gesamte Strecke bis zum Nordufer der Großen Seen könnte einen Monat dauern, dachte Evan. Es hing davon ab, was von den Straßen und den großen und kleinen Städten entlang der Strecke noch vorhanden war. Zhaawnong, die Welt im Süden, war schon lange nichts als eine große Leere, und sie konnten nur mutmaßen, wer oder was dort noch lebte.
»Wir müssen auf alles vorbereitet sein«, fuhr Walter fort, als hätte er Evans Gedanken gelesen. »In zwei Tagen möchte ich wieder eine Versammlung, mit mehr von euch. Ich rede mit denen, die ich zusätzlich dabeihaben will. Ihr hier kommt einfach noch mal. Nahaaw, baamaapii.«
Damit entließ Walter die Gruppe und drängte sie, nach Hause und ins Bett zu gehen. Er bat, in den kommenden Tagen nicht darüber zu sprechen. Der Kreis löste sich auf, alle standen auf und schlurften, ohne viel miteinander zu reden, im Uhrzeigersinn um das Feuer herum zum Ausgang. »Evan, Nicole«, rief Walter. »Bleibt bitte noch. Ich möchte mit euch reden. Mit dir auch, Tyler.«
Evan und Nicole flüsterten den anderen ein paar Abschiedsworte zu. Der Raum leerte sich. Tyler blieb am Feuer sitzen, den Blick auf die Scheite gerichtet. Er sah nur kurz auf, um Nick ein kurzes Lächeln zuzuwerfen.
Sobald sie allein waren, bat Walter, der immer noch mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden hockte, sich wieder zu setzen. An Tyler gewandt machte er eine fächelnde Bewegung. Sacht brachen Tylers lange Finger einige Salbeistängel von dem Häuflein





























