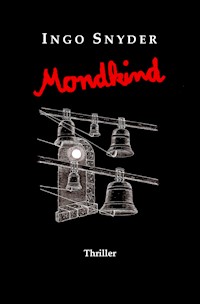
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als an einem Junimorgen massenhaft tote Fledermäuse in den Straßen gefunden werden, ahnt niemand, was der Stadt und ihren Bewohnern noch bevorsteht. Auf die Fledermäuse folgen Hunde, schließlich Ratten und bald klagen viele Menschen über rätselhafte Kopfschmerzen. Der Journalist Wolf Schmidt macht sich daran, Nachforschungen über diese Phänomene zu betreiben. Die Fledermäuse wurden vor einiger Zeit aus dem Turm der Sankt-Nikolaus-Kirche umgesiedelt, wo demnächst das Eröffnungskonzert des neuen Carillons stattfinden soll. Das neue Quartier der Fledermäuse scheint mit Schadstoffen belastet zu sein. Bald gibt es den ersten menschlichen Todesfall. Das Konzert endet in einer Katastrophe. Schmidt und seine Kollegin Jennifer Wörner geraten selbst in den Strudel der Ermittlungen und werden zu Gejagten. Doch wer sind ihre Verfolger und welche Ursache steckt hinter alledem?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mondkind
MondkindAnmerkung des AutorsPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77DankeQuellenDer AutorBereits in Arbeit ...ImpressumIN G O SN Y D E R
Для Андреа
-
Für Andrea
Anmerkung des Autors
Die Welt ist im Wandel und wir mit ihr.
Alle Schauplätze und Personen dieser Geschichte sind erfunden, wenngleich Ähnlichkeiten zu real existierenden Orten und Personen nicht ausgeschlossen sind. Die Organisation Trust Your Mind gibt es nicht. Physik bleibt Physik. Ihre Gesetze sind unumstößlich. Vielleicht aber auch nicht. Forschung und Entwicklung bringen oft per Zufall ans Licht, was bisher unvorstellbar war. Manchmal geschieht Fortschritt auch durch individuelle Genialität. Ob zum Wohle oder Schaden der Menschheit, bleibt dahingestellt.
Mir ist bewusst, dass das eine oder andere physikalische Phänomen in diesem Buch, wie beschrieben, heute (noch) nicht möglich ist, eventuell sogar in die Absurdität abdriftet. Die Zukunft wird zeigen, was möglich sein wird. Verletzte Seelen und kranke Gehirne wird es jedoch immer geben, vielen bleibt die Heilung verwehrt, und es bedarf des Handelns Einzelner, sie in ihre Schranken zu verweisen und aufzuhalten.
Dieses Buch hat nichts mit dem Roman ‚Moonchild‘ von Aleister Crowley zu tun.
Prolog
Alleinsein macht ihm nichts aus, im Gegenteil. Und er ist oft allein – zu oft. Die eigene Welt, in die er sich zurückzieht, bietet ihm relativ guten Schutz. Die anderen können ihn nicht verstehen und er kann sie nicht verstehen. Und er hasst sie, er hasst sie abgrundtief. Scham und Wut steigen in ihm auf, sind ihm eine Quelle für Energie, aber zunächst geht diese Energie ins Leere. Sein Körper leidet, sein Geist leidet, sein Gehirn erkrankt, für ihn nicht wahrnehmbar, aber doch unausweichlich geschehend. Tränen bahnen sich ihren Weg. Hastig wischt er sie beiseite, als sie auf die Tastatur fallen. Keine Schwäche zeigen, den äußeren Körper von der Seele drinnen abtrennen.Sie können meinen Körper verletzen, aber meine Seele rühren sie nicht an.Sein Außen und Innen sind zwei separate Bereiche, er hat sie fein säuberlich getrennt. Die Trennlinie dazwischen ist scharf gezogen. Doch insgeheim hat seine Seele Schaden genommen, ohne dass er es wahrnimmt. Er kann es nicht wahrnehmen, Denken und Empfinden haben sich bereits verselbständigt. Wieder tropfen Tränen auf die Tastatur.
In der Welt der Technik ist er sicher, hier gilt er etwas, alles hört auf sein Kommando. Nichts Zwischenmenschliches, einfache klare Strukturen, berechenbar, verlässlich, steuerbar, unkompliziert. Und vor allem nicht verletzend. Erfolg zu haben, Anerkennung zu erhalten, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Er muss sich seinen Erfolg selbst verschaffen und es gelingt ihm. Die Technik reagiert nach seinen Vorgaben. Sie belohnt seine Anstrengungen. Sie verschafft ihm ein Gefühl der Sicherheit. Verletzungen können vielleicht heilen, aber er wurde zu tief verletzt. Wer gewährt ihm Linderung von seinen Schmerzen? Da ist niemand, er ist auf sich allein gestellt. Und immer diese Scham. Er fühlt sich schmutzig, doch es ist nur sein Körper, der schmutzig ist. Nur Blendwerk, nur Tand. Mit der Zeit lernt er, sich selbst von seinem Körper abzukoppeln. Nur das Innen ist wichtig, da können sie nicht hinein, zumindest nicht dort oben, wo er sich alles ausdenkt und plant, seine Erfolge verbucht. Wozu braucht man Intelligenz, wenn man sie nicht nutzt? Er nutzt sie. Alles wird registriert, abgespeichert, verbucht, aufgezeichnet. Und er entwickelt langsam einen Plan, zunächst nur vage, undeutlich, mit den Jahren immer klarer, eindeutiger, professioneller. Schuld und Sühne, Gräueltat und Bestrafung, Qual und Vergeltung.
Er fällt erschöpft in einen unruhigen Schlaf. Schemenhafte bunte Karos und Rauten. Im Traum sieht er sich selbst am Schreibtisch sitzen. Oskar ist nicht mehr.
Kapitel 1
- Dienstag -
„… und drücke auf den roten Knopf …“ – Willy musste unwillkürlich schmunzeln, als er um 0:04 Uhr dem Computer den Befehl gab, das Programm zu starten. Er dachte an das Hörspiel von Kasperl Kullerkopf, der mit dem roten Knopf die Rakete Emma auf den Flug zum Mond geschickt hatte und wurde dabei ein wenig wehmütig. Das Hörspiel hatte er als Kind rauf und runter gehört, doch die Erinnerung daran verblasste allmählich.
An seine Kindheit erinnerte sich Willy nur ungern. Er hatte nicht viel Liebe von seinen Eltern erfahren, diese waren zu sehr mit ihrer Karriere beschäftigt gewesen. Später kamen viele private und gesundheitliche Rückschläge dazu, so dass er auf sein inzwischen vierzigjähriges Leben nicht besonders stolz zurückblicken konnte. Doch die Wunden waren vernarbt. Jetzt, mit diesem, seinem Projekt, würde sich endlich Erfolg einstellen.
Natürlich gab es hier keinen roten Knopf, es war vielmehr ein einfacher Mausklick auf einen grauen Bildschirmbutton mit der Aufschrift „Run Program“, dieser jedoch hatte weitreichende Folgen. Er dachte, er müsste ein schwaches Klickgeräusch der schaltenden Relais erahnen, doch die waren weit unten im Keller im Hochsicherheitstrakt und hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt, genauso wie die Großrechner und Massenspeicher.
Es war ein genialer Schachzug von ihm gewesen. Die Idee, für die Unterbringung der Einheiten die ausrangierten und nutzlos gewordenen Kästen zu verwenden, stammte von ihm. Deren Innenleben war sowieso eine Erfindung von Willy und auch bei der Programmierung der Software war er maßgeblich beteiligt gewesen. Diese Umstände hatten ihm die Gunst von T eingebracht und ihn auf der Karriereleiter der Organisation weit aufsteigen lassen. Er hatte Physik zwar nicht in Harvard studiert, sondernnuran einer Universität in Berlin, dennoch war er heute einer der engsten Mitarbeiter von T.
Der Master, oder einfach T, wie er sich nennen ließ, besaß einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität von Harvard. Man sagte ihm Kontakte zu einer mächtigen kriminellen Vereinigung nach. Angeblich hatten ihn seine Osteuropa-Studien auch in Verbindung zu einem einflussreichen russischen Drogenkartell treten lassen. Gesichert wusste das niemand, aber jedenfalls würde es erklären, wie er in so kurzer Zeit – er war erst Anfang dreißig – eine solche Unsumme an Geld hatte verdienen können, um die Rechen- und Steuerungszentrale der Organisation zu finanzieren. Jedenfalls war er hochintelligent, er sprach mehrere Sprachen fließend, darunter Slawisch und Russisch und hatte unter anderem das griechische und das kyrillische Alphabet verinnerlicht.
Nach außen hin war die Organisation ein Versicherungsunternehmen. „Trust Your Mind“, kurz TYM. „Traue deinem Verstand – vertraue uns“, war ihr zynischer Werbespruch. Tatsächlich versicherten sie auch, ihr offizielles Produktportfolio bestand aus Kapitallebensversicherungen, jedoch betrieb die Organisation Kundenakquise eher zurückhaltend und im Verborgenen. Neben wenigen legalen Kunden setzte sich die Versicherungsklientel mehr aus kriminellen Subjekten und dubiosen Firmen unterschiedlicher Couleur zusammen, es waren auch Auftragskiller darunter. Das Geschäft schien dennoch gut zu laufen. Die Versicherungspolicen waren hoch und der Versicherungsfall trat selten ein.
Das eigentliche Geschäft von Trust Your Mind war jedoch das Ausspähen von Daten aller Art. Das Handy der Kanzlerin abzuhören, wie es die NSA vorgemacht hatte, war zwar nicht schlecht, aber herkömmliche Spionage durch das Anzapfen von Leitungen war nicht mehr up-to-date. Diese Sache würde größer werden, weitreichender, globaler. Besonders wenn ein zahlungsfähiger Abnehmer der Daten dahintersteckte. Zunächst lief das Projekt im Probelauf, in relativ überschaubarem Umkreis. Wenn der Probelauf erfolgreich war, und davon war bei TYM auszugehen – der Master duldete keine Fehler – würden nach einem straff ausgearbeitetem Zeitplan weitere Einheiten folgen, die zunächst Deutschland, später Europa und schließlich die ganze Welt flächendeckend umspannen sollten.
Willy setzte sich auf seinem Stuhl zurecht. Der Zeitplan für die Nacht hatte eine geringfügige Verzögerung erlitten. Da Willy bei Nervosität dazu neigte, zu viel Kaffee zu trinken, hatte sich seine Blase um kurz vor Mitternacht so vehement für eine Druckentlastung ausgesprochen, dass er diesem Drang in Furcht vor einem peinlichen Desaster nachgegeben und die Toilette am Ende des Ganges aufgesucht hatte.
Am Waschbecken stehend hatte er im Spiegel seine von Schlafmangel dunkel umrandeten Augen erblickt. Einen Schwall kalten Wassers mit beiden Händen ins Gesicht spritzend, sagte er sich vor, dass sich T ruhig mal etwas in Geduld üben könnte. Wo wäre die Organisation ohne ihn? Schließlich ging ein Großteil des aktuellen Projektes auf seine Rechnung. Nachdem er sich Gesicht und Hände mit einem Papierhandtuch getrocknet hatte, war er zurück in sein Büro gespurtet, hatte sich in seinen Sessel plumpsen lassen und Emma zum Mond geschickt. Gleich darauf traf ihn der strafende Blick Ts, dessen Gesicht, von einer Webcam übertragen, auf dem zweiten Monitor von Willys Computer heute Nacht ständig präsent war.
Willy griff zum Telefon, drückte die Kurzwahltaste und sobald er sah, dass T das Telefon abhob, meldete er sich sehr pathetisch mit „The eagle has landed“. „Wurde aber auch Zeit“, entgegnete T kurz angebunden. „Irgendwelche Probleme?“ „Natürlich nicht“, versicherte Willy.
Er hasste es, wenn er T in diesem unterwürfigen Ton antwortete, aber der Master hatte die uneingeschränkte Kontrolle über die Organisation und war äußerst pedantisch. Niemand innerhalb von Trust Your Mind wollte bei ihm in Ungnade fallen. Wem es passierte, der wurde außer Gefecht gesetzt. Was das bedeutete, wollte niemand ausprobieren. Es gab dafür eine eigene Abteilung, quasi den Sicherheitsdienst. Doch heute Nacht würde es ein Erfolgszug werden und Willy hatte nicht nur dazu beigetragen, es war sein Projekt und T würde sich dafür erkenntlich zeigen.
Kapitel 2
Als Wolfgang Schmidt an diesem Junitag morgens in seinem Bett erwachte, hatte sich die Welt um ihn herum verändert. Ihn überkam das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas anders war, aber er konnte es nicht näher beschreiben. Das erste was er jedoch spürte, waren leichte Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, ein mäßiges Ziehen, noch nicht schlimm. Er gedachte es beim Frühstück mit Kaffee und einer Tablette Paracetamol zu beseitigen, bevor es sich verstärkte. Normalerweise wirkte das Medikament bei ihm recht gut. Komisch, er hatte am Vortag weder übermäßig getrunken noch geraucht, dann hätte er gewusst, worin der Schmerz seine Ursache hatte. Aber die Art von Katerkopfschmerz hätte sich bei ihm auch eher im hinteren Bereich des Schädels bemerkbar gemacht.
Als er aufstand, wanderte sein Blick durch die halboffene Jalousie auf die Sonnenspiegelung im Fluss, der sich unweit seiner Wohnung im ersten Stock durch die Stadt schlängelte. Es versprach ein schöner Tag zu werden. Nach seinen allmorgendlichen Verrichtungen im Bad ging er in die nachträglich eingebaute Singleküche, um sich sein Frühstück zu machen. In der Erdgeschosswohnung unter ihm war es noch ruhig, seine Frau Bettina schlief für gewöhnlich länger. Der Unfall vor mittlerweile acht Jahren hatte ihrer beider Leben auf den Kopf gestellt. Die ersten Jahre hatten sie noch versucht, ihre damals junge Ehe irgendwie nach außen aufrecht zu erhalten. Doch mittlerweile gingen sie getrennte Wege.
Sie hatten früh geheiratet, als sie sich gerade einmal ein Jahr kannten. Wolf war 28, Bettina 27 gewesen. Zwei Jahre später passierte der Unfall. Danach war alles anders. Drei Jahre quälten sie sich, die Beziehung irgendwie normal erscheinen zu lassen, doch es war nichts mehr so wie früher.
Vor fünf Jahren zogen sie die Konsequenz und bauten das Haus in zwei separate Wohnungen um. Das Haus hatten sie ein Jahr nach der Hochzeit gemeinsam gekauft, der Tilgungsplan für den aufgenommenen Kredit hatte eine Laufzeit von zwanzig Jahren gehabt.
Inzwischen gehörte das Haus Bettina. Das ihr zuerkannte Schmerzensgeld der Versicherung des Unfallgegners hatte eine vorzeitige restlose Ablösung des Kredits, trotz Vorfälligkeitsentschädigung, ermöglicht. Ihr Fall wurde von der Bank als Härtefall eingestuft, schließlich musste das Erdgeschoss behindertengerecht umgebaut werden. Später ermöglichte Bettinas Schmerzensgeld auch den Umbau des Hauses in zwei Wohnungen. Bettina wohnte jetzt unten, er oben. Insofern hatte der Unfall auch sein Gutes, wobei das natürlich Schwachsinn war, denn ohne das tragische Ereignis wäre es gar nicht so weit gekommen. Jedenfalls verdankte Wolf Bettina einiges. Sie ließ es ihn jedoch niemals spüren, dass er finanziell in ihrer Schuld stand. Geld spielte für Bettina keine große Rolle, sie gab es aus und dachte nicht lange darüber nach. Auf ihre Art war sie in diesem Bereich großzügig und das schätzte Wolf sehr an ihr. Sie wohnten zwar jetzt getrennt, aber eine offizielle Scheidung war für beide bisher kein Thema gewesen.
Nach dem Frühstück holte Wolf sein Rad aus der Garage und machte sich auf den Weg in die Redaktion. Er genoss das Privileg, die tägliche Distanz ins Büro mit dem Fahrrad zurücklegen zu können. Sein Rad war überhaupt das Verkehrsmittel Nummer eins für ihn. Kein Stau, keine Hektik, keine Parkplatzsorgen. Lediglich wenn er morgens einen Auswärtstermin hatte, benutzte Wolf das Auto. Doch an solchen Tagen fehlte ihm etwas, es fühlte sich dann an wie ein Start ohne Warmlaufmodus.
Als er sein Vehikel in der Fahrradgarage der Redaktion abgestellt hatte, war der Kopfschmerz schon fast vergangen, ein weiterer Vorteil des Frühsports. Die Strecke betrug nur ungefähr 20 Minuten, je nach Verkehrslage ging es auch schneller. Als er sein Rad mit dem ausgeleierten Spiralschloss absperrte, machte er sich die Hände an der Felge schmutzig. Schwarzer Bremsabrieb, wie fast jeden Morgen. Trotzdem mochte er sein Rad. Es war alt, hatte ein paar Rostflecken, aber damit lief er weniger Gefahr, dass es geklaut wurde.
Wolf hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, nicht den Aufzug zu benutzen, obwohl sich die Räume der Redaktion im dritten Stock befanden. Aufzüge waren seiner Meinung nach etwas für Weicheier und hoffnungslose Romantiker, die darauf hofften, dass irgendwann die Angebetete in die Aufzugskabine steigt, in der man gerade fährt – natürlich alleine – und dann der Strom ausfällt. Er könnte sich zwar vorstellen, dass eine solche Situation mit Jenny bestimmt reizvoll wäre. Trotzdem entsagte er regelmäßig dem Aufzug und ging die drei Stockwerke zu Fuß.
Jennifer Wörner war eine Kollegin. Sie war zehn Jahre jünger als Wolf und arbeitete als Fotografin und Grafikdesignerin für den Overview, dem Journal, das einmal wöchentlich erschien. Jenny sah wirklich gut aus. Sie hatte schulterlange kastanienbraune Haare, die, wenn sie sie offen trug, in leichten Naturwellen beim Gehen auf und ab wogten. Das war auch schon das einzige, was beim Gehen bei ihr wogte. Ihr kleiner Busen nicht und auch sonst war sie ausgesprochen schlank, lediglich ihr Hintern neigte ein wenig zum Lateinamerikanismus, was ihrem Aussehen aber in keinster Weise abträglich war. Außerdem war sie mit einer geschätzten Größe von einem Meter siebzig nicht gerade klein. Leider trug sie ihr Haar oft zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden, was ihr Aussehen zuweilen etwas altmodisch erscheinen ließ. Jenny war zwar keine klassische Schönheit, sie legte auch keinen Wert auf übertriebenes Schminken, hatte aber eine Ausstrahlung, der sich so mancher Mann, und durch ihre gewinnende Art zuweilen auch Frau, nicht entziehen konnte.
Jennifer arbeitete seit einem Jahr für die Zeitschrift und Wolf hatte sie bei der letzten Weihnachtsfeier erst richtig bemerkt. Nicht, dass es dabei zu einer gegenseitigen Annäherung gekommen wäre. Sie waren am Ende einer ausgelassenen Feier mit ein paar weiteren Kollegen am längsten geblieben und Jenny war ihm seit diesem Abend nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es war aber nur eine rein platonische Angelegenheit. In der Redaktion war bekannt, dass Wolf verheiratet war und dass er sich um seine Frau kümmerte. Von dem Unfall wusste sowieso jeder, auch wenn auf Wolfs Schreibtisch ein Foto von Bettina aus der Zeit von vor dem Unfall stand. Wolf brachte es irgendwie nicht übers Herz, das Bild in die Schublade zu legen, also stand es weiterhin an seinem Platz.
Als Wolf die Redaktionsräume betrat, war die Aufregung nicht zu überhören. Natürlich hatte er schon morgens im Bad beim Blick auf sein Handy bemerkt, dass etwas im Gange war. Weil er jedoch für die Recherchen hinter den Geschichten zuständig war, musste er nicht immer am schnellsten vor Ort sein. Beim Gang durch das Großraumbüro, in dem sein Schreibtisch stand, wurde Wolf schnell klar: Es war wieder mal die Geschichte mit den Fledermäusen, die seit dem Bau des Carillons umgesiedelt worden waren.
Das wardiegroße Story in der Stadt, Umwelt- und Tierschützer waren massiv auf die Barrikaden gegangen. Aber der Obrigkeit war die Chance, die Stadt wieder auf die Liste der Veranstaltungssorte für Carillonkonzerte zu bringen, zu wichtig erschienen, so dass die Fledermäuse das Nachsehen hatten. Auch das Pfarramt von Sankt Nikolaus errechnete sich Popularität und damit Einnahmen durch das Glockenspiel im Kirchturm. So waren sich Politik und Klerus schnell in Fragen der Finanzierung einig.
Der Turm der Kirche Sankt Nikolaus, ein wuchtiger romanischer Sakralbau, hatte schon früher ein Glockenspiel beherbergt. Ende des 19. Jahrhunderts erklang in der Stadt immer am Sonntag nach dem Hauptgottesdienst ein Konzert für die Stadtbürger. Als im Dritten Reich Eisen aus bekannten Gründen knapp wurde, mussten auch diese Glocken den schweren Gang in die Schmelzöfen der Waffenmanufakturen antreten. Vor zehn Jahren hatte dann der Direktor der örtlichen Kirchenmusikschule die Idee, das Carillon wieder herzustellen, zumal Spieltisch und Seilzüge noch vorhanden und nur teilweise ersetzt, erweitert oder wieder instandgesetzt werden mussten. Carillons sollen mindestens über 23 Glocken, also über zwei chromatische Oktaven verfügen. Darüber wacht sogar ein eigener Verband, die World Carillon Federation. Das Glockenspiel von Sankt Nikolaus sollte 51 Glocken beinhalten. Eine stattliche Größe, so groß wie das Carillon der Nikolai-Kirche in Hamburg.
Um dieses Bauvorhaben durchziehen zu können, mussten allerdings erst die Fledermäuse weichen. Das war im letzten Sommer geschehen, als die Großen Hufeisennasen aus dem Turm der Sankt-Nikolaus-Kirche fachmännisch eingesammelt und in den Dachboden der Stadtbibliothek fünfhundert Meter weiter transferiert worden waren. Die Aktion war problematisch, da Fledermäuse für gewöhnlich im Spätsommer ihre Winterquartiere in Höhlen mit konstanter Temperatur und relativ hoher Luftfeuchtigkeit aufsuchen. Höhlen waren in der Umgebung der Stadt aufgrund ihrer Lage in einem Flusstal und den sich im Norden ersteckenden Hängen nicht selten, jedoch war fraglich, ob die Fledermäuse nach dem Winter zurück kommen würden. Da die Einfluglöcher im Turm von Sankt Nikolaus nun mit Drahtgeflecht versperrt worden waren, sollten sie eigenständig ihren zugewiesenen Platz in der Bibliothek finden. Weil die Große Hufeisennase in Deutschland sehr selten vorkommt, war das Ganze für den Tierschutz natürlich von großer Brisanz. Was zählte mehr: Kultur oder Artenschutz?
Der Dachboden der Stadtbibliothek wurde als geeignetster und störungsfreister Wohnraum für die kleinen Nachtflieger erachtet. Dazu mussten jedoch extra Einflugfenster installiert werden. Tatsächlich konnte im Frühjahr eine, wenn auch kleine, Population im Dachboden der Stadtbibliothek gezählt werden. Der Vogelschutzbund konnte bei Messungen eine leicht erhöhte Schadstoffbelastung durch Dämmungsmaterial in der neuen Behausung nachweisen, so dass die gut gemeinte Umzugsaktion bei den Tierschützern erst recht in Ungnade gefallen war. Das Dämmungsmaterial stammte aus den 70er-Jahren. Nicht zwischen den Dachsparren, sondern am Boden des Speichers war die Dämmung aus Glasfaserplatten aufgeklebt worden. Das Material war für die darunterliegenden Räume der Bibliothek angeblich unbedenklich, nicht jedoch, so argumentieren die Vogelschützer, für die neuen Untermieter auf dem Dachboden. Ein nachträgliches Entfernen der Dämmung war bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, weil man befürchtete, damit die wenigen verbliebenen Nasen gänzlich zu vergraulen.
Warum sich überhaupt der Vogelschutzbund als Fürsprecher der Hufeisennasen stark gemacht hat, wo doch Fledermäuse zu den Säugetieren zählen, bleibt dahingestellt, jedenfalls rechneten die Gegner der Umsiedlung mit dem baldigen Ableben der kleinen Tiere durch Toxine. Dass es allerdings so plötzlich und massenhaft passierte und ein Jahr nach dem Umzug, überraschte selbst die pessimistischsten unter den Tierschützern. Zunächst waren nämlich keine nennenswerten Rückstände bei den Minivampiren zu verzeichnen. Durch die geringere Entfernung zum Grüngürtel der Stadt, den der mäandernde Fluss mit seinen Ufern erzeugte, schienen unsere kleinen Freunde ausreichend Nahrung im Flug zu erhaschen. Die Stadtreinigung hatte an diesem Morgen allerdings einen grausigen Fund gemacht.
„Am Fischmarkt haben sie auch welche gefunden, sollen zwanzig Tiere gewesen sein.“ Bens Stimme war am deutlichsten auszumachen. „War wohl doch zu viel Chemie für die Hufeisennasen. Jetzt habt ihr euren waschechten Tierschutzskandal!“ tönte es von weiter hinten.
„Ich schnappe mir die Kamera und versuche noch ein paar von den armen Tierchen vor die Linse zu bekommen. Wer kommt mit?“ Die Frage kam von Jenny. Eigenartig, fand Wolf, dass sie es bei ihrem eher zarten Gemüt so eilig hatte, ein paar Tierkadaver zu fotografieren.
Jenny war schon viel herumgekommen. Sie war eine gute Fotografin, aus ihren Bildern sprach für Wolf manchmal etwas zu viel Gefühlsduselei. Vor zwei Jahren hatte sie den Preis für das beste alternative Pressefoto Deutschlands gewonnen. Das Motiv zeigte eine Collage aus zwei Bildern. Auf dem einen war ein Mädchen mit einer leeren Eiswaffel in der Hand abgebildet. Das Kind weint herzzerreißend, Tränen rinnen ihm über die Wangen, weil seine Erdbeereiskugel auf dem Boden zerfließt. Auf der anderen Hälfte des Bildes ist ein dunkelhäutiger Junge mit großen Augen und traurigem Blick abgebildet, der einen leeren Reisnapf in der Hand hält. Darüber der Bildtitel: Echte Not? Das Foto hatte es in die meisten namhaften Zeitungen und Zeitschriften geschafft. Richtig berühmt war Jenny damit aber nicht geworden.
„Ich gehe mit“, rief Wolf. Die Fledermausgeschichte war von Beginn an seine Story gewesen. Alle paar Wochen gab es wieder neue Informationen und Hintergründe, die im Journal veröffentlicht werden sollten. Dass nun Jenny für das Bildmaterial sorgen wollte, wunderte ihn. Bislang hatte sie lieber Menschen fotografiert.
Es war das erste Mal, dass Wolf und Jenny gemeinsam an einer Sache arbeiten sollten. Ihr Abteilungsleiter Herb, ein für sein Gewicht deutlich zu klein geratener Mittfünfziger, der die Eigenschaft hatte, sich oft tagelang nicht aus seinem Schreibtischsessel zu erheben, gab grünes Licht.
Als sie die Fahrradgarage erreichten und Jennifer ihren Fotorucksack auf den Rücken schnallte, hing Wolfs Blick für kurze Zeit an ihr fest. Jenny erklomm den Sattel und ihre tiefsitzende Hüftjeans gab die Gegend um ihre Nieren frei. Dabei konnte er nicht umhin, sie einfach nur zu bewundern. Jenny hatte eine geniale Treffsicherheit bei der Auswahl ihrer Klamotten. Egal ob enge Jeans, leichtes Sommerkleid oder Strickpullover im Winter, die Kleidung umspielte ihren Körper auf natürliche Art, unterstrich ihre Schlankheit ohne aufdringlich zu sein und ließ sie auf geschmackvolle Weise einfach sexy erscheinen.
Wolf stockte kurz, als er bemerkte, dass er in Tagträumerei versunken einfach stehengeblieben war und noch nicht einmal das Fahrradschloss entriegelt hatte. Ohne hektisch zu erscheinen öffnete er das Schloss, stieg auf, Jenny lächelte ihn kurz an und dann starteten beide Richtung Innenstadt.
„In letzter Zeit radeln wir öfter gemeinsam“, bemerkte Jenny. „Ja, aber zum ersten Mal im Dienst“, entgegnete Wolf schmunzelnd. Seit besagter Weihnachtsfeier liefen sich Wolf und Jenny in der Redaktion häufig über den Weg. Woran das lag, vermochte Wolf nicht auszumachen. Jedenfalls waren sie in den letzten Wochen öfter in der Fahrradgarage aufeinander getroffen und hatten ein Stück gemeinsamen Nachhausewegs zurückgelegt. Wolf war aufgefallen, dass Jenny offensichtlich einen kleinen Umweg in Kauf nahm, damit beide noch länger nebeneinander fahren konnten. Irgendwann trennten sich dann ihre Wege, man blieb kurz stehen, nahm nach ein paar Worten Abschied voneinander und Wolf meinte jedes Mal eine kleine Befangenheit auf beiden Seiten zu spüren. Er konnte es nicht recht einordnen, jedenfalls fühlte er sich zu Jenny hingezogen. Wäre zu schön, wenn dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte, dachte Wolf.
„Was glaubst du, woran sind die Tiere gestorben?“, wollte Jenny wissen. „Das gilt es herauszufinden. Ich habe vor, so schnell wie möglich mit Professor Manfred Kübler zu sprechen.“ Kübler war Leiter der Fakultät für Biologie und Biochemie an der Johannes-Keppler-Universität. Seine Mitarbeiter hatten das Verhalten der Fledermäuse vor und nach der Umsiedlung dokumentiert. Das biomedizinische Labor könnte sicherlich dazu beitragen, etwas über die Todesursache der Großen Hufeisennasen herauszufinden.
Als die beiden über die Fischerbrücke fuhren, die ihren Namen dem früher am südlichen Brückenfuß stattfindenden Markt verdankte, war von einer größeren Menschenansammlung nichts zu bemerken. Am Brunnen des Marktplatzes stand ein orangefarbener Wagen der Straßenreinigung. Die beiden Männer hatten soeben ihr Werkzeug auf die Ladefläche des Kleintransporters gelegt und machten Anstalten, ins Führerhaus zu steigen. Wolf hielt mit seinem Fahrrad genau von dem Fahrzeug, womit er es am Wegfahren hinderte.
„Was gibt’s denn?“ Der Fahrer des Wagens kurbelte gemächlich die Seitenscheibe herunter. „Entschuldigen Sie, ich bin vom Overview und recherchiere in der Sache mit den Fledermäusen. Haben Sie heute welche eingesammelt?“ Offensichtlich gehörten die beiden Straßenreiniger nicht zum Leserkreis des Journals, sonst hätten sie Wolf erkannt. Jeder Artikel erschien mit einem kleinen Foto und dem Namen des Autors am Ende des Textes und es waren seit der Umsiedlung schon einige Berichte erschienen.
„Dürften an die zweihundert gewesen sein. Sind in den blauen Säcken auf der Ladefläche.“ Der Fahrer deutete nach hinten. Wolf warf einen Blick auf die Müllbeutel, sie waren bei weitem nicht voll aber gut zugeknotet und er hatte nicht die Absicht, sie zu öffnen.
Jenny winkte ab, ein Sack voller Kadaver gehörte nicht zu ihren bevorzugten Fotomotiven. Wolf wollte nicht gefühlskalt erscheinen, besonders nicht vor Jenny, dennoch fragte er: „Gibt’s anderswo noch … also, liegen woanders noch welche?“ Der Fahrer der Straßenreinigung deutete zum südlichen Ende des Fischmarkts, wo eine schmale Gasse mündete. „Wir sind noch nicht ganz fertig“, bekundete er.
Wolf und Jenny traten in die Pedale in Richtung des südlichen Platzendes und fuhren in die Kantgasse, die so schmal war, dass sich das Auto der Straßenreinigung nicht hinein zwängen konnte. Nach wenigen Metern wurden sie bereits fündig. Es waren ungefähr zwanzig der possierlichen Tierchen. Sie lagen auf dem Granitsteinpflaster und regten sich nicht mehr.
„Kein schöner Anblick“, bemerkte Wolf deprimiert, als er die armen Tierchen vor sich liegen sah. Die leblosen flauschigen Körper mit den hauchdünnen Flughäuten an den Vorderbeinen sahen wirklich erbärmlich aus. Jenny ging in die Hocke und betrachtete sie aus der Nähe. Ihr tat der Anblick richtig weh. „Hoffentlich mussten sie nicht leiden.“
Bedrückt nahm sie ihre Kamera zur Hand, machte ein paar Fotos aus der Totale und einige Detailaufnahmen. Manchen Tieren quoll Blut aus Wunden und Körperöffnungen. Die beiden Straßenreiniger waren inzwischen zu Fuß erschienen und füllten pflichtbewusst einen weiteren Sack, was Jenny dokumentierte.
Obwohl Wolf kein Spezialist für Fledermäuse war, fiel ihm dabei auf, dass die Tiere unterschiedlich groß waren. „Vielleicht sind Jungtiere darunter“, sinnierte Wolf. Doch dann bemerkte er, dass sich auch die Gesichtsform der Tiere unterschied. Die kleineren Fledermäuse hatten eher spitze Nasen, wohingegen die größeren die typischen flachen Hufeisen trugen.
„Wohin bringen Sie die Tiere?“, wollte Jenny wissen. „Eigentlich müssten wir sie zur Tierkörperverwertung bringen, aber unser Chef hat uns vorhin telefonisch angewiesen, dass wir sie zur Uni fahren sollen. Die wollen sie wohl untersuchen“, gab der Mann von der Straßenreinigung bereitwillig Auskunft.
Wolf atmete erleichtert auf. Er würde hernach noch versuchen, bei Professor Kübler einen Termin zu bekommen. Vielleicht schon für morgen, wenn möglicherweise die ersten Ergebnisse vorlägen. Für jetzt wäre noch eine Augenzeugenbefragung geplant. Er musste sich umhören, ob nicht Anwohner Zeugen der nächtlichen Tragödie geworden waren oder sonst irgendetwas beobachtet haben. Wolf bat Jenny, ihn zu begleiten, um Reaktionen der Bürger wie Betroffenheit, Ratlosigkeit oder Verärgerung bildlich zu dokumentieren. Für das Einfangen von Gefühlsregungen, die sich in Gesichtern spiegelten, war Jenny ja Spezialistin.
Kapitel 3
Willy war hundemüde. Er war der Chef der technischen Abteilung. Deren Aufgabe war es, die Einheiten einzubauen und dafür zu sorgen, dass sie flächendeckend arbeiteten. Die Feldarbeit musste nachts vonstattengehen, gut bewacht von Sicherheitsleuten, die dafür sorgten, dass niemand den Einbau störte oder beobachtete. Der Clou bei der Sache war, dass die Montageteams als Angestellte eines Notfalldienstes für Handwerksleistungen auftraten, um, selbst wenn sie gesehen wurden, keinen Verdacht zu erregen. Der Einbau selbst war meist schnell passiert.
Die Einheiten hatten die Form eines Quaders mit einer Kantenlänge von ungefähr fünf auf zehn auf vierzehn Zentimetern und wurden in der Laborwerkstatt von TYM komplett vormontiert. Innerhalb der silberfarbenen Metallschatulle war eine trichterförmige Antenne zum Senden und Empfangen, die an einer Seite offen aus dem Gehäuse schaute. Vorort musste nur noch der Einbau, die Aktivierung und die Tarnung des Kastens gewährleistet werden. Dazu war eher grobes Werkzeug und mechanisches Knowhow notwendig. Wichtig war nur, dass es schnell ging und die Sache unbeobachtet blieb.
Während diese Arbeit nur nachts vonstattengehen konnte, geschah das Sammeln von Daten natürlich rund um die Uhr. Heute trat das Projekt nun in die heiße Phase, die ersten Daten liefen ein.
Im Hochsicherheitskeller der Zentrale waren genug Speicherserver, um die kompletten Daten der mobilen Internetbewegungen ganz Deutschlands für drei Monate zu speichern. Mehrere Hochgeschwindigkeitsrechner und deren Bediener arbeiteten in Schichten rund um die Uhr, um die Daten nach brauchbaren Informationen zu filtern. Die Crew aus Mitarbeitern aus der ganzen Welt war hochqualifiziert, es würden noch viel mehr werden, wenn das Einzugsgebiet von Deutschland auf Europa ausgedehnt werden würde.
Auch aufgrund seines Schlafmangels konnte Willy seine Nervosität nicht verbergen. „Wann meldet sich dieser italienische Schwachkopf Daniele endlich mit ersten Treffern?“, zischte Willy gereizt. Er stand auf und wollte sich gerade auf den Weg zum Fahrstuhl machen, der vom anderen Ende des Korridors in den Keller führte. Da blinkte auf dem Bildschirm seines PCs eine Meldung auf:data recieved – filter runs – store active.
Das System arbeitete! Willy tat innerlich einen Luftsprung, er hatte gewusst, dass sie funktionierten, die Einheiten waren seine Babys. Ausgehend von der Fläche Deutschlands mit 347.000 Quadratkilometern zählten knapp 50.000 Quadratkilometer als bewohnte Siedlungs- und Verkehrsfläche. Damit würde es ungefähr 5000 Einheiten benötigen, um Deutschland flächenmäßig abzudecken. Da die dünn besiedelten Gegenden für die Datensammlung uninteressant waren, konnte man hier sparen. Trotzdem lag in der Anzahl das Problem. Eine Einheit konnte ungefähr eine Fläche von 10 Quadratkilometern abdecken. Momentan. Willys Plan war es, die Einheiten technisch so aufzurüsten, dass sie viel größere Radien erfassen konnten. Sonst würden bei einer Siedlungs- und Verkehrsfläche von geschätzten 450.000 Quadratkilometern allein in der Europäischen Union etwa 45.000 Einheiten benötigt, und das war schwer zu realisieren.
Die hundertfünfundzwanzig Einheiten, die jetzt quasi für den Probelauf in der Stadt und im näheren Umkreis installiert waren, arbeiteten jedenfalls. Erst mal nachschauen, ob was Brauchbares an Daten reinkommt, dachte Willy. Dem Problem mit der Fläche konnte er sich später widmen. Es würde von ihm relativ schnell gelöst werden, so spekulierte er. Das Projekt war ja schließlich erst in der Anfangsphase. Zwar hatte T schon sein Missfallen an der Hochrechnung der Anzahl der Einheiten ausgedrückt – dabei waren die Zahlen zunächst nur für Deutschland gewesen – doch Willy hatte bereits auf eigene Faust vorgearbeitet und wusste, was er zu tun hatte.
Kapitel 4
Es war ein ganz gewöhnlicher Morgen. Bettina hatte gehört, wie Wolf die überdachte Außentreppe seiner Wohnung im ersten Stock hinunter geschlichen war. Er verhielt sich wirklich rücksichtsvoll, trotzdem wurde sie jedes Mal wach. Meistens schlief sie dann aber noch ein Weilchen oder döste zumindest. Wenigstens konnte sie sich nicht erinnern, letzte Nacht vom Unfall geträumt zu haben, das geschah nämlich regelmäßig. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie das Ereignis einfach noch nicht verarbeitet hatte. Martin sagte immer, sie solle sich endlich einen richtigen Psychologen suchen, nicht so einen wie der letzte.
Sie hatte die Nase voll von Psychologen, schon die erste Therapeutin im Krankenhaus hatte sich an ihr die Zähne ausgebissen. Bettina war so voller Schmerz, Schock und Ohnmacht gewesen, dass sie die Gespräche regelrecht torpediert hatte, irgendwann war die Frau dann ausgeblieben. Mit einem Empfehlungsschreiben an die ärztlichen Kollegen in der Reha-Klinik hatte sie sich des Falles entledigt.
Auf Reha erging es ihr nicht anders, zwar machte sie körperlich große Fortschritte, doch psychisch blieb sie äußerst labil. Der dortige Psychologe war sehr bemüht, Bettina war es aber satt, mit einfühlendem Verstehen und Empathie wie mit einer glänzenden dicken Wachsschicht überzogen zu werden. Sie wurde aggressiver, hitziger und damit schmolz die Wachsschicht ab. Übrig blieb ein brodelnder Vulkan, der Feuer spie und leiden wollte. Die Diagnose lautete schließlich auf posttraumatische Belastungsstörung. Damit ließ sich was anfangen, sie war ein Psycho.
Das Erlebnis mit dem dritten Psychologen war erst drei Jahre her. Sie hatte sich von Wolf überreden lassen, es noch einmal zu versuchen. Er war nett, fachlich bestimmt kompetent, machte aber einen entscheidenden Fehler: Er verliebte sich in Bettina. Sie wunderte sich zunächst nur, da er ihre Sitzungen häufiger in Cafés und Bars in den Abendstunden verlegte, dachte sich aber nichts dabei. War vielleicht eine Psychomasche, das Ambiente angenehmer zu gestalten, mutmaßte Bettina. Sie bemerkte aber schließlich, dass er seine Sitzungen der Krankenkasse nicht mehr in Rechnung stellte. Darauf angesprochen, gestand er ihr seine Gefühle und Bettina war auf und davon. Dazu war sie nicht bereit, davon wollte sie absolut nichts wissen und schon gar nicht von einem Psychiater.
Der gute Martin. Martin war Sozialarbeiter, aber nicht einer von diesen Latzhosenträgern, die waren mittlerweile fast ausgestorben. Martin arbeitete beim Jugendamt und war für die Vermittlung von Pflegefamilien zuständig. Er mochte seinen Job, was Bettina nicht verstehen konnte, bestand er doch zu einem Großteil aus Bürotätigkeit und man musste oft in familiäre Abgründe blicken. Vor dem Unfall war Bettina am liebsten im Freien gewesen, nur den Himmel über sich. Wände um sich herum hatte sie nicht gerne gehabt. Das war jetzt anders, wenn Wolf oder Martin sie nicht ab und zu überredeten, ein Konzert zu besuchen oder zum Einkaufen zu gehen, blieb sie sehr oft zuhause.
Der Rollstuhl stand neben dem Bett. Er hatte einen Platten. „Auch das noch“, zischte Bettina, als sie sich trotzdem auf das Sitzkissen hievte. Wie oft hatte sie Martin schon gesagt, er solle die Einkaufsliste nicht mit Reißnägeln an die schäbige Korkwand heften, sondern Klebefilm verwenden. Sie brauchte dringend eine Magnetwand. Reißnägel waren so heimtückisch. Fuhr man mit dem Reifen hinein, ging die Luft ganz langsam und schleichend aus. Meist bemerkte man den Schaden erst am nächsten Tag, da die Luft über Nacht genügend Zeit hatte, langsam zu entweichen.
Auch diesmal war der Übeltäter schnell gefunden. Er war rosarot. Bettina ließ ihn im linken Reifen stecken und holte die Luftpumpe aus der Besenkammer. Da sie mittlerweile gut durchtrainiert war, fiel es ihr nicht schwer, sich aus dem Rollstuhl auf den Boden gleiten zu lassen, die Pumpe aufs Ventil zu stecken und den Reifen wieder aufzupumpen. Sie hatte zu kämpfen gelernt. Die Luft würde ein paar Stunden halten, später würde sie Martin oder Wolf bitten, den Reifen zu flicken.
Wolf konnte Martin nicht leiden. Er war nicht eifersüchtig auf ihn. Er ertappte sich sogar bei dem Gedanken, dass es für alle Beteiligten das Beste wäre, wenn Martin Bettina den Hof machte und die beiden zusammen kämen. Aber weder hatte Martin derlei Ambitionen, noch würde sich Bettina auf eine Beziehung einlassen. Martin war Bettina einfach ein guter Freund. Warum Wolf ihn nicht mochte, konnte er nicht sagen. Vielleicht war Martin zu perfekt. Warum kümmerte er sich so aufopfernd um Bettina? Vermutlich war es dieses schlechte Gewissen, das er damit in Wolf hervorrief, und das seine Abneigung provozierte.
Als Bettina in die Küche kam, schaltete sie das Radio ein. Eine Meldung ließ sie aufhorchen. An einigen Stellen in der Stadt hatte man tote Fledermäuse gefunden. Die nächtlichen Flugkünstler waren einzeln oder in Gruppen, meist auf Straßen und Plätzen entdeckt worden. Einige wiesen äußere Verletzungen auf, anderen schienen zumindest von außen unversehrt. Insgesamt waren es wohl über zweihundert verendete Fledermäuse, die an diesem Morgen eingesammelt wurden.
„Wir möchten noch nicht von einem Massensterben sprechen, doch es ist uns ein Rätsel, welche Ursache das Verenden der Tiere hat. Es waren Große Hufeisennasen und Zwergfledermäuse darunter“, berichtete die Stimme aus dem Radio. Konstantin Brinckmann war der Vorsitzende vom örtlichen Naturschutzbund und einer der Hauptgegner der Umsiedelung der Fledermäuse gewesen. „Es liegt uns fern, schon jetzt Vermutungen zu äußern, jedoch wird eine Obduktion von einigen Exemplaren Aufschluss darüber geben, ob sich Mineralfasern und Lösungsmittelsubstanzen aus Klebstoff nachweisen lassen.“
Kapitel 5
„Guten Tag, Willy!“ Erschrocken fuhr Willy herum. „Virginia! Welch edler Glanz in meiner bescheidenen Hütte.“ Willy rutschte seine zu große Brille auf dem Nasenrücken nach oben und strich sein zerzaustes Haar glatt.
„T möchte dich sprechen“, erwiderte Virginia, als sie durch die offene Tür in Willys Büro spazierte. „Warum sagt er mir das nicht selber?“ Mist! Willy ärgerte sich im gleichen Augenblick, dass er Virginia so angeblafft hatte. Schlafmangel und Nervosität waren offensichtlich keine guten Berater wenn es ums Süßholzraspeln ging. Anscheinend kam Virginia gerade von einem Meeting mit T. Sie trug einen Stapel Schreibunterlagen an ihre Brust gepresst, wie es Collegegirls zu tun pflegten.
„Und ich dachte du kommst mich besuchen, um mir endlich ein gemeinsames Frühstück in Aussicht zu stellen.“ Willy versuchte Boden gut zu machen. „Keine Zeit! Termine, Termine.“ Das war Virginias Standardantwort. Willy mochte versuchen was er wollte, er konnte bei Virginia nicht landen. Ein einziges Mal hatte sie sich dazu überwinden können, mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken. Der Kaffee war lauwarm gewesen, das Gespräch dabei unterkühlt.
Virginia stand in der Hierarchie der Organisation inzwischen ganz oben. Mit welchen Mitteln sie das in so kurzer Zeit geschafft hatte, darüber wurde viel spekuliert. Eingestellt wurde sie vor zwei Jahren als Kommunikationsbeauftragte. Sie bearbeitete die interne Nachrichtenzustellung und machte Botengänge. Mittlerweile war Virginia die Pressesprecherin der Organisation. Sie arbeitete eng mit T zusammen, sie war sozusagen die Außenministerin, zuständig für die draußen sichtbare Tätigkeit von Trust Your Mind, die legale Versicherungsarbeit. Viel gab es nach außen jedoch nicht zu berichten, es war eher eine Alibifunktion. Einmal wurde sie zu einem Interview für das Journal Overview eingeladen und pries darin die Vorzüge von Trust Your Minds Kapitallebensversicherungen. Virginia war sogar mit einem Foto abgebildet worden. Der kurze Artikel erschien im Rahmen einer Serie über lokale Unternehmen und TYM verfolgte damit nicht die Absicht, haufenweise Kunden zu gewinnen. Die Organisation wählte sich ihre Klientel stattdessen bewusst aus und behielt nur einen kleinen Stamm legaler Kunden zum Schein.
Neben Matt, dem Sicherheitschef, und Willy als oberstem Techniker bildete Virginia den engsten Vertrautenkreis um T. Eine Ebene darunter waren die Abteilungsleiter der einzelnen Bereiche angesiedelt. Da gab es die Laborwerkstatt, zuständig für den Bau der Sender, ein technisches Außenteam, das die Einheiten installierte, die Riege der Programmierer, die Willys Software am Laufen hielten und eine Abteilung für das Abfangen, Filtern und Speichern der ausspionierten Daten. Weiter unten in der Hierarchie arbeitete noch ein Team von Haustechnikern, die die Hardware, angefangen von den Rechnern und Servern im Keller, bis hin zu den Antennen auf dem Dach einschließlich tausender Meter Kabel zwischen den einzelnen Komponenten warteten. Und schließlich existierte eine kleine Alibiabteilung von Versicherungssachbearbeitern und Angestellten der Haustechnik sowie der Gebäudeinstandhaltung. Die wenigen Mitarbeiter dieser untersten Ebene im Organigramm von TYM hatten von den eigentlichen Zielen und kriminellen Machenschaften der Organisation keinen blassen Schimmer. Dieses Informationsgefälle behütete Virginia, sie wachte darüber, welcher Bereich welche Details erfahren durfte. Sie hielt die Unwissenden bei Laune und versah die Eingeweihten mit den nötigen Informationen.
Ihren ostdeutschen Dialekt konnte Virginia nie ganz verbergen, so sehr sie es auch versuchte. Ihre Eltern waren in der ehemaligen DDR mehrmals inhaftiert gewesen. Sie hatten als Staatsfeinde gegolten, weil sie gegen das bestehende System aufbegehrt hatten. Kinder von Systemkritikern erhielten damals als Zeichen des Protests von den Eltern gerne Vornamen aus westlichen Kulturen. Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika waren bei den Rebellen besonders beliebt: Caroline oder eben Virginia. Aus der letzten Inhaftierung waren Virginias Eltern nicht mehr aufgetaucht. Damals war sie zwölf gewesen. Noch nicht alt genug, um den Protest ihrer Eltern fortzusetzen, sie kam in ein systemkonformes Heim, doch ihre kritische Haltung allem Gleichmacherischen gegenüber blieb. Dann kam die Wende.
Virginia beendete ihre Schullaufbahn, mit achtzehn zog sie aus dem Heim aus und studierte Kommunikationswissenschaften. Nach etlichen Anstellungen bei mehr oder weniger erfolglosen Firmen heuerte sie schließlich bei TYM an. Man munkelte, dass ihr Aussehen den entscheidenden Ausschlag bei T gegeben hatte.
Sie hatte kurze blonde Haare, die immer perfekt gestylt waren und ausgeprägte Wangenknochen. Ihre körperbetonte Kleidung in Verbindung mit ihrer großen Oberweite ließ sie bei ihrer eher geringen Körpergröße irgendwie drall erscheinen, obwohl sie schlank war. Sie verkörperte damit genau den Typ Frau, auf den Willy stand. Wahrscheinlich war es jedoch eher die Kombination aus ihrem öffentlichkeitswirksamen Aussehen und ihrer, von den Eltern geerbten systemkritischen Einstellung, was sie für die Arbeit in der Organisation prädestinierte.
„Jetzt gleich?“ Willy lenkte das Gespräch wieder auf den Grund für Virginias Besuch. „Gerade hat T noch eine Fernkonferenz mit Kunden, aber ich glaube er sähe es gerne, wenn du heute Vormittag noch bei ihm vorstellig würdest.“ „Dann hab ich ja noch Zeit einen Kaffee zu trinken. Kommst du mit?“ Willy ließ nicht locker. „Wie du ja vielleicht weißt, ist gerade Einiges am Laufen. T möchte Ergebnisse sehen und das weitere Vorgehen muss auch noch kommuniziert werden. Du tätest gut daran, dich ein wenig vorzubereiten. Sorry!“
Virginias Augen funkelten und holten Willy in die reale Arbeitswelt zurück. „Du hast ja recht, wie immer.“ Virginia zwinkerte ihm zum Abschied zu und verschwand aus der Tür. „Klasse Frau“, murmelte Willy fast unhörbar, „ich werde es ihr schon noch beweisen, was ich drauf habe, ich werde es allen beweisen.“
Als Willy den Flur entlang ging, war er wieder ganz auf die bevorstehende Arbeit fokussiert. Er bog am Ende des Ganges um die Ecke, ließ das Treppenhaus links liegen und steuerte auf den Fahrstuhl zu. Alle Türen, die in besonders geschützte Bereiche oder ins Treppenhaus führten und die Aufzugtüren, waren mit elektronischen Türcodeschlössern gesichert. Jeder Mitarbeiter, von der Putzfrau bis zum Programmierer, hatte seine eigene sechsstellige Zahlenkombination, die ihm Zugang zu den Bereichen innerhalb des Gebäudes verschaffte oder eben auch nicht. Das ging so weit, dass man mit seinem Code zwar den Aufzug benutzen konnte, um beispielsweise vom Bürotrakt ins Erdgeschoss zu gelangen, wo der Ausgang lag, oder in die Tiefgarage, nicht jedoch weiter in den Keller, wo die sensiblen Bereiche angesiedelt waren.
Es oblag allein T zu entscheiden, wer zu welchem Bereich Zugang hatte. Natürlich hatte er seine Mitarbeiter für die Programmierung des Schließsystems, aber die Berechtigungsstufen vergab nur der Master.
Die Zahlenkombination von Willy öffnete ihm fast alle Bereiche. Als er die Tasten an der Aufzugtür drückte, gab diese mit einem leichten Summen den Weg ins Innere des Fahrstuhls frei und Willy betätigte den Button U2. U1 war die Autotiefgarage, U2 lag noch einiges darunter und beherbergte die gesamte Server- und IT-Hardware. Noch ein Geschoss tiefer in U3 war Willys Herzstück untergebracht, die Ansteuerung der Einheiten und die Werkstatt. Über einen zentralen Kabelschacht, der fast so groß dimensioniert war wie ein Aufzugschacht, wurden die einzelnen Stockwerke von den Untergeschossen bis aufs Dach miteinander physisch verbunden. Wenn Willy sportlicher gewesen wäre, hätte er das Treppenhaus benutzt. Auch hier waren die einzelnen Geschosstüren mit eigenen Schlössern ausgestattet, so dass nicht jeder überall das Treppenhaus verlassen konnte.
Nach kurzer Fahrt stoppte der Fahrstuhl auf U2, die Türen glitten zur Seite und Willy betrat einen neonlichtdurchfluteten Raum. Der begehbare Untergrund bestand zunächst aus einer Brücke aus Eisengitter, etwa einen Meter darunter war der eigentliche Betonboden. Nach ein paar Metern verließ Willy über fünf Stufen den Steg. Im Raum war es angenehm kühl. Dafür sorgte die Klimaanlage, die permanent auf Hochtouren lief. Das war auch nötig, weil die Superrechner und Server – sie waren luftgekühlt – sonst innerhalb kürzester Zeit heiß laufen würden.
Der Eisensteg führte vom Aufzug auch in die entgegengesetzte Richtung in einen Raum, der dem anderen bis aufs Haar glich. In den beiden Arealen waren zwei redundante Systeme installiert, von denen eines als Ersatz beim Ausfall des anderen einsprang. Im momentanen Betrieb war aber nur das linke System aktiv, das andere im Standby-Modus. Die Kosten für den Aufbau dieses Imperiums waren dadurch zwar verdoppelt worden, doch der Master baute auf absolute Sicherheit und es war unvorstellbar für ihn, einmal angenommene Aufträge von Kunden nicht zu erfüllen. Um das Ausfallrisiko auszuschalten und um weiterhin im Verborgenen operieren zu können, wurde eine eigene Abteilung beschäftigt, um Zugriffe von außen zu verhindern. Ein ausgeklügeltes System aus mehrstufigen Firewalls schottete das IT-System von Trust Your Mind gegen Cyberangriffe und Hacker ab.
Einige Mitarbeiter in weißen Kitteln waren in den Gängen zwischen den Rechnerschränken unterwegs. An der gegenüberliegenden Seite des Raumes war mittig ein Glaskubus angebracht. Willy steuerte darauf zu. Daniele war rein äußerlich der Inbegriff eines südländischen Gauners, italienischer Abstammung und ausgesprochen gutaussehend.
„Buongiorno!“, begrüßte er Willy mit einem fetten Grinsen, als dieser durch den Eingang in das Glasbüro trat. Daniele erhob sich vom Schreibtisch und reichte Willy die Hand. „Warum so förmlich?“, entgegnete Willy. „Na gibt es Grund zum Feiern. Iste Champagner schon kalt gestellt?“ „Nun mal langsam, erst will ich Ergebnisse sehen“, bremste Willy.
Daniele fuchtelte überschwänglich mit den Armen und platzierte dann seine Rechte kumpelhaft auf Willys Schulter. Mit der anderen Hand deutete er auf den Bildschirm. Ein fortlaufendes Liniendiagramm gab unschwer zu erkennen, dass da etwas gemessen wurde, was definitiv nicht auf Nulllinie war. „Das ist die gesamte Datenmenge.“ Daniele tat, als müsste er Willy alles wie einem Laien erklären. Willy ließ es über sich ergehen, es fühlte sich gut an, die Ergebnisse seiner monatelangen Arbeit präsentiert zu bekommen.
„Seit Mitternacht ist der Graph nach oben geschnellt und seit Tagesanbruch nochmal. Das zeigt uns, dass nachts weniger gesurft wird.“ Daniele schmunzelte. Eigentlich konnte er akzentfrei sprechen, nur wenn er den Italiener rauskehren wollte, verfiel er in diesen Italo-Slang.
„Schön und gut, aber gibt’s auch schon erste Treffer?“ Willy drängte. „Was erwartest du? Sind wir in Hauptstadt oder iste hier Provinz?“ Natürlich hatte der Italiener recht. Die großen Fische würden ihnen hier nicht ins Netz gehen. Daniele gab einige Befehle in den PC ein und ein zweiter Bildschirm aktivierte sich.
„Ein bisschen was haben wir schon. Das beweist, dass die Filter funktionieren.“ Daniele war offensichtlich gut gelauntund machte überhaupt keine Anstalten, es zu verbergen. „Hier haben wir zum Beispiel eine Mitteilung über Salafisten. Dann zwei mitHeil Hitlerund dann noch eine Botschaft mit einer Anleitung zum Rohrbombenbau.“ „Alles uninteressant, wir arbeiten schließlich nicht für den Bundesnachrichtendienst.“ Obwohl Willy froh war, dass sein System offenbar funktionierte, wusste er doch, dass das alles nur ein Probelauf war und T ihm mit der baldigen Erweiterung im Nacken hockte.
„Ich frage mich sowieso, wer die Daten kaufen soll“, tat Daniele neugierig. Ein schlechter Charakterzug für einen Mitarbeiter der Organisation, dachte Willy. Tu deinen Job und frage nicht nach dem Warum, war oberste Maxime von Trust Your Mind. „Das braucht dich nicht zu interessieren“, erwiderte Willy. „Jedenfalls verstehst du jetzt, dass wir den Ausbau schnell voranbringen müssen, denn solche Informationen kaufen uns unsere Kunden bestimmt nicht ab.“
Als Willy den Aufzug betrat, widerstand er der Versuchung, auch noch einen Abstecher nach U3 zu machen. Es war nun doch besser, gleich mal bei T vorzusprechen, also fuhr er direkt wieder auf die Büroebene in den zweiten Stock. Willy klopfte kurz an und betrat das Machtzentrum von TYM. Allein schon von der Ausstattung her konnte jeder, der das Privileg hatte diesen Raum betreten zu dürfen, merken, dass hier der Chef residierte. Die Größe und Ausstattung von Ts Büro stand im krassen Gegensatz zu der Moderne und Funktionalität des restlichen Gebäudes. Die schweren dunklen Nussbaummöbel und Marmortischplatten erweckten eher den Eindruck vom Interieur eines gediegenen Landhauses. Durch das von außen halb verdunkelte Fenster drang schummeriges Licht.
„Nur immer herein, Willy.“ T saß auf dem dunkelbraunen Ledersofa in der Besprechungsecke und bot Willy einen Platz gegenüber an. „Was gibt’s Neues von der technischen Abteilung?“ „Ich komme gerade aus dem Rechenzentrum, die ersten Treffer haben wir bereits.“ Willy versuchte im Brustton der Überzeugung zu sprechen. „Ich habe sie schon auf dem Bildschirm“, setzte T Willy ins Bild. „Unser kleiner Italiener war so freundlich, sie mir raufzuschicken.“
Willys Selbstbewusstsein schwand ein wenig. „Ich weiß“, sagte er „die Treffer sind noch nicht das Gelbe vom Ei, aber wir sind ja schließlich noch in der Testphase.“ „Entspann dich!“ T schenkte Willy eine Tasse Kaffee ein. „Wir müssen die Zeitplanung besprechen. Wie schnell können wir das Einzugsgebiet auf Deutschland ausweiten?“ „Das Problem ist die Reichweite“, gab Willy zu bedenken. „Momentan arbeiten meine Techniker rund um die Uhr, um neue Einheiten zu produzieren. Wir haben auf Vorrat gearbeitet, mittlerweile sind 1100 Stück in der Lagerhalle.“
Willy wusste, dass das T nicht zufriedenstellte. „Damit wäre gut ein Fünftel erreicht“, antwortete T knapp. „Unsere Kunden wollen bald die ersten brauchbaren Ergebnisse sehen. Wir sprechen über einen Zeitraum von einem Vierteljahr.“ Willy spürte, wie er ins Schwitzen kam. „Der Einbau ist nicht das Problem, die Produktion geht nicht so schnell vonstatten und vor allem brauchen wir Standorte.“
T lehnte sich auf seinem Sofa zurück und nahm einen großen Schluck Kaffee. „Willy, du weißt, dass ich dir vertraue. Wenn du mehr Leute brauchst, werde ich Personal akquirieren. Aber wir haben unseren Kunden gegenüber Verpflichtungen. Bezahlt werden wir nach Treffern und die Trefferquote erhöht sich nur mit der Flächenabdeckung.“ Das wusste Willy nur zu gut. „Ich bekomme das schon hin“, versicherte er brav.
Als er das Büro des Masters verließ, am Kaffee hatte er nur einmal genippt, überfiel Willy eine unbeschreibliche Müdigkeit. Der Druck, der auf ihm lastete, war enorm. Doch das Ziel würde er mit der Erhöhung der Einheitenzahl zu langsam erreichen. Er musste jetzt schleunigst seinen eigenen Plan B umsetzen, aber vor allem brauchte er erst einmal Schlaf.
Kapitel 6
- Mittwoch -
Wolf hatte am folgenden Tag den Termin mit Professor Manfred Kübler für 13:30 Uhr an der Universität vereinbart. Zunächst wollte er aber noch in die Redaktion, um den neuen Artikel vorzubereiten. Als er die Redaktionsräume im dritten Stock betrat, hatte er ein Déjà-vu. Aus mehreren Kehlen erklang ihm der Singsang ‚Oh Shit, Herr Schmidt‘ entgegen. Ein Hit aus dem Jahr 1997, der ironischerweise von der Band ‚The Wolf‘ gesungen worden war und eigentlich ‚Oh Shit, Frau Schmidt‘ hieß.
Beim letzten Mal vor ungefähr einem Jahr war es ein missglücktes Interview mit dem Bürgermeister gewesen, das ihm den Spott seiner Kollegen eingebracht hatte. Es ging damals um das Thema Ehe und Familie, einem Thema, dem Wolf aus bekannten Gründen lieber aus dem Weg gegangen wäre. Jedenfalls war der Bürgermeister, mittlerweile in dritter Ehe verheiratet und mit fünf Kindern von vier Frauen nicht gerade der ideale Interviewpartner für dieses Thema gewesen. Wolf hatte mit seiner bohrenden Fragerei – und Wolf konnte hartnäckig sein – bei ihm wohl einen wunden Punkt getroffen und das Stadtoberhaupt sah sich offenbar dazu veranlasst, Beschwerde beim Chefredakteur vom Overview einzureichen. Dieser wiederum gab den Rüffel an den Abteilungsleiter weiter und Herb hatte Wolf in seinem Sessel sitzend ziemlich rasiert.
Warum Wolf heute singend empfangen wurde, ahnte er bereits. Jenny sah ihn mitleidig an und flüsterte ihm im Vorbeigehen zu: „Du sollst dich sofort bei Herb melden.“
Als Wolf in das Büro des Abteilungsleiters trat, fiel ihm gleich der säuerliche Ausdruck aufs Herbs Gesicht auf. Wenigstens explodiert er nicht schon bei meinem Anblick, schöpfte Wolf Hoffnung. Er beschloss gleich in die Offensive zu gehen. „Wenn sie die Tiere auch einfach in die Hausmülltonne schmeißt, das kann doch wohl nicht sein.“
Herb bedeutete Wolf sich zu setzen. „Aber musstest du das Thema ausgerechnet mit der Nachbarin vom Bürgermeister diskutieren?“ Bei der Augenzeugenbefragung am gestrigen Nachmittag, war ein Interview eskaliert. Jenny hatte noch versucht, beruhigend einzuwirken, aber die Interviewpartnerin war beim Anblick von Jennys Kamera erst recht ausgeflippt. Wolf hatte eigentlich nur versucht herauszubekommen, ob jemand in der Nachbarschaft des Fischmarktes von dem nächtlichen Sterben etwas mitbekommen hatte. In einem größeren Innenhof fanden sie auch eine gesprächsbereite Nachbarin, die berichtete, morgens beim Gang durch den Vorgarten über vier tote Fledermäuse gestolpert zu sein. Auf die Frage, wo die Tiere nun seien, hatte sie auf die Mülltonnen gedeutet. Wolf hatte nicht fassen können, dass jemand so gedanken- und pietätlos Beweismittel entsorgt und noch nicht einmal mitbekommt, dass die Vorkommnisse an mehreren Stellen in der ganzen Stadt passiert sind und es folglich wichtig gewesen wäre, den Fund mitzuteilen.
„Aber mit dem ungefragten Öffnen der Mülltonne bist zu wirklich zu weit gegangen. So was ist Hausfriedensbruch.“ Herb war spürbar gereizt. Auf eine Anklage gegen den Overview hatte er wirklich keine Lust. „Hausfrieden? Na das würde passen, wenn dieses Subjekt auch noch in der Mülltonne wohnt.“
Beim Blick in die Tonne hatte Wolf außer den toten Fledermäusen auch noch einen aufgerissenen Müllbeutel bemerkt, aus dem schwarzes Lederzeug mit Nieten, etwas ausgefranstes Peitschenähnliches und benutzte Präservative herausschauten. Sichtlich irritiert hatte er den Deckel nicht sofort wieder geschlossen, was dazu geführt hatte, dass die Dame kreischend auf ihn zugefahren, ihm den Deckel der Tonne entrissen und scheppernd zugeknallt hatte. Auf die darauf folgenden wüsten Beschimpfungen und den erfolglosen Vermittlungsversuch von Jenny, hatte Wolf den Rückzug angetreten, nicht ohne zu bemerken, dass die Leute in den Nachbarwohnungen bereits an den Fenstern standen. Dass in einem der Häuser auch Wolfs ‚alter Freund‘ der Bürgermeister wohnte, hatte er in diesem Augenblick gar nicht realisiert. Diese Erkenntnis traf ihn erst vorhin im Büro des Abteilungsleiters.
Wolf verließ mit einer Rüge den Raum und betrat mit dem wohlbekannten, diesmal etwas leiseren Singsang im Ohr das Großraumbüro, wo ihn die feixenden Blicke der Kollegen trafen. Wie sonst selten tagsüber, hatte er jetzt Lust auf eine Zigarette. Leider hatte er aber keine dabei, so dass er beschloss, in den gegenüberliegenden Supermarkt zu gehen und sich welche zu besorgen. Auf dem Rückweg hielt er in der Fahrradgarage beim Aschenbecher. Er steckte sich gerade die Zigarette an, als ihn eine vertraute und angenehm tiefe Frauenstimme ansprach.
„Du rauchst?“ Es war Jennifer, die ihn offensichtlich erwartet hatte. „Bei einem sportlichen Typen wie dir hätte ich damit nicht gerechnet.“ Wolf fühlte sich irgendwie ertappt. Er versuchte neuerdings immer, sich vor Jenny von seiner besten Seite zu zeigen und dazu passte das Rauchen gerade gar nicht. „Nur am Feierabend und wenn ich Stress habe“, antwortete Wolf entschuldigend.
„War es denn schlimm?“, erkundigte sich Jennifer mitfühlend. „Es tut mir leid, dass ich dich gestern nicht vor der Situation bewahren konnte. Mir hat gleich der Atem gestockt, als du in ihrem Beisein die Mülltonne geöffnet hast. Investigativer Journalismus muss manchmal im Geheimen geschehen.“
Jenny hatte recht. Es war ein Fehler von ihm gewesen. Und die Tatsache, dass der Bürgermeister in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnte, hatte die Sache natürlich noch zusätzlich aufgeblasen.
„Aber ich habe dir noch gar nicht erzählt, was sonst noch in der Mülltonne war.“ Wolfs Gesichtsausdruck veränderte sich schelmisch. „Schieß los“, sagte Jenny ungeduldig. Wolf tat geheimnisvoll und ließ Jennifer etwas betteln. Als er schließlich doch von den Leder- und Nietenteilen und den Kondomen erzählte, prustete Jenny los. Vertraut berührte sie Wolf am Oberarm und hielt sich an ihm fest. „Nicht wirklich, oder? Jetzt verstehe ich erst, warum sich die Dame so aufgeregt hat. Ob die Nachbarn auch wissen, was die Lady sonst so treibt?“ „Wahrscheinlich sind das ihre besten Kunden und der Bürgermeister ist ja bekanntermaßen auch kein Kind von Traurigkeit“, steuerte Wolf bei.
Beide mussten herzhaft lachen. Das Lachen tat gut. Der Berührung von Jenny spürte Wolf noch lange nach. Er hätte sie jetzt am liebsten in den Arm genommen, doch er traute sich nicht. Außerdem war es ihm ihr gegenüber unangenehm, da er nach Zigarettenrauch roch.
Am Nachmittag war die dicke Luft schon wieder verflogen und Wolf strampelte auf seinem Fahrrad Richtung Uni. Jenny hatte sich angeboten mitzukommen, doch Wolf hatte das Angebot abgelehnt, weil er wusste, dass Jenny in einer anderen Grafikangelegenheit noch viel zu tun hatte. Ein Foto von Professor Kübler würde er schon selber hinbekommen.
Als Wolf, pünktlich wie die Eisenbahn, kurz vor halb zwei den Campus erreichte, war er ein ums andere Mal erstaunt, wie hässlich ein Gebäudekomplex sein konnte. Der Universitätsbau stammte aus den 60er-Jahren und war ein einziges graues Betonmonstrum, unterbrochen nur von farbigen Fensterelementen. Die damals üblichen Flachdächer waren längst undicht, was zu Folge hatte, dass die Uni eine Dauerbaustelle war. Auch der Gebäudeteil in dem die biologische Fakultät und das Büro Professor Küblers untergebracht waren, wurde momentan von einem stattlichen Außengerüst eingerahmt.
Für einen Fremden war es nicht leicht, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Der gesamte Komplex wurde von einer Vielzahl von Innenhöfen, Plätzen, Teichen und Springbrunnen unterbrochen, was dem ganzen Beton wenigstens ein klein wenig die Massivität nahm. Wolf war schon öfter hier gewesen und er wusste, wo es zum Biologietrakt ging. Er betrat das Gebäude und stellte nach einem kurzen Blick auf die Infotafel fest, dass das Büro Küblers im zweiten Stock angesiedelt war. Er nahm die Treppe sportlich und klopfte an die Tür.
„Treten Sie ein!“, vernahm er die sonore Stimme des Professors. „Guten Tag, Schmidt mein Name, vom Overview“, stellte sich Wolf vor. „Ich weiß, wer Sie sind“, entgegnete der Professor, „ich lese Ihre Artikel seit der Umsiedlung der Fledermäuse regelmäßig.“ Wolf fühlte sich geschmeichelt. „Schön, dass Sie sich so kurzfristig für mich Zeit genommen haben.“ Kübler bot Wolf einen Stuhl am Schreibtisch an, Wolf setzte sich dankbar. Das Büro war vollgestopft mit Regalen, die von Büchern und Ordnern überquollen. Zwar gab es auch eine kleine Sitzecke, doch diese war ebenfalls so vollgestellt mit weiteren Büchern und Manuskripten, dass der Professor sie Wolf gar nicht erst angeboten hatte.
„Herr Professor Kübler“, begann Wolf, „Sie haben gestern die aufgesammelten Kadaver der verendeten Fledermäuse in Ihr Institut beordert.“ Der Professor nickte. „Können Sie schon etwas über die Todesursache sagen?“ Kübler neigte nachdenklich den Kopf. „Nun ja“, begann Professor Kübler, „von den Verletzungen her ist es jedenfalls äußerst mysteriös, da nicht alle Tiere äußerliche Wunden aufweisen. Natürlich können Toxine innere Blutungen hervorrufen. Das würde erklären, warum bei einigen Tieren aus natürlichen Körperöffnungen Blut ausgetreten ist. Andererseits haben manche Tiere offensichtliche Verletzungen, die durch Giftstoffe für gewöhnlich nicht entstehen und eher für äußerliche Gewalteinwirkung sprechen.“
„Haben Sie noch keine biochemische Analyse nach Giftstoffen durchgeführt?“, wollte Wolf wissen. „Nur langsam“, bremste der Professor, „mit unseren bescheidenen Mitteln dauert das mindestens eineinhalb bis zwei Tage, bis wir Substanzen nachweisen können und gestern Nachmittag haben wir die Tiere erst ins Labor bekommen.“
Wolf war enttäuscht, er hatte gedacht, schon eindeutige Ergebnisse mit in die Redaktionskonferenz bringen zu können. Der Professor erhob erneut das Wort: „Was mich allerdings am meisten wundert, ist die Tatsache, dass Große Hufeisennasen und Zwergfledermäuse gefunden wurden.“ Wolf war in der Gasse beim Fischmarkt auch aufgefallen, dass sich die Tiere in Größe und Nasenform unterschieden. „Und was heißt das?“, wollte er wissen.
Offensichtlich drückte sich der Professor vor einer eindeutigen Antwort. Vielleicht wollte er nicht, dass seine Spekulationen im Overview abgedruckt wurden. „Das heißt, dass ich noch nicht genau sagen kann, woran die Fledermäuse verendet sind. Ich gebe Ihnen aber gerne meine Telefonnummer. Sie können mich morgen um diese Zeit anrufen. Wenn ich schon gesicherte Informationen habe, werde ich Sie ins Bild setzen.“
Wolf begnügte sich mit der Antwort und überreichte dem Professor seine Visitenkarte. Er stellte noch ein paar Fragen zur Person Manfred Kübler und fotografierte ihn inmitten seines Chaos. Der Professor war so freundlich, Wolf auf dem Rückweg zu begleiten und zeigte ihm noch einen Teil seiner Labors, was Wolf noch zusätzliche Fotos bescherte.
Heute war die Redaktionssitzung auf 16 Uhr angesetzt. Wolf hatte also noch genügend Zeit, auf dem Weg in die Redaktion sein ausgefallenes Mittagessen nachzuholen. Er wählte den Weg durch die Altstadt. Unwillkürlich steuerte er Richtung Fischmarkt, wo sich ein nettes kleines Bistro befand. Er stellte sein Rad ab und setzte sich an einen freien Tisch. Die Luft war angenehm warm an diesem Sommertag. Als er auf seine Bestellung wartete, fiel sein Blick in Richtung der südlichen Gasse und er musste an die Mülltonnengeschichte denken. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Plötzlich wurde sein Blick durch etwas in der Luft abgelenkt. Ein nervöses Schwirren oder Flattern fesselte seinen Blick. Ein ganz schön hektischer Vogel, dachte Wolf. Unvermittelt knallte der Flieger an die Hauswand und stürzte zu Boden. Wolf erkannte nun, dass es sich um eine Fledermaus handelte. Sie rappelte sich auf, startete etwas mühsam vom Boden und entfernte sich flatternd Richtung Fluss.
Wolf konnte sich an ein einziges Mal erinnern, eine Fledermaus tagsüber gesehen zu haben. Damals hatte es sich um eine Zwergfledermaus gehandelt und er war noch ein Kind gewesen. Das Tierchen war zweifellos durch irgendetwas aus seinem Versteck aufgescheucht worden und hatte sich dann an die Unterseite vom Balkon seines Elternhauses gekrallt. Merkwürdig, dachte Wolf, jetzt fliegen sie schon am Tag. Außerdem gelten Fledermäuse doch als Flugkünstler und weichen jedem Hindernis gekonnt aus. Warum dann der Aufprall gegen die Hauswand?
Kapitel 7
Das vom Fahrstuhl aus gesehen rechte Kellerareal von U3 wurde nur durch gedämpftes Licht erhellt. Bevor Willy an Schlaf denken konnte, hatte er noch ein paar Erledigungen abzuhaken. Hier unten war sein Reich. Von der Aufzugtür aus nach links, genau unter dem momentan arbeitenden Rechenzentrum, befand sich die Laborwerkstatt, in der die Einheiten produziert wurden und rechts die Sende- und Empfangszentrale für das Signal. Natürlich wurde das Signal nicht vom Keller aus gesendet, dafür stand oben auf dem Dach, geschützt unter einer Kuppel, ein stattlich dimensioniertes Antennensystem. Aber die Herstellung des Signals und dessen Rücklauf geschahen im Untergeschoss 3.
T verirrte sich eigentlich nie nach hier unten. Er residierte im zweiten Obergeschoss in seinem prunkvollen Büro und kümmerte sich hauptsächlich um die Geschäfte. Für die eigentliche Arbeit brauchte er Leute wie Willy. Willy verbrachte genauso viel Zeit im Keller wie in seinem Büro oben. In der Laborwerkstatt drüben war reger Betrieb. Willy hatte dem Werkstattleiter, einem schlaksigen Kerl namens Phil, gerade den Auftrag erteilt, die Produktion unverändert fortzusetzen.
„Wir haben noch Material für ungefähr 2000 Einheiten, zusätzlich zu den bereits fertigen im Lager“, sagte Phil. „Die Schatullen sind nicht das Problem, als erstes werden die Membranen und Keramiken knapp.“ „Dann sofort nachbestellen“, kommentierte Willy knapp. Die Produktion musste wie geplant weiterlaufen, auch wenn Willy insgeheim damit rechnete, mit einer weit geringeren Zahl auszukommen.
Hier im rechten Bereich von U3 war Willy allein. Er hatte sich in seinem Bürostuhl niedergelassen und die Brille abgenommen, um sein Gesicht und die Schläfen zu massieren. Willys knapp schulterlanges braunes Haar war mittlerweile im Begriff fettig zu werden. Kein Wunder, eine Dusche hatte er länger nicht benutzt. Willy sah erbärmlich aus. Auch sonst, in gepflegtem Zustand, glich er nicht gerade Adonis. Er war leicht untersetzt, seine Haut war stets trocken und blass, was mit Sicherheit Willys ungesunder Ernährung und dem fehlenden Sonnenlicht geschuldet war. Für gewöhnlich trug er eine ausgebeulte Jeans und karierte Hemden. Als er sich die Brille wieder aufsetzte, vervollständigte er das Bild eines typischen Nerds.
Als er seinen Rechner aus dem Standby-Modus erweckte, war Willy sich darüber im Klaren, dass er die nächste Stufe einleiten musste. Bereits weit im Vorfeld des Startschusses der imaginären Rakete Emma in der vorletzten Nacht hatte Willy die Parameter für die Signalstärke entscheidend verändert. Damit wurde die Reichweite des Signals beeinflusst, was bei dem verwendeten Medium aus physikalischen Gründen aber nicht unbegrenzt möglich war.
Willy hatte sich wie Albert Einstein gefühlt, als er vor zwei Jahren ein Verfahren entwickelt hatte, das Transportmedium, das von den Einheiten ausgesandt wurde, als Spionagemedium für elektromagnetische Wellen zu nutzen. T hatte dieses Projekt millionenschwer gefördert und das geglückte Ergebnis bescherte Willy einen enormen Bonus beim Master. Auf eigene Faust hatte Willy später weiterexperimentiert. Es war ihm gelungen, das Transportmedium so zu modifizieren, dass er die Reichweite noch erhöhen und nicht nur mobiles Internet, sondern auch W-LAN und Mobilfunk anzapfen konnte. Diesen Erfolg hatte Willy aber bislang geheim gehalten, weil die Testungen noch keine fehlerfreien Ergebnisse geliefert hatten.
„Jetzt wird es sich entscheiden“, murmelte Willy vor sich hin, als er ein weiteres Mal die Parameter veränderte. Die Berechnungen waren eindeutig, es musste funktionieren! T wird mir ewig dankbar sein und Virginia wird mich dafür lieben, dachte Willy, als er auf die Tastatur einhackte, ein paar Zahlen veränderte und sie schließlich ins laufende Programm einspeiste. Ein paar Sekunden später schnellte der Graph auf dem zweiten Bildschirm nach oben.
Kapitel 8
Auf dem Weg vom Fischmarkt zum Redaktionsgebäude ließ sich Wolf die Informationen von Professor Kübler noch einmal durch den Kopf gehen. Viel war es nicht, was er in der Redaktionssitzung erzählen konnte, vermutlich reichte es nur für einen Kurzbericht.
Wolf wollte sich vorher noch frisch machen. Im Spiegel des Waschraumes blickte er in zwei wache blaue Augen. Eigentlich habe ich mich ganz gut gehalten, dachte Wolf bei sich. Mit seinen 38 Jahren steckte er sportlich gesehen so manchen Mittzwanziger in die Tasche. Er war zwar nicht übertrieben muskulös, doch untrainiert sah er auch nicht aus. Seine kurzen dunkelbraunen Haare waren meist etwas zerzaust, an seinem Kinn prangte ein kleines Ziegenbärtchen. Da er bei einer Größe von einem Meter achtzig eher untergewichtig war, vermied er es, zu enge Klamotten zu tragen. Meist trug er Jeans und ein weites T-Shirt.
Die Konferenz begann pünktlich. Neben dem Chefredakteur Joachim van der Valk – seine Vorfahren stammten aus den Niederlanden – waren die Abteilungsleiter anwesend und jene Mitarbeiter, die gerade an brisanten Themen arbeiteten. Die Runde bestand aus fünfzehn Personen, die an Tischen im Halbrund in einem lichtdurchfluteten Raum im obersten Stockwerk des Redaktionsgebäudes Platz genommen hatten.
Nach den üblichen organisatorischen Punkten, ging der Chefredakteur gleich zu den Themen über. Auf die Abteilungsleiter für Politik, Gesellschaft und Kultur folgte Herb als Vertreter für Regionales. Diese Sparte hatte sich der Overview erhalten, weil vor Jahren der Versuch, sich deutschlandweit neben Stern, Fokus und Spiegel zu etablieren, gescheitert war. Man zielte inzwischen wieder vermehrt auf regionale Leserschaft und mit diesem Konzept fuhr man momentan gut. Die stetig leicht ansteigenden Auflagezahlen bewiesen es.
„Der Carillonbau im Sankt-Nikolaus-Turm ist fast abgeschlossen“, hob Herb an. „Ich weiß, dass wir damit im Bereich der Kulturabteilung wildern“ – dieser Seitenhieb galt dem Chef der Kultur, es waren heftige Grabenkämpfe zwischen ihm und Herb über die Zugehörigkeit des Themas zur Abteilung vorausgegangen und Herb hatte sich schließlich durchgesetzt – „aber es wird die Leserschaft interessieren, dass vor dem offiziellen Eröffnungskonzert im Juli, bereits ein Testspiel geplant ist. Näheres kann uns Ben in gebotener Kürze berichten.“
Ben König war nicht nur ein Kollege von Wolf, sondern auch ein guter Freund. Die beiden verband außerdem die gemeinsame Leidenschaft zur Rockmusik, sie spielten sogar in derselben Band. Wolf zupfte den Bass, Ben war Gitarrist und Sänger.
„Das stimmt“, meldete sich Ben zu Wort. „Die 52 Glocken hängen bereits, der Spieltisch ist komplett restauriert und erweitert. Nach Aussage des Instrumentenbauers müssen die Drahtzüge noch justiert werden.“ „Und wann soll das Testspiel stattfinden?“, wollte van der Valk wissen. „Den Termin wollen sich die Veranstalter noch offen halten, er wird erst durch die Tagespresse bekannt gegeben. Ich glaube, sie möchten damit auch einem zu großen Besucherandrang aus dem Weg gehen.“ Diese Vermutung Bens war nicht ganz unbegründet, sollte irgendetwas schief laufen, wäre das bestimmt peinlich für die Carillonbefürworter und die Erbauer. „Jedenfalls habe ich einen schönen Achtseiter über das großartige Instrument und die Geschichte der Nikolauskirche in petto.“ Damit beendete Ben seine Ausführungen.





























