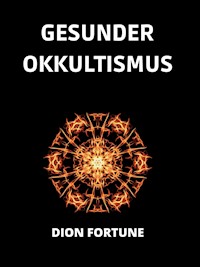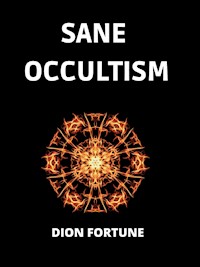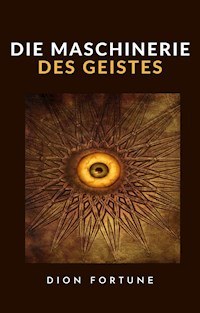Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mondmagie ist die in sich abgeschlossene Fortsetzung von Die Seepriesterin und führt die Leserin und den Leser tiefer in die Magie und die Geheimnisse des Tantra, praktiziert von einer geheimnisvollen Frauengestalt: Morgan le Fay, hier verkörpert durch Lilith, die Ur-Frau, die genauso rätselhaft wieder auftaucht, wie sie verschwand. Nach ihrem geheimnisvollen Verschwinden blieb die Seepriesterin nicht im Grab liegen, ihre Seele beharrte darauf, aufzuerstehen und umherzuwandeln. Ihr Geist ging so beharrlich in dem Geist der Autorin spazieren, dass diese wie unter Zwang schrieb. Lilith nahm ihr die Geschichte aus der Hand und erzählte sie selbst, und so war die Autorin nur noch ihr Werkzeug. Lilith sieht sich als Priesterin der Großen Göttin Natur, verkörpert in Isis – und kann nach menschlichen Gesetzen göttliche Rechte beanspruchen. Sie lebt ihre eigene Art und Weise, aber nicht nur für sich, sondern auch für andere. Vielleicht wird sie Ihnen als Schattenfigur im Zwielicht des Geistes erscheinen, begleitet von Malcolm, den sie zu ihrem Priester ernannt hat ... Der faszinierende Folgeband für alle, die sich von der Seepriesterin und ihrem Geheimnis haben bezaubern lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dion Fortune
Mondmagie
Das Geheimnis der Seepriesterin
Mystic Fantasy
Aus dem Englischen übersetzt und neu bearbeitet von
Mara Ordemann
Smaragd Verlag
Bitte fordern Sie unser kostenloses Verlagsverzeichnis an:
Smaragd Verlag e.K.
Neuwieder Straße 2
56269 Dierdorf
Tel.: 02689.92259-10
Fax: 02689.92259-20
E-Mail: [email protected]
www.smaragd-verlag.de
Oder besuchen Sie uns im Internet unter der obigen Adresse und melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Originaltitel: „Moon Magic“
Erstauflage England 1956
© Smaragd Verlag, 56269 Dierdorf
Deutsche Erstausgabe Oktober 1990
Vollständig überarbeite Neuauflage Januar 2017
© Cover: marcel - fotolia.com
Umschlaggestaltung: preData
Satz: preData
ISBN (epub) 978-3-7418-8121-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, übernehmen wir für deren Inhalt keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Vorwort von Dion Fortune
Es heißt, wenn ein Schriftsteller eine bestimmte Situation vor Augen hat, dann wird er diese irgendwann zu Papier bringen.
Wie dem auch sei – als ich für meinen ersten Roman, „Die Seepriesterin“, die Figur der Vivian Le Fay Morgan erdachte, – oder Lilith Le Fay, wie sie sich gelegentlich selbst nannte – schuf ich eine Fiktion.
Im zweiten Roman, den Sie jetzt in Händen halten, hat sie sich weiterentwickelt und ist alles, nur keine Marionette in meiner Hand – im Gegenteil: Sie hat selbst die Regie übernommen. Und das ist gut so, denn Gestalten müssen lebendig werden, sonst bleibt der Roman Makulatur.
Jeder, der mit der Kunst der Schriftstellerei vertraut ist, kennt die Gefahr, dass der Autor von den Höhen des Erzählens in die Niederungen des Berichtens abstürzt oder die Höhen erst gar nicht erklimmt. Diese Gefahr ist in MONDMAGIE – DAS GEHEIMNIS DER SEEPRIESTERIN nicht gegeben, denn ich lasse sie für sich selbst sprechen.
Nach ihrem geheimnisvollen Verschwinden blieb die Seepriesterin nicht im Grab liegen, sondern ihre Seele beharrte darauf, aufzuerstehen und umherzuwandeln. Und ihr Geist ging so beharrlich in meinem Geist spazieren, dass ich diesen Roman wie unter Zwang geschrieben habe.
Eine klare Vorstellung von der Handlung hatte ich nicht. Sechsmal habe ich das Buch angefangen, und sechsmal fand es sich im Papierkorb wieder. Schließlich machten die verschmähten Kapitel den Umfang eines mittleren Romans aus. Ich wollte schon aufgeben, da geschah etwas Merkwürdiges: Lilith nahm mir die Zügel aus der Hand und erzählte die Geschichte selbst, und so war ich nur noch ihr Werkzeug. In der Terminologie des Romans ausgedrückt: Sie benutzte mich, wenn auch auf andere Weise als ihren Gegenspieler, Dr. Malcolm. Und so kann ich keine Verantwortung übernehmen, weder für die Geschichte, noch für die Personen – auch sie schufen sich selbst. Und glauben Sie mir: Das Ende der Geschichte hat mich selbst überrascht. Manch einer würde das Ganze als „automatisches Schreiben“ bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde. Ich meine eher, es geschah das, was die Hauptperson wollte. Wie dem auch sei – ich übernehme jedenfalls keinerlei Verantwortung – weder für die Geschichte selbst, und schon gar nicht für die Romanfiguren – sie schufen sich selbst.
Unter diesen Umständen ist es für mich außerordentlich schwierig, den Wert des Romans einzuschätzen. Ich halte ihn nicht unbedingt für ‚hohe Literatur‘, was auch immer das sein mag, wohl aber für eine psychologische Rarität. Zudem passieren seltsame Dinge, von denen ich nichts ahnte, bevor ich sie dann hier las.
Die Weltanschauung von Lilith Le Fay ist als heidnisch zu bezeichnen, aber sie ist eine Rebellin mit dem Hang, die Gesellschaft zu verändern. Unumwunden gebe ich zu, dass sich viel von mir in Lilith Le Fay wiederfindet, noch viel mehr hat jedoch nichts mit mir zu tun. Mag sein, dass sie mein Freud‘sches Unterbewusstsein wachgerüttelt hat. In einem Punkt unterscheiden wir uns allerdings gewaltig: Ich bin noch keine einhundertzwanzig Jahre alt – zumindest jetzt noch nicht.
Malcolm ist vielen Quellen entsprungen. Zu meiner Zeit kannte ich eine Reihe von Malcolms, und ich werde garantiert noch etliche kennenlernen, bevor ich mich, wie Lilith Le Fay, aus dem Staub mache und die Kraft, die mich trägt, zurückgenommen wird.
Vieles ist Fiktion, das Haus jedoch ist Tatsache; seine Türen sind vor meinen Augen geschlossen worden. Nie mehr werde ich es betreten, aber es bleibt ein geweihter Ort.
Diejenigen unter Ihnen, die diese Geschichte um des reinen Vergnügens willen lesen, kommen vielleicht nicht auf ihre Kosten, denn sie ist nicht zur reinen Unterhaltung geschrieben worden. Ich habe mich zu Liliths Handlangerin machen lassen, um herauszufinden, was es mit der Geschichte auf sich hat. Das Schreiben, wie in Trance vollbracht, war vielleicht sogar eine magische Handlung. Wenn es stimmt, dass das, was in der Fantasie heraufbeschworen wird, in der inneren Welt weiterlebt, dann frage ich mich, was ich mit Lilith Le Fay erschaffen habe? Was Malcolm betrifft, der kann in dieser Welt und der nächsten auf sich selbst aufpassen. Aber wer und was ist Lilith, und warum war sie immer noch lebendig, nachdem sie die Hülle der Seepriesterin abgestreift hatte, und was hat sie bewogen, erneut aufzutauchen und sich meiner zu bedienen? Habe ich mir eine dunkle Freundin geschaffen? Und wo ist sie jetzt, und was treibt sie?
Lilith sieht sich als Priesterin der Großen Göttin Natur und kann nach menschlichen Gesetzen göttliche Rechte beanspruchen. Das ist etwas, was ich nicht beurteilen kann. Ich weiß nur, sie lebt auf ihre eigene Art und Weise, aber nicht nur für sich, auch für andere wie mich. Vielleicht wird sie Ihnen als Schatten im Zwielicht des Geistes erscheinen, wer weiß…
Für so viele Menschen sind Konventionen und Gesetze, auch die ungeschriebenen, sinnlos und haben ihnen eher geschadet als genutzt, so wie es bei Malcolm der Fall war, und sind es bis zum heutigen Tag. Aber warum soll es für sie kein Entkommen in die Sphären der Traumwelt geben – dorthin, wo Lilith ihren Geliebten entführt hat?
Diese Fragen muss sich jeder selbst beantworten, denn so, wie Lilith für den lebensmüden Malcolm gesungen hat: „Vergessen sind die Wege des Schlafes und der Nacht!“, dürfen wir das Schlussgebet der Anrufungshymne leise wiederholen:
„Öffne die Pforte, die Pforte hat keinen Schlüssel
– die Pforte der Träume,
durch die Menschen zu dir gelangen.
Hüter der Ziegen,
oh antworte mir!“
Dion Fortune
***
Teil 1: Traum oder Wirklichkeit
1
In der imposanten Halle der Medizinischen Fakultät drängten sich die Menschen zur Preisverleihung. Auf dem Podium unter dem berühmten Fenster im Gedenken der Nächstenliebe des Gründers saßen in einem Halbkreis in Scharlachrot gekleidete Gestalten, die sich leuchtend von der dunklen Eichenpaneele im Hintergrund abhoben. Die Mützen der einzelnen Universitäten in Karminrot, Kirschrot, Magenta und verschiedenen Blautönen belebten die Farbskala noch mehr. Über den Bändern der Kappen tauchte eine Reihe Gesichter auf, Geiern oder Füchsen nicht unähnlich. In ihrer Mitte thronte der Vorsitzende, der soeben die Preise verliehen hatte. Unter der eindrucksvollen Zahl von Kopfbedeckungen, die so viele hervorragende Hirne behüteten, sah er relativ normal aus. Unten in der Halle starrte die dunkle Masse der Studenten gemeinsam mit ihren Freunden und Familienangehörigen hinauf zu dieser Kollektion Paradiesvögel.
„Mit der Haarfarbe sollte der nicht so eine bunte Mütze tragen“, meinte eine kleine alte Dame, offensichtlich vom Land, zu dem plumpen Grünschnabel an ihrer Seite, der ein Diplom hätschelte, das ihm die Erlaubnis gab, von jetzt an seinen Mitmenschen das erdenklich Schlimmste anzutun.
„Er hat keine Wahl. Es ist die Studentenkappe seiner Universität.“
„Dann sollte ein Mann mit der Haarfarbe eine andere Universität mit seiner Gegenwart beehren.“
Die Mischung aus Magenta und Scharlachrot war sicherlich eine unglückliche Kombination für einen rothaarigen Mann, aber das kantige Gesicht mit den granitgrauen Augen unter dem zurückgekämmten roten Haar, dessen Schläfen bereits Geheimratsecken zierten, starrte gleichgültig und dumpf in die Gegend.
„Er sieht aus wie ein Metzger“, sagte die kleine alte Dame. „Stimmt! Er ist einer unserer Ärzte.“
„Von dem möchte ich aber nicht kuriert werden!“
„In seiner Abteilung wird nicht ‚kuriert’!“
„Was dann?“
„Nichts. Jedenfalls nicht kuriert. Manchmal können die Chirurgen kurieren, manchmal nicht. Er sagt ihnen, ob man operieren kann oder nicht. Er ist der Einzige, von dem sie Anordnungen akzeptieren. Wenn er sagt, „tu es“, tun sie es; und wenn er sagt, „lass es“, dann lassen sie es.“
„Ich hoffe nur, er lässt mich“, meinte die kleine alte Dame. „Das hoffe ich auch, Mutter“, sagte der freche Sohn mit einem Glucksen und nahm sich vor, sich den Witz für den Gemeinschaftsraum der Studenten aufzuheben.
Die Hymne ,God save the Queen‘ brachte die Veranstaltung zum Abschluss. Das Objekt ihres Interesses nahm seine Position am äußeren Rand des Halbkreises wahr und schlüpfte vom Podium, dem Gedränge seiner Kollegen zuvorkommend.
Das Ende der Tribüne, wo er gesessen hatte, bildete das äußere Ende des Ankleideraums, und so fand er sich in dem Durchgang wieder, der zum Speisesaal führte, immer noch in seinem farbenfrohen Aufzug und inmitten eines Meeres von Menschen, die auf der Suche nach Erfrischungen hereinschwappten. Die Menge hatte ihn gegen eine kleine alte Dame gedrückt, die ihn mit demselben unpersönlichen Interesse anstarrte, das den Horse Guards, die in Whitehall Wache schieben, zu eigen ist.
Eine solche Aufmerksamkeit nicht gewöhnt, hielt er sie für eine ehemalige Patientin.
„Guten Tag, wie geht es Ihnen?“, fragt er mit einem kurzen Nicken.
„Sehr gut, danke“, antwortete sie mit dünner, etwas verwunderter Stimme. Offensichtlich hatte sie nicht erwartet, angesprochen zu werden.
„Meine Mutter“, sagte der junge Mann neben ihr.
„Huh“, sagte der ältere Mann unfreundlich und zog plötzlich, zur Verwunderung aller Anwesenden, seine riesige Robe aus und stand in Hemdsärmeln da, wickelte die wunderschönen Kleider zu einem Bündel und drückte sie dem erstaunten Studenten in die Hände.
„Bring sie in den Gemeinschaftsraum für die höheren Semester, ja?“, sagte er, und bahnte sich, gnadenlos seine Ellbogen gebrauchend, einen Weg durch die Menge.
„Was für ein komischer Kerl!“, sagte die kleine alte Dame.
„Du kannst es dir leisten, komisch zu sein, wenn du einen Ruf hast wie er“, sagte ihr Sohn.
„Ich glaube nicht, dass ich ihn mag“, sagte sie. „Niemand mag ihn“, sagte ihr Sohn, „aber wir vertrauen ihm.“ Zwischenzeitlich eilte das Objekt ihrer Missbilligung einen Aufgang hinauf, drei Steinstufen auf einmal nehmend, stürzte in ein leeres Labor, riss eine alte Tweedjacke vom Haken und flüchtete, unpassend gekleidet und hutlos, durch eine Seitentür in einen dunklen viereckigen Hof. Er überquerte ihn mit schweren Schritten, sodass eine Schwester aus einem Krankenzimmer hinausschaute, und fügte ein weiteres Stück der Legende über die Exzentrizität des berühmten Dr. Malcolm hinzu. Dann ging er blicklos weiter, durch Hinterstraßen bis zur U-Bahn-Station. Dort angekommen, stieß er einen Fluch aus – sein Notizbuch mit Brieftasche und Zeitkarte steckte in der Brusttasche des Jacketts, das er im Ankleideraum gelassen hatte. Das Sammelsurium in seinen Hosentaschen brachte drei Kupfermünzen zum Vorschein.
Er war zu ungeduldig, um ins Krankenhaus zurückzukehren. Das Wetter war außergewöhnlich mild für die Jahreszeit, und so beschloss er, zu Fuß am Themse-Ufer entlang zu seiner Wohnung in der Grosvenor Road zu gehen, keine große Entfernung für einen so energiegeladenen Mann, wie er es war.
Über Kopfsteinpflaster nahm er seinen Weg hinter Lagerhäusern, kletterte über den Stützpfeiler eine Brücke hinauf und gelangte schließlich zum Kai.
Es hatte geregnet: Die Gestalten, die sich sonst bei Dämmerung am Themse-Ufer herumtrieben, hatten Zuflucht in Obdachlosenheimen und bei der Heilsarmee gefunden. Zu dieser Stunde gab es nur wenige Fußgänger, und er hatte das breite Pflaster am Ufer praktisch für sich allein.
Während er in dem für ihn üblichen schnellen Tempo ausschritt, genoss er nach der stickigen Hitze der großen Halle, in der er einen langweiligen Nachmittag verbracht hatte, die frische, vom Regen gereinigte Luft. Er beobachtete den Schimmer der Lampen auf dem Wasser und das Auf und Ab der Lichter der vertäuten Boote. Ein Schlepper mit Kähnen mühte sich stromaufwärts, flussabwärts tuckerte eine Barkasse der Wasserpolizei.
Während der Mann – eine Weile die große Stadt, das riesige Krankenhaus und die tägliche Tretmühle der Routine zwischen der Wimpole Street und den Slums vergessend – den Fluss beobachtete, ging das vertraute Leben auf dem Strom weiter.
Für ihn typisch, hielt er so plötzlich an, dass ein anderer Fußgänger, der direkt hinter ihm ging, beinahe über ihn gestürzt wäre.
Die Ellbogen auf die Steinmauer gelehnt, folgte er in seiner Fantasie dem Lauf des Stroms, vorbei an den Docks und Ladestellen, und fragte sich, was geworden wäre, wenn er seinem ersten Impuls nachgegeben und die Laufbahn eines Seemanns eingeschlagen hätte. Dann wäre er jetzt Schiffsoffizier auf Wache – ein schlecht bezahlter, harter, unbequemer Job. Sein jetziger Job war auch hart, weil er sein eigener Sklaventreiber war, aber er war nicht schlecht bezahlt, und die Arbeit lag ihm.
Aber das sagte nicht wirklich etwas aus, denn er war kein Mann, der die Gabe hatte, sich und seiner Umgebung das Leben angenehm zu gestalten. Seine Frau, seit der Geburt ihres Kindes im ersten Ehejahr pflegebedürftig, lebte in einem Seebad, wo er sie häufig an den Wochenenden besuchte. Diese Besuche waren von ihr gefürchtet und von ihm gehasst. Aber als ein Mann mit unbeugsamem Pflichtgefühl fuhr er Jahr für Jahr zu ihr, bis sein feuerrotes Haar von grauen Strähnen durchzogen und lichter wurde, und sein Naturell etwas abkühlte. Er gratulierte sich zu seiner Selbstbeherrschung.
Die Jahre des Zölibats waren nicht leicht gewesen. Von Natur aus treu und aufrichtig, war die Vorstellung einer Liaison mit einer anderen Frau für ihn Horror. Außerdem war er stolz auf seinen starken Willen, der ihm die perverse Freude bereitete, mit seinen eigenen Dämonen, wilden Tieren gleich, zu kämpfen. Je mehr die Natur versuchte, die Tür zu seinem Moralkodex aufzustemmen, desto mehr klemmte sie. Ethisch war das Ergebnis bewundernswert, aber es hatte weder seine Laune versüßt, noch ihn zu einem angenehmen Kollegen oder Lebensgefährten gemacht. Rote Haare und Verdrängung passen nicht gut zusammen, und rastlose Reizbarkeit war der Lohn für seine Moral. Außerdem schlief er schlecht, und nur seine Vitalität und seine gesunde Natur brachten ihn durch das Semester.
Seine Studenten hassten ihn, denn er schikanierte sie und trieb sie unerbittlich an; andererseits konnte er einen hitzigen Streit mit einem Kollegen vom Zaun brechen, der einem seiner Schüler eine schlechte Note verpasst hatte. Und weil er ein Pedant war, mochten ihn auch die Schwestern nicht; dennoch würde er notfalls für sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Mit seinem brüsken, harschen Benehmen erschreckte er die Patienten, schonte aber weder sich noch das Krankenhaus, um ihnen zu helfen. Ein großer Teil seiner Arbeit bestand darin, den an einer organischen Krankheiten Leidenden die Hysterie auszutreiben, und es trug nicht gerade zu seiner ohnehin dürftigen Popularität bei, wenn er dem notorischen Gelähmten sagen musste: „Steh auf, nimm dein Bett und wandle.“
Jahr für Jahr kampierte er in möblierten Zimmern, in denen sich Bücher, Papiere und Proben in verschiedenen Konservierungsstadien häuften. Seine Wirtin durfte ihn nach ihrem Gusto bekochen und sein Schneider ihn nach seiner hochgeschätzten Modeauffassung kleiden. Sein Leben war nur ein halbes Leben, aber die Hälfte, die er lebte, war ein Segen für andere. Wenn dieser Mann, der nie ein Skalpell in die Hand nahm, neben dem Chirurgen stand und diesen zu der Stelle im Gehirn führte, wo sich die Wurzel allen Übels eingenistet hatte, das in so vielen grotesken und bizarren Auswüchsen in Erscheinung trat, wurden der Blinde, der Hinkende, der Taube, der Epileptiker, der Geisteskranke – sie alle wurden von ihren Zwängen befreit und kehrten zu einem normalen Leben zurück. Was er über die Funktionsweise des Hirns nicht wusste, war es nicht wert, gewusst zu werden. Über das Gehirn selbst wusste er wenig.
Während er jetzt forsch neben dem dunkel dahinströmenden Wasser ausschritt, fragte er sich, warum er bisher nie diesen Weg der überfüllten U-Bahn vorgezogen hatte. Auch der Gedanke an ein eigenes Auto war ihm in den letzten Jahren nie gekommen; ein Auto war Unsinn, zumal die Parkplätze am Krankenhaus von den Nobelkarossen der Studenten belegt waren, die sie sich zwar nicht leisten konnten, aber glaubten, diese für ihr Prestige zu brauchen. Er, der alles Prestige der Welt besaß, nahm für Hausbesuche ein Taxi.
Er ging gerne spazieren. Wenn er seine Frau besuchte, verbrachte er den Tag mit einem ausgedehnten Marsch über die Hügel. Abends, von der frischen Luft und der ungewohnten Anstrengung erschöpft, schlief er in einem Sessel vor dem Feuer ein. Die Ironie all dessen wurde ihm nie bewusst. Mehrfach hatte er eine Wandertour ins Auge gefasst, aber es gelang ihm nie, Urlaub zu machen. Stattdessen arbeitete er im August, wenn das Krankenhaus knapp besetzt war, für drei. Andere Interessen als seinen Beruf hatte er nicht, und Entspannung suchte er nur bei der Lektüre internationaler Fachliteratur.
Ein hartes, freudloses Leben, dessen Widersinn ihm nicht bewusst wurde. Da es in seinem Fachgebiet nur wenige Therapiemöglichkeiten gab, bestand der größte Teil seiner Arbeit aus Diagnostik. Früher einmal hatte er – für seine Kollegen unvorstellbar – über seine Fälle reflektiert, aber in den letzten Jahren die Taten Gottes mit gewisser Philosophie akzeptiert, indem er eine Diagnose und eine Prognose herausbellte und dann die Angelegenheit aus seinem Kopf verbannte, ausgenommen bei Kindern.
Manchmal hatte er daran gedacht, sich zu weigern, Kinder zu untersuchen, aber das war in diesem Krankenhaus nicht möglich, wo er alles nehmen musste, was kam. Kranke Kinder belasteten ihn. Wenn er die ersten zarten Anzeichen einer Erkrankung bei einem Kind entdeckte, stand dessen Zukunft so klar vor seinen Augen, dass ihn das Bild tagelang verfolgte. Und was war die Folge? Sein Verhalten gegenüber Kindern war noch ungeschickter. Das schreiende Kind, die ungehaltene Mutter und die angewiderten Studenten boten ein unerträgliches Bild, zumal die Meinung herrschte, dass es für seine Prognose weder vor Gott noch vor Menschen eine Rechtfertigung gab. Wenn er sagte, ein Kind wächst als Krüppel auf, dann würde es als Krüppel aufwachsen. Er behauptete das so souverän, dass es wie ein Urteil klang.
Genauso wie über Krankenhauskorridore – wo er es den Krankenpflegern und Schwestern überließ, ihm mit den Betten und Tragen auszuweichen,– stürmte er jetzt am Themse-Ufer entlang. Es gab keinen Fußgänger, den er nicht überholte.
Plötzlich bemerkte er vor sich einen Schatten. Ständig dasselbe Tempo haltend, gelang ihm ein Überholmanöver nicht. Er musste die Gestalt unbewusst wahrgenommen haben, denn als er sie bemerkte, wurde ihm klar, dass er ihr bereits eine beträchtliche Weile gefolgt war, und während ihm dies dämmerte, begann seine Fantasie zu arbeiten. Die Szene ähnelte einem Traum, der ihn in den letzten Jahren verfolgte, wenn er überarbeitet war, und diese Träume führten zu noch schlechterem Schlaf. Malcolm lag dann in einem seltsamen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, nicht weit genug weg, um wieder in seinen Traum einzutauchen, und nicht wach genug, um ihn als Traum zu realisieren. Immer wieder glitt er über die Schwelle und kehrte zurück, manchmal im Reich des Schlafs wandelnd, manchmal die schattenartigen Szenen mehr oder weniger bewusst wie einen Film im Kino anschauend.
Gleichbleibend spielten diese Träume an Land und auf See, und sehr oft verbanden sich Land und See, was er auf seine Wanderungen über die Hügel während der Besuche bei seiner Frau zurückführte. Nie tauchten in diesen Szenen Menschen auf, mit einer Ausnahme: Eingehüllt in einen Mantel mit einem breitkrempigen Hut erschien eine Gestalt, die er auf eine Portwein-Werbung zurückführte, in den farbigen Lichtern, die auf einem Gebäude an- und ausgingen, wenn er zwischen seinen Behandlungsräumen in der Wimpole Street und seiner Wohnung im Pimlico-Viertel pendelte.
Obwohl Psychologie für ihn eine untergeordnete Rolle spielte und er sie nur für seine medizinischen Diagnosen als Unterscheidungshilfe verwendete, hatte er seine theoretischen Kenntnisse in seiner eigenen Sache in der Praxis umgesetzt, indem er einen Teil der Traumsymbole auf die mit Bungalows bestückten Hügel hinter der Stadt an der See zurückführte und die anderen auf die Reklame für Sandeman Portwein, die ihm oft genug begegnet war. Er schrieb das seiner unterdrückten Sexualität zu, eine gute Erklärung für die meisten respektablen Bürger, und für einen Akademiker seines Formats geradezu ein Indiz. Das andere Symbol erklärte er mit dem unbewussten Wunsch nach dem so malerisch angebotenen Stimulans – der sehr verständliche Wunsch eines überarbeiteten Mannes. Warum sollte er sich Gedanken machen? Beide Wünsche wurden ohne den geringsten Kompromiss unterdrückt, und selbst einem Mann wie Dr. Rupert Annesley Malcolm, Neurologe und Endokrinologe, war klar, dass sie sich durchaus in seinen Träume breit machen könnten. Dass es mehr sein könnte – darauf würde er nie kommen.
Die in einen Mantel gehüllte Traumgestalt, die vor ihm in der Dämmerung über das nasse Londoner Pflaster wandelte, wie sooft zuvor in den Landschaften seiner Träume, regte seine Fantasie an. Natürlich wusste er, dass es eine Frau in einem Regenmantel war, aber dennoch – die Begegnung mit der nun objektiv wahrgenommenen Fantasie seines Unterbewusstseins entzückte ihn.
Die Gestalt schritt nach wie vor etwa zwanzig Meter vor ihm zügig aus. Dr. Malcolm beschleunigte seinen Schritt, aber es gelang ihm nicht, den Abstand zwischen sich und der Gestalt, die er jetzt geradezu verfolgte, wahrnehmbar zu verringern.
Sein nächster Impuls war loszurennen, aber das würde der Aufmerksamkeit eines Hüters von Gesetz und Ordnung nicht entgehen, und er hatte kein Verlangen danach, vor ein Polizeigericht zitiert zu werden, wo man seiner Erklärung, nur einen Traum analysiert zu haben, kaum Glauben schenken würde.
Malcolm war ein Mann, der für Frauen keine Verwendung hatte, und bei den Frauen war das umgekehrt, soweit ihm bekannt war, genauso.
Obwohl sich allmählich der Abstand zwischen ihm und der Frau vor ihm verringerte, war es höchst unwahrscheinlich, dass er sie einholen würde, selbst wenn ihm die Ampeln wohlgesonnen wären. Dr. Malcolm strengte sich noch mehr an, denn er wollte wenigstens einen Blick in ihr Gesicht werfen. In diesem Moment sah er eine Polizistin, die in ihrer unkleidsamen Uniform genauso aussah wie Mrs. Noah, und ihn argwöhnisch betrachtete.
Und dann geschah genau das, was er befürchtet hatte – die Ampel sprang auf Rot; der frei gelassene Verkehr ergoss sich über die Brücke, und die Gestalt in dem Mantel tauchte in der Londoner Dämmerung unter und ließ ihn mit einem unerklärlichen Gefühl der Enttäuschung, des Verlusts, ja, der Leere zurück.
Fünf weitere Minuten in gemütlicherer Gangart brachten ihn zu seiner Wohnung in die Grosvenor Road, die er, weil preiswert, in der Zeit gemietet hatte, als er versuchte, in seinem Beruf Fuß zu fassen, und die er aus Gewohnheit, Gleichgültigkeit und mangelnder Initiative behalten hatte. Sie war unordentlich, aber gemütlich. Er kleidete sich aus und frottierte sich ab, denn bei den Strapazen in der Schwüle des Abends war er stark ins Schwitzen gekommen. Wieder wunderte er sich über die Geschwindigkeit, mit der sich die Frau bewegt hatte.
Später im Bett fragte er sich, ob die ungewöhnliche Ermüdung durch den langen Heimweg ausreichen würde, die Gestalt in die Landschaft seines Traums zu holen, in der er in den vergangenen zwei Wochen nahezu Nacht für Nacht herumgewandert war. Aber ausgerechnet an diesem Abend glitt er in einen normalen Schlaf. Es war, als hätte sich die angestaute Langeweile seines freudlosen Lebens in dem enormen Interesse an der Gestalt einer unbekannten Frau im Schatten der Dämmerung gelöst.
Das Semester war vorbei, und so fuhr er am nächsten Tag zu seiner Frau. Die arme Seele hatte jedoch einen ihrer schlechten Tage und wünschte alles – nur nicht seine Gesellschaft.
Also war er frei für seine üblichen Wanderungen über die Hügel. Bei Einbruch der Dämmerung kehrte er erschöpft zu der roten Ziegelvilla zurück, denn er war länger als sonst unterwegs gewesen. Das rettete ihn vor einem Abendbrot mit seiner Frau und ihrer Betreuerin. Man hatte Sandwiches und eine Flasche Milch neben den Kamin in seinem Schlafzimmer gestellt, aber die Sandwiches waren so trocken, dass sie sich an den Ecken bogen. So überließ er sie ihrem Schicksal und trank nur die Milch, um bald darauf im Korbstuhl neben dem Feuer in einen unruhigen Halbschlaf zu fallen.
Der Stuhl war unbequem, außerdem knarrte er im Takt seines Atems, was ihn störte. Trotzdem stellte sich das ein, was ihm die ganze Woche versagt geblieben war: der Traum, und allen Versuchungen, sich zu bewegen und aufzustehen, trotzend, beobachtete Malcolm, wie sich die Bilder auf der Schwelle zum Schlaf bildeten, wieder auflösten und erneut in immer deutlicheren Formen entstanden.
Zuerst waren es Fetzen aus dem Alltag: seine Hauswirtin; die Putzfrau im Labor des Krankenhauses; die Betreuerin seiner Frau; das ältliche Mädchen, halb Schwester, halb Haushälterin. Er wartete geduldig, wohlwissend, dass es der übliche Trick seines Verstandes war, sich von oberflächlichen Eindrücken zu befreien, bevor sich die tieferen Schichten öffneten. Ein Rest seines bewussten Verstandes, durch wissenschaftliches Training geformt, beobachtete eine Prozession ältlicher, einfacher und geschlechtsloser Wesen. Dann tauchte die Polizistin vom Themseufer auf, und seine Hoffnungen stiegen; aber sie reihte sich nur in die Prozession ein.
Geräusche auf dem Treppenabsatz rissen ihn hoch, und er hörte durch die offene Schlafzimmertür die quengelnde Stimme seiner Frau. Offensichtlich hatte sie wieder eine schlechte Nacht. Sollte er nach ihr sehen? Aber aus der Vergangenheit wusste er, dass es sie aufregen würde. Ihr eigener Arzt war zuständig; von ihm würde er hören, was los war, und er würde alles für die unglückliche Frau tun, die sich zwischen Bett, Couch und ihrem Rollstuhl bewegte, seit ihr Versuch, sein Kind zur Welt zu bringen, gescheitert war.
Die leichte Störung hatte gereicht, ihn kurzfristig von der lähmenden Müdigkeit zu befreien, die durch den langen Tag im Freien entstanden war. Er zündete sich eine Zigarette an und starrte ins Feuer. Seine Erinnerung ging zurück zu der Nacht vor zwanzig Jahren, die das lebhafte kleine Ding, das er geheiratet hatte, in eine neurotische, korpulente, halb gelähmte Matrone verwandelt hatte. Er haderte nicht mit dem Schicksal, das hatte er lange hinter sich; er saß nur dort, die Zigarette zwischen den vom Tabak gelben Fingern, und dachte darüber nach.
Unverständlicherweise gab er sich selbst die Schuld, wie nach einem groben Fehler bei einer Diagnose. Sie beide hatten das Kind, das das Chaos hervorgerufen hatte, sehnlichst herbeigewünscht, aber das schien keinen Unterschied zu machen. Letztendlich lag die Schuld bei ihm; ohne ihn hätte es kein Kind gegeben – die Logik war unausweichlich. Aber es war verfänglich, in der Vergangenheit zu wühlen, ein Luxus, der seinen Preis forderte und zu Tagen voller Depression führte. Nur eine strenge Kontrolle des Verstandes und der Fantasie konnte seine inneren Dämonen, die wilden Tiere von Ephesus, in Schach halten. Diesen Kniff hatte er vor Jahren entdeckt, und es hatte ihn gewundert, dass seine Kollegen in der Psychiatrie ihm nie auf die Schliche gekommen waren.
Er rief seine Gedanken von diesem gefährlichen Thema zurück und erinnerte sich an das Bild des Themse-Ufers an einem milden nassen Winterabend, an dem die letzten Blätter der Platanen auf dem Pflaster Muster bildeten und der Fluss schnell und dunkel und voller Strudel vorbeiströmte. Er erlebte diesen Moment erneut in lebhafter Vorstellung, ging weiter und weiter zurück bis zu seiner Promotion. Er sah die Szene der Preisverleihung, die Studenten, die ihre Diplome in Empfang nahmen, übermütig und schlurfend, unreife Jungs, mit einer Verantwortung belastet, die viel zu groß war, als dass sie von einem menschlichen Wesen hätte getragen werden können, und fragte sich, wie vielen von ihnen er zugetraut hätte, eine Mausefalle aufzustellen, geschweige denn, ihnen Leben und Tod anzuvertrauen. Eine Fehleinschätzung seines Professors für Geburtshilfe hatte zu dem Wrack im Raum nebenan geführt.
Erneut ging er in Gedanken zurück und dachte an das verwunderte Gesicht der kleinen alte Dame, die er irrtümlich für eine Patientin gehalten hatte, und den grinsenden Gesichtsausdruck ihres Sohnes, dem gewisse Hintergründe seiner Fachrichtung bekannt waren, die zu routinemäßigem Ausschluss führten; und ihm fiel ein, wie der Professor für Geburtshilfe, als Entschuldigung für sein Versagen, auf einige Fälle mit einer Prädisposition für das Unglück hingewiesen hatte, das durch seinen eigenen Mangel an Vorsicht entstanden war, und mit Bitterkeit dachte er an die Ideale und die Selbstdisziplin seiner Jugend und seiner frühen Männlichkeit, die ihm weder Demütigung noch Selbstvorwürfe erspart hatten.
Erneut zwang er seine Gedanken unter Kontrolle und wanderte im Geist zurück zum Fluss, dem Themse-Ufer und der schattenhaften, dahineilenden Gestalt, die er, in Erinnerung an ein vergessenes Schulbuch, „winkende Fee“ nannte, obwohl sie weiß Gott nicht gewunken hatte, und er entrüstet gewesen wäre, wenn sie es getan hätte. Außerdem wäre dies höchst problematisch gewesen, selbst wenn sie einigermaßen passabel ausgesehen hätte.
Er malte sich aus, ihr nachzugehen wie an jenem Abend; dieses Mal aber ohne ein Gefühl der Eile oder des Misslingens, sondern nur in der schnellen mühelosen Bewegung des Traums. Das Themse-Ufer und die Lichter verschwanden, und er war wieder in der weiten Landschaft des Schlafs, farblos wie mattes Silber in einem Licht, das es weder an Land noch auf See gab.
Aber es war keine Vision; die Gestalt war verschwunden. Indem er sich verzweifelt an die Schwelle des Schlafs klammerte, versuchte er bewusst, sich in die Landschaft voller Schatten zu drängen, aber sie entglitt ihm und drohte, sich in einen Albtraum zu verwandeln. Dann wurde der Bann durch die Stimme der Betreuerin, die in der Halle telefonierte, gebrochen, und er war wieder voll da.
Das Geräusch eines Autos, Schritte auf den Stufen, Gemurmel im Schlafraum nebenan, aber er bewegte sich nicht. Als sich die Schlafzimmertür erneut öffnete und er auf dem Treppenabsatz schwere Schritte hörte, stand er mit den lässigen Bewegungen einer Katze auf, öffnete die Tür und winkte seinem Kollegen schweigend, hereinzukommen. Im dumpfen Glanz des verlöschenden Feuers sahen sich die zwei Männer an. Malcolm wäre nie auf die Idee gekommen, das Licht anzuzünden.
Der andere kannte den Ehemann seiner Patientin seit Jahren, und er kannte auch die vielen winzigen, verschrobenen Verhaltensweisen, denen er unbewusst huldigte. In der Dunkelheit nahm er schwach die blassen Umrisse des kantigen harten Gesichts wahr, mit der hohen Linie des zurückgekämmten Haars und dem Glitzern der scharfen blassen Augen, die wie die Augen einer Schlange funkelten, zum Kampf bereit. Auf dem Sprung bleiben, das schien die außergewöhnliche Fähigkeit Malcolms zu sein, und jetzt, um zwei Uhr früh in dem abgedunkelten Raum, in dem er offensichtlich gedöst hatte, war er so wachsam wie immer.
„Nun?“, fragte Malcolm, über die gesellschaftlichen Gepflogenheiten eines Smalltalks hinweggehend.
Auch Dr. Jenkins war daran gewöhnt. „Nichts Ernstes“, antwortete er. „Hauptsächlich die Nerven, aber das beeinflusst natürlich das andere. Wenn Sie erlauben, dass ich so offen spreche – ich glaube, Ihr Besuch hat sie aufgeregt, was meistens jedoch erst zum Ausbruch kommt, wenn Sie wieder weg sind. An Ihrer Stelle würde ich meine Besuche auf ein Minimum beschränken – Weihnachten, Geburtstag, Hochzeitstag usw., – Sie verstehen?‘‘
„Sehr gut“, sagte der andere kurz angebunden, „ich werde das tun, was Sie mir raten.“
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, ging Dr. Malcolm zu seinem Stuhl am verlöschenden Feuer zurück und fragte sich, warum Jenkins erst jetzt vorgeschlagen hatte, ihm sein monatliches Fegefeuer zu ersparen.
Als er am nächsten Morgen gehen musste, lag Mrs. Malcolm immer noch in betäubtem Schlaf. Er wechselte mit der Betreuerin ein paar Worte. Seine Erklärungen nahm sie mit einer so devoten Dankbarkeit auf, dass er einen scharfen Stich verspürte, zumal er sich kaum bemüht hatte, bei seinen Besuchen eine angenehme Atmosphäre zu verbreiten.
Als er auf seiner Rückreise in die Stadt aus dem Zugfenster starrte, fragte er sich, ob er etwas versäumt oder getan hatte, dessen er sich schämen müsste. Schließlich gab er die Grübelei auf und fuhr zurück zum Krankenhaus, wo die Studenten wie aufgescheuchte Hühner um ihn herumflatterten, und ein Angestellter der Klinik aus reiner Nervosität seinen Bleistift fallen ließ und alle Papiere durcheinanderbrachte. Den Patienten erging es besser, aber nicht viel, und nach einem für alle Beteiligten anstrengenden Vormittag schnappte er sich vom Buffet an der U-Bahn-Station eine Tasse Kaffee und ein Sandwich und ging in seine Praxis in der Wimpole Street, wo sich die Routine des Vormittags mit einigen Variationen wiederholte. Einige seiner Kollegen brüsteten sich, ihre Krankenhauspatienten bekämen genau dieselbe Behandlung wie ihre Privatpatienten. Für Dr. Rupert Malcolm war das selbstverständlich. Er konnte für keinen von ihnen mehr tun, als er tat, aber es war charakteristisch für ihn, dass er es genau in derselben Art und Weise tat. Ein Prinz musste aus seinen Kleidern mit derselben Schnelligkeit herausschlüpfen und wieder hinein wie der Sozialhilfeempfänger, und er nahm von der Prinzessin wie von der Reinmachefrau gnadenlos dasselbe Honorar – trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft. Eins allerdings verband beide: Sie zahlten nur widerstrebend.
***
2
Die einzige Entspannung, die sich Rupert Malcolm gönnte, bestand darin, vor einer Gesellschaft von Gelehrten Vorlesungen über sein eigenes Fachgebiet oder verwandte Gebiete zu halten oder als Zuhörer teilzunehmen, und da er jedes Mal verschwand, wenn der gelehrige Teil der Veranstaltung vorbei war und der gesellige begann, war die Zeit, in der er sich eine Entspannung gönnte, nur minimal. Sein brüskes „unmögliches Benehmen“ und sein hartes ausdrucksloses Gesicht machten es jedoch unwahrscheinlich, dass es sich für ihn, wäre er wirklich geblieben, gelohnt hätte.
Krönung des langen Tages nach der Rückkehr vom Seebad war ein Abend der ‚Erbauung‘ der Gelehrten untereinander. Er verließ die Gesellschaft früh, aber nicht zu früh, um nicht gegen die Etikette zu verstoßen, nahm ein Taxi zu seiner Wohnung und kletterte müde die über einhundert Stufen zum Dachgeschoss hinauf.
Seine jetzige Wirtin war die Nichte der früheren. Am Ablauf hatte sich nichts geändert. Gelegentlich drohte sie, seine Zimmer aufzuräumen, zog sich jedoch beim Anblick seiner finsteren Miene verschüchtert zurück und begnügte sich damit, die Wände seiner Wohnung während seines Aufenthalts an der See neu zu streichen.
Ohne sich umzuschauen, betrat er seine schmuddelige, altmodisch eingerichtete Wohnung, warf Hut und Aktentasche auf den Tisch und den Mantel hinterher, ließ sich in den abgenutzten Ledersessel neben der Feuerstelle fallen, brachte das heruntergebrannte Feuer mit der Spitze des Schuhs wieder zum Glühen, blieb dort sitzen und starrte in die Flammen. Seit er den Zug verlassen hatte, sein ungelöstes Problem mit sich herumschleppend wie einen schweren Koffer, war es der erste Augenblick, in dem er Muße für seine Gedanken hatte.
Er war erstaunt, dass seine Erlösung von dem, was er immer als eisern zu erfüllende Pflicht angesehen hatte, ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. All die Jahre seiner Ehe, die keine Ehe gewesen war, hatte ihn der Glaube hochgehalten, seine Frau bedürfe seiner Hilfe. Jetzt musste er feststellen, dass er einem Irrtum aufgesessen war. Statt Erleichterung zu verspüren, fühlte er sich wie ein verlorener Hund. Der Mann, der die wenigen vernünftigen Worte in dem vom Feuer erhellten Raum ausgesprochen hatte, ahnte nicht im Geringsten, welche Wirkung diese Worte auf den anderen gehabt hatten. Kein Schwanken in der Stimme, kein Zucken des Mundes hatte ihn verraten; derselbe granitharte Gesichtsausdruck wie immer.
Dennoch, ein Lebensabschnitt war zu Ende, und er musste Mittel und Wege finden, einen neuen zu beginnen. Rupert Malcolm fühlte sich steuerlos, haltlos, jedem Sturm ausgesetzt. Der Ehrenkodex, den er sich selbst geschaffen hatte, verlangte von ihm immer noch Nibelungentreue, aber er wusste auch, alles, was die kranke Frau in dem Seebad von ihm verlangte, waren die Bequemlichkeiten, die ihr sein Einkommen problemlos bescherten. Von dem Mann wollte sie nichts – außer in Ruhe gelassen zu werden. Ihre emotionalen Bedürfnisse wurden von ihrem kleinen Hund, ihren Wellensittichen und ihrer treuen Betreuerin erfüllt. Wenn eines der Tiere starb, wurde es ‚ersetzt‘, und das Leben in dem freundlichen sonnigen Haus an der See ging nach kurzem tränenreichem Zwischenspiel unverändert weiter. Der einzige störende Faktor – er – war beseitigt worden, und er konnte sich vorstellen, wie die beiden Frauen ihr gewohntes Abendlied sangen:
„Jetzt danken wir alle unserem Gott.“
Weil ihn das vorhanglose Fenster irritierte, ging er durch den Raum und zog den staubigen grünen Vorhang vor. Den zweiten Vorhang haltend, verharrte er und sah hinaus in die vom Lichtbogen erhellte Nacht und auf den trüben Fluss. Direkt gegenüber seinem Viertel, auf der anderen Seite des dunklen Wassers, mündete eine Sackgasse in die Uferstraße, und an ihrem Ende konnte er etwas sehen, das ihm zuvor nie aufgefallen war – die erleuchtete Fassade einer kleinen Kirche. Er erkannte die runden Umrisse des Westfensters. Ob das farbige Glas ein fantasiereiches religiöses Motiv oder das unifarbige Glas ein einfaches Motiv darstellte, konnte er nicht erkennen. Er stand dort, den Vorhang in der Hand, starrte hinüber und fragte sich, welche Konfession ihre Anhänger mitten in der Nacht dorthin gelockt hatte. Er vermutete, die katholische; Protestanten erfüllten ihre religiösen Pflichten im Laufe ihres Acht-Stunden-Tages.
Während er auf die erleuchtete Fassade starrte, hinter der er Menschen vermutete, die ihren Schöpfer anbeteten, dachte er darüber nach, dass jeder in der Religion alles finden könnte. ,Es muss für sie doch etwas dabei herausspringen, sonst würden sie nicht so daran hängen.‘ Aber was das sein könnte, lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Dann verlosch drüben das Licht, er nahm es als Zeichen und ging zu Bett, wo er wieder in dem silbergrauen Land zwischen Schlafen und Wachen umherwanderte, aber dieses Mal ohne Begleitung.
Die Vorstellung, alle Wochenenden nach seinem Gusto zur freien Verfügung zu haben, gab Malcolm ein vages Gefühl von Freiheit und Erleichterung. Weil er die Wanderungen über die Hügel vermisste, dachte er daran, die Wochenenden aufs Land zu fahren, aber irgendetwas hinderte ihn daran. Weder wusste er, wohin er gehen, noch was er tun, noch wie er es anstellen sollte – und so fiel er zurück in einen Trott, der langweiliger war als je zuvor. Der Versuch, einen modernen Roman zu lesen, scheiterte. Es war besser, schlafende Hunde nicht zu wecken.
Ein Besuch in der Nationalgalerie endete damit, dass er die Nackten auf ihr hormonelles Gleichgewicht hin untersuchte. Schließlich fasste er den Entschluss, sein Leben weiterzuführen wie bisher und so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Er träumte immer noch von Landschaften, obwohl die Medizinische Fakultät wegen Ferien geschlossen und seine Arbeit dadurch beträchtlich leichter war. Das beunruhigte ihn ein wenig, denn er dachte: ‚Wenn das jetzt schon so ist, wie soll das erst werden, wenn das neue Semester mit all dem Stress wieder begonnen hat?‘
Plötzlich fiel ihm ein, dass die zusätzliche Belastung des Unterrichts und der Vorlesungen die verhüllte Gestalt in seine Träume zurückbringen könnte, und er ertappte sich dabei, dass er mit seltsamer Begierde auf den Beginn des neuen Semesters wartete, ja, er ertappte sich sogar, die Tage zu zählen, und da wurde ihm klar, wie sehr die Vorstellung der Frau, deren Antlitz er nie gesehen hatte, seine Fantasie beschäftigte. Der Gedanke, seine armseligen Perlen vor die Säue geworfen zu haben, begann ihn sogar zu trösten.
Die sicherste Methode einzuschlafen war, wenn er sich die Erinnerung an jenen Spaziergang am Ufer mit der verhüllten Frau zurückholte. Nie versuchte er, sie einzuholen und ihr Gesicht zu sehen; er fürchtete es sogar und war sich einer Enttäuschung sicher; dennoch spürte er, dass er in der schemenhaften verhüllten Gestalt eine Art Geistführerin durch die Wirren des Lebens gefunden hatte. Hinter seinem komplexen Verstand verbarg sich im Grunde genommen eine einfache Seele.
Während er Nacht für Nacht mit unfehlbarer Regelmäßigkeit denselben Weg in das Königreich des Schlafes nahm – den Weg am Themse-Ufer entlang mit den blattlosen Platanen auf der einen Seite und dem dunklen, glitzernden dahinströmenden Wasser auf der anderen – ergriff die Vorstellung von der verhüllten Gestalt mehr und mehr Besitz von ihm. Früher oder später tauchte sie auf, und er folgte ihr mit einem unbändigen Gefühl der Erleichterung in das Land der Schatten.
Dann bemerkte er etwas Seltsames: Um frische Luft hereinzulassen, zog er vor dem Schlafengehen die Vorhänge vor dem Fenster zurück, und bei seinem Blick über den Fluss sah er manchmal, dass die Fassade an der südlichen Seite der Kirche erleuchtet war. Es schien keinen Rhythmus oder Grund für die Stunden zu geben, in denen die Religionsgemeinschaft dort ihre Andachten hielt. Häufig war sie dort bis ein Uhr oder zwei Uhr morgens, und er konnte nicht eher schlafen, bis das Licht auf der anderen Flussseite ausging. Wenn ihn der Schlaf im Stich ließ, setzte er sich im Bett auf, sah durchs Fenster hinüber und wartete, und sobald das Licht ausging, legte er sich erwartungsvoll auf das Kissen zurück. Nach etwa zwanzig Minuten tauchte die Gestalt auf, er folgte ihrer Spur und entwich in den Schlaf. Der Schlaf, den er auf diese Art und Weise fand, war besonders erholsam, und manchmal kam er sogar mit einem Gefühl in die Wirklichkeit zurück, das er lange entbehrt hatte: Glück.
Als die Tage dahingingen, wurde er von der Suche nach der verhüllten Frau geradezu besessen. Nie verspürte er den Wunsch, sie einzuholen, aber wenn eine Nacht verging und er ihre schemenhafte Gestalt nicht gesehen hatte, war er am nächsten Tag nervös, geradezu unglücklich, und fand erst Frieden, wenn die Fantasie wieder in seinen Schlaf gehuscht war. Aber es war mehr als Fantasie; er konnte sich das Themse-Ufer in der Dämmerung mit seinen Platanen und dem wirbelnden Fluss bildlich vorstellen, aber das Bild der schemenhaft verhüllten Gestalt bedeutete ihm nichts; nur wenn sie spontan in seiner Fantasie auftauchte, brachte sie ihm Frieden. Er spürte diese Freude nur so lange, wie er sich auf der Schwelle des Schlafs halten konnte, ohne wach zu sein und ohne in die Bewusstlosigkeit zu entgleiten. Und im Laufe der Zeit wandelte sich die Freude, sie auf Sichtweite zu halten, in Ekstase. Nach solchen Nächten empfanden ihn die Menschen im Krankenhaus als zerstreut, aber umgänglicher.
Die Ferien neigten sich dem Ende zu, das Semester begann, und er stürzte sich mit wildem Eifer in die Arbeit, mit der Absicht, sich bis zu dem Punkt zu erschöpfen, an dem die Vision in seinen Träumen erschien. Als er bereits für drei arbeitete, erkrankte ein Kollege, und er übernahm auch noch dessen Privatpraxis.
Die Tage wurden länger, aber die Extraarbeit hielt ihn so lange im Krankenhaus, dass er nie bei Tageslicht nach Hause kam. Er nahm sich vor, jeden Abend zu Fuß nach Hause zu gehen und so die Spaziergänge in den Hügeln zu ersetzen, die er vermisste. Aber er war nach den endlosen Stunden in den Krankenzimmern oder den Vorlesungsräumen viel zu erschöpft, und so hielt der Frühling Einzug, ohne dass er ihn überhaupt wahrnahm.
Als er eines Tages jedoch das Krankenhausviertel verließ, erblickte er den Abendstern, die Venus, die kurz vor Sonnenuntergang bereits am westlichen Himmel stand, und beschloss, obwohl müde, wieder am Themse-Ufer entlang nach Hause zu gehen. Irgendjemand hielt ihn auf; er musste Papiere im Büro des Sozialarbeiters unterzeichnen, und als er die Stufen der Brücke hinaufkletterte, die ihn zum Themse-Ufer führten, war die Venus bereits im Abendnebel verschwunden und die Dämmerung hereingebrochen.
Er hatte sich diesen Weg sooft ausgemalt, dass er kaum wusste, ob dieser Abend Fantasie oder Realität war. In die zunehmende Dunkelheit starrend, suchte er nach der schemenhaften verhüllten Gestalt, aber sie erschien nicht. Enttäuscht und mit schmerzenden Füßen erreichte er schließlich seine Wohnung und ließ sich mehr tot als lebendig in den alten Sessel fallen. Aber dann, beim Abstreifen der Schuhe von einem Impuls bewegt, den er nicht einordnen konnte, quälte er sich aus den schmuddeligen Kissen, durchquerte den Raum, zog die Vorhänge zurück und schaute hinaus, um zu sehen, ob die Fassade der Kirche auf der anderen Seite des Flusses erleuchtet war. Sie war es. Die Gestalt kam nie, wenn sie Gottesdienst hielten. Das beruhigte ihn. Warum, wusste er nicht. Ohne Abendbrot ging er zu Bett und schlief ein. Gedanken über verhüllte Damen machte er sich nicht. Gegen Mitternacht jedoch wurde er wach, stand auf und schaute wieder hinaus. In diesem Moment ging das Licht aus; kurz nahm er die verhüllte Gestalt wahr und betrat noch einmal in ihrer Begleitung das Land der Träume.
Hocherfreut wiederholte er den Spaziergang am Themse-Ufer am nächsten Tag zu früherer Stunde, die Pracht des Sonnenuntergangs über Westminster vor Augen, und von dem Tag an wurde der Weg am Ufer nach Hause zur Gewohnheit, was seiner Gesundheit sehr guttat. Auch im Geist war er heiterer, stellte aber gleichzeitig fest, wie abhängig er von diesen nächtlichen Visionen geworden war.
Als eine Woche lang seine Traumfrau nicht auftauchte, wurde er fast verrückt. Nichts hätte ihn dazu gebracht, einen Kollegen zu konsultieren und sich selbst Beruhigungsmittel zu verschreiben, und so ging es ihm immer schlechter. Als er mit seiner Kraft fast am Ende war, kam der Traum wieder, der ursprüngliche Traum der verhüllten Gestalt in der grauen Landschaft – der allererste Traum, der sich bis dahin, trotz all seiner Anstrengungen, nie wieder eingestellt hatte. In seiner Ungeduld war er so verzweifelt, dass er die verhüllte Gestalt zum ersten Mal geradezu verfolgte, mit der Absicht, sie einzuholen. Wie in einem Albtraum arbeitete er sich über die graue Landschaft vorwärts, aber seine Füße schienen bei jedem Schritt kleben zu bleiben, und sein Herz schlug, als ob es bersten wollte. Als er die Gestalt beinahe erreicht hatte und die Hände ausstreckte, um den flatternden Umhang zu packen, wachte er in Schweiß gebadet auf, den Schrei einer Frau in den Ohren. Er sprang aus dem Bett, riss das Fenster auf und streckte den Kopf hinaus. In dem Moment ging auf der anderen Seite des Wassers das Licht an.
In der mondbeschienenen Straße war alles ruhig, auch in dem muffigen Haus, als er sich über den Treppenschacht beugte und lauschte. Die kleine Miss Humphrey, seine Wirtin, wie immer um ihn besorgt, würde zu ihm hocheilen, wenn etwas nicht stimmte. Da sich nichts regte, ging er wieder zu Bett mit dem Gedanken, die schreiende Frau müsste entweder tot, gerettet oder ein Phantom seiner Fantasie gewesen sein.
Am nächsten Tag wurde er lange im Krankenhaus aufgehalten. Wenn auch durch die unterbrochene Nachtruhe müde, war sein Geist doch ruhig. Obwohl es spät war, entschloss er sich, wieder zu Fuß nach Hause zu gehen. Es war inzwischen zum Ritual für ihn geworden, und nichts hätte ihn davon abhalten können.
Es herrschte die gleiche Stimmung wie bei dem ersten Spaziergang am Themse-Ufer, aber an diesem Abend schien seine Wallfahrt eine besondere Realität zu haben. Während des Spaziergangs machte er sich Gedanken darüber, welche Art Ehemann er wohl abgegeben hätte, wenn seine Ehe normal verlaufen wäre: anspruchsvoll, ungestüm, eifersüchtig; aber er hätte das leichtherzige, kleine Geschöpf, das er geheiratet hatte, mit Liebe überhäuft. Zum ersten Mal wurde ihm klar, dass seiner Ehe auch dann kein Erfolg beschieden gewesen wäre, wenn ihnen die Katastrophe mit dem Kind erspart geblieben wäre, und das erleichterte und befreite ihn. Als die Bürde von seinen Schultern fiel, sah er etwa zwölf Fuß vor sich die verhüllte Gestalt einer Frau –, nicht in der Fantasie, sondern in Wirklichkeit.
Er schwankte wie betrunken, doch dann fasste er sich wieder. Die Realität besaß nicht dieselbe Faszination wie die Fantasie, außerdem war es mehr als unwahrscheinlich, dass dies die Trägerin des Mantels war, die ihn in seine Träume geschickt hatte.
Seinen Weg fortsetzend, beobachtete er amüsiert die verhüllte Gestalt. Es gab keinen Grund, Aufheben um eine Frau in einem Regenmantel zu machen. Dann fiel ihm plötzlich wieder das Tempo auf, mit dem sie ging. Es musste die Gestalt in dem Umhang aus dem Traum sein, denn nur wenige Frauen schritten so forsch aus. Durch einen Sprint verkürzte er den Abstand. Jetzt konnte er beobachten, wie sie sich bewegte. Von Haltung und Gang verstand er etwas, schließlich war es sein Beruf, aus diesen Komponenten seine Diagnosen zu stellen. Sie glitt in einer schwingenden Bewegung, die sich wie eine Welle vom Fußballen bis zur Hüfte ausbreitete, über den Boden, wobei die Falten des Capes um die breiten Schultern wie ein Pendel schwangen. Nie zuvor hatte er einen Menschen gesehen, der sich so harmonisch bewegte. Seine romantischen Anwandlungen einen Augenblick vergessend, beobachtete er ihren Gang mit beruflichem Interesse und verfolgte die perfekte Koordination eines jeden Muskels in dem sich rhythmisch bewegenden Körper. Ihre Figur konnte er nicht erkennen, denn die Falten des Umhangs verdeckten alles, ihren Gang jedoch würde er nie vergessen.
Dann schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der so verrückt war, dass er ihn sofort wieder verwarf. Das, was er vorhatte, war für einen Mann seines Standes undenkbar. Außerdem verbarg sich hinter seinem robusten Äußeren und seinem brüsken Benehmen ein schüchterner Pennäler. So schritt er tüchtig aus, bis ihn die Ampel erneut austrickste und er die Gestalt aus den Augen verlor.
Er raste die Stufen zu seinem Zimmer hinauf, riss den Vorhang zur Seite und starrte über den Flug. Genau in dem Moment wurde die dunkle Fassade der Kirche auf der anderen Seite des Wassers in Licht getaucht. ,Eines Abends‘, sagte er sich, ,werde ich über die Brücke zu der Kirche gehen. Ich will endlich wissen, welche Sekte ihrem Kult so launenhaft frönt.‘ Aber er war so beschäftigt, dass er vorübergehend seine Spaziergänge am Themse-Ufer aufgab. Seine Vision brachte ihn dennoch Nacht für Nacht mit treuer Regelmäßigkeit in den Schlaf. Er brauchte sie sich gar nicht mehr vorzustellen, denn sobald er seinen Kopf auf das Kissen legte, kam sie von selbst.
Er hatte an einer Versammlung des Verwaltungsrats des Krankenhauses teilgenommen, dem er als Mitglied angehörte. In einflussreichen Kreisen hatte man sich über seine Manieren und Methoden beschwert. Die Sache war aufgegriffen worden, so taktvoll wie möglich, aber immerhin, genau zu dem Zeitpunkt, als der Arzt seiner Frau ihn gebeten hatte, seine unerwünschten Besuche einzustellen, und so hatte er bestürzt, verwirrt und gedemütigt feststellen müssen, dass er andere aufgeregt und sich unbeliebt gemacht hatte. Das Gremium, dem davor gegraust hatte, eines seiner Mitglieder einen Maulkorb zu verpassen, war verwundert, als er seine Kollegen bat, ihm zu sagen, was er falsch gemacht habe. Er nahm ihnen den Wind aus den Segeln, und die Sache endete damit, dass man ihm versicherte, er hätte nichts falsch gemacht. Man beruhigte und besänftigte ihn, lehnte sich, nachdem er wie üblich überstürzt verschwunden war, im Stuhl zurück und schaute sich verwundert an.
Als er das Krankenhausviertel verließ, war es neblig, aber das änderte nichts an seinem Entschluss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Nichts konnte ihn so beruhigen und trösten wie die eingebildete Gegenwart seiner Fee. Wenn ein Mann ein Vierteljahrhundert sein Bestes gegeben hat und man ihm plötzlich sagt, es wäre nicht gut genug, dann stürzt die Welt für ihn ein.