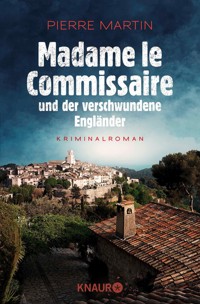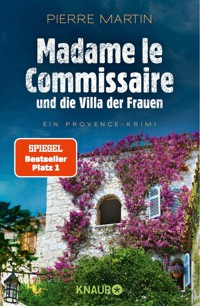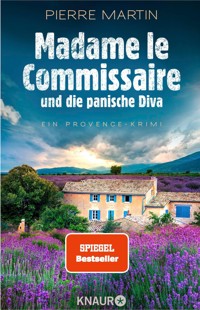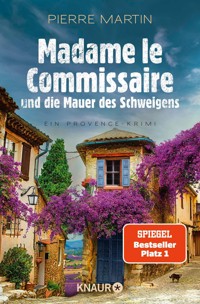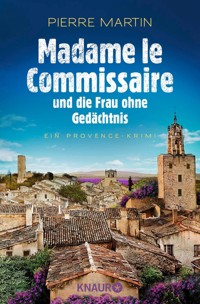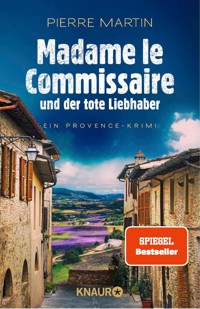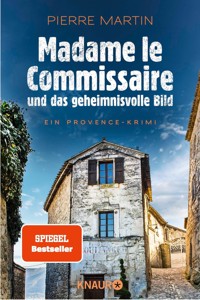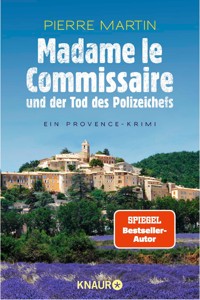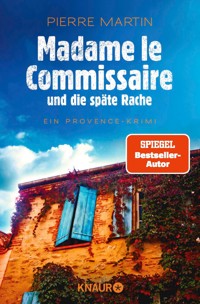12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Monsieur-le-Comte-Serie
- Sprache: Deutsch
Südfrankreich, provenzalische Lebensart und abenteuerliche Aufträge für Monsieur le Comte : der 3. Urlaubskrimi um den Auftragsmörder, der sich weigert, seine Opfer umzubringen »Monsieur le Comte und die Kunst der Entführung« ist der 3. Band von Pierre Martins Krimi-Reihe um Lucien de Chacarasse. Lucien Comte de Chacarasse genießt das Leben an der Côte d'Azur in vollen Zügen: azurblaues Wasser, provenzalische Köstlichkeiten und die Leichtigkeit des Sommers. Doch dann überbringt seine Onkel Edmond einen neuen Mordauftrag. Das Opfer, ein schwerreicher Argentinier, lebt auf Sardinien. Und der Mann soll unbedingt vor seiner deutlich älteren Frau das Zeitliche segnen. Warum, will Edmond nicht verraten. Notgedrungen reist Lucien auf die italienische Mittelmeerinsel. Während er sein Opfer ausspioniert, hat er eine geniale Idee: Er inszeniert eine Entführung – und geht im letzten Moment dazwischen. Der geschockte Argentinier ist Lucien so dankbar, dass er ihn als Leibwächter einstellt. Jetzt muss der junge Comte nur noch ein Familiengeheimnis aufdecken und einen Weg finden, seinen Auftrag zu erfüllen, ohne jemanden zu töten … Zurück im südfranzösischen Nizza gerät Lucien dann von allen Seiten in die Schusslinie. Eine junge Frau trachtet ihm nach dem Leben – eine völlig ungewohnte Situation für Lucien, den Auftragsmörder wider Willen. Er trifft eine kreative Entscheidung... Ein cosy Krimi, der humorvoll und spannend in die zauberhafte Provence entführt Lassen Sie sich von Bestseller-Autor Pierre Martin mit auf eine spannende und atmosphärische Reise nehmen an die Sehnsuchtsorte der Provence: Charmant und mit Humor besteht der Auftragsmörder wider Willen, Comte de Chacarasse neue Abenteuer – Urlaubslektüre zum Eintauchen und Entspannen. Die Frankreich-Krimis um Monsieur le Comte sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens - Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung - Monsieur le Comte und die Kunst der Entführung Entdecken Sie auch Pierre Martins Kult-Bestseller-Reihe um Madame le Commissaire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Pierre Martin
Monsieur le Comte und die Kunst der Entführung
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lucien Comte de Chacarasse genießt das Leben an der Côte d’Azur in vollen Zügen: azurblaues Wasser, provenzalische Köstlichkeiten und die Leichtigkeit des Sommers. Doch dann überbringt ihm sein Onkel Edmond einen neuen Mordauftrag. Das Opfer, ein schwerreicher Argentinier, lebt auf Sardinien. Und der Mann soll unbedingt vor seiner deutlich älteren Frau das Zeitliche segnen. Warum, will Edmond nicht verraten. Notgedrungen reist Lucien auf die italienische Mittelmeerinsel. Während er sein Opfer ausspioniert, hat er eine geniale Idee: Er inszeniert eine Entführung – und geht im letzten Moment dazwischen. Der geschockte Argentinier ist Lucien so dankbar, dass er ihn als Leibwächter einstellt. Bloß wie kann Lucien seinen Auftrag erfüllen, ohne jemanden zu töten? Zurück in Südfrankreich gerät Lucien von allen Seiten in die Schusslinie. Eine junge Frau trachtet ihm nach dem Leben – eine völlig ungewohnte Situation für Lucien, den Auftragsmörder wider Willen. Er muss kreative Entscheidungen treffen ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prologue
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Épilogue
Nachbemerkung
Prologue
In seiner ansonsten karg eingerichteten Wohnung in Villefranche-sur-Mer hatte Lucien ein überaus wertvolles Gemälde von Nicolas de Staël hängen. Eine abstrakte Komposition vor blauem Hintergrund. Der französische Künstler hatte sich 1955 das Leben genommen. Geplagt von Depressionen, hatte er sich in Antibes vom Balkon seines Ateliers gestürzt.
Lucien hatte nicht die Absicht, es ihm gleichzutun. Aber auch er kannte depressive Momente – wie gerade eben. Und einen Balkon hatte er auch: im vierten Stock. Das würde reichen.
Doch Lucien war nicht wirklich gefährdet. Er war von Natur aus zuversichtlich, und er liebte die schönen Seiten des Lebens. Die Phasen gedrückter Stimmung begleiteten ihn erst seit dem gewaltsamen Tod seines Vaters. Sie dauerten nie lang, aber sie waren unvermeidbar. Was am Versprechen lag, das er seinem Vater auf dem Sterbebett gegeben hatte: nämlich die jahrhundertealte Tradition der Familie fortzusetzen und als Auftragsmörder Menschen umzubringen. Das trübte die Leichtigkeit des Seins. Auch wenn es ihm bislang gelungen war, keinem Opfer wirklich Gewalt anzutun.
Er saß auf seinem Balkon über dem Quai de l’Amiral Courbet und blickte versonnen über die große Bucht zum gegenüberliegenden Cap Ferrat. Dort war sein eigentliches Zuhause. In der Villa Béatitude war er groß geworden. Sie war von hohen Bäumen und dichten Hecken umgeben. Sehen konnte er sie von hier nicht. Und das war gut so. Lucien empfand die Bucht als eine Art emotionalen Wassergraben. Sechzig Meter tief und über einen Kilometer breit. Und doch fuhr er fast jeden Tag auf die andere Seite – aber es war seine Entscheidung. Er könnte es auch sein lassen.
Wieder dachte er an den Maler Nicolas de Staël. Sein Großvater hatte den Baron russisch-baltischer Herkunft persönlich gekannt, weshalb in der Villa Béatitude einige Gemälde von ihm hingen. Eines hatte Lucien in seine Wohnung nach Villefranche »entführt«. Weil er fand, dass das intensive Blau ganz wunderbar mit dem Blick von seinem Balkon harmonierte. Nicht von ungefähr wurde das Meer an der Côte d’Azur »le grand bleu« genannt. Tragisch, dass sich de Staël im Alter von nur einundvierzig Jahren das Leben genommen hatte. Er hätte noch so viele großartige Bilder malen können. Auch in anderen Farben, die für den Süden Frankreichs charakteristisch waren. Leuchtendes Rosa wie die Bougainvillea. Blauviolett wie der Lavendel. Gelb wie die Mimosen oder Zitronen. Ocker wie die berühmten Felsen im Luberon.
Lucien goss sich ein Glas Wein ein. Nach seiner Erfahrung wirkte ein Grand Cru fast so gut wie ein Antidepressivum. Ihm war klar, warum er heute besonders bedrückt war. Denn am Vormittag hatte er das Familiengrab der Grafen Chacarasse in Roquebrune-Cap-Martin besucht. Seit Generationen lagen auf dem Cimetière de Saint-Pancrace seine Vorfahren begraben. Auf der Grabplatte waren ihre Namen eingemeißelt. Auch der seiner verstorbenen Mutter Laetitia, einer gebürtigen Italienerin. Und natürlich der seines Vaters: Alexandre Comte de Chacarasse.
Lucien hatte eine weiße Rose auf das Grab gelegt. Sie war für einen Chacarasse bestimmt, dessen Name auf dem Marmor fehlte – weil er nie das Licht der Welt erblickt hatte. In der an Gewalt und Unglücken reichen Geschichte der Chacarasses war er das jüngste Opfer. Er hätte nur noch wenige Wochen bis zu seiner Geburt gehabt. Aber ein schwerer Autounfall hatte ihn aus einem Leben gerissen, das für ihn noch gar nicht begonnen hatte. Seine Mutter Francine hatte überlebt. Dafür dankte Lucien dem Herrn im Himmel. Grâce à Dieu!
Francine war etwa in seinem Alter, und sie trafen sich fast täglich. Der Verdacht lag also nahe, dass er der Erzeuger des ungeborenen Chacarasse sein könnte. Denn ein Chacarasse wäre der Knabe zweifellos geworden. Doch bei aller Zuneigung war er der schönen Francine nie zu nahe gekommen … aus Respekt vor seinem Vater. Schließlich war sie seine Geliebte gewesen. Und das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug, stammte von ihm. Ein letztes Geschenk – drei Tage nach der Zeugung wurde der Comte erschossen.
Lucien goss sich ein zweites Glas Wein ein. Er kam zu dem Schluss, dass er nicht wirklich unter einer Depression litt, er war nur sentimental. Oder melancholisch. Schließlich hatte er heute Vormittag seinem ungeborenen Halbbruder die Ehre erwiesen. Auch hatte er sich bei seinem Vater entschuldigt, dass es zu dem verhängnisvollen Unfall gekommen war. Dabei konnte er nichts dafür, er war überhaupt nicht dabei gewesen. Aber vielleicht hätte er besser auf sie aufpassen können.
Lucien versuchte, dem tragischen Tod einen positiven Gedanken abzugewinnen. Wenigstens blieb dem jungen Chacarasse der Fluch der Familie erspart. Ihn würde man nie dazu zwingen, die Kunst des Tötens zu erlernen – mit dem Ziel, andere Menschen umzubringen.
1
Nicht mehr ganz nüchtern, aber schon wieder frohen Mutes schlenderte Lucien am frühen Abend von seiner Wohnung durch die engen Gassen von Villefranche-sur-Mer zum Restaurant P’tit Bouchon. Er hatte keinen Tisch reserviert, was in seinem Fall auch nicht nötig war, denn ihm gehörte das Lokal. Auf dem Weg begegnete ihm eine hübsche junge Frau. Früher hätte sie ihn stürmisch umarmt. Immerhin hatten sie mal eine Nacht zusammen verbracht. Dass sie sich das in der Öffentlichkeit nicht mehr traute, lag an ihrer Uniform der Police municipale. Es war ihm unerklärlich, warum sie ausgerechnet einen Beruf mit so rigiden Bekleidungsvorschriften ergriffen hatte, das passte gar nicht zu ihr. Auch stand sie jetzt streng genommen auf der anderen Seite des Gesetzes. Dass sie ihm dennoch einen flüchtigen Kuss auf die Wange hauchte, überraschte ihn. Durfte sie das überhaupt? Gleichzeitig ging ihm durch den Kopf, dass es nicht schaden konnte, bei der kommunalen Polizei eine Verbündete zu haben. Schon deshalb, weil er mit seiner Vespa bevorzugt bei Rot über Ampeln fuhr und Einbahnstraßen notorisch missachtete.
Lucien kam an der Église Saint-Michel vorbei. Vor der Kirche hatte er eine weitere unerwartete Begegnung. Diesmal mit dem Pfarrer, der ihn mit den Worten Salut à toi, mon ami begrüßte. Dabei hob er die Hände zum Himmel. Gleichzeitig versperrte er ihm geschickt den Weg, sodass sich Lucien auf ein Gespräch einlassen musste.
»Lucien, mein lieber Freund, dich schickt der Himmel«, begann der Pfarrer.
Lucien dachte, dass seine von den Vätern ererbte Mission eher in der Hölle ihren Ursprung hatte. Denn das Töten von Menschen vertrug sich nicht mit dem fünften Gebot.
»Wie du weißt«, fuhr der Pfarrer fort, »hat dein Vater, Gott hab ihn selig, unsere Kirche gelegentlich mit einer großzügigen Spende bedacht. So hat erst seine finanzielle Zuwendung die Instandsetzung der wunderbaren Mosaikziegel auf dem Dach unseres Glockenturms ermöglicht. Er war ein wahrer Christenmensch.«
Lucien ging der Ablasshandel der katholischen Kirche durch den Kopf, mit dem man sich im Mittelalter von seinen Sünden freikaufen und die Zeit im Fegefeuer verkürzen konnte. Er fürchtete nur, dass das bei seinem Vater nicht funktionierte.
»Ich erinnere mich«, sagte Lucien. »Wobei meine Mutter die treibende Kraft hinter den Spenden war.«
Der Pfarrer nickte.
»Ich weiß, die Contessa Laetitia hatte ein goldenes Herz. Wie so viele Italienerinnen stand sie der Kirche besonders nahe.« Er räusperte sich verlegen. »Nun hoffe ich, dass auch du, mein lieber Lucien, unserer Kirche einen Dienst erweisen kannst. Hast du einen Moment Zeit? Dann würde ich dir gerne unsere fantastische Orgel zeigen. Sie stammt aus dem Jahre 1790 und ist ein Meisterwerk der Gebrüder Grinda aus Nizza …«
»Ich bin leider etwas in Eile«, unterbrach ihn Lucien. »Außerdem kenne ich die Orgel. Kombiniere ich richtig, dass nach den Mosaikziegeln auf dem Glockenturm nun die Orgel restauriert werden muss?«
»Du kombinierst richtig, mein Sohn. Leider ist das ein ausgesprochen kostspieliges Unterfangen. Nun hoffe ich, dass du die ehrenvolle Tradition deiner Familie fortsetzt und uns mit einer großzügigen Spende hilfst.«
Lucien fragte sich, warum er das tun sollte. Er hätte nur etwas davon, wenn er häufiger in die Kirche ginge und die Orgel mit eigenen Ohren hören könnte. Dann aber kam ihm die Vorliebe seiner Mutter für Orgelmusik in den Sinn. Vor allem die Werke von Johann Sebastian Bach hatten es ihr angetan. Auch jene der Franzosen César Franck und Olivier Messiaen. Die Namen kannte er von ihr. Sein persönlicher Musikgeschmack war definitiv ein anderer.
»Wie großzügig müsste eine solche Spende ausfallen?«, fragte Lucien lächelnd.
Im Gesicht des Pfarrers löste sich die erwartungsvolle Anspannung.
»Das, mein Sohn, bliebe natürlich dir überlassen. Aber eine fünfstellige Summe wäre von großem Nutzen.«
Fünfstellig? Das eröffnete einen großen Spielraum, überlegte Lucien.
»Dann gehen Sie mal davon aus, dass sich die Familie Chacarasse an der Orgel beteiligt«, sagte er.
Der Pfarrer bekreuzigte sich.
»Ich danke dir, mein Sohn.«
»Sie müssen nicht mir danken, sondern meiner verstorbenen Mutter. Sie hätte es so gewollt.«
»Que Dieu la bénisse, Gott segne sie!«
Weil es nur noch wenige Schritte bis zum P’tit Bouchon waren, blieben ihm weitere Begegnungen erspart. Erst recht solche, die ins Geld gingen. Wäre er nur ein kleiner Restaurantbesitzer, hätte ihn der curé kaum um eine Spende gebeten. Allenfalls hätte er sich zum Abendessen einladen lassen. Lucien kannte seine Vorlieben. Gerne bestellte er chateaubriand au foie gras. Das Rinderfilet mit Gänsestopfleber war eines der teuersten Gerichte auf der Speisekarte. Gleiches galt für den Pinot noir aus dem Burgund. Der Pfarrer hatte einen erlesenen Geschmack – vorausgesetzt, er musste nicht zahlen.
Vor dem Betreten des Lokals warf Lucien einen Blick auf die Schiefertafel mit den plats du jour. Zum Auftakt, pour commencer, empfahl sein Chefkoch Roland heute tartare de tomates à la menthe fraîche. Danach, à suivre: les raviolis de daube à la niçoise. Und als Hauptgang entweder eine ganze dorade oder gambas flambées. Lucien lächelte zufrieden. Erst vor einigen Tagen hatte er sich mit Roland, nicht zum ersten Mal, eine heftige Diskussion geliefert. Er solle nicht immer Tagesgerichte empfehlen, die so kreativ waren, dass sie keiner verstand – nicht einmal das Servicepersonal. Offenbar hatte Roland die Kritik beherzigt. Blieb abzuwarten, wie lange er durchhielt.
Die Tische im P’tit Bouchon waren schon zum Teil belegt. Paul, der an einem Stehtisch mit dem carnet de réservation stand und die Gäste willkommen hieß, begrüßte Lucien mit der Nachricht, dass sie komplett ausgebucht seien. Er habe schon die ersten unangemeldeten Gäste wegschicken müssen. Allerdings habe er eine Ausnahme gemacht. Vor fünf Minuten sei plötzlich Achille Giraud aufgetaucht. Er wollte den Capitaine der Gendarmerie nationale nicht brüskieren und habe ihn an Luciens table du patron gesetzt.
Paul hob entschuldigend die Schultern. Er wisse, dass er ihm damit den Abend verdorben habe …
»Pas de problème«, unterbrach ihn Lucien. »Achille ist zwar ein Quälgeist, aber einer, den ich lieber zum Freund als zum Feind habe. Außerdem hat er mich schon entdeckt. Zu spät also, um mich zu verdrücken.«
»Er hat bereits einen Weinwunsch geäußert. Ob wir einen Château Margaux auch glasweise ausschenken, hat er gefragt.« Paul sah Lucien verschmitzt an. »Weil er sich wie immer eingeladen fühlt, schlage ich einen kleinen Etikettenschwindel vor. D’accord?«
Lucien verstand sofort, was er vorhatte.
»Natürlich bin ich einverstanden«, antwortete er grinsend. »Aber nicht übertreiben. Ganz so dumm ist Achille nämlich auch nicht. Ein Rotwein aus dem Médoc sollte es schon sein.«
Eine Viertelstunde später kam Paul mit einer Flasche Margaux an ihren Tisch. Er entschuldigte sich für die Verspätung. Aber eine Champagner-Bestellung für einen wichtigen Stammgast sei dazwischengekommen. Paul zeigte kurz die Flasche mit dem Etikett. Amüsiert beobachtete Lucien, wie er dabei den Flaschenhals verdeckte, damit die entfernte Kapsel nicht auffiel. Das konnte Paul gut, denn er hatte riesige Hände. Mit seiner hünenhaften Statur entsprach er kaum der Vorstellung eines feingliedrigen Sommeliers. Er wirkte eher wie ein Catcher – was er bis zu seiner Anstellung im P’tit Bouchon auch gewesen war.
Achille nickte zustimmend. Un bon millésime, stellte er fest. Ob er sich mit den Jahrgängen wirklich so gut auskannte?
Lucien fand, dass der Capitaine immer dreister wurde. Früher hatte er sich mit preisgünstigen Weinen begnügt. Mittlerweile war er beim Margaux angelangt. Viel Steigerungsmöglichkeiten gab es kaum. Das nächste Mal vielleicht ein Pétrus? Da würde Lucien nicht mitspielen. Obwohl ihm klar war, dass der Capitaine etwas gegen seine Familie in der Hand hatte. Er wusste nicht, was, aber offenbar so viel, dass sein Vater ihm regelmäßig einen Scheck hatte zukommen lassen. Lucien hielt es für klug, diese Tradition fortzusetzen. Aber regelmäßige Einladungen ins P’tit Bouchon hatten sie nicht vereinbart. Erst recht nicht Weinbestellungen in dieser Preisklasse.
Paul entkorkte die Bouteille. Nach Luciens Überzeugung nicht zum ersten Mal. Er dekantierte den Wein in eine Karaffe.
»Er bräuchte noch etwas Luft zum Atmen«, sagte er.
»Kann schon sein«, erwiderte Achille, »aber Luftholen kann er in meinem Gaumen. Nun schenk schon ein!«
Lucien schwenkte den Wein im Glas. Er tat so, als ob er die Farbe begutachten würde. Er inhalierte die Aromen. Ohne weitere Verkostungsrituale nahm er einen ersten Schluck.
»Très bon«, stellte er fest. Das war nicht gelogen. Für einen durchschnittlichen Cru bourgeois war er wirklich nicht schlecht.
»Excellent«, stimmte ihm Achille mit einem Zungenschnalzer zu.
Einem weiteren vergnüglichen Verlauf des Abends stand also nichts mehr im Wege. Bald hatte der Capitaine einen Schwips. Auto fahren dürfte er jedenfalls nicht mehr. Mit einem Blaulicht auf dem Dach aber ging es wohl doch. Zum Abschied bedankte sich Achille für Luciens Großzügigkeit. Er gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Lucien ertrug es mit Fassung. Den einen küsste die Muse, bei ihm tat es halt ein Capitaine der Gendarmerie nationale.
2
Nach ihrem schweren Verkehrsunfall hatte er Francine jeden Tag im Krankenhaus besucht. Körperlich erholte sie sich erstaunlich schnell. Schwerer wogen ihre seelischen Verletzungen. Sie hatte ihr ungeborenes Kind verloren. Lucien wusste nicht, wie er sie darüber hinwegtrösten könnte. Seine Fürsorge war von großer Hilflosigkeit geprägt. Die vergangenen zwei Wochen hatte sie sich in ein Sanatorium zurückgezogen. Er respektierte ihren Wunsch, alleine zu sein. Alleine mit sich und mit ihren Erinnerungen.
Für den heutigen Tag hatte Francine ihr Kommen angekündigt. Lucien war deshalb schon am frühen Vormittag von Villefranche-sur-Mer zur Villa Béatitude auf Cap Ferrat gefahren.
Rosalie, die alte Haushälterin der Grafen von Chacarasse, war so aufgeregt, dass sie vergessen hatte, ihre morgendlichen Tabletten zu nehmen. Wichtiger war ihr, Francines Lieblingskuchen zu backen: einen gâteau aux amandes et au citron. Wobei Rosalie Wert darauf legte, den Zitronenmandelkuchen sans farine, also ohne Mehl, zuzubereiten, dafür sparte sie nicht am Mandellikör.
Auch Lucien war aufgeregt, aber er ließ es sich nicht anmerken. Prompt unterstellte ihm Rosalie, herzlos zu sein. Aber erstens wusste sie es besser, und zweitens machte er sich Sorgen um ihren Blutdruck. Ihre Wangen glühten.
Sogar die Malteserhündin Coco schien zu spüren, dass ein besonderes Ereignis bevorstand. Jedenfalls rannte sie noch irrwitziger durchs Haus als üblich. Warum sie im Treppenhaus ausgerechnet die Marmorbüste von Luciens ehrwürdigem Urgroßvater anbellte, blieb ihr Geheimnis.
Gegen elf Uhr hörte Lucien ein Auto vorfahren. Der Motor klang nach Francines altem Alfa Romeo. Aber der konnte es nicht sein, denn er war nach dem Unfall in der Schrottpresse gelandet.
Seltsamerweise hatte auch Rosalie trotz ihrer ausgeprägten Schwerhörigkeit das Auto gehört. Und obwohl sie auf den altersschwachen Beinen nicht die Schnellste war, schaffte sie es, noch vor Lucien die große Eichentür der Villa zu erreichen. Mit ausgebreiteten Armen lief sie Francine auf dem Vorplatz entgegen.
Lucien ließ ihr bereitwillig den Vortritt und beobachtete die herzliche Begrüßung. Dabei fiel ihm ein, dass Rosalie in der Küche einen Monitor der Videoüberwachung stehen hatte. So zumindest erklärte sich ihre schnelle Reaktion. Ihn überraschte, dass Francine in einem roten Alfa Cabrio vorgefahren war, das genauso aussah wie ihr Vorgängerauto. Das Modell wurde nicht mehr hergestellt. Aber Francine war gut im Recherchieren. Irgendwo hatte sie auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen Klon aufgestöbert. Wenig überraschend war dagegen, dass sie fantastisch aussah. In einem engen schwarzen Leinenkostüm mit braunen Pumps. Top gepflegt wie immer. Ihr war nicht anzusehen, was sie durchgemacht hatte.
Nicht zum ersten Mal dachte Lucien, dass sie perfekt zu seinem Vater gepasst hatte – trotz des großen Altersunterschieds. Francine wirkte immer beherrscht und kontrolliert. Sie hatte jenes je ne sais quoi, das gewisse Etwas, das man nur schwer erklären konnte. Jedenfalls strahlte sie mehr aristokratische Noblesse aus als er selbst. Was schon mal daran lag, dass er darauf keinen Wert legte. Er bevorzugte verwaschene Jeans und Flipflops. Seine strubbelige Frisur bändigte er, indem er mit den Fingern durch die Haare fuhr. Der Kamm, den ihm Rosalie mal mit mahnenden Worten geschenkt hatte, war ihm abhandengekommen. Immerhin hatte er im Schrank einen Blazer mit dem Wappen der Grafen von Chacarasse. Er konnte sich jedoch nicht erinnern, wann er das Sakko das letzte Mal getragen hatte.
Eine Stunde später saß er mit Francine auf einer Bank im parkähnlichen Garten. Vor ihnen das Rosenbeet, das schon seine verstorbene Mutter angelegt hatte. Heute wurde es von einem Gärtner gepflegt. Ihm ging durch den Kopf, dass Francine fast seine Stiefmutter geworden wäre – aber vor einer möglichen Hochzeit hatte man seinen Vater erschossen.
Lucien sah sie von der Seite an.
»Erinnerst du dich an unser Gespräch auf der Terrasse des Chèvre d’Or?«, fragte er.
»Natürlich, damals habe ich dir gestanden, dass ich in der Geburtsurkunde meines Kindes keinen Vater angeben werde. Ich wollte, dass der Junge meinen Nachnamen erhält.« Francine fuhr sich über die Stirn. »Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen …« Sie sprach nicht weiter.
»Ich konnte deine Entscheidung nachvollziehen. Nein, ich wollte ein anderes Thema aufgreifen. Damals habe ich dich gefragt, wie du meinen Vater kennengelernt hast. Du hast mir eine ausweichende Antwort gegeben. Unter nicht sehr romantischen Umständen, hast du gesagt. Und dass der Beginn auch gleichzeitig das Ende hätte sein können.«
»Habe ich das gesagt? Nun ja, so war das auch.«
»Willst du mir nicht mehr erzählen?«
Francine rang sich ein Lächeln ab.
»Eigentlich nicht.«
Lucien überlegte, wie wenig er von ihr wusste. Ihr Vater war Diplomat gewesen, weshalb sie in Washington und Tokio aufgewachsen war. Den Highschoolabschluss hatte sie in London gemacht. Finanziell schien sie unabhängig und nicht darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Seit fünf Jahren lebte sie in Monte Carlo, wo sie eine Zeit lang in einer Privatbank gearbeitet hatte. Heute half sie ihm als Privatsekretärin. In allen Geschäften, die mit seiner Familie zu tun hatten. Niemand anderes käme dafür infrage. Denn nur sie wusste von der unheilvollen Vergangenheit der Chacarasses. Und auch, dass sein Vater seiner Bestimmung als Auftragsmörder nachgekommen war.
»Aber vielleicht solltest du es wirklich wissen«, sprach Francine plötzlich weiter. »Während meiner Genesung habe ich viel über alles nachgedacht. Auch über den Namen, den mein Kind bekommen hätte …«
»Alexandre, nach meinem Vater«, ergänzte Lucien, »das hast du mir schon verraten. Und mit Nachnamen Lambert wie du.«
Sie knetete ihre Finger.
»Nein, nicht Lambert«, sagte sie leise. »So heiße ich nicht.«
Er brauchte einen Moment, um zu verstehen. Oder besser gesagt: um nicht zu verstehen. Obwohl er sie immer mit Vornamen anredete, wusste er definitiv, dass Francine mit Nachnamen Lambert hieß. So stellte sie sich vor, so unterschrieb sie ihre Briefe, so nannte sie der Concierge in Monaco.
»Was willst du mir damit sagen?«, fragte er zögernd.
»Dass mein richtiger Nachname Delacroix lautet. Aber mein Vorname stimmt. Kannst also weiter Francine zu mir sagen.«
Er schüttelte ungläubig den Kopf.
»Also Delacroix statt Lambert … Warum dieser Namenswechsel?«
Sie atmete tief durch.
Ihre Erklärung kam stockend.
»Ich musste untertauchen … Ich brauchte eine neue Identität. Das ist jetzt fünf Jahre her … damals habe ich in London gelebt.«
»Untertauchen, eine neue Identität«, wiederholte er fassungslos.
Ihm war natürlich klar, dass es so etwas gab. Aber doch nicht Francine?
»Schau nicht so ungläubig«, sagte sie.
»Hast du was angestellt?«
»Das traust du mir zu? Nein, habe ich nicht.«
Lucien war normalerweise schnell von Begriff. Gerade eben aber war er im Kopf wie gelähmt.
»Was ist vor fünf Jahren passiert?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Man hat einen professionellen Mörder beauftragt, mich zu erschießen.«
Lucien spürte, wie sich sein Puls beschleunigte.
»Aber du konntest dich rechtzeitig in Sicherheit bringen?«
»Nein, konnte ich nicht.«
»Hat er etwa vorbeigeschossen?«, suchte Lucien nach einer Erklärung für die offensichtliche Tatsache, dass sie noch am Leben war.
»Nein, er hätte mich ganz sicher nicht verfehlt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil der gedungene Auftragsmörder …« Ihr fiel es schwer weiterzusprechen.
Lucien beschlich eine Ahnung.
»Weil der Auftragsmörder dein Vater war! Er hätte nie vorbeigeschossen.«
3
Lucien hatte schon immer gespürt, dass Francine ein Geheimnis mit sich herumtrug. Doch dass es ein solches war, hatte er sich nicht vorstellen können. Konsterniert saß er neben ihr auf der Parkbank. Sein Vater hatte also den Auftrag erhalten, Francine umzubringen. Aber er hatte sie am Leben gelassen. Dabei hatte er immer gepredigt, dass jeder Auftrag ohne Ansehen der Person ausgeführt werden müsse. Für ihren Job brauche man ein kaltes Herz, hatte er gesagt. Skrupel seien keine Option. Doch wusste Lucien von zumindest einem Fall, bei dem sein Vater mit dieser ehernen Regel gebrochen hatte. Den Auftrag, seinen alten Segelfreund Valentino Blancfontaine zu töten, hatte er abgelehnt. Jetzt kannte er also einen zweiten Tabubruch. Auch bei Francine hatte er sich geweigert, der Anweisung zu folgen. Lucien stellte fest, dass er seinen Vater zunehmend von einer neuen, verborgenen Seite kennenlernte. Und diese Seite gefiel ihm. Eine Erklärung hatte er dennoch nicht.
»Ich wollte dich nicht schocken«, sagte Francine.
»Genau betrachtet ist es das Gegenteil eines Schocks. Schließlich bist du am Leben. Und wie du mit Nachnamen heißt, ist mir nun wirklich egal.«
Er sah, wie Rosalie mit einem Tablett näher kam.
»Ihr schaut so bedrückt aus der Wäsche. Ich glaube, ein Stück von meinem Mandelkuchen könnte euch guttun. Dazu zwei Gläser Mandellikör. Danach geht’s euch wieder besser.«
»Rosalie, du bist großartig.«
Sie runzelte die Stirn.
»Natürlich bin ich artig. Was soll denn diese Bemerkung?«
»Großartig habe ich gesagt. Du bist fantastisch, wollte ich zum Ausdruck bringen.«
»Sag’s doch gleich!«
Francine und Lucien sahen ihr lächelnd hinterher, als sie zurück ins Haus ging.
»Ich glaube, sie kam genau zur rechten Zeit. Jetzt probieren wir deinen Lieblingskuchen, dann können wir weiterreden.«
»Ist gar nicht mein Lieblingskuchen. Nur weil ich ihr einmal ein Kompliment gemacht habe, glaubt sie das. Und ich will ihr nicht widersprechen.«
Lucien lachte.
»Den kriegst du jetzt bis zu deinem Lebensende.«
»In Anbetracht von Rosalies Alter hoffe ich nicht.«
»Womit wir wieder beim Thema wären. Ich frage mich, warum mein Vater nicht abgedrückt hat. Weil du eine schöne Frau bist? Aber das wäre kein hinreichender Grund. Ich erinnere mich, dass Alexandre mal eine attraktive Springreiterin aus dem Sattel geschossen hat.«
»Die Geschichte kenne ich. Die Springreiterin war eine schlimme Pferdeschinderin. Aber zugegeben, deshalb hätte sie nicht sterben müssen.«
»Stimmt, es gab ein anderes, schwerwiegenderes Motiv. Aber zurück zu dir. Warum hat dich mein Vater verschont?«
»Er hat noch sehr viel mehr für mich getan. Er hat mich nicht nur am Leben gelassen, sondern mir auch beim Untertauchen geholfen. Er hat mir eine neue Identität besorgt und unter falschem Namen einen Neustart in Monaco ermöglicht. Er hatte immer ein Auge auf mich. Eine Freundschaft hat sich entwickelt – und irgendwann ist mehr daraus geworden.«
Lucien sah, wie sich Francine eine Träne von der Wange wischte. Er hatte sie noch nie weinen sehen.
»Seid ihr euch vielleicht schon früher mal begegnet?«, suchte Lucien nach einer Erklärung.
»Nein, sind wir nicht. Alexandre hat etwas getan, das ich auch von dir kenne. Nach Erhalt des Auftrags, mich zu töten, hat er nach den Hintergründen gesucht …«
Genau das, dachte Lucien, widersprach der Tradition der Chacarasses. Ein Auftrag war ein Auftrag, c’est si simple. Hatten seine Vorfahren gefragt, warum sie einen Attaché des Vatikans umbringen sollten oder einen hohen Finanzbeamten Napoleons? Nein, sie hatten es einfach getan. Ob es die Opfer verdient hatten, spielte keine Rolle. Die Chacarasses verstanden sich als Assassinen, die die Kunst des Tötens beherrschten. Sie waren nicht auf der Suche nach Gerechtigkeit.
»Und die Hintergründe haben meinem Vater nicht gefallen«, schlussfolgerte Lucien.
»Er hat herausgefunden, dass ich nur deshalb getötet werden sollte, weil ich durch meinen Vater von einem Geheimnis wusste, das keinesfalls publik werden durfte. Du musst wissen, mein Vater war wenige Wochen zuvor einem Herzinfarkt erlegen, er konnte nichts mehr ausplaudern.«
»Was für ein Geheimnis, und wem hätte es geschadet?«
»Du stellst viele Fragen«, konstatierte Francine.
Sie schob sich ein Stück Mandelkuchen in den Mund. Entweder brauchte sie Zeit zum Nachdenken, oder sie wollte das Thema hiermit beenden.
»Entschuldige, ich will dich nicht bedrängen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich ins Vertrauen gezogen hast. Jetzt verstehe ich manches besser.«
»Das freut mich. Bei nächster Gelegenheit erzähle ich dir den Rest der Geschichte. Aber bitte nicht heute. Es strengt mich an. Ich finde auch, das war schon ziemlich viel auf einmal.«
Das war es wirklich, dachte Lucien. Er würde sich also gedulden müssen. Was ihm nicht leichtfiel. Denn plötzlich ergaben sich ganz neue Fragen. Zum Beispiel, ob Francines frontaler Zusammenstoß womöglich kein Unfall, sondern ein Attentat gewesen war. Vielleicht war ihre wahre Identität aufgeflogen? Dann wäre sie in akuter Lebensgefahr. Dagegen sprach, dass der Lenker des entgegenkommenden Wagens beim Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen war. Außerdem war er sturzbetrunken gewesen und wohl deshalb auf die falsche Fahrbahn geraten.
Francine nahm sich die Zeit, im Büro die liegen gebliebene Post durchzusehen. Es war nichts Dringendes dabei. Sie machte Rosalie die Freude, sich mit ihr am großen Küchentisch zusammenzusetzen und etwas zu plaudern. Lucien leistete ihnen Gesellschaft. Rosalie erwähnte, dass sein neues Appartement im Seitenflügel der Villa Béatitude bezugsfertig sei.
Stimmt, dachte er. Aber »bezugsfertig« bedeutete nicht, dass er in Zukunft dort regelmäßig übernachten würde. Auch wenn sich Rosalie das wohl wünschen würde.
Francine, die sich bis zu ihrem Unfall um die Bauabwicklung gekümmert hatte, fragte, ob sie es sehen könne.
»Selbstverständlich. Außerdem hat Rosalie den Schlüssel.«
Rosalie hielt eine Hand ans Ohr.
»Was für eine Schüssel?«
Lucien lachte.
»Die zu meinem Appartement.«
»Du meinst wohl Schlüssel. Lucien, mein Lieber, langsam mache ich mir Sorgen. Du bringst immer häufiger Worte durcheinander. Du musst dich besser konzentrieren.«
»Ich werde mich bemühen.«
»Ist das Appartement so geworden, wie du es dir vorgestellt hast?«, fragte Francine.
An seiner Stelle antwortete Rosalie.
»Die Wände sind grau angepinselt, bis auf die alten Mauern, die so aussehen, als ob sie erst noch verputzt werden müssten. Der Boden besteht aus schwarzen Platten, wie in einer Fabrikhalle. Kann man zum Saubermachen aber wahrscheinlich mit dem Schlauch abspritzen. Wenigstens ein Vorteil. Die wenigen Möbel sind laut Lucien Bauhaus-Klassiker, was immer das auch sein mag. Ich halte das für eine faule Ausrede. Kurzum: Mein Geschmack ist das nicht.«
Lucien lächelte.
»Nicht böse sein, aber genau deshalb gefällt’s mir.«
»Ton père serait horrifié«, erwiderte Rosalie, »dein Vater wäre entsetzt.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, kommentierte Francine lächelnd.
»Wären da nicht die bodentiefen Fenster, käme ich mir vor wie in einem Bunker«, ließ Rosalie nicht locker.
»Ist es ja auch bis zu einem gewissen Grad. Die Fenster sind schussfest«, erklärte Francine
»Warum eigentlich?«, fragte Lucien.
»Weil auf Cap Ferrat heute bei vielen neuen Häusern schussfestes Glas verbaut wird. Der Architekt hat es angeboten, und weil es nur wenig teurer war, habe ich zugestimmt. Dachte, da muss ich dich nicht erst fragen.«
»Musst du natürlich nicht …« Lucien grinste. »Aber dann kann ich auch nicht von innen nach außen schießen.«
»Papperlapapp«, mischte sich Rosalie ein. »In diesem Haus wird überhaupt nicht geschossen. Und wer sich nicht daran hält, der bekommt es mit mir zu tun.«
4
Der nächste Tag begann so, wie es Lucien am liebsten mochte: Er schlief ewig lange aus. Geweckt wurde er erst durch die Sirene eines in der Bucht ankernden Kreuzfahrtschiffs. Diese Unart sollte man verbieten. Als ob vor Villefranche dichter Nebel herrschen würde, dabei blendete ihn die Sonne, sogar auf dem Bett. Er stand auf und machte sich einen Cappuccino. So jedenfalls stand es auf dem Display seiner Maschine. Der Geschmack erinnerte nur entfernt daran. Aber er war zu faul, ihn so zuzubereiten, wie er es von seiner italienischen Mutter gelernt hatte.
Lucien setzte sich auf den Balkon seiner Wohnung. Und zwar so, wie er aus dem Bett gekrochen war: nackt – aber mit Sonnenbrille und mit der Cappuccino-Tasse in der Hand. Er beobachtete eine Jacht beim Segelsetzen. Am Ruder stand eine junge Frau in einem gelben Bikini. Auch die Winsch zum Setzen des Großsegels wurde von einer Frau bedient. Irgendetwas klemmte. Das halb hochgezogene Segel flatterte im Wind. Männliche Unterstützung war nicht zu sehen. Vielleicht sollte er mit seinem Zodiac rausfahren und seine Hilfe anbieten?
Er verwarf den Gedanken. Viel zu anstrengend. Dennoch konnte er der Versuchung nicht widerstehen, die beiden Grazien durch ein Fernglas näher zu betrachten. Oh là là, vielleicht sollte er seine Entscheidung noch einmal überdenken.
Die Rudergängerin eilte zu ihrer Freundin an den Mast. Dabei stolperte sie und fiel der Länge nach ins Cockpit. Tant pis! Der Bug des Schiffes sollte gegen den Wind stehen, sonst wurde nie was draus. Aber die Jacht drehte sich unaufhaltsam zur Seite. Das Knattern des halb hochgezogenen Segels war bis hier zu hören.
Lucien konnte sich das Elend nicht länger ansehen. Er schlüpfte eilig in Strandshorts und zog sich ein Poloshirt über. Dann schnappte er sich sein Handy, rannte die Treppen runter und sprintete zu seinem Boot, das gleich vorne am Pier lag. Er löste die Festmacherleine und sprang in sein »Schlauchboot«. Das Zodiac hatte einen festen Rumpf und am Heck zwei schwere Außenborder. Das gleiche Modell wurde vom französischen Militär eingesetzt.
Wenig später ging Lucien an der Jacht längsseits. Er zog sich an der Reling hoch.
»Pardon mesdames. Avez-vous un problème? Puis-je aider?«, bot er seine Hilfe an.
»Forbandet, pokkers …«, hörte er die Frau am Mast. Französisch war das nicht. Wohl eher ein beherztes Fluchen in einer fremden Sprache.
Die Freundin neben ihr drehte sich zu ihm. Wow, aus der Nähe sah sie noch besser aus. Selbst mit einer Schramme am Kopf.
»Sie schickt der Himmel, kommen Sie an Bord!«
Keine fünf Minuten später hatte Lucien das Problem gelöst. Das Segel war gesetzt, und die Jacht nahm Fahrt auf – das Zodiac hinter sich herziehend. Jetzt noch die Fock ausrollen. Tout va bien.
»Ich bin Freja«, stellte sich die Rudergängerin vor und reichte ihm die Hand. »Und meine Freundin heißt Nora. Wir kommen aus Dänemark.«
Ihm gefiel ihr Akzent.
»Enchanté, ist mir ein Vergnügen.«
»Hast du keinen Namen?«
»Ach so, natürlich. Ich bin Lucien.«
Nora gab ihm überfallartig einen Kuss. Und zwar auf den Mund.
»Den hast du dir verdient.«
Lucien war noch nie in Dänemark. Aber er beschloss spontan, das Land zu mögen. Jedenfalls die beiden Botschafterinnen.
»Entschuldige, dass wir uns so dumm angestellt haben«, sagte Freja. »Aber wir haben das Schiff erst vor zwei Tagen gechartert. Wir kennen noch nicht alle Tücken.«
Lucien grinste frech.
»Aber segeln könnt ihr schon?«
»Natürlich«, empörte sich Nora. »Unsere Vorfahren waren Wikinger. Das Segeln liegt uns im Blut.«
Für einen kurzen Moment stellte er sich die jungen Frauen in dicken Fellmänteln und mit hörnerbewehrten Helmen vor. In Bikinis gefielen sie ihm definitiv besser.
»Von wo bist du eigentlich plötzlich hergekommen?«, stellte Freja eine naheliegende Frage.
»Ich war zufällig am Hafen und habe euch mit dem Segel kämpfen sehen. Da dachte ich, ihr könntet etwas Hilfe gebrauchen.«
Freja lachte.
»Da hast du dich getäuscht. Das machen wir immer so, um Männer an Bord zu locken.«
»Dann habt ihr aber Glück gehabt, dass euch nicht unser Hafenmeister gesehen hat. Er ist über siebzig, hat eine Zahnlücke und keine Haare auf dem Kopf.«
Freja steuerte die Jacht an einem Fischerboot vorbei Richtung offenes Meer.
Lucien deutete auf sein Zodiac, das sie im Schlepptau hatten.
»Ich weiß ja nicht, wo ihr hinwollt, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt von Bord gehe.«
»Du verlässt freiwillig zwei schöne junge Frauen?«
»So ist das Leben. Voller Rückschläge.«
»Um deine Frage zu beantworten, wir wollen heute nur ein bisschen spazieren segeln, um uns mit dem Schiff vertraut zu machen. Am Abend ankern wir wieder vor Villefranche. Morgen früh wollen wir dann auf große Fahrt gehen und nach Calvi auf Korsika ablegen. Wir haben die Jacht für drei Wochen gechartert.«
»Ganz alleine, ohne Männer?«
»Die Bedeutung von Männern wird überschätzt. Vor allem von den Männern selbst. Nora und ich kommen sehr gut ohne sie aus.«
Lucien sah zwischen den beiden hin und her. Einen lesbischen Eindruck machten sie nicht. Aber konnte man es wissen?
»Bleib doch in den nächsten Stunden bei uns«, schlug Freja wie zum Beweis des Gegenteils vor. »Wir liefern dich heute Abend wieder in Villefranche ab.«
Der Gedanke gefiel ihm. In der Villa Béatitude würde er nicht gebraucht. Francine, wenn sie denn überhaupt kam, hätte genug mit dem liegen gebliebenen Bürokram zu tun. Rosalie würde ihn nicht vermissen, sie hatte ja Coco.
Während er noch zögerte, fragte Nora: »Oder hast du keine Zeit? Bist du im Urlaub oder musst du ins Büro?«
»Ich gehe derzeit keiner geregelten Arbeit nach«, erklärte er lächelnd.
»Etwas runtergekommen siehst du auch aus«, kommentierte Freja.
Kein Wunder, dachte Lucien, er kam gerade aus dem Bett.
»Aber ich mag das«, fügte sie hinzu.
»Okay, ich nehme euer Angebot dankend an. Aber unter einer Voraussetzung: Habt ihr was zum Frühstücken an Bord?«
»Du würdest dich wundern, was wir alles an Bord haben. Spiegeleier mit Speck sind unsere leichteste Übung.«
Wie sich herausstellte, kamen die beiden Däninnen mit dem Boot gut zurecht. Seine Hilfe wurde nicht mehr benötigt. Sie umrundeten Cap Ferrat und segelten bei achterlichem Wind parallel zur Küste Richtung Monaco. Das angehängte Zodiac bremste ein wenig, aber das machte nichts. Nora übernahm das Steuer. Freja lotste Lucien am Mast vorbei aufs Vorschiff. Dort machten sie es sich auf einem Polster bequem. Freja lächelte – und trennte sich von ihrem Bikinioberteil. Was unter der Sonne der Côte d’Azur freilich das Selbstverständlichste der Welt war.
»Kriegst auch von mir einen Kuss«, sagte sie. »Nora hat sich wie immer vorgedrängt. Aber dafür dauert meiner länger.«
Im Nachhinein fragte sich Lucien, warum er so dumm gewesen war, sein Handy mit an Bord zu nehmen. Und erst recht, warum er einen unangenehmen Anruf entgegengenommen hatte. Als einzige Entschuldigung ließe sich vorbringen, dass er auf dem spiegelnden Display nicht erkennen konnte, wer ihn sprechen wollte.
»Hallo, Lucien«, begrüßte ihn sein Onkel Edmond. »Gut, dass ich dich erreiche. Ich erwarte dich in spätestens einer Stunde. Wir haben etwas zu besprechen.«
Lucien schluckte. Er wusste, was der Anruf zu bedeuten hatte. Edmond war der Bruder seines Vaters. Ihre Beziehung beruhte auf gegenseitiger Ablehnung. Weshalb sich Edmond auch nur dann bei ihm meldete, wenn er einen neuen Auftrag hatte. So war schon zu Lebzeiten seines Vaters die Arbeitsteilung gewesen. Edmond Comte de Chacarasse nahm die Aufträge entgegen. Lucien hatte keine Ahnung, auf welchen verschlungenen Pfaden dies geschah. Die Ausführung lag nach dem Tod seines Vaters bei ihm.
»Je suis desolé«, antwortete Lucien. »Aber ich bin momentan verhindert.«
Was stimmte, denn er massierte Freja gerade die Füße.
»Interessiert mich nicht. Du hast maximal eine Stunde, keine Minute länger. Ist übrigens keine Schikane. Ich muss am Nachmittag ins Krankenhaus. Aber mach dir keine falschen Hoffnungen, mir geht’s prächtig, ist nur ein kleiner Routineeingriff.«
Keine falschen Hoffnungen? Tatsächlich hatte sich Lucien schon oft gefragt, ob nach einem etwaigen Tod seines Onkels Ruhe in sein ansonsten friedliches Leben einkehren könnte. Einfach deshalb, weil es keine Mordaufträge mehr geben würde. Aber diesen Zahn hatte ihm Edmond schon bei ihrem ersten »Planungsgespräch« gezogen. Seine Nachfolge sei geregelt, hatte er gesagt – und dabei hämisch gegrinst.
Lucien warf einen fast schon wehmütigen Blick auf seine beiden Grazien.
»Edmond, du kannst einem den schönsten Tag verderben …«
»Immer wieder gerne. Also in einer Stunde.«
Schon hatte sein Onkel aufgelegt. Widerspruch zwecklos.
Am liebsten hätte Lucien sein Handy ins Meer geworfen. Aber das war auch keine Lösung. Jetzt nicht mehr.
Freja sah ihn ungläubig an.
»Sag bloß, du verlässt uns?«
Er verzog das Gesicht.
»Ein Notfall. Mein Lieblingsonkel muss ins Krankenhaus. Er will mich vorher noch einmal sehen.«
»O mein Gott, das tut uns natürlich leid.«
»Mir erst. Ich hätte unsere vielversprechende Völkerverständigung gerne fortgesetzt.«
Freja und Nora warfen sich einen kurzen Blick zu.
»Da spricht doch nichts dagegen. Wie lange wird dich dein Onkel in Anspruch nehmen?«
»Nicht so lange. Am späten Nachmittag bin ich wieder zurück in Villefranche.«
»Dann kommst du heute Abend zu uns an Bord. Wir ankern an der gleichen Stelle. Wir kochen was Feines, und du bringst was zu trinken mit.«
Lucien lächelte. Die beiden Mädels retteten ihm jetzt doch noch den Tag.
»Merci pour l’invitation.Avec plaisir.«
Beide küssten ihn zum Abschied. Er zog das Zodiac heran und sprang hinein. Freja warf ihm die Leine zu.
Lucien winkte. Dann startete er die Motoren.
5
Nach Beaulieu-sur-Mer, wo Edmond wohnte, war es nicht weit. Lucien drehte sich am Ruderstand einige Male um und sah, wie die Segeljacht der beiden Däninnen immer kleiner wurde. Dass seine Laune nicht ins Bodenlose fiel, war auf ihre Einladung zurückzuführen. Sie war quasi der Silberstreifen am Horizont. Sein Onkel dagegen kam ihm vor wie der König von Syrakus, der ein Damoklesschwert über seinem Haupt schweben ließ, gehalten nur von einem Pferdehaar. Lucien durfte sich nie sicher fühlen und unbeschwert das Leben genießen. Edmond könnte das Schwert jederzeit auf ihn niedersausen lassen. Da erging es ihm nicht anders als dem Diener Damokles in der Legende. Jetzt musste er aber doch lächeln, denn von dieser Parallele abgesehen hatte er es zweifellos besser als ein Höfling, der sich nach dem Wohlstand seiner Herrschaft sehnte. Schließlich verfügte er über ein beachtliches Vermögen. Er müsste keine Minute arbeiten und könnte sich dennoch alle Wünsche erfüllen. Dass er freilich kaum Wünsche hatte, lag an ihm selbst. Sein Reichtum und sein Einkommen standen in einem umgekehrten Verhältnis zu seinen Bedürfnissen. Einen einzigen Wunsch aber gab es doch: dass ihn Edmond mit seinen Aufträgen verschonen möge. Doch dazu müsste er ihn wohl umbringen … Und selbst dann würde es nach dessen eigener Aussage kein Ende nehmen.
Beaulieu liegt quasi spiegelbildlich zu Villefranche auf der anderen Seite vom Cap Ferrat. Lucien legte im kleinen Hafen neben der Villa Kérylos an. In der Bristol Marine kannte man sein Zodiac.
Er zog seine durchnässten Bootsschuhe an und sprang auf den Quai. Dabei dachte er, dass sein Onkel auf ein gepflegtes Äußeres Wert legte. Strandshorts und ein von der Sonne verblichenes Poloshirt widersprachen definitiv seinem Dresscode. Lucien lief am Hafen entlang, überquerte die Avenue Fernand Dunand und eilte dann durch den kleinen Ort zu Edmonds Art-déco-Villa, die sich hinter hohen Hecken versteckte. Das schmiedeeiserne Tor war geöffnet. Er wurde erwartet.
»Oh my God«, begrüßte ihn Edmonds Butler am Hauseingang. Er schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. »So können Sie doch nicht bei Comte Edmond erscheinen …«
Lucien sah ihn belustigt an.
»Wenn Sie meinen, dann gehe ich wieder. Bitte richten Sie ihm aus, dass Sie mich abgewiesen haben.«
»Ähm, natürlich nicht. Wenn Sie bitte einen Moment warten, dann avisiere ich Sie beim Comte und bereite ihn schonend auf Ihr Erscheinungsbild vor.«
»Tun Sie das, aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit damit, sonst bin ich wirklich wieder weg.«
»Mais non, I’ll be right back.«
Der Butler, der aus Marseille stammte, aber sich zu Luciens Amüsement gerne englisch ausdrückte, verschwand kurz im Haus. Als er wiederkam, bedeutete er Lucien, ihm ins Gewächshaus zu folgen. Der Comte erwarte ihn dort.
Edmond saß zwischen Orchideen in seinem Rollstuhl und sah ihn missbilligend an.
»Willst du mich provozieren oder warum erscheinst du in diesem runtergekommenen Aufzug?«
»Warum sollte ich dich provozieren? Du hast mir eine Frist von einer Stunde gesetzt. Ich hatte keine Zeit mehr, nach Hause zu fahren und mich umzuziehen.«
»Du willst also sagen, dass du dich außer Hause so verlottert herumtreibst? Du bist ein Comte de Chacarasse. Dein Vater wäre entsetzt.«
Tatsächlich, dachte Lucien, hatte auch sein Vater auf korrekte Kleidung geachtet. Wenn es die Umstände zuließen, war er sogar seiner »Arbeit« im gepflegten Outfit nachgegangen. Dem Opfer half es allerdings wenig, von einem Mann im maßgeschneiderten Anzug erschossen zu werden.
»Tut mir leid, aber ich war gerade dabei, ein Boot zu reparieren.«
»Warum machst du denn so was? Dafür gibt es Leute.«
»So ist es«, erwiderte Lucien grinsend. »Ich wollte mir etwas Geld dazuverdienen.«
Edmond schüttelte den Kopf.
»Du nimmst mich auf den Arm. Aber Geld ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen neuen Auftrag. Die Bezahlung erfolgt nach unserem Standardtarif. Eine Million Euro. Vierzig Prozent gehen an mich, sechzig an dich. Also alles wie immer.«
»Was soll ich dafür tun? Ein Boot reparieren?«
»Dein Humor gefällt mir nicht. Ich fasse mich kurz: Die Zielperson heißt Santiago Lopez-Montequari und lebt auf Sardinien. Unsere Auftraggeber möchten, dass er so bald wie möglich verschwindet. Dabei gibt es ein entscheidendes Kriterium: Er muss nachweislich vor seiner Ehefrau das Zeitliche segnen.«
Lucien registrierte, dass Edmond gerade von mehreren Auftraggebern gesprochen hatte.
»Sagtest du Sardinien? Ist ja nicht gleich um die Ecke.«
»Hast richtig gehört. Solltest dich freuen, so kommst du etwas herum. Deinen Vater haben die Aufträge bis nach Lissabon und Marrakesch geführt …«
Und bis nach London, dachte Lucien. Dort hätte er Francine umbringen sollen.
»Dann halt Sardinien. Warum muss dieser Santiago sterben?«
Edmond lachte.
»Du versuchst es immer wieder. Zu unserem Arbeitsethos gehört, dass wir keine Hintergründe wissen wollen. Die Zielperson wird liquidiert, ohne Ansehen der Person. C’est aussi simple que ça. Du bekommst von mir ein Foto des Delinquenten, außerdem eine Art Steckbrief und seine Adresse auf Sardinien. Er wohnt ziemlich pompös in einer gut gesicherten Villa an der Costa Smeralda. Keine Ahnung, wie man an ihn rankommt. Aber dir wird schon was einfallen.« Edmond reichte ihm einen verschlossenen Umschlag. »So, jetzt muss ich Schluss machen. Wie gesagt muss ich kurz im Krankenhaus einchecken. Ein kleiner Eingriff, in ein paar Tagen bin ich wieder draußen. Dann erwarte ich von dir positive Nachrichten.«
»So schnell wird’s nicht gehen.«
»Aber trödle nicht herum. Wie gesagt, seine Frau darf nicht vor ihm sterben, sonst wird der Auftrag storniert, und wir müssen die Anzahlung rückerstatten. Das wäre nicht gut für meine angegriffene Gesundheit.«
Lucien dachte spontan, dass er genau aus diesem Grund den Auftrag in den Sand setzen sollte. Aber sein Onkel war ein zäher Hund. Und Geld hatte er genug, weshalb ihm ein stornierter Auftrag keine schlaflosen Nächte bereiten würde. Es ging ihm nur darum, die makellose Bilanz der Chacarasses fortzusetzen. Darauf basierte ihr Renommee. Und zwar seit Generationen. Ein Renommee von höchst zweifelhafter Qualität.
Als Lucien eine Stunde später sein Boot am Pier von Villefranche festmachte, war er äußerlich zwar ruhig, innerlich aber aufgewühlt. Wieder einmal stand er vor der Aufgabe, jemanden umbringen zu müssen – ohne ihn zu töten. Sein Onkel ahnte ja nicht, wie schwer das war.
Dank seiner italienischen Mutter war Lucien zweisprachig aufgewachsen. So gesehen war Sardinien nicht schlecht. Was konkret auf ihn zukam, wusste er nicht. Er zügelte seine Neugier und ließ den Umschlag ungeöffnet. Das hatte bis morgen Zeit.
Die Segeljacht von Nora und Freja war noch nicht an ihren Ankerplatz zurückgekehrt. Vielleicht hatten sie sich doch anders entschieden und waren gleich nach Korsika weitergesegelt? Zuzutrauen wäre es ihnen. Das wäre zwar schade … Lucien lächelte. Aber womöglich besser so. Denn bei realistischer Betrachtung waren zwei Däninnen eine zu viel.
Den Umschlag versteckte er in seiner Wohnung. Bei einem kurzen Besuch im P’tit Bouchon versicherte er sich, dass die Vorbereitungen für das Abendgeschäft problemlos verliefen – also so chaotisch wie immer. Roland löschte in der Küche gerade mit dem Geschirrtuch eine brennende Flambierpfanne. Als Maître de cuisine hatte er eigentlich andere Aufgaben. Alain, sein Souschef, debattierte mit dem Gardemanger die Zubereitung einer Apfelschaumsuppe mit Calvados. Aus der Ecke für die Desserts rief die Pâtissière, wer ihren Schneebesen geklaut habe.
Lucien nickte zufrieden. Auch wenn es anders aussah, sein Team hatte alles im Griff. Falls es also doch noch zur Einladung auf die Jacht kommen sollte, konnte er sich beruhigt absetzen.
Paul besorgte ihm eine Kühltasche. Eine Flasche Champagner sollte reichen. Dazu drei Flaschen Rosé: Whispering Angel vom Château d’Esclans. Lucien musste lächeln. Die Vorstellung, dass ihm ein blonder Engel etwas Nettes ins Ohr flüstern könnte, gefiel ihm.
Paul war die Diskretion in Person. Deshalb fragte er nicht, was sein Chef vorhatte.
Später entdeckte Lucien von seinem Balkon die Jacht. Sie ankerte etwas weiter hinten als heute früh. Er nahm sein Fernglas und erkannte, dass im Cockpit tatsächlich ein Tisch gedeckt war. Es sah ganz so aus, als ob er erwartet würde.
Eine Uhrzeit hatten sie nicht vereinbart. Auch keine Telefonnummern ausgetauscht. Sollte er noch etwas warten? Eine Etikette für Abende wie diesen gab es nicht. Außerdem hatte er Hunger.
Er ging die Stufen hinunter zum Quai de l’Amiral Courbet. Sein Boot lag nur wenige Schritte entfernt an der Mole. Er hob die Kühltasche an Bord und legte ab.
6
Lucien war es gewohnt, regelmäßig Alkohol zu trinken. Als Gastronom fast schon berufsbedingt. Immerhin beschränkte er sich auf Wein. Von Pastis und anderen Spirituosen ließ er die Finger. Allenfalls ein Gläschen Marc mit Rosalie. Weil er wusste, wie viel er vertrug, war Lucien so gut wie nie betrunken. Das war ihm wichtig, denn er hasste es, die Kontrolle zu verlieren. Außerdem ersparte er sich so etwaige Nachwirkungen. Einen Kater kannte er nicht … bis heute, bis gerade eben.
Er war gerade aufgewacht, aber noch hielt er die Augen geschlossen. Vorsichtshalber. Denn auch so war ihm schwindlig. Hinter seinen Schläfen hämmerte es, und ihm war übel. Einen Filmriss hatte er zudem. Okay, er erinnerte sich, wie er gestern Abend von den beiden jungen Frauen auf der Jacht herzlich empfangen wurde, sogar ausgesprochen herzlich. Dann hatte er den Champagnerkorken fliegen lassen, und sie hatten auf einen schönen Abend angestoßen. Was hatte es zu essen gegeben? Merde, schon das wusste er nicht mehr. Jetzt fiel ihm doch noch was ein. Nora und Freja hatten ihn mit der dänischen Trinkkultur vertraut gemacht und ihn mit Aquavit abgefüllt. Dieser Schnaps hatte definitiv einen höheren Alkoholgehalt als sein mitgebrachter Whispering Angel. Was er gerade zu hören glaubte, war auch kein flüsternder Engel, sondern ein Kobold, der ihm mit einem Hämmerchen gegen die Schädeldecke klopfte. Hämmerchen? Wohl eher Thors Hammer.
Lucien stellte fest, dass er nun doch einiges herausgefunden hatte. Durch schieres Nachdenken und ohne die Augen zu öffnen. Aber deshalb wusste er noch lange nicht, wo er sich gerade befand. Wahrscheinlich gab es nur eine Möglichkeit, sich Klarheit zu verschaffen: Er musste seine Augen aufmachen. Vielleicht sollte er erst mit einem anfangen?
Es ging einfacher, als er dachte. Es half, dass in der Kajüte nur gedämpftes Licht war. Die Vorhänge vor den Bullaugen hielten allzu grelle Sonnenstrahlen ab. Vorsichtig versuchte er, sich zu orientieren. Sein erster Befund war in höchstem Maße irritierend: Er hielt ein nacktes Bein im linken Arm. Ohne sich zu bewegen, betrachtete er den Fuß aus nächster Nähe. Er war sehr ansprechend geformt, und die Nägel waren rot lackiert. Wie aber erklärte sich, dass gleichzeitig ein Kopf in seiner rechten Armbeuge lag? Hatte er es mit einem Schlangenmenschen zu tun? Nein, es gab nur eine logische Erklärung: Es handelte sich um zwei verschiedene Lebewesen.
Er tastete mit der Hand nach dem zugehörigen Körper. Jetzt kam sein zweiter Befund: Die Person war nackt – und zweifellos weiblicher Natur. Und sie lebte, denn ihre Brust hob und senkte sich.
Lucien gelangte zur naheliegenden Erkenntnis, dass er mit Freja und Nora in der Kajüte ihrer Jacht lag. Blieb die Frage, wie es dazu kommen konnte und wie nahe sie sich in der letzten Nacht gekommen waren. Er konnte sich an keine pikanten Details erinnern. Weshalb er es für möglich hielt, dass sie alle drei zu später Stunde sturzbetrunken eingeschlafen waren – ohne dass irgendwas passiert wäre. Lucien lächelte versonnen. Aber womöglich täuschte er sich.
Es war schon später Vormittag, als sie unter einem Sonnensegel frühstückten. Mit rohen Eiern im Glas und Worcestersauce. Nach Frejas Überzeugung das beste Mittel gegen einen Hangover. Immerhin waren auch die beiden Mädels verkatert. Das beruhigte ihn. Hätte ja sein können, dass Däninnen über ein spezielles Aquavit-Verträglichkeits-Gen verfügten.
Nora kühlte sich die Stirn mit Eiswürfeln.
»Du hast uns betrunken gemacht«, sagte sie vorwurfsvoll.
Lucien sah sie empört an. »Ich doch nicht, ich kann nichts dafür.«
»Ich meinte auch nicht dich. Freja ist schuld. Sie hat gestern Abend dauernd nachgeschenkt und dabei Skål gerufen, daran erinnere ich mich.«
Freja verdeckte mit einer Hand ihre Augen.
»Wirklich? Dann bitte ich um Vergebung.«
»Wenigstens leidest du genauso wie wir.«
»Schlimmer, viel schlimmer …«
Die nächsten Minuten widmeten sie sich schweigend ihrem Katerfrühstück. Lucien brachte kaum einen Bissen runter. Dafür trank er viel Wasser.
Schließlich wechselten die beiden Mädels einige Sätze auf Dänisch.
»Was hältst du davon, uns auf unserem Törn zu begleiten?«, fragte Nora nach einer Weile.
Im Prinzip war das eine verlockende Idee, überlegte Lucien. Aber verbunden mit unwägbaren Risiken. Außerdem hatte ihm Edmond die Entscheidung längst abgenommen.
»Geht leider nicht«, antwortete er. »Ich hab zu tun.«
»Das ist eine faule Ausrede, du traust dich nicht.«
»Was kann mir mit euch schon passieren?«, erwiderte er. »Aber nein, ich kann wirklich nicht.«
»Kannst du dir nicht einige Tage freinehmen? Du hast uns gar nicht erzählt, was du beruflich machst?«
»Mal dieses und mal jenes«, antwortete er. »Irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen.«