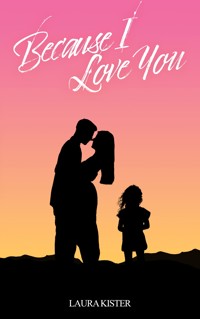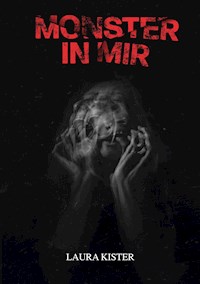
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Kleine Kinder haben Angst vor den Monstern unter ihrem Bett - Ich fürchte mich vor den Monstern in meinem Kopf« Psychopathin - Realität oder nur Fassade? Nachdem Clary aufgrund psychischer Erkrankungen mehrere Morde begeht, landet sie in einer Forensischen Psychiatrie. Mit allen Kräften versucht sie sich gegen die Therapien und die Gefangenschaft zu wehren und kämpft um ihre Freiheit. Komplett allein und auf sich gestellt, versucht sie zu überleben, denn sie hegt einen tiefen Hass gegen alle anderen, von denen sie umgeben ist. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit den anderen Patienten, mit welchen sie immer wieder aneinandergerät. Doch dann taucht eine neue Patientin auf, welche Clarys Aufmerksamkeit erregt. Es scheint, als könnte sich alles zum Besseren wenden. Aber ist das wirklich real oder trügt der Schein? Wartet vielleicht schon der nächste Schicksalsschlag, das nächste Drama auf Clary, um ihr den Boden unter den Füßen zu entreißen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält psychische Krankheiten – vor allem Depressionen, Borderline und andere Persönlichkeitsstörungen, soziale Phobie, Bipolare Störung, Schizophrenie, Pyromanie, Narzissmus und Essstörung – sowie Straftaten – überwiegend Morde. Außerdem werden selbstverletzendes Verhalten und suizidale Handlungen beschrieben. Gewalt, Schimpfwörter und Beleidigungen sind ebenfalls vorhanden.
PROLOG
Leben… Was ist das?
Leben… Was ist das? Wer kann das schon sagen?
Leben… Was ist das? Das, was geschieht? Das, was um mich herum ist?
Leben… Was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt es sich an?
Schön? Was bedeutet schön überhaupt? Was ist das für ein Gefühl? Ist das Leben schön? Kann es schön sein? Ich kenne dieses Gefühl nicht.
Schön… Glücklich…
Glücklich… Was ist das? Glücklich, wenn es mir gut geht? Was bedeutet das? Ich weiß es nicht.
Schöne Gefühle… Wann fühlt man sie? Wie fühlt es sich an?
Anders als die ständigen Tränen?
Das ständige Blut, das meinen Arm hinunterfließt?
Wenn die kalte Klinge meinen Arm berührt und dann ein kurzer Schmerz und das warme rote Blut hinunterfließt?
Meine Arme, vernarbt…
Überall Narben, vom Ritzen…
Von der Klinge…
Das spüre ich…
Schmerz, Traurigkeit, Einsamkeit, Kälte… Schrecklich…
Ich habe noch nie so etwas wie Glück gespürt…
Ich wünschte ich wüsste, wie es sich anfühlt, aber ich weiß es nicht…
Mein ganzes Leben besteht aus Schmerz… Endloser Schmerz…
Nichts hilft…
Keine Therapie…
Die Psychiatrie, in der ich lebe und gefangen gehalten werde… Kann man das überhaupt Leben nennen?
Leben… Was ist das?
Leben… Freiheit…
Freiheit… Was muss das für ein Gefühl sein…
Ein schönes? Aber was ist schön? Positiv? Was bedeutet das?
Da ist so viel, was ich nicht weiß…
Jeder sollte das Recht auf Freiheit haben…
Auf Leben…
Ich sitze hier… In meiner Zelle… Gefangen… Die Klinge griffbereit neben mir…
Niemand weiß von ihr… Sonst würden sie sie mir wegnehmen…
Leben… Was ist das?
Leben…
Freiheit…
Ich wünsche es mir…
Die Klinge auf meiner Haut…
Über der Pulsader…
Ein Schnitt…
Blut…
Warmes rotes Blut…
Fließt aus der Wunde…
Blut…
Zu viel, um zu überleben…
Alles wird schwarz…
Freiheit…
Glück…
Leben… Was ist das?
Leben…
KAPITEL 1
Das Klicken einer Tür verriet mir, dass jemand meinen Trakt betreten hatte. Dies war seltsam, da um diese Zeit sonst niemand kam. Das Mittagessen war gerade vorbei und alle anderen waren entweder im Gemeinschaftsraum oder in ihren Zellen. Ich hatte keine Lust meine Zeit mit den anderen zu verschwenden, weshalb ich mich dazu entschieden hatte, hier zu bleiben.
Da ich neugierig war, ging ich zu meiner Zellentür und spähte hinaus auf den Gang.
»Parker, du hast Besuch!«, sagte der Wärter, welcher gerade bei mir angekommen war, und machte die kleine Luke auf, durch die er mir die Handschellen anlegen konnte. Ich musterte seine dunkelblaue Uniform, an der auf Höhe der Taille ein Gürtel befestigt war. An diesem hingen normalerweise die Handschellen, welche ich gerade trug. Außerdem waren daran noch ein Schlagstock, ein Elektroschocker und ein Funkgerät befestigt. Letzteres benutzen die Wärter für die Kommunikation untereinander, um beispielsweise Verstärkung zu rufen, sollten einige Patienten mal wieder aus der Reihe tanzen und Ärger machen.
Der Wärter führte mich aus meiner Zelle hinaus auf den Gang.
Es wunderte mich, dass mich jemand besuchte, denn das geschah für gewöhnlich nicht, da sich niemand für mich interessierte und ich allen Menschen, die ich kannte, egal war.
Ich war nun schon seit einigen Wochen hier und in dieser Zeit hatte ich außer den Wärtern und Therapeuten nur die anderen Gefangenen gesehen. Und selbst die anderen hatte ich bis vor kurzem nur selten gesehen, weil diese Anstalt es bevorzugte, die Gefangenen in den ersten Wochen den Großteil der Zeit von allen abgeschottet zu lassen. Nur bei Gruppentherapien konnte man soziale Kontakte knüpfen, sonst waren die einzigen Menschen, mit denen man regelmäßig Kontakt hatte, Wärter und vor allem die Therapeuten, mit denen man mehrmals wöchentlich reden musste.
Ich war in einer Psychiatrie, die gleichzeitig auch ein Gefängnis war. Der Fachbegriff dafür lautete Forensische Psychiatrie. Es war ein Gefängnis für Psychopathen und andere psychisch Kranke, die irgendeine Straftat begangen hatten und aufgrund ihrer verminderten Zurechnungsfähigkeit und ihrer psychischen Krankheit, die viele zu ihren Straftaten verleitet hatte, in kein gewöhnliches Gefängnis kamen. Der einzige Unterschied zu einer Psychiatrie war, dass alle, die hier gefangen gehalten wurden, eine oder mehrere Straftaten begangen hatten. Und der Unterschied zu einem normalen Gefängnis war die Tatsache, dass hier nur Menschen mit psychischen Krankheiten waren.
Hier wurden die Leute nicht nur gefangen gehalten, sondern auch therapiert und mit Medikamenten vollgepumpt. Anders als in einem gewöhnlichen Gefängnis blieb man hier nicht, bis man seine Strafe abgesessen hatte, sondern man kam nur dann heraus, wenn man wieder gesund war, beziehungsweise sich der Zustand des Patienten so sehr verbessert hatte, dass das Risiko weiterer Straftaten nur noch sehr gering war und dies von den Ärzten bestätigt wurde. Sonst konnte es sein, dass man hier länger blieb, als die eigentliche Strafdauer es eigentlich vorgesehen hätte.
Diese Gefängnis-Psychiatrie war schon etwas Besonderes, wie ich und alle anderen die hier waren. Ich gehörte hierher und das wusste ich auch. Ich hatte eine Borderline Persönlichkeitsstörung und wurde hierhin geschickt, nachdem ich nach jahrelangen Depressionen und Selbstverletzung einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, daraufhin komplett durchgedreht und ausgerastet war und ein paar kleine Kinder entführt und ermordet hatte. Seitdem war ich hier gefangen ohne jegliche Privatsphäre und hatte nur wenige Rechte.
Borderline war eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, weshalb mein Selbstbild gestört war und wodurch ich vor allem unter sehr starken Stimmungsschwankungen litt und meist sehr impulsiv handelte ohne Rücksicht auf die möglichen Konsequenzen zu nehmen. Dadurch hatte ich auch oft Wutausbrüche, die schon durch Kleinigkeiten ausgelöst wurden. Diese Krankheit bedingte auch mein selbstverletzendes Verhalten und meine Ver-lassensängste. Außerdem fühlte ich manchmal nichts außer Leere.
Wir waren hier in unseren kleinen Zellen eingepfercht wie irgendwelche wilden Tiere. Ich verbrachte viel Zeit in meiner Zelle, von deren kalten Wänden der Putz abbröckelte. Auch das Bett war schon alt. Es war nur ein wackeliges Gestell mit einer Matratze und grüner Bettwäsche, die einem Hoffnung geben sollte, da grün ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung war. Ich hasste diese Bettwäsche und das Bett. Wenn man sich bewegte, knarrte es und man hatte das Gefühl, es würde jede Sekunde zusammenbrechen. Außerdem gab es einen Tisch mit einem Stuhl. Vor dem Fenster in meiner Zelle war ein Gitter angebracht, damit ich keinen Fluchtversuch wagte und mich noch mehr eingesperrt fühlte. Die Gitter waren vor jedem Fenster dieser Anstalt, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und das Fluchtrisiko dieser zu minimieren.
Alle Patienten trugen die gleiche Kleidung; einen langärmligen cremefarbenen Pullover ohne Kapuze und dazu eine dunkelbraune weite Hose. Ich hasste diese Kleidung, vor allem diese hässlichen kackbraunen Hosen gefielen mir überhaupt nicht, da ich diese Farbe schrecklich fand. Die Pullover waren sogar ganz bequem, aber auch deren Farbe sprach mich nicht so an. Aber immerhin mussten wir nicht diese hässlichen orangen Overalls tragen, wie sie die Insassen eines Gefängnisses immer trugen.
Wir hatten keine eigenen Toiletten, wahrscheinlich hatten sie Angst, dass jemand auf die Idee kam sich zu ertränken. Deswegen lagen die Toiletten auf dem Flur und wurden von allen genutzt. Außerdem wurde man immer von einem Wärter überallhin begleitet und auch allein duschen war nicht möglich, was echt ziemlich erniedrigend war. Außerhalb der Zelle wurde man von den Wärtern bewacht und in den Zellen war man allein. Allerdings kamen regelmäßig Wärter, um nach dem Rechten zu sehen.
Essen gab es dreimal am Tag, aber meistens war es so wenig, dass man nicht satt wurde oder es schmeckte so widerlich, dass man freiwillig verzichtete. Wenn man Glück hatte, bekam man zwischendurch noch zusätzlich etwas zu trinken, doch das war eher selten der Fall. Die Wärter waren in der Regel streng und schreckten auch nicht vor ihren Schlagstöcken zurück und auch von ihren Elektroschockern machten sie regelmäßig Gebrauch. Wer nicht gehorchte wurde geschlagen, verprügelt oder kam in Isolationshaft, wo man dann von allen komplett abgeschottet war.
Jeder Tag war gleich. Wir wurden zu unterschiedlichen Zeiten geweckt. Jeder wurde einzeln zum Badezimmer gebracht, in dem man dann 10 Minuten Zeit hatte, sich fertig zu machen. Danach ging es zurück in die Zellen, wo man warten musste, bis alle fertig waren. Anschließend wurde allen das Frühstück gebracht.
Nach meiner Ankunft hatte ich die meiste Zeit des Tages allein in meiner Zelle verbracht, wo ich mich selbst beschäftigen musste. Da es in den Zellen jedoch nichts gab, womit man sich seine Zeit vertreiben konnte, war es immer sehr langweilig gewesen. Seit ein paar Tagen allerdings durfte ich in meiner Freizeit zu bestimmten Zeiten in den Gemeinschaftsraum, wo ich auch andere Patienten traf.
Jede Woche mussten wir zu verschiedenen Therapien. Die Themen der Therapien waren meistens unterschiedlich. Einmal ging es um die Straftaten, die wir begangen hatten und in einer anderen Therapie ging es spezifisch um unsere Krankheit. Generell fragten uns die Therapeuten immer über unsere Gefühle aus und taten dabei so, als würden sie uns verstehen, obwohl sie das nicht konnten, da sie nicht in unserer Lage waren. Einmal in der Woche mussten wir zur Gruppentherapie, wo wir mit Leuten zusammen waren, die etwas Ähnliches getan hatten und auch die gleiche Krankheit hatten und Leuten, die etwas anderes getan hatten. Gruppentherapien verliefen meist ohne irgendwelche Zwischenfälle, allerdings kam es manchmal vor, dass sich einzelne Patienten anschrien oder selten auch alles eskalierte. Doch die Wärter konnten immer noch rechtzeitig eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern.
Neben den Therapien gab es noch Dienste, wie zum Beispiel die Wäsche waschen oder die Bäder putzen. Auch beim Essen musste man manchmal helfen, was wahrscheinlich die Erklärung dafür war, dass das Essen so ekelhaft schmeckte. Wahrscheinlich spuckten manche einfach rein oder gaben sich absichtlich keine Mühe. Zu diesen Diensten wurde man meist in kleinen Gruppen eingeteilt; Ausnahmen gab es nur selten. Außerdem gab es noch Aktivitäten, an welchen man teilnehmen konnte und mit anderen Patienten in Kontakt treten konnte. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, an einer dieser Aktivitäten teilzunehmen, da jeder Patient in den ersten Wochen isoliert wurde, damit die Ärzte sich erst einmal ein Bild von dem jeweiligen Patienten, dessen Krankheit und der Gefahr, welche von ihm ausging, machen konnten. Außerdem hatte ich auch eigentlich gar keine Lust, Zeit mit anderen Patienten zu verbringen. Jedoch würde ich bestimmt bald dazu gezwungen werden, da die Ärzte die Patienten hier resozialisieren wollten und die Aktivitäten mit den anderen Patienten laut ihnen dazu beitrugen. Allgemein war das Leben hier nicht so schön, aber ich ertrug es.
Der Wärter führte mich durch die Gänge, vorbei an anderen Zellen, Wärtern und durch schwere, verriegelte Türen, bis wir zu einem Raum kamen. Der Wärter öffnete die Tür und schubste mich hinein.
Ich sah diesen Raum zum ersten Mal, da ich vorher noch nie Besuch bekommen hatte. In der Mitte war eine Reihe mit Stühlen und ein langer Tisch, der in verschiedene Abschnitte eingeteilt war. Darauf befand sich eine dicke Glasscheibe, die diese Seite von der gegenüberliegenden abgrenzte.
Ich blickte die Reihe entlang durch die Scheibe, bis ich die Person sah, welche hinter der Scheibe saß und mich anschaute. Es überraschte mich, dass sie hier war und gleichzeitig war es mir gleichgültig, so wie mir hier drin so gut wie alles gleichgültig geworden war. Dennoch ging ich auf sie zu und setzte mich ihr gegenüber. Sie nahm den Hörer ab und hielt ihn sich ans Ohr. Ich schaute sie an, bevor auch ich mir den Hörer nahm und mich bereit machte, nach so langer Zeit wieder mit ihr zu reden und ihre Stimme zu hören.
Ich schwieg und überließ ihr die ersten Worte.
»Hallo Clary«, begrüßte sie mich. Ich konnte in ihrer Stimme hören, dass sie nervös war.
»Hey Bella«, erwiderte ich und sah sie an. Sie schwieg. Offensichtlich wusste sie nicht, was sie sagen sollte. »Was willst du hier?«, fragte ich sie kalt.
»Was? Was ich hier will? Ich wollte dich sehen und dich besuchen!«, erklärte sie. Sie hatte diese Frage wohl nicht erwartet.
»Mich besuchen? Ja klar! Das glaubst du doch selbst nicht!«, fuhr ich sie an.
»Was? Wieso? Doch klar! Ich…«, fing sie an. Doch ich unterbrach sie.
»Nach 7 Wochen? Ernsthaft?! Du kommst nach 7 Wochen auf die Idee mich zu besuchen? Ich bin hier seit 7 Wochen und du hast mich nicht einmal besucht oder mir auch nur einen Brief geschrieben. Nichts! Ich habe nichts von dir gehört. Und das, weil ich dir die ganze Zeit egal war, wie ich es auch für alle anderen bin. Niemand interessiert sich für mich! Absolut niemand! Auch du nicht! Nicht einmal du…« Den letzten Satz sagte ich etwas leiser und Bella starrte mich an.
»Das stimmt nicht! Ich interessiere mich für dich. Du bist meine beste Freundin!«, widersprach sie. Ich schüttelte den Kopf.
»Du warst meine beste Freundin! Aber das ist Vergangenheit, so wie alles andere! Du hast mich in dem Moment im Stich gelassen, wo ich dich am meisten gebraucht hätte! Doch das war dir egal… Ich war dir egal. Du hast dich doch nur um dich selbst gekümmert! Wie immer! Ich war dir doch schon lange unwichtig geworden. Als ich mich damals verändert habe, hat das doch auch unsere Freundschaft verändert. Die Veränderung hat dir nicht gefallen. Ich habe dir nicht mehr gefallen. Ich war nicht mehr so, wie ich vorher war. Ich war nicht mehr gut genug für dich. Und was hast du gemacht? Nichts! Du hast mich fallen gelassen. Anstatt mir zu helfen, hast du es ignoriert. Du hast es nicht einmal bemerkt, dass ich Hilfe brauchte. Du hast deine Augen vor der Wahrheit verschlossen. Also erzähl mir nichts von besten Freunden! Wir sind doch schon lange nicht mehr so gut befreundet. Und das ist nicht meine Schuld! Nein. Es ist Deine! Denn du hast unsere Freundschaft nicht ernst genommen und mich immer mehr vernachlässigt. Du hast unsere Freundschaft verraten. Das ist alles deine Schuld!«, führte ich ihr die Vergangenheit vor Augen.
Ich sah wie sich ihre Augen mit Tränen füllten und sie wild den Kopf schüttelte. Sie war noch nie stark gewesen und konnte ihre Gefühle nicht verbergen, geschweige denn die Tränen zurückhalten.
»Das ist nicht wahr! Ich habe nichts bemerkt, weil du dich vor mir verschlossen hast. Du hast dich immer mehr von mir und der restlichen Welt abgeschottet! Ich kam überhaupt nicht mehr an dich heran. Und irgendwann wolltest du, dass ich mich von dir fernhalte!«, verteidigte sie sich.
»Und das hast du getan. Das war einer der Fehler, die unsere Freundschaft zerstört haben! Du hättest mich niemals allein lassen dürfen!«, erwiderte ich.
»Aber du wolltest es so!«, sagte sie und ich schüttelte meinen Kopf.
»Nein das wollte ich nicht. Du hattest die Wahl. Entweder du lässt mich allein oder du hilfst mir. Du hast dich für das Erste entschieden, das ist ja auch viel einfacher und beides geht nicht. Aber das war die falsche Entscheidung. Damit hast du das Todesurteil für unsere Freundschaft unterschrieben! Es ist deine Schuld. Es ist alles deine Schuld!«, redete ich auf sie ein.
»Es tut mir leid! Du verstehst das falsch! Es tut mir leid…«, flüsterte sie traurig.
»Vielleicht ein bisschen zu spät für eine Entschuldigung. Du kommst hier einfach hin, nach 7 Wochen, in denen du dich nicht für mich interessiert hast und erwartest, dass alles gut ist und ich dir alles vergeben kann? Da liegst du falsch! Ich kann nicht einfach alles vergessen! Du hast mich fallen gelassen und deinetwegen ist unsere Freundschaft kaputt gegangen! Aber das ist mir egal! Mir ist alles scheißegal! Du bist mir egal! So wie ich es für dich war. Also lass mich in Ruhe und komm nie wieder! Ich will dich nie wieder sehen! Nie wieder!«, schrie ich sie an.
Bevor sie irgendetwas sagen konnte, knallte ich den Hörer auf die Gabel und stand auf. Ich sah noch einmal kurz in ihr trauriges, verletztes Gesicht und wandte ihr dann den Rücken zu. Der Wärter öffnete mir die Tür und führte mich dann wieder zurück in meine kleine einsame Zelle.
Eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und Trauer breitete sich in mir aus und ich hatte das Bedürfnis, etwas gegen die Wand zu werfen. Leider war meine Zelle nicht sehr möbliert, also konnte ich nur den Stuhl gegen die Wand schleudern und mit meiner Hand auf diese einschlagen. Meine Hand ballte sich zu einer Faust und ich schlug so fest auf die Wand ein, dass es wehtat. Schließlich fing ich an zu schreien. Ich konnte mich nicht kontrollieren und schrie mir die Seele aus dem Leib. Dann ging ich zu meinem Bett und suchte es hektisch nach einer lockeren Schraube ab. Als ich eine fand, schraubte ich sie mit zittrigen Händen heraus und setzte mich dann aufs Bett. Dort setzte ich sie an meinem Unterarm an und drückte fest zu, als ich sie über meine Haut zog. Es entstand ein roter Strich, doch es kam kein Blut. Ich hatte nicht fest genug gedrückt. Also wiederholte ich den Vorgang, bis mein Arm mit frischen Wunden und Blut übersät war. Es fühlte sich so gut an, so befreiend. Dieser leichte, brennende Schmerz beruhigte mich. Ich wollte weitermachen, doch ich hörte mehrere Wärter, die meine Zelle betreten hatten und versuchten mich festzuhalten. Ich wehrte mich mit allen Kräften und schrie herum. Vergeblich versuchte ich sie abzuschütteln, als ich plötzlich etwas an meinem Hals spürte, was mir einen Stromschlag verpasste, woraufhin ich zu Boden sank und mein Bewusstsein verlor.
KAPITEL 2
Langsam öffnete ich meine Augen und schaute mich um. Ich lag auf einem Bett, welches weitaus bequemer als das in meiner Zelle war. Um mich herum befand sich nicht viel. Es gab nur ein paar Gegenstände, die man typischerweise in einem Krankenzimmer fand, denn dort war ich. Ich war schon öfter hier gewesen, deswegen hatte ich es sofort erkannt. Meist war ich allein. Nur manchmal traf ich hier andere Patienten. Da wir voneinander getrennt wurden, zumindest die meiste Zeit, und die Wärter uns immer überwachten, gab es normalerweise keine Schlägereien. Wer dennoch auf der Krankenstation lag hatte sich meist selbst etwas angetan. So wie ich.
Ich wollte aufstehen, doch ich war an das Bett gefesselt. Ich stöhnte genervt auf und versuchte mich vergeblich zu befreien. Doch die Fesseln saßen bombenfest. Mein Handgelenk schmerzte bei dem Versuch, mich davon zu lösen und ich sah auf den Verband, welcher dieses umschloss. Auch mein Unterarm war verbunden. Im Gegensatz zum Handgelenk war der Verband nicht mehr weiß, sondern mit roten Blutflecken versehen. Nach einer Weile gab ich es auf und blieb einfach still liegen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam eine Krankenschwester in Begleitung eines Wärters und untersuchte mich.
Als sie fertig war sagte sie: »Du kannst die Station wahrscheinlich heute Abend wieder verlassen.« Ich verdrehte die Augen. Wieso musste ich jetzt den ganzen Tag hierbleiben? Wenigstens war das Bett, in welchem ich lag, weitaus bequemer als das in meiner Zelle. Warum konnten die diese Betten nicht auch in unsere Zellen stellen? Das wäre doch für alle besser und man würde viel besser schlafen können. Aber wahrscheinlich waren die einfach zu geizig, uns dies zu gewähren und wollten uns quälen. Ich wollte gerade etwas sagen, als die Tür aufging. Meine Therapeutin steuerte schnurstracks auf den Wärter zu.
»Wieso hat mir niemand Bescheid gesagt?«, fuhr meine Therapeutin den Wärter an.
»Es tut mir leid. Das muss irgendwie untergegangen sein«, rechtfertigte sich dieser.
»Ihre Besuche müssen genehmigt werden und benötigen ein psychologisches Gutachten, damit genau das, was heute passiert ist, verhindert werden kann!«
»Es tut mir wirklich leid. Das wird nicht wieder vorkommen«, versicherte der Wärter ihr.
»Nein, das wird es nicht. Ich werde eine Besuchssperre beantragen. Dann muss vor jedem einzelnen Besuch ein Antrag gestellt werden. So wird sich das von heute nicht wiederholen.« Der Wärter nickte. »Gerade ihre ehemalige beste Freundin bringt alte Gefühle wieder hervor und löst etwas in ihr aus. Das belastet ihre Psyche sehr stark. Wir können von Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Sie hätte einen kompletten Nervenzusammenbruch haben können und einen noch viel stärkeren Wutausbruch! In Zukunft werden alle Besucher bei mir angekündigt, dann liegt es in meiner Beurteilung, ob er zugelassen wird oder nicht!«, erklärte meine Therapeutin entschlossen dem Wärter.
»Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich darum!«, antwortete der Wärter schuldbewusst.
»Sehr gut! Jetzt gebt ihr bitte Beruhigungsmittel. Ich will kein Risiko eingehen«, erwiderte sie. Dann wandte sie sich an mich und senkte ihre Stimme in einen besorgten Tonfall: »Ruh dich aus Clary. Wir sehen uns morgen und können dann über alles reden.« Ich verdrehte nur die Augen und drehte mich weg. Ich hörte wie meine Therapeutin noch leise mit der Krankenschwester redete. Schließlich verließ sie das Zimmer. Die Krankenschwester kam auf mich zu. Sie hielt eine Spritze in der Hand, welche sie mir injizierte. Ich nahm an, dass dies das Beruhigungsmittel war, über welches meine Therapeutin gerade gesprochen hatte. Ich schloss die Augen und versuchte zu schlafen, was mir bereits nach wenigen Minuten gelang.
Ich wurde durch ein leichtes Rütteln geweckt. Als ich meine Augen öffnete, erblickte ich die Krankenschwester.
»Du wirst gleich abgeholt und darfst wieder zurück in deine Zelle. Aber hör bitte mit dem Ritzen auf, das ist nicht gut für dich und es hilft dir nicht!« Ich lachte.
»Was wissen Sie denn schon? Das ist meine Sache, also hören Sie endlich auf damit. Es ist meine Entscheidung und was Sie für richtig halten interessiert mich einen Scheiß! Also lassen Sie mich in Ruhe und kümmern sie sich um ihre eigenen Sachen!«, giftete ich sie an.
»Ich will dir doch nur helfen! Du warst schon zu oft hier! Das muss doch irgendwann aufhören! Irgendwann wirst du es bereuen. Du kannst dein Leben wieder in den Griff bekommen und du kannst es hier raus schaffen!«, redete sie auf mich ein.
»Sie haben absolut keine Ahnung! Sie wissen doch überhaupt nichts über mich! Sie haben nicht den blassesten Schimmer von alledem hier, oder? Sie wissen doch gar nicht, wie es hier zugeht. Sie glauben ich kann geheilt werden? Schön! Glauben sie, was sie wollen. Aber vielleicht will ich ja gar nicht geheilt werden. Vielleicht bin ich eben genau das, was ich bin. Vielleicht bin ich die Person, die alle in mir sehen. Ja, ich bin eine Psychopathin und wissen Sie was? Ich bin stolz darauf! Ich ritze mich gerne und es hat mir Spaß gemacht diese Kinder umzubringen! Das bin ich! Das Monster, für das mich alle halten, das ist mein wahres Ich!«, schrie ich sie an. Geschockt starrte sie mich an.
»Nein das darfst du nicht denken! Das bist du nicht!«, widersprach sie mir. Ich schüttelte den Kopf.
»Hören Sie auf zu reden. Sie wissen rein gar nichts über mich und jetzt holen Sie einen Wärter, damit ich zurück in meine Zelle kann und mir nicht mehr Ihr jämmerliches Gelaber anhören muss!«, entgegnete ich und sah sie eindringlich an. Dann warf sie mir einen traurigen Blick zu und verschwand.
Wenig später kam sie mit einem Wärter wieder, der mir Handschellen anlegte und meine Fesseln löste.
»Aufstehen!«, sagte er grob und zerrte mich von dem Bett herunter. Wir gingen aus dem Raum hinaus auf einen Gang, auf dem noch weitere Krankenzimmer lagen. Als ich einen kleinen Abstelltisch entdeckte, hellte sich meine Miene auf, denn ich hatte etwas entdeckt. Auf dem Tisch lag ein Skalpell. Ich überlegte kurz, dann hatte ich eine Idee, wie ich es bekommen konnte. Als wir den Tisch passierten, tat ich so, als würde ich stolpern und das Gleichgewicht verlieren und stieß gegen den Tisch. Das Skalpell viel runter und auch ich ließ mich auf den Boden fallen. Ich stöhnte auf und versuchte dann mich wieder aufzurappeln und griff dabei nach dem Skalpell. Ich bekam es zu fassen und schob es schnell in meinen Ärmel. »Steh auf! Los! Weiter!«, befahl der Wärter und geleitete mich zurück zu meiner Zelle.
Als der Wärter wieder weg war, holte ich das Skalpell hervor und suchte ein geeignetes Versteck dafür. In einer Ecke lag ein Haufen Putz, der von der Wand abgebröckelt war. Kurzerhand versteckte ich es dazwischen und legte mich dann aufs Bett. Sie räumten den Putz nie weg, weshalb ich mir keine Sorgen machen musste, dass sie das Versteck fanden.
Ich starrte die hässliche Decke an und dachte nach. Über alles Mögliche, das Leben, mein Leben, den Ort, an dem ich war, wie lange ich hier wohl noch bleiben musste und wie ich fliehen konnte. Hier war es zwar auszuhalten, aber ich liebte nun mal die Freiheit. Ich wollte hier raus und… Ja was wollte ich machen, wenn ich draußen war? Ich wusste es nicht. Was würde ich in Freiheit machen? Ein neues Leben leben, nochmal von vorne anfangen und alles hinter mir lassen? Oder würde ich mein Leben weiterleben, so bleiben wie ich war und da weitermachen, wo ich aufgehört hatte? Wollte ich immer noch diese Personen sein, die ich jetzt war? Dieses psychisch kranke oder gestörte Mädchen, das Kinder umbringt? Oder wollte ich gesund werden und ein normales Leben führen? Normal – das war langweilig! Nein, ich wollte nicht normal sein, nicht wie die anderen. Ich war etwas Besonderes und das wollte ich auch bleiben. Ich mochte mein jetziges Ich. So wie ich war, war ich perfekt. Das war ich und das wollte ich auch sein. Ich wollte mich nicht verändern, für niemanden. Ich wollte genau so bleiben, wie ich jetzt war. Also ja, ich wollte die Person sein, die ich jetzt war und ich wollte weiterhin Kinder umbringen, weil es mir Spaß machte. So war ich nun mal. Ich brauchte kein normales Leben. Das war mein wahres Gesicht und würde es immer bleiben.
Ein teuflisches Lächeln schlich sich auf mein Gesicht. Ich würde hier irgendwie rauskommen, um meiner Bestimmung zu folgen, koste es was es wolle. Ich war bereit alles zu geben und zu riskieren, um frei zu sein.
Ich wurde von einem Klopfen aus meinen Gedanken gerissen. Als ich mich umsah erblickte ich den Wärter, der gegen meine Tür hämmerte. »Essen!«, sagte er streng und deutete auf das kleine Tablett, das er durch die Öffnung, die für diesen Zweck in der Tür eingebaut war, geschoben hatte. Ich stand auf, um es mir zu holen. Danach setzte ich mich wieder auf mein Bett, um dort zu essen. Es gab trockenes Brot, das bestimmt schon mehrere Tage alt war. Dazu gab es Kartoffelpüree, das nach nichts schmeckte und außerdem war da noch ein Glas Wasser. Auch wenn mich das Essen mehr anekelte als dass es mir Appetit machte, beschloss ich es dennoch zu essen, da ich großen Hunger verspürte. Also würgte ich schnell das Brot mit dem Kartoffelmatsch hinunter und trank das Wasser aus.
Nachdem ich fertig war, stellte ich das Tablett wieder vor die Tür und wartete auf den Wärter. Als dieser kam gab er mir meine Tabletten, die ich schlucken sollte. Ich tat so, als ob ich sie wirklich runterschlucken würde, doch in Wirklichkeit nutzte ich die Zeit dazu sie in meinem Wangen zu verstecken, wo man sie nicht sehen konnte, wenn ich den Mund öffnete, damit ein Wärter überprüfen konnte, ob ich die Medikamente wirklich geschluckt hatte.
Am Anfang hatte ich die Tabletten sogar wirklich geschluckt, aber mittlerweile tat ich das nicht mehr. Mir wurde oft schlecht davon und ich fühlte mich komisch. Außerdem war ich davon überzeugt, dass ich nicht krank war und deswegen wollte ich auch keine Tabletten schlucken. Ihrer Meinung nach war ich krank, doch ich wollte nicht gesund werden, wie sie es wollten. Und genau aus diesem Grund schluckte ich die Tabletten nicht, sondern spülte sie immer im Klo hinunter. Bis jetzt war es noch niemandem aufgefallen, worüber ich froh war, da sie mich sonst stärker kontrollieren würden.
Auch dieses Mal merkte der Wärter nicht, dass ich sie nicht geschluckt hatte. Er nickte nur und ging dann wieder weg. Als er außer Sichtweite war spuckte ich die Tabletten aus und steckte sie in meinen Ärmel. Dort war eine offene Naht, dank der ein kleines Täschchen entstanden war, in das die Tabletten hineinpassten. Ich setzte mich wieder auf mein Bett.
Als der Wärter wiederkam, um mich zur Toilette und zum Badezimmer zu begleiten, wartete ich schon und folgte ihm ohne Widerstand. Da bei den Tabletten auch welche zur Beruhigung dabei waren, konnte er meine Handschellen lösen, damit ich besser auf die Toilette gehen konnte. Dabei schaute er mir zum Glück nicht zu, sondern wartete nur davor, bis ich fertig war. Ich ging wie gewöhnlich aufs Klo, doch als ich fertig war, holte ich die Tabletten aus meinem Ärmel. Dann spülte ich sie hinunter und öffnete die Toilettentür, die man übrigens nicht abschließen konnte. Nachdem ich meine Hände gewaschen hatte, brachte mich der Wärter in das angrenzende Badezimmer. Ich putzte mir wie immer meine Zähne und wusch mein Gesicht.