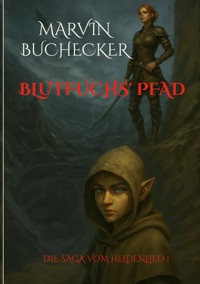Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: JustTales Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Toter im Feld, das Gesicht eingeschlagen bis zur Unkenntlichkeit, ruft die junge Profilerin Tanja Wilkes vor Ort. Mit dem Einsatz neuer Techniken soll sie die örtliche Polizei unterstützen und Klarheit in das Netz aus Blut, Gewalt und Bitterkeit zu bringen, notfalls auch gegen den Willen des ortsansässigen Kommissar Samt, der von Frauen bei der Polizei generell nicht viel hält. Dabei kommt sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur, das tief in der Vergangenheit begraben wurde - und besser dort geblieben wäre. Viel zu spät wird Tanja bewusst, wer ihr wahrer Feind ist und dass dieser entschlossen ist, jeden Mitwisser aus dem Weg zu räumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marvin Buchecker
Monster muss man töten
„Wer die Seele tötet, weckt die Dämonen.“
Saul Bellow, amerikanischer Schriftsteller (1915 – 2005)
Impressum
Ausführliche Information
über unsere Autoren und Bucher erhalten Sie auf
www.JustTales.de
Psychothriller von Marvin Buchecker
1. Auflage 2018
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
JustTales Verlag, Bremen
Geschäftsführer Andreas Eisermann
Copyright © 2018 JustTales Verlag
An diesem Buch haben viele mitgewirkt, insbesondere:
Lektorat: Michaela Marwich, Britta-Chr. Engel
Korrektorat: Michaela Marwich
Coverentwurf und Gestaltung: Hannah Böving
Buchsatz: Da-TeX Gerd Blumenstein, Leipzig
Paperback (ISBN 978-3-947221-10-3)
E-Book (ISBN 978-3-947221-11-0)
Ein Toter im Feld, das Gesicht eingeschlagen bis zur Unkenntlichkeit, ruft die junge Profilerin Tanja Wilkes vor Ort. Mit dem Einsatz neuer Techniken soll sie die örtliche Polizei unterstützen und Klarheit in das Netz aus Blut, Gewalt und Bitterkeit bringen, notfalls auch gegen den Willen des ortsansässigen Kommissar Samt, der von Frauen bei der Polizei generell nicht viel hält.
Dabei kommt sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur, das tief in der Vergangenheit begraben wurde – und besser dort geblieben wäre.
Viel zu spät wird Tanja bewusst, wer ihr wahrer Feind ist und dass dieser entschlossen ist, jeden Mitwisser aus dem Weg zu räumen.
Schreiben und soziales Engagement sind für mich wichtige Lebensinhalte. (Marvin Buchecker)
Marvin Buchecker ist ein echtes Kind des Ruhrgebietes. 1993 in Essen geboren und immer noch der Stadt verbunden, hat er nun sein Herz auch der Gemeinde Reken geschenkt, deren Bewohner und Institutionen, in und für die er sich gerne Zeit nimmt. Dies spürt man hier in seinem ersten Thriller deutlich.
Wir wünschen Ihnen spannende Unterhaltung – und freuen Sie sich: Die nächsten Geschichten des Autors warten schon, zu Papier gebracht zu werden.
Widmung
Für meine Mutter Manuela,
meinen Vater Holger,
meine Schwester Sharina,
meinen Bruder Julien,
meine Großeltern Horst und Christa,
Anneliese und Friedhelm,
Kurt und Regina.
Und für Anne,
die Frau an meiner Seite.
Und die Menschen, die mich in meinen
dunkelsten Stunden begleitet haben:
Pia, Henning, Ellen, Frank, Steffi,
Stephan, Bibbi, Andre und Mike.
Prolog
04.08.1994, 13:45 Uhr
„Lauf schneller, Klein-Fetti!“
Toms Befehl jagt „Fetti“ einen Schauer über den Rücken. Wieso lassen sie ihn nicht in Ruhe? Der Kies knirscht unter seinen schwerfälligen Schritten. Je hektischer er sich bewegt, desto mehr rutscht seine Jeans. Mit seinen fleischigen Fingern fasst er die Rückseite seines Hosenbunds und versucht, diesen immer wieder hoch zu ziehen. Sein kariertes Hemd ist bereits vom Schweiß getränkt und klebt an seinem Körper. Mit jedem Schritt wabbelt das überflüssige Fleisch an seinem Bauch. Er atmet schwer durch den Mund.
Wie lange könnte er noch vor ihnen weglaufen? Tränen bilden sich in seinen Augen, sein fettiges Haar haftet an seiner Stirn.
„Guck mal Tom, man sieht fast seinen Arsch“, gackert Jerome giftig. Er ist der Kleinere von beiden. Jerome, der immer noch nachtrat.
Toms Handlanger. Ein Mitläufer.
„Wir sollten ihm eine draufklatschen. Mal sehen, wie lange Fettis Arsch schwabbelt.“ Toms Stimme quietscht. Seine Mundwinkel, in dem mit Pickeln übersäten Gesicht, verziehen sich zu einem sadistischen Grinsen. Er war das erste Kind in der Klasse, das in die Pubertät gekommen war. Er wird ihm sicher wieder wehtun. Seine Schläge waren nicht so schlimm wie von Erwachsenen, aber sie taten trotzdem sehr weh.
Fettis schwitzige Finger halten immer noch den Stoff seiner Jeans fest. Ein Gefühl der Taubheit durchströmt seine Beine. Die Seite seiner Lenden fühlt sich beim Einatmen an, als würde ihm jemand ein Messer hineinstechen.
Ich muss noch ein Stück durchhalten.
Dieser Satz brennt sich in Fettis Kopf fest. Lässt ihn hoffen, seinen Peinigern zu entkommen. Er war ihnen bis jetzt doch immer entwischt. Warum soll ihm dieses Mal nicht die Flucht gelingen?
Hätte Fetti geahnt, dass dies seine letzte Flucht vor diesen Rüpeln sein würde, dass sein erbärmliches Leben, so wie er es kannte, in nicht einmal zehn Minuten vorüber sein würde – er wäre vielleicht stehengeblieben und hätte Toms Schläge eingesteckt. Doch Fetti war nicht in der Lage dies vorauszusagen. Kein Zwölfjähriger hätte dies gekonnt.
Schadenfroh brennt die Sonne auf Fettis Nacken nieder, während Tom und Jerome neben ihm her joggen. Sie sind viel sportlicher als er. Und viel stärker. Zwei Löwen, die die kranke Antilope jagen. Selektion. Eine natürliche Auslese. Sie haben ihn eingeholt und jetzt spielen sie noch ein wenig mit ihm.
Fetti fühlt sich verloren, sein ganzes Leben begleitete ihn schon dieses Gefühl. Der Mais, der zu dieser Jahreszeit seine volle Größe erreicht hatte, scheint ihm wie eine Wand. Eine grüne Falle. Er ist ganz alleine mit Tom und Jerome. Der Bauernhof, auf dem er lebt, mindestens noch zwei Kilometer entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erwachsener um diese Uhrzeit hier vorbeikommen würde, ist gleich null. Der Feldweg führt zu Fettis Elternhaus – alle im Dorf meiden diesen Hof. Aus gutem Grund.
„Na komm Tom, polieren wir ihm jetzt mal die Fresse. Meine Mudder kommt gleich nach Hause“, drängelt Jerome.
Immer noch grinsend lässt Tom seine Fingerknöchel knacken.
„Ich glaube heute schlage ich ihn mal in seine fette Wampe.“
Es gibt nur einen Ausweg. Mit einem schweren Seufzer macht Fetti einen Satz in das Maisfeld.
„Komm los, hinterher. Du gehst da lang“, hört er noch Toms quietschende Stimme hinter sich her brüllen.
Die scharfen Blätter der Pflanzen schneiden ihm durch sein Gesicht. Ziellos presst er sich durch die Reihen, die wie Soldaten in fester Formation stehen. Mit jedem Meter, den er tiefer in das Feld dringt, knickt er einen von ihnen um. Sie würden die Spur finden. Ihn erneut jagen. Es war aussichtlos. Seine Schuhe füllen sich mit Erde. Er stampft noch mehrere Minuten weiter, bis sich vor ihm eine bereits plattgetretene Fläche öffnet – vielleicht von einer Rotte Wildscheine? Die Fläche kommt ihm vor wie die Lichtung in einem finsteren Wald.
Fetti hat das Gefühl, als würde ihm eine fremde Person den Finger in den Hals stecken. Er hört hinter sich das Knistern von Tom und Jerome, die sich mühselig durch den Mais kämpfen. Es ist vorbei. Er hat keine Kraft mehr wegzulaufen. Nach Luft japsend blickt er um sich. Die Maiskolben ragen bedrohlich um ihn herum in den Himmel. Fast, als würden sie ihn für den Tod ihrer Artgenossen anklagen.
Er wendet seinen Blick ab. Graue Wolken schieben sich vor die Sonne. Das Licht dimmt deutlich ab. Das Schlucken bereitet ihm Schmerzen.
Bom, bom. Fettis Herz schlägt unregelmäßig. Unkontrolliert zittern seine Hände. Er schaut wieder zu den Maiskolben. Ihr Grün scheint dunkler geworden zu sein, ihre Reihen zusammengerückt. Undurchdringbar. Unheilvoll. Er kann durch sie hindurch nicht mehr das Ende sehen.
Wie weit war er in das Feld gelaufen? Ein Rascheln zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Er spürt einen kalten Atem in seinem Nacken. Langsam blickt er zu dessen Urheber. Seine Augen weiten sich. Es ist nicht Tom. Es ist auch nicht Jerome.
Er ist es.
Kein Zwölfjähriger hätte es voraussagen können, was nun passieren würde, kein Mensch hätte es gekonnt …
Kapitel 1
Gegenwart
Klack klack.
Klack klack.
Klack klack.
Mit der Spitze seines Daumens wischte Raphael Traudmann die feinen Tabakfasern in die Auskerbung der Stopfmaschine. Nicht zu lasch und auch nicht zu fest. Wenn er die Zigarette zu leicht stopfte, dann hatte er sie in wenigen Sekunden aufgeraucht. Was in Raphaels Beruf durchaus auch mal ganz praktisch sein konnte. Gerade dann, wenn er einen der Bewohner zu dem Einrichtungsbus schob und sich somit eine extra „Raucherpause“ schaffte.
Klack.
Er ließ das Oberteil der Stopfmaschine sinken. Mit dem Gefühl, sich bei einer Bombe zwischen dem blauen oder roten Draht entscheiden zu müssen, schob er vorsichtig die leere Zigarettenhülse in die dafür vorgesehenen Rohrstütze.
Es klackte erneut.
Zufrieden hielt Raphael die fertige Zigarette in seiner Hand. Er wiederholt einige Male diese Prozedur, bis er seiner Meinung nach genug Kippen produziert hatte, um den Arbeitstag zu überstehen. Entspannt wanderte sein Blick auf die Uhr des Pausenraumes.
6:56 Uhr.
„Ja Gerd, das ist wieder einmal der Fußballhammer des Jahres, Meister 2017 ist der FC Bayern noch bevor die Saison …“
Ehe die begeisterte Stimme des Radiomoderators noch weitersprechen konnte, hatte Raphael den Regler leiser gemacht. Er mochte den FC Bayern nicht. Zu viel Geld. Zu arrogant. Außerdem war er St. Pauli Fan. Einer von den richtigen Fans.
6:57 Uhr, sollte ich Simon noch besuchen?
Der Gedanke an seinen Bruder wärmte ihm für einen Augenblick das Herz.
Lieber nicht, es würde ihn so frühmorgens aufwühlen.
Er beschloss nach Feierabend einen Abstecher in Simons Gruppe zu machen. Ein neigte seinen Kopf und sein Blick fiel auf seinen Unterarm.
„SIMON“.
Es war seine erste Tätowierung gewesen; er war damals erst siebzehn Jahre alt.
Was für ein Glück, dass der Tätowierer die Kohle brauchte.
Simon war gerade ein Jahr alt gewesen, da hatte der Kinderarzt die Vermutung geäußert, dass er autistisch veranlagt sein könnte. Seine Eltern reagierten kaum auf diese Bedenken. Seine Mutter trank jeden Tag und sein Vater hatte nie Interesse an Raphael, geschweige denn an Simon gezeigt. Eher Verachtung. Er wollte nie Kinder haben, und das hatte er Raphael spüren lassen – seine gesamte Kindheit über. An diese erinnerte er sich nur wenig.
Die Bilder, was sein Vater mit ihm gemacht hatte – sie waren verdrängt. Begraben unter anderen Erinnerungen. Tief in seiner Seele, wo sie für immer bleiben sollten.
Die Tür des Pausenraumes wurde aufgeschwungen. Kira Sommer taumelte unbeholfen herein. Sie hatte unter ihrem Arm viel zu viele Aktenordner und war vermutlich mit ihren letzten Kräften die Treppen hochgekeucht. Der Aufzug der Einrichtung für Menschen mit Behinderung war seit zwei Tagen defekt. Was für Raphael und für die anderen Heilerziehungspfleger kein unerhebliches Problem darstellte. Jeder Bewohner im Rollstuhl musste nun die Treppe runtergetragen werden. Nicht jeder von diesen war ein Leichtgewicht.
„Guten Morgen Raffi“, seufzte Kira und ließ die Ordner auf den Tisch, an dem Raphael saß, niederfallen.
„Morgen“, brummte er als Antwort und räumte sein Stopfwerkzeug in seinen Jutebeutel.
„Schlecht geschlafen, Großer?“
Er musterte kurz ihren zierlichen Körper, ihre bunt gefärbten Haare gefielen ihm, dann sagte er: „Doch, ganz gut, wie ein Riesenbaby.“
Kira schmunzelte. „Ein sehr großes bärtiges Riesenbaby.“
Er erhob sich und nun hätte er ihr wirklich auf den Kopf spucken können. Mit seinen 1,93 m war er der größte Pfleger in der ganzen Einrichtung. In seinem Beruf war es manchmal von Vorteil so gebaut zu sein wie er. Als er noch bei der Bundeswehr war, schien es eher ein Nachteil. Beim Appell stach er immer aus der Kompanie und wurde gerne vom Ausbilder traktiert.
„Traudmann, machen Sie mal mehr Kniebeugen! Dann hören Sie auch auf, so ernst zu gucken!“
Raphael hasste Kniebeugen. Sie waren nicht für große Menschen gedacht.
„Ich werde aus Trost nicht schlau. Erst setzt er alles daran, dass Frau Ziller dieses neue Präparat bekommt, damit sie ihre Epilepsie unter Kontrolle kriegt.“ Sie atmete einmal tief ein; Raphael kannte diesen Tick von ihr, sie tat dies immer, wenn sie ein „Aber“ andeutete. „Aber er macht keinen Finger krumm, um den Aufzug reparieren zu lassen.“ Sie nahm sich einen der Ordner und schlug diesen auf.
„Na ja. Trost weiß halt, dass Frau Ziller Geld einbringt. Wir hingegen kosten Geld“, sagte Raphael.
„Ich freue mich ja für Frau Ziller, vor allem aber ist das Medikament teuer. Mich hat es nur gewundert, wie sehr sich Trost dafür stark gemacht hat, dass sie es bekommt.“
Raphael verdrehte die Augen. Kira versuchte ständig das Verhalten ihrer Mitmenschen zu interpretieren – vermutlich war sie deshalb auch Psychologin geworden. Doch das „Interpretieren“ war in ihrem Arbeitsfeld sowieso ein Problem. Es war immer sehr schwer, von beruflich wieder auf privat umzuschalten.
„Ich finde Herr Trost führt das Haus nicht mitarbeiterfreundlich“, begann sie erneut, doch Raphael hatte keine Lust sich über seinen Chef aufzuregen, es wäre sowieso sinnlos.
„Dann komm mal in meine Gehaltsklasse“, sagte Raphael kurz angebunden und schaute zur Uhr. 7:15 Uhr, er musste in seine Gruppe, die morgendliche Pflege begann gleich.
„Sag mal, hast du dich geprügelt?“, fragte Kira und deutete mit ihrem Zeigefinger auf sein Gesicht. „Dein linkes Auge sieht geschwollen aus.“
Er zuckte mit seinen Schultern. „Keine Zeit, die Schicht fängt an.“ Mit einem kräftigen „Rums“ schlug er die Tür hinter sich zu.
Der Korridor war leer. In Gedanken versunken schüttelte er seinen Kopf. Alles war hier steril. So aalglatt. Eigentlich völlig unpassend für die jungen Bewohner, besonders für Simon. Aber wenn man genau hinschaute sah man, wie die Fassade der Einrichtung bröckelte. So wie jede Fassade Risse offenbarte, wenn man sie genauer betrachtete. Mit seinem Handrücken strich er sich über sein Jochbein. Das Fleisch war gereizt und pochte. Er musste aufpassen; Menschen wie Kira schauten sehr intensiv auf Fassaden. Wenn er nicht wollte, dass seine Risse offenbart wurden – dann musste er auf der Hut bleiben.
„Bitte Joshua. Glaub mir.“ Es war erst 9:30 Uhr und Nikola Lehmann lallte bereits. Zielstrebig liefen sie in die Seitenstraße hinein.
Beim Gehen massierte sich Joshua seine Schläfe. Sein Kopf schmerzte. Hatte er gestern Abend getrunken? Er wusste es nicht. Es war lange her, dass er mit einem Filmriss aufgewacht war. Je mehr er sich versuchte an den gestrigen Abend zu erinnern, umso mehr schmerzte sein Kopf. Er fühlte sich gerädert, sein Körper protestierte bei jeder Bewegung. Der Tag gestern war sehr wichtig für Joshua gewesen. Die Erinnerung war ihm geblieben, doch was genau geschehen war? Er hatte es vergessen.
Pass auf, du bekommst noch Demenz.
Sein Bauch gluckerte, er hatte nicht gefrühstückt. Bloß der Gedanke an Essen ließ ihm übel werden.
Ich sehe bestimmt genauso grausam aus wie Nikola.
Sie hatte wieder das beschmierte Unterhemd an. Ihre braunen Haare waren fettig und zu einem zopfähnlichen Knäuel zusammengebunden. Ihre blauen „Crocs“-Schuhe quietschten beim Laufen. Das Quietschen machte seine Kopfschmerzen nicht besser.
„Ich glaube dir doch, Nikola“, versuchte er seine Klientin zu beruhigen. Genau wie bei einem Anwalt, war das für einen Sozialarbeiter eine Standardlüge. Glauben, vertrauen, ermutigen oder befähigen. Alles schöne Dinge, wenn sie nur klappen würden. Seit einem Jahr betreute er die trockene Alkoholikerin. Seit zehn Jahren war sie geschieden. Seit zehn Jahren hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Das einzige, was sie hatte, war der Alkohol.
„Hast du mit Herrn Weber geredet? Das wolltest du doch tun.“ Der Geruch von billigem Fusel begleitete Nikolas Worte.
Joshua hatte das vorgehabt. Er konnte sich nur auch daran partout nicht mehr erinnern. Was war denn nur gestern mit ihm gewesen? Hatte er einen Schlag auf den Kopf gekriegt? Das könnte passen, er war nicht wie sonst in seinem Bett, sondern auf dem Wohnzimmerboden liegend wach geworden. Erst hatte er überlegt die Polizei zu rufen, doch seine Wohnung sah nicht durchwühlt aus. Vielleicht sollte er später mal zum Arzt gehen. Oder sich nach dem Gespräch mit Herrn Weber, dem Leiter der Anonymen Alkoholiker, frei nehmen.
„Mir wäre es lieber, wenn du mit dabei bist, Nikola. Du kannst solche Gespräche führen. Das schaffst du.“ Wieder eine Lüge. Nikola war noch nicht mal in der Lage, sich gegen sich selber durchzusetzen.
Er fühlte sich zu Menschen, insbesondere Frauen, die in solchen Situationen waren, hingezogen. Helfersyndrom. Das Päckchen des Sozialarbeiters. Eine Schweißperle lief seine Stirn herunter. Sein kurzes braunes Haar war bereits nass. Es mussten mindestens schon 25 Grad sein. Vielleicht würde er frei machen und spazieren gehen? Den Kopf leeren. Er hatte viel Arbeit in letzter Zeit gehabt. Viel Arbeit bedeutet viel Stress. Wenig Zeit für sich selbst. Er sollte sie sich mal wieder nehmen. Das Schöne am Dorfleben war, dass die Natur nicht weit weg war.
„Ich habe es doch bereits versucht …“ Sie gurgelte und spuckte dann einen gelben Klumpen Schleim auf die Pflastersteine. Sein Magen fühlte sich noch flauer an, er ekelte sich vor Spucke.
„… aber er hat mich nur ausgelacht. Mir würde doch keiner glauben.“
Da bist du auch selber schuld, dachte Joshua, ohne es auszusprechen. Was war das auch für eine Geschichte, mit der Nikola zu ihm gekommen war?
Christoph Weber leitete seit zwanzig Jahren die Suchtgruppe in der Gemeinde Reken. Er war ein angesehenes Mitglied des 14.000-Seelen-Dorfes.
Jeden Donnerstag traf sich die Gruppe und tauschte sich über ihren Entzug aus. Machten sich gegenseitig Mut, gaben sich Lösungsstrategien oder hörten stumm den anderen Mitgliedern zu. Das Standardprogramm. Nikola war schon, bevor sie Joshua zugeteilt wurde, in dieser Gruppe, und bis letzte Woche gab es keine Probleme. Da behauptete sie plötzlich, dass Herr Weber sie erpresste.
Sie hatte sich Weber anvertraut und ihm gestanden, dass sie, um ihren Konsum zu finanzieren, mit kleinen Mengen Marihuana dealte.
Joshua wusste dies bis dato selber nicht, aber es war nichts Neues, dass Süchtige dealten. Es war ihm aber neu, dass Suchtberater dies ausnutzten. Ihr Vorwurf war nicht vorstellbar. Aber Joshua wusste auch dank seines Berufes, dass man Menschen nur vor den Kopf gucken konnte. Doch dieser Kopf hatte das gesamte Bistum Münster hinter sich stehen und war deshalb ein sehr heißes Eisen. Fingerspitzengefühl war jetzt gefragt.
„Ich hoffe, ich tue das Richtige, Joshua. Du weißt doch, mir wird immer schlecht, wenn ich mich gegen Männer meines Alters stellen muss.“
„Keine Sorge Nikola, wenn das, was du sagst stimmt, musst du nichts befürchten. Außerdem bin ich ja auch noch da.“
Sogar das Sprechen verstärkte seine Kopfschmerzen. Warum habe ich meine Sonnenbrille nicht mitgenommen? Anders als sonst empfand er das Licht der Sonne heute als lästig.
Vielleicht habe ich doch getrunken. Ich zähle später besser mal die Weinflaschen nach.
Außer in seinem Beruf hatte er nicht viel Kontakt mit anderen Menschen, wenn er jetzt das „Alleine trinken“ anfing, müsste er sich Sorgen machen.
Er schob seine Gedanken erstmal beiseite. Sie waren am Pfarrheim angekommen. Das mit Efeu umrankte Gebäude stand wie eine einsame Bastion zwischen den vielen verklinkerten Einfamilienhäusern. Die Rollladen waren noch nicht hochgezogen. Das Quietschen von Nikolas Crocs wurde intensiver, als sie sich der Eingangstür näherten. Joshua fühlte ihre Anspannung. Das würde jetzt kein leichtes Gespräch werden.
Doch sie wurden von einem Zettel an der Tür gestoppt. Mit schwarzem Filzstift hatte jemand auf diesen geschrieben:
Aus Krankheitsgründen fallen alle Gespräche heute aus. Gruß Christoph
Ein erleichtertes Seufzen entwich Nikolas Mund. Es war einfacher einem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
„Na toll …“, murmelte Joshua, während er sein Diensthandy aus der Jeanstasche zog. Er wischte mit seinen Fingern über den Touchscreen; es war keine Nachricht von seiner Einrichtung im „Messenger“ eingegangen. Hieß: Weber hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, im Büro Bescheid zu geben, dass ihr Termin ausfiel.
Hatte er doch schon mit ihm geredet? – Nein, er würde sich daran erinnern.
„Und jetzt?“, holte Nikola ihn aus seinen Gedanken.
„Also, ich brauche erstmal einen Kaffee. Wir können ja in einem Rollenspiel üben, wie das Gespräch ablaufen könnte.“
Nikola nickte wortlos. Wer weiß, was sie sich unter Rollenspiel vorstellte? Missmutig las Joshua noch einmal die Worte. Noch ahnte er nicht, was wirklich dahinter stand.
Wie jeden Morgen schloss Janina Renger ihre Wohnungstür hinter sich. Wie jeden Morgen begrüßte sie ihre Nachbarin mit einem gekünstelt freundlichen „Guten Morgen Frau Weber“, bevor sie langsam losjoggte. Es würde ein herrlicher Tag werden, die Sonne strahlte und die Temperatur erinnerte die junge Frau an ihren letzten Sommerurlaub.
Janina hatte Glück mit ihrem Beruf als Sekretärin; sie musste immer erst ab 14:00 Uhr auf der Arbeit sein. Weshalb ihr ritualisierter Frühsport nicht zu kurz kommen würde. Ihr Körper war der Vierundzwanzigjährigen besonders wichtig. Ehe sie mit ihrer Runde loslegte, postete sie noch ein Bild von sich auf Instagram mit der Info „Gehe jeden Tag an dein Limit“. Dann lief sie mit ihren neuen Adidas-Schuhen los. Erst mit langsamen Schritten, schneller würde sie werden, wenn sie den Feldweg in der Nähe ihres Wohnblocks erreicht hatte. Ihr Smartphone hielt sie fest in ihrer Hand. Während sie lief, begann der Schweiß an ihrer solariengebräunten Haut herunterzulaufen, als bereits ihr Handy vibrierte. Es war keine SMS oder WhatsApp, sondern nur die Benachrichtigung, dass zwei Benutzer unlängst ihr Foto mit „Gefällt mir“ markiert hatten.
Janina war es wichtig, in den sozialen Netzwerken präsent zu sein. Sie genoss die Bestätigung, dass sie einen trainierten Körper hatte. Insgeheim hoffte sie irgendwann so viele Follower zu bekommen wie Kristin Moor – ebenfalls eine aktive Nutzerin von Instagram & Co. in der Gemeinde Reken.
Sie erhöhte ihr Tempo. Der akkurat gepflasterte Bürgersteig war einem mit Löchern übersäten Feldweg gewichen. Sie blickte um sich, der Mais stand noch nicht besonders hoch. Wie Haarstoppeln ragten die kleinen Setzlinge aus dem Boden der Felder, die rechts und links des Weges bewirtschaftet wurden. Das wahre Dorfleben – kurz stand man noch zwischen Häusern und im nächsten Augenblick war man in der Pampa.
Vielleicht bleibe ich ja länger mit Emrin zusammen. Seine Eltern sind ja sehr tolerante Moslems. Dann könnten wir auch ein Haus in Reken bauen. Er verdient ziemlich gut. Ich könnte aufhören zu arbeiten. Er wäre eine gute Partie. Emrin weiß, was Frauen wie ich wollen.
An dieser Stelle wurde ihr Gedankenkarussell abrupt gestoppt. Sie stolperte über etwas Weiches und knallte mit einem langen Satz auf ihren Bauch. Das Smartphone flog ihr aus der Hand. Die Haut über ihrer Kniescheibe brannte. Irritiert schaute sie sich um.
„So eine Scheiße …“ Der Rest des Satzes blieben ihr im Hals stecken. Sie wollte schreien, doch sie konnte nur den Mund öffnen. Langsam stand sie auf. Ihr gesamter Körper zitterte. Ihr Hals fühlte sich an, als würde eine kräftige Hand ihn zudrücken. Sie machte kehrt und setzte sich langsam in Bewegung. Der Druck um ihren Hals fühlte sich immer stärker an. Wie paralysiert schlug sie die Richtung auf die Eingangstür des ersten Wohnhauses ein, das am Beginn des Feldweges stand. Sie presste die Spitze ihres Zeigefingers gegen die Klingel. Dauerklingeln. Erst als ein genervter älterer Herr ihr öffnete, lockerte sich der Druck um ihren Hals und sie begann zu schreien. Es war ein Schrei, der so viel Angst und Panik in sich trug, wie er nie wieder aus ihr herauskommen würde.
Kapitel 2
Kindheit, 15.02.1985
Das dreijährige Kind sitzt in der Finsternis auf seinem Bett. Die Matratze ist von seinem Urin durchzogen und der beißende Geruch lässt es husten. Rolf hat die Glühbirne des Zimmers rausgenommen. Es hatte sich eingenässt. Die Hose musste an bleiben. Das war seine Strafe.
Das Kinderzimmer ist völlig von der Dunkelheit verschlungen.
Was, wenn das Monster im Zimmer ist?Das Monster, das immer öfter kommt.
Seine Mutter könnte ihm nicht helfen. Das Monster hatte doch gesagt, es soll Pipi in seine Hose machen. Es hatte die ganze Zeit auf es eingeredet, bis das Kind nicht mehr einhalten konnte und sich in die Hose gemacht hatte. Dann war das Monster verschwunden.
Seine Schreie hallen durch das gesamte Haus. Dicke Tränen kullern aus den Augen des Kindes. Es hat Angst vor dem Monster, auch wenn das Monster behauptet sein einziger Freund zu sein.
Das Kind hat ihn oft gefragt, warum es ausgerechnet mit ihm befreundet sein wollte.
„Weil ich dich besonders lieb habe“, hat es mit seiner tiefen Stimme geantwortet.
„Aber der liebe Gott ist doch schon mein Freund.“ Das hat ihm jedenfalls seine Mutter eingetrichtert, der liebe Gott passt auf alle auf. Anscheinend nur nicht auf seine Mutter und ihn. Sonst würde Rolf ihnen diese bösen Dinge nicht antun.
„Das ist eine Lüge. Da, wo ich herkomme, gibt es keinen lieben Gott.“ Als das Monster dem Kind dies das erste Mal sagte, hat es dies noch entschlossen verneint. Doch mittlerweile ist seine Entschlossenheit Verzweiflung gewichen.
Der Geruch von vermoderter Erde vermischt sich mit dem des Urins. Zwei behaarte Pranken nehmen das Kind in eine kalte Umarmung. Der Körper des Kindes erstarrt, als der Atem des Monsters in seinen Nacken haucht: „Glaubst du noch an Gott?“, fragt es.
Als Antwort schüttelt das Kind nur mit seinem Kopf.
Das Monster kichert boshaft, dann wispert es dem Kind ins Ohr: „Glaubst du an mich?“
Diese Frage brennt sich tief in seine unschuldige Seele.
„Glaubst du?“
Kein bärtiger liebender Mann fragt es dies, kein wärmespendender brennender Dornenbusch und auch kein selig strahlendes Licht. Das Monster presste das Kind fester an sich.
Die Tränen kullern von der Wange des Kindes, das Flehen seiner Mutter und die wütenden Schreie von Rolf dröhnen als Echo und füllen die Finsternis.
„Glaubst du an mich?“ Dieses Mal ist Nachdruck in der Stimme.
Langsam beginnt das Kind zu nicken.
Gegenwart
„Gibt es heute Pudding?“, fragte Kai, wobei sich auf seinem flachen Gesicht ein breites Lächeln bildete. Seine gefurchte Zunge, die viel zu groß war, ragte wenige Millimeter aus seinem Mund. Ein Speichelfaden lief aus diesem und tropfte auf den sterilen Fußboden.
Raphael gluckste. „Keine Ahnung. Werden wir aber gleich erfahren, Kai.“ Neben dem großen Raphael sah der Bewohner seiner Gruppe wie ein Zwerg aus. Mit seinen Stummelfingern umfasste Kai die breite Hand des Heilerziehungspflegers. Kai hätte auch alleine zum Mittagessen gehen können. Doch Raphael wusste, dass er sich sicherer fühlte, wenn er begleitet wurde.
Kai war mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Früher wäre es ein Drama gewesen und den Jungen hätte man Zuhause gehalten oder in eine Förderschule gesteckt. Doch in der heutigen Zeit, in der das Wort „Inklusion“ als Menschenrecht für Menschen mit Behinderung im Grundgesetz verankert war, konnte Kai sich völlig barrierefrei entfalten. Jedenfalls in der Einrichtung, in der Raphael arbeitete. In seiner Gruppe war er das fröhlichste Kind. Das Kind, das auf jeden Bewohner Rücksicht nahm. Merkte, wenn es anderen, auch Pflegenden, schlecht ging. Nicht neidisch war, sondern sich freute, wenn andere ein Geschenk bekamen. Doch so waren fast alle Bewohner. Natürlich gab es auch mal Streit oder auch eine Rangelei. Doch Hass gab es nie. Diese Menschen waren so viel friedlicher als der Rest der Menschheit. Als die Menschen, die Raphael als Kind erlebt hatte.
Wenn er darüber nachdachte, wie verachtend sein Vater immer über „Diese Irren“ geredet hatte … bis zu jenem Tag, an dem seine Frau Simon bekam. Ab diesem Tag redete er nicht mehr über „Irre“. Er hatte bekommen, was er verdiente; das hatten sie alle bekommen.
„Traudmann.“
Eine sehr vertraute, dominant klingende Stimme ließ ihn in seiner Bewegung verharren. Ohne sich umzudrehen, antwortete er: „Herr Trost?“ Er sprach automatisch tiefer, wenn er mit dem Einrichtungsleiter redete.
„Auf ein Wort in meinem Büro.“ Dann fügte er noch „Sofort“ hinzu.
Raphael seufzte. Was wollte der Dicke jetzt schon wieder von ihm? Bestimmt war es wegen dem Ausstempeln; Raphael machte erst die Übergabe an die nächste Schicht, wenn er sich bei allen Bewohnern verabschiedet hatte. Das empfand er als richtig. Die halbe Stunde, die er dann länger blieb, wollte er noch nicht mal bezahlt haben. Doch er wusste, dass er Trost sowieso ein Dorn im Auge war.
„Den Rest musst du alleine gehen, Kai. Ist das Ok für dich?“
Kai lockerte den Griff um Raphaels Hand.
„Ja, ja.“ Kai ließ seinen Kopf auf dem kurzen Hals freundlich nicken. „Ich halte dir einen Pudding frei.“
Dann trottete er friedlich in Richtung der Kantine. Menschen wie er waren wirklich Engel.
Die anderen waren der Abschaum.