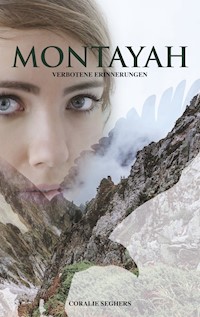
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kinder-&Jugendbuch ab 10 Jahren. Was ist, wenn nichts mehr so ist, wie es einmal war? Eine andere Welt, ein anderes Leben... Die Freundinnen Susan und Jessi werden in die bizarre und ärmliche Parallelwelt Montayah entführt. Susans Aufgabe ist es, sich um den immer fröhlichen Herrschersohn Mali zu kümmern, Jessi soll, entgegen ihren Willen, neue Herrscherin werden. Unter Zeitdruck planen sie ihre Flucht nach Hause in ihre alte (Konsum-)Welt. Durch Glück und die Hilfe ihrer Freunde kommen sie nicht nur an das alte Rezept für den Cocktail, der den Wechsel der Welten möglich macht, sondern auch an die einzelnen Zutaten. Ihre Suche führt sie in verschiedene geheimnisvolle und abenteuerreiche Regionen innerhalb und außerhalb der Bergkette, einer Begrenzung des Staatsgebietes. Dabei werden sie vom Herrscher Thimosius verfolgt und immer wieder vor neue, aufregende und auch lebensbedrohliche Herausforderungen gestellt, bei denen sie nicht nur an ihre körperlichen Grenzen geraten. In der wunderschönen, aber gefährlichen Neverland-Zone entscheidet es sich, ob ihnen die Flucht aus Montayah gelingt. Wollen sie vielleicht auch gar nicht mehr zurück? Ein Roman, der spannend, phantasievoll und auch gesellschaftskritisch geschrieben ist. Leseempfehlung mit fünf Sternen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für
CAROLINE
LENNART
PAUL JULIAN
LISA MARIE
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
KAPITEL 1
SUSAN
Wo bleibt Jessi denn? Diese Frage beschäftigte mich schon seit einer halben Stunde. Über Handy konnte ich sie nicht erreichen.
Morgens in der Schule hatten wir uns hier im Parkcafé verabredet, um unser Referat über „Religion im Mittelalter“ zu beenden. Eine dieser unsinnigen Hausaufgaben, mit denen uns unsere Religionslehrerin Frau Heuer zweimal pro Halbjahr quälte. Eigentlich waren wir total genervt, da wir das Thema absolut langweilig fanden und es zudem gerade die heißesten Tage des Sommers waren. Eine Abkühlung im nahe gelegenen Strandbad wäre uns da viel lieber gewesen. Wenigstens hatten wir uns an einem schön entspannten Ort mit den besten Milchshakes der Stadt verabredet.
Ich hatte mich für einen runden Bistrotisch in der Nähe der leise surrenden Klimaanlage entschieden, von dem ich gut die offen stehende Eingangstür und die gläserne Fensterfront zum See beobachten konnte. Ab und an hörte ich eine der vielen Enten schnattern, die leise ihre Bahnen auf dem ruhigen, silbrig schimmernden Wasser zogen. Sonnenhungrige Menschen lagen, von der außergewöhnlichen Hitze ermattet, auf ihren bunten Handtüchern oder Strandmatten in der Nähe des Seeufers. Die hohen Laubbäume spendeten ihnen Schatten. Ein Hund bellte. Freudig suchte er in den Uferzonen des Sees Abkühlung oder machte Jagd auf Haubentaucher, die sich zu nahe an den Schilfgürtel wagten. Schwalben flogen dicht über der Wasseroberfläche, um die dicksten Mücken in den riesigen Schwärmen zu erhaschen.
Getrübt wurde diese Sommeridylle von der schweren, stickig-heißen Luft sowie von ersten Wolken als Vorboten eines aufziehenden Gewitters. Ich fand, dass eine baldige Abkühlung bei solch einer schwülen Hitze von über 33 Grad gerade recht kommen würde.
Die Bedienung, kaum älter als ich selber, kam nun zum wiederholten Male an meinen Tisch.
„Was kann ich dir jetzt bringen?“
Sie war zwar immer noch freundlich, allerdings schon etwas fordernder als beim ersten Mal.
Ich überlegte kurz, ob ich einen der leckeren Milchshakes oder lieber eine Cola nehmen sollte. Wegen meines knappen Geldbeutels wählte ich eine große Cola mit Eiswürfeln, obwohl ich den Vanilleshake mit Schokostreuseln besonders liebte. Den gab’s dann vielleicht beim nächsten Mal.
Ich griff zu meinem brandneuen Handy, das vor mir auf dem Tisch lag, um keine Nachricht von Jessi zu verpassen. Mehr oder weniger lustlos fing ich an, im Internet zu surfen. Was für eine sinnlose Zeitverschwendung. Daher beschloss ich, schon mal alleine mit dem Referat fortzufahren. Unbedingt musste ich bis zu meiner geliebten Sportschau heute Abend damit fertig sein. Und das entweder mit oder ohne Jessi.
Seufzend angelte ich meinen Schulrucksack unter dem Tisch hervor, um den Spiralblock mit den handschriftlichen Aufzeichnungen herauszuholen. Dabei warf ich einen Blick auf mein Handy. Immer noch keine neuen Nachrichten oder Anrufe. Nach einer weiteren WhatsApp an Jessi begann ich, auf verschiedenen Internetseiten nach Informationen zu stöbern. Im Grunde führten diese Recherchen aber nicht wirklich zu neuen, bahnbrechenden Erkenntnissen.
Mit den Worten „Hier, deine Cola mit Eis“ wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. Unsanft stellte die Bedienung das Glas auf den Tisch, sodass ein wenig des klebrig-süßen Getränkes über den Rand schwappte. Egal. Ich nahm das Glas und trank hastig einen großen Schluck der eisgekühlten Cola. Das tat gut.
Ein leiser Luftzug kündigte das Eintreten neuer Gäste an. In Erwartung, dass es Jessi war, drehte ich mich zur Eingangstür um. Fehlanzeige. Langsam begann ich, mir ernsthafte Sorgen zu machen. Hoffentlich war ihr nichts passiert.
Ein Mann mittleren Alters, gekleidet mit einem beigen altmodischen Business-Anzug, braunen, hochglanzpolierten Lederschuhen und einer großen, dunklen Sonnenbrille auf der Nase betrat zögernd das Café. Einen schwarzen, an den Ecken schon recht abgestoßenen Aktenkoffer aus Leder presste er eng an seinen untersetzten Körper. Irgendwie wirkte das merkwürdig. Wie gerne hätte ich gewusst, was in dem Koffer war. Vielleicht Geld? Oder Schmuck? Diebesgut?
Suchend sah sich der Fremde in dem großen, sonnendurchfluteten Raum um, bis er sich schließlich an den Nachbartisch am Fenster setzte. Geistesabwesend nahm er die Getränkekarte. Er schien nervös zu sein. Unruhig blickte er immer wieder von der Karte hoch und sah sich hektisch im Raum um.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich meinen Tischnachbarn. Schon auf den ersten Blick war der Mann mir sonderbar erschienen. Warum, das konnte ich nicht sagen. Seine Erscheinung faszinierte mich, doch sie widerte mich gleichermaßen an. Seine leicht fettigen, schwarzgrauen Haare, die nur noch einen schmalen Kranz um seinen Kopf bildeten, waren im Nacken mit einem einfachen roten Gummiband zu einem winzigen Zopf zusammengebunden. Über sein blasses Gesicht rannen im Zeitlupentempo erbsengroße Schweißperlen. Seine unreine, großporige Haut erinnerte mich an einen unfertig gebackenen, fettigen Pfannkuchen. Sein leicht untersetzter Körper war in ein hellblaues, deutlich verschmutztes Hemd gepresst. Bei jedem seiner Atemzüge wartete ich gespannt darauf, dass die Knöpfe seines zu engen Hemdes abplatzten und sein Schwabbelbauch zum Vorschein kam. Was für eine eklige Vorstellung.
Umständlich zog der Fremde seine Jacke aus, die er über die hölzerne Lehne seines Stuhls hängte. Die nassen Flecken unter seinen Achseln waren widerlich. Er musste unter starker Anspannung stehen. Ich beobachtete, wie er nervös mit Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand auf der Tischplatte zu trommeln begann. Vielleicht war er ein Krimineller? Ein gesuchter Verbrecher?
Ich schüttelte mich, als mir sein Schweißgeruch in die Nase stieg, der sich im ganzen Café ausbreitete. Zumindest kam mir das so vor. Auch von anderen Gästen war er schon bemerkt worden, die nun ebenfalls angewidert zu ihm herüberblickten.
Erneut versuchte ich, mich auf meine Aufzeichnungen zu konzentrieren, doch meine Gedanken klebten nach wie vor bei dem Typen. Was war bloß das Besondere an ihm?
Vielleicht hatte sich mein Instinkt aber einfach nur getäuscht. Trotzdem. Jedenfalls war er eine willkommene Ablenkung von dem langweiligen Referat. Immer wieder warf ich einen Seitenblick zum Nachbartisch. Zwischenzeitlich hatte er sich ein Glas Mineralwasser bestellt, das er hastig in einem Zug geleert hatte. Entweder sah er auf seine goldene Armbanduhr oder schaute weiterhin mit unruhigem Blick im Raum umher. Ob er vielleicht noch jemanden erwartete, der oder die sich, genau wie Jessi, verspätete? Oder fühlte er sich selber beobachtet, weil er etwas auf dem Kerbholz hatte? Oder hatte dieses seltsame Auftreten mit dem Aktenkoffer zu tun, den er mittig unter den Tisch zwischen seine Füße presste?
Nachdenklich lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück. Ich starrte auf mein leeres Glas und malte mir die verschiedensten Szenarien über die Umstände des rätselhaften Unbekannten aus. Hatte ich in letzter Zeit vielleicht zu viele Krimis gelesen, sodass ich nun schon zu einer Agentin mutierte?
Während ich grübelte, ließ ein leichter Windstoß mein oberstes Notizblatt auf den Fußboden wehen. Mit sanft schaukelnden Bewegungen landete es zwischen meinem Tisch und dem Nachbartisch auf den weißen, leicht klebrigen Steinfliesen. Sofort beugte ich mich nach unten und streckte meinen rechten Arm aus, um das Papier aufzuheben. Im gleichen Moment neigte sich auch der Fremde unter den Tisch. Ich kam ihm zuvor und ergriff als erstes den Bogen. In diesem Moment waren unsere Köpfe nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Für eine Millisekunde trafen sich unsere Blicke. Obwohl der Mann eine dunkle Sonnenbrille trug, fielen helle Sonnenstrahlen so auf sein fahles Gesicht und seine Brille, dass ich das Aussehen seiner Augen erahnen konnte. Obwohl es heiß war, lief mir ein kalter Schauder über den Rücken, der sich bis in jede einzelne Zehe und jede kleinste Haarspitze hin ausbreitete. Seine Augen waren unnatürlich weit aufgerissen und wirkten starr wie Glasaugen, zugleich aber auch unglaublich durchbohrend. Mir wurde heiß. Auf seltsame Weise fühlte ich mich erkannt. Durchschaut. Gläsern. Blitzschnell wandte ich meinen Blick ab und setzte mich wieder gerade hin. Regungslos saß ich auf meinem Stuhl und starrte auf das Colaglas. Sah ich jetzt schon Dinge, die es gar nicht gab? Hatte ich mir die sonderbaren Augen des Mannes etwa nur eingebildet?
Nachdem ich mich von dem Schreck erholt hatte, musste ich über mich selber lachen. Wie blöd war ich! Und tatsächlich bekam ich ein schlechtes Gewissen dem hilfsbereiten Fremden gegenüber. Schuldbewusst schielte ich zum Nachbartisch rüber, aber der Mann war spurlos verschwunden. Nur ein paar Münzen und das leere Glas zeugten von seiner Anwesenheit. Die leise Hintergrundmusik eines italienischen Sängers, das Gemurmel und Lachen der Gäste sowie das Klappern der Espressotassen hinter der Bar klangen beruhigend vertraut. Irgendwie war ich erleichtert und schaute aus dem Fenster.
Der Himmel hatte sich in der Zwischenzeit verdunkelt. Die vorher entspannten Leute auf der Wiese rafften eilig ihre Sachen zusammen und flohen vor dem aufkommenden Gewitter. Auch im Eiscafé war es unruhig geworden. Einige Gäste verließen hektisch ihre Plätze, andere riefen unruhig nach der Bedienung, um ihre Eis- und Getränkerechnungen zu bezahlen, bevor sie sich ebenfalls zügig auf den Heimweg machten.
Auch ich entschied mich dafür, möglichst schnell nach Hause zu gehen. Wenn ich mich beeilte, würde ich es bestimmt noch vor Beginn des Gewitters schaffen. Da ich nicht auf die überlastete Bedienung warten wollte, legte ich das abgezählte Geld sichtbar neben mein leeres Colaglas. Auf dem Rückweg wollte ich noch kurz bei Jessi nachsehen, ob alles in Ordnung war. Sicherlich gab es eine ganz einfache Erklärung dafür, warum sie nicht wie verabredet erschienen war und sich auch nicht per Handy gemeldet hatte. Vielleicht waren ihre Kopfschmerzen von heute Morgen schlimmer geworden? Oder hatte sie unser langweiliges Referatstreffen einfach vergessen?
Das war nicht undenkbar, wenn sie einen neuen Schwarm hatte. Seit letzter Woche sah man Jessi fast jede freie Minute mit dem gutaussehenden, blondgelockten Marek aus dem Jahrgang über uns. Vielleicht haben die beiden den ganzen Nachmittag WhatsApp geschrieben und darüber die Zeit vergessen?
Ich schmunzelte, schließlich gönnte ich Jessi ihren neuen Schwarm von Herzen. Wie gut, dass wir beide auf ganz unterschiedliche Typen standen. Dunkle Haare, top durchtrainierte Figur, Sixpack, am besten noch Kampfsportler. Das war schon eher was für mich als Jessis blonden „Softies“, wie ich sie immer im Spaß nannte. Stopp! Ich musste schnell los.
Hastig fischte ich meine pinkfarbene, mittlerweile extrem zerknüllte Sportjacke aus dem Rucksack und zog sie über. Jetzt war genug Platz für Block, Mappe und Etui. Versehentlich stieß ich beim Einpacken an meinen Kugelschreiber, der zu Boden fiel. Während ich mich bückte, entdeckte ich unter dem Nachbartisch einen gefalteten Zettel. Ich hätte schwören können, dass er vorhin, als ich mich an den Tisch gesetzt hatte, dort noch nicht gelegen hatte. Mein Spürsinn war von neuem geweckt. Vielleicht eine Notiz des Fremden? Etwa ein Geheimcode? Oder nur ein einfacher Einkaufszettel?
Schnell schnappte ich mir das Papier, das schon recht abgegriffen war, und faltete es auf. Die Buchstaben waren unordentlich mit schwarzem Filzstift geschrieben. Eine Liste.
Ein Teil des Zettels war abgerissen und damit auch das Geschriebene unvollständig.
„Hä? Susan? Warum steht denn da mein Name?“, stieß ich lautlos hervor und legte die Stirn in Falten. War das Zufall oder steckte da womöglich ein tieferer Sinn dahinter? Hatte der Fremde etwas damit zu tun und war er es gewesen, der den Zettel bewusst oder unbewusst verloren hatte? Wollte er vielleicht sogar, dass ich ihn finde?
Quatsch! Sicherlich war das nur ein Notizzettel von einer meiner Freundinnen, der sich zwischen meine Sachen geschummelt hatte und rausgefallen war. Mamas Schrift war es jedenfalls nicht.
Trotzdem wollte ich nur noch weg. Fort von dem Ort, an dem meine Fantasie mit mir durchging. Hektisch riss ich meinen Rucksack hoch. Während ich zur Tür rannte, verfing sich ein Träger an einer Stuhllehne und der Stuhl kippte laut krachend um. Eine genervte Kellnerin beschimpfte mich, doch ich ignorierte ihre unfreundliche Aufforderung, den Stuhl wieder hinzustellen. So schnell ich konnte, sprintete ich los.
Dicke Tropfen schienen die stickige Luft wie Pistolenkugeln zu durchlöchern. Ein erster Donner krachte nicht weit vom Stadtpark entfernt. Mein Rucksack wippte auf meinem Rücken auf und ab, wobei sich meine Trinkflasche in meinen Rücken bohrte. Ich spürte keinen Schmerz, doch morgen würde ich an dieser Stelle einen großen Bluterguss haben. Egal. Durch den immer stärker einsetzenden Regen klebten mir die Kleider an meinem Körper. Unangenehm fühlte sich das an. Strähnen meiner blonden, langen Haare hatten sich aus dem Pferdeschwanz gelöst und hingen mir wirr ins Gesicht.
Der Wind blies nun so stark, dass ich nur langsam vorwärtskam. Zudem bekam ich Seitenstechen, obwohl ich total fit war. Zu Jessi wollte ich jetzt doch nicht mehr. Der eigentlich kurze Heimweg kam mir unendlich lang vor, die Straßen waren fast menschenleer. Unbewusst hielt ich den Zettel fest in meiner Faust eingeschlossen, um ihn vor dem mittlerweile starken Regen zu schützen. Ich rannte, so schnell ich konnte.
Grelle Blitze zuckten am dunkelgrauen Himmel, laute Donnerschläge hallten nun in Sekundenabstand um mich herum. Was für ein Naturschauspiel. Normalerweise hätte ich mir vermutlich einen sicheren Unterschlupf gesucht, um das Gewitter in aller Ruhe anzusehen. Doch heute war es anders. Zu Hause zu sein war das Einzige, was ich jetzt wollte. In der Ferne konnte ich schon die weiß gestrichene Gartenpforte und den hohen, alten Apfelbaum mit seinem dichten Geäst ausmachen. Und dann, wenige Sekunden später lief ich den schmalen, überschwemmten Kiesweg entlang und konnte mich gerade noch vor dem Fallen retten. Das schlammig-braune Regenwasser spritzte mir bei jedem Schritt bis zu den Knien hoch. Aus den Augenwinkeln nahm ich die überfluteten Blumen- und Gemüsebeete mit den vom Regen zerschlagenen Blüten war. Was für ein trauriger Anblick!
Zumindest war ich angekommen und in Sicherheit.
KAPITEL 2
SUSAN
Nachdem ich zitternd meinen Daumen auf die Klingel gepresst hatte, sank ich erschöpft keuchend auf den braunen Kokosabtreter, der alle Besucher mit der Inschrift „Herzlich Willkommen“ empfing.
Ich japste nach Luft und hatte das Gefühl, dass meine Adern unter dem rasenden Puls bersten würden.
Niemand öffnete.
„Scheiße! Total herzliches Willkommen, bei diesem Sauwetter!“, schimpfte ich wütend vor mich hin und klingelte erneut. Diesmal deutlich länger. Wieder nichts. Ich überlegte. Genau. Mein Vater war auf Geschäftsreise. Und meine Mutter nahm jeden Mittwoch Tennisstunden bei Erol, dem extrem süßen Tennistrainer, im nahegelegenen Sportzentrum. Ich seufzte. Also blieb mir nichts weiter übrig, als meinen durchnässten Rucksack nach meinem eigenen Hausschlüssel zu durchforsten.
Fehlanzeige. Das kleine, violette Filztäschchen in Form einer Eule, das ich zu meinem zehnten Geburtstag bekommen hatte, war nicht da. Verdammter Mist. Genervt kippte ich den Inhalt des Rucksacks in die noch trockene Ecke an der Haustür. Wieder nichts. Ich musste also auf anderem Wege ins Haus kommen. Aber wie?
Auf Mama war immer Verlass, besonders wenn es darum ging, das Haus vor Dieben zu schützen. Nachdem bei einem Einbruch vor drei Jahren ihr ganzer Schmuck geklaut worden war, hatte sie im ganzen Haus abschließbare Fenster- und Türgriffe anbringen lassen, die sie jedes Mal gewissenhaft kontrollierte, bevor sie das Haus verließ. Vermutlich war das jetzt mein Pech. Trotzdem musste ich nachsehen, ob mich nicht zufällig doch ein offenes Fenster oder eine unverschlossene Tür retten konnte.
Genervt raffte ich mich auf. Umhüllt von Blitz und Donner rüttelte ich an allen Fenstern und Türen. Fehlanzeige. Alles war, wie ich erwartet hatte, fest verschlossen. Ernüchtert setzte ich mich wieder auf die Fußmatte und merkte erst jetzt, wie kalt mir war. „Verdammte Scheiße“, brüllte ich in den prasselnden Regen hinein. Ich war wütend. Auf mich. Auf Mama. Auf die Welt. Auf alles eben.
Frustriert beobachtete ich, wie erste Rinnsale meinen Spiralblock und das verhasste Mathebuch erreichten. Sollte das Papier doch aufweichen. Wie egal war mir das in diesem Moment. Zum Glück klang der Donner nun weiter entfernt, auch die Abstände zwischen Blitz und Donner wurden größer. Der Regen hatte jedoch eher noch an Stärke zugenommen. Er glich, abgesehen von der Temperatur, dem Duschstrahl, unter dem ich jeden Morgen minutenlang versuchte, wach zu werden.
Die Lufttemperatur war erheblich gesunken. Ich fror nun noch mehr, eine Erkältung war damit schon vorprogrammiert. Obwohl der Reißverschluss meiner Trainingsjacke bis obenhin zugezogen war, schaffte ich es, das untere Bündchen über meine angezogenen Knie zu zerren, um mich auf diese Weise vor der aufsteigenden Kälte zu schützen. Im Geiste hörte ich Mama schimpfen, dass so meine teure Sportjacke ausleiern würde. Wie egal war mir das in diesem Moment. Wichtiger war es, dass ich nicht noch mehr auskühlte und ich einen Plan entwickelte, was ich machen sollte. Vielleicht zu Jessi laufen und ihr die ganze Geschichte mit dem mysteriösen Fremden und seinen merkwürdigen Augen erzählen? Oder besser den Bus zur Tennishalle nehmen? Oder eine Scheibe am Haus einschlagen?
Während ich fieberhaft überlegte, klingelte plötzlich mein Handy.
„Wie bin ich doch bescheuert! Jessi oder Mama anzurufen, daran hätte ich gleich denken können“, schimpfte ich mit mir selber und drückte das Feld mit dem grünen Hörer. Ich hörte ein leises Rauschen, dann ein Knacken und die Verbindung wurde, wahrscheinlich durch eine gestörte Funkverbindung, unterbrochen. Bei Gewitter kam das schon mal vor. Also kein Grund zur Sorge, beruhigte ich mich selbst.
Dann versuchte ich es bei Mama und auch bei Jessi. Erfolglos. Nachdem ich beiden eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen hatte, steckte ich genervt das Handy zurück in meine Jackentasche. Dann wartete ich.
Der Regen hatte nachgelassen und ich konnte los. Um meine eiskalten Glieder nicht zu überfordern, lief ich mit leichtem Laufschritt durch die Gartenpforte auf die mit großen Pfützen übersäte Straße. Irgendwie beschlich mich das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich drehte mich mehrmals um, konnte aber niemanden entdecken. Also alles nur ein Hirngespinst meiner übermächtigen Fantasie.
Ich joggte durch das Wohngebiet hin zu der belebten Hauptstraße mit ihren zahlreichen kleinen Geschäften und gemütlichen Straßencafés, in denen ich mich gerne mit meinen Freundinnen traf. Bei diesem Wetter war die Straße jedoch menschenleer, kein Hund hielt sich freiwillig draußen auf.
Unter der Markise des altmodischen Bekleidungsgeschäftes stoppte ich, um zu verschnaufen und einen Blick auf mein Handy zu werfen. Vielleicht hatte ich das Klingeln überhört.
Immer noch keine Nachrichten. Machte sich denn niemand Sorgen um mich und wollte wissen, wo ich bei diesem saumäßigen Wetter steckte?
Enttäuscht ließ ich meinen Blick über die trostlose Straße und die Geschäfte schweifen. Die Gullis konnten die Flut an Wassermassen nicht mehr bewältigen. Fast wäre ich noch nasser geworden, als ein Auto direkt vor mir durch eine riesige Pfütze fuhr, doch ich konnte gerade noch dicht an die Hauswand springen. Was für ein Vollidiot!
Als ich wieder loslaufen wollte, sah ich jemanden am Bistro auf die Hauptstraße einbiegen. Endlich noch so eine verrückte Menschenseele, die sich nach draußen gewagt hatte. Nach und nach konnte ich ihn immer deutlicher erkennen und war mir sicher, dass ich ihn kannte. Er ging langsam, sein Kopf war gesenkt. Vor seine Brust presste er einen Aktenkoffer. Jetzt war klar: Es war der seltsame Fremde aus dem Café. Panik ergriff mich. Kopflos stürzte ich in das altmodische, leicht muffig riechende Bekleidungsgeschäft, in dem Mama allenfalls ein paar Strümpfe kaufte. Schon die wenig ansprechend dekorierten Auslagen im Schaufenster richteten sich an Damen im höheren Seniorenalter. Keine der Verkäuferinnen war zu sehen. Sie tranken, so vermutete ich, im hinteren Büroraum Kaffee und unterhielten sich dabei über die neusten Strickanleitungen, da sie bei diesem Wetter keine Kundschaft erwarteten. Das war perfekt. Schnell schlüpfte ich in eine Umkleidekabine, zog die Vorhänge zu und ließ mich erschöpft auf den abgenutzten, mit braun-orangenem Samt bezogenen Hocker sinken. Wenigstens war es angenehm warm. Vorsichtig öffnete ich mit zwei Fingern einen schmalen Schlitz zwischen den beiden Vorhangschals und spähte hindurch zur Ladentür.
Warum ich mich vor diesem Mann fürchtete, war mir selber ein Rätsel. Wahrscheinlich hatte ich mich gedanklich in irre Fantasien verstrickt, die purer Unsinn waren. Vielleicht sollte ich in der nächsten Zeit besser meinen Krimikonsum drosseln, gab ich mir selber den Rat, während ich den Gehweg beobachtete.
Da kam er. Langsam trottend ging er am Geschäft vorbei. Pitschnass. Den Kopf gesenkt und den Blick auf den Gehweg gerichtet. Er wirkte erschöpft. Irgendwie fertig mit sich und der Welt. Er schien mich eben nicht bemerkt zu haben. Warum auch?
Erleichtert lehnte ich mich mit dem Rücken an die hölzerne Wand der Umkleidekabine und schloss für ein paar Sekunden die Augen. Dann wagte ich einen Blick in den Spiegel. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah: Ein komplett durchnässtes und verschrecktes Mädchen. Welch trostloser Anblick. Das schummrige Neonlicht tat sein Übriges dazu. Nach einer Schrecksekunde riss ich mich zusammen und überlegte, wie es weitergehen sollte. Ewigkeiten konnte ich hier nicht verbringen, ohne von einer der in schwarz-weiß gekleideten Verkäuferinnen entdeckt zu werden. Wie peinlich würde das sein!
Ich musste telefonieren. Obwohl mein Handy in der Innentasche meiner Jacke leicht feucht geworden war, funktionierte es noch. Da auch jetzt weder Mama noch Jessi erreichbar waren, versuchte ich es bei meiner Freundin Mia, die ganz in der Nähe der Hauptstraße wohnte. Vielleicht konnte sie mir helfen.
Glücklicherweise war Mia zu Hause. Dankbar nahm ich ihr Angebot an, zu ihr zu kommen. Es gelang mir, mich unbemerkt aus dem Laden zu stehlen. Von dem Fremden war weit und breit nichts zu sehen. Mittlerweile hatten erste Sonnenstrahlen den Regen und die grauen Wolken vertrieben. Ein wunderschöner Regenbogen spannte sich von der golden schillernden Kirchturmspitze über die dunkelroten, nass glänzenden Dächer der Altstadt bis hin zum kleinen Wäldchen in der Nähe meiner Schule. Letzte dicke Regentropfen fielen von den Bäumen und Häusern. Die Gullys hatten nach wie vor Mühe, die Wassermassen zu fassen, sodass die auf den Straßen und Bürgersteigen nun wieder mehr werdenden Passanten Slalom um die Pfützen laufen mussten. Die jetzt abgekühlte Luft war wieder klar und roch angenehm frisch.
Nach nur wenigen Minuten bog ich erleichtert in die Gartenstraße ein, in der das rettende Reihenhaus von Mias Eltern stand. Meine Freundin wartete bereits in der geöffneten Haustür und begrüßte mich grinsend: „Hi Su, wo kommst du denn her? Ey, sag mal, und wie siehst du überhaupt aus? Hast du in einer Pfütze gebadet?“ Und schon hatte sie mich, ohne meine Antwort abzuwarten, ins Bad in der ersten Etage gezogen, wo bereits ein Handtuch und trockene Kleidung auf mich warteten.
Während Mia Tee kochte, föhnte ich meine Haare und zog die etwas zu große Kleidung über. Egal. Hauptsache, ich war wieder trocken und das entsetzliche Kältegefühl wich schnell aus meinen Gliedern. Vorsichtshalber vermied ich einen Blick in den Spiegel, denn ich wollte nicht nochmal geschockt sein. Und überhaupt: Für Eitelkeit war jetzt keine Zeit.
Ein Platz an der Heizung, eine große, köstlich schmeckende Tasse Pfefferminztee und ich wurde langsam wieder die Alte. Ich lächelte Mia dankbar an.
„Na komm schon, jetzt erzähl! Warum in aller Welt treibst du dich bei diesem Wetter draußen rum? Irgendwie warst du vorhin total durch den Wind, als du mich angerufen hast.“ Erwartungsvoll sah Mia mich an.
Ich beschloss, ihr wahrheitsgemäß von dem Referat, der missglückten Verabredung im Parkcafé, dem aufkommenden Gewitter und dem fehlenden Hausschlüssel zu berichten. Den Fremden und den mysteriösen Zettel wollte ich lieber verschweigen. Langsam kam ich mir selber lächerlich vor. Außerdem sollte sich morgen nicht die ganze Klasse über mich lustig machen. Mia war zwar eine gute Freundin, doch mit Geheimnissen musste man bei ihr zurückhaltend sein. Diese Erfahrung hatten wir, Jessi und ich, leider schon mehrmals machen müssen.
Als es an der Haustür klingelte, ließ mich Mia für ein paar Minuten alleine. Ich nutzte die Zeit, um mir nochmals die Ereignisse von vorhin ins Gedächtnis zu rufen. Wahrscheinlich war alles nur ein unglaublicher Zufall und die vielen Krimis von Mama, die ich in letzter Zeit verbotener Weise verschlungen hatte, hatten meine Phantasie übermäßig aufblühen lassen. Da war ich jetzt sicher. Der Fremde war nur ein hilfsbereiter, altmodischer Mensch gewesen, der seine kranken Augen mit einer Sonnenbrille schützte. Und die Begegnung auf der Straße war einfach nur Zufall gewesen. Langsam schämte ich mich sogar für meine voreilige Beurteilung. Und was die unvollendete Nachricht anging, so war diese sicher nicht für mich bestimmt gewesen. Und warum mein Name...
Mia betrat ihr Zimmer mit einem Teller voll Schokokeksen. Erst jetzt spürte ich meinen riesigen Hunger. Gierig griff ich zu. Die Zeit verstrich schnell, bis Mama mich am späten Nachmittag mit dem Auto abholte.
Nachdem ich zu Hause ausgiebig die wohltuende Wärme der Badewanne genossen hatte, machte ich es mir auf dem Sofa bequem und ließ mich vom Fernseher berieseln. Die dicke Wolldecke und die heiße Milch mit Honig brachten mich ganz schön ins Schwitzen. Wozu doch ein Unwetter und ein fehlender Hausschlüssel gut waren, wenn man dann ohne lange Diskussion chillen durfte. Ich grinste, während ich mich noch tiefer in den Kissenberg kuschelte. Und das Beste war, dass Mama mir sogar unaufgefordert vorschlug, mir für das Referat morgen eine Entschuldigung zu schreiben. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Am nächsten Morgen aber wachte ich mit Fieber und Halsschmerzen auf.
Obwohl es nur eine Woche war, dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis ich wieder fit wurde und zur Schule gehen konnte. Es war die langweiligste Zeit meines Lebens. Anfangs fühlte ich mich so schlapp, dass ich noch nicht einmal Spaß daran hatte, im Internet zu surfen, zu chatten, fernzusehen oder die Sportseiten der Tageszeitung zu lesen. Einzig und alleine mein graubraun getigerter Kater Pelle brachte mich auf andere Gedanken. Wie sehr liebte ich es, wenn er sich unter meine Decke kuschelte und nach wenigen Sekunden ein lautes Schnurren zu hören war.
Am frühen Nachmittag meines ersten Krankheitstages rief Jessi an und wollte wissen, warum ich nicht in der Schule gewesen war. Mit heiserer Stimme erzählte ich ihr den Grund und fragte sie, warum sie gestern nicht wie verabredet ins Parkcafé gekommen ist.
„Oh, sorry. Tut mir leid. Echt. Hab’ unsere Verabredung einfach verpennt. Ich war eine halbe Ewigkeit beim Kieferorthopäden. Nur für so ‘nen blöden neuen Draht. Ich kann noch nicht mal mehr Weißbrot kauen, so fies tun meine Zähne jetzt weh. Na egal. War echt cool, dass ich das Referat heute nicht ohne dich halten musste. Wie auch, wenn’s nicht fertig war. Also: Glück gehabt. Wir können uns ja die nächsten Tage nochmal treffen, um es fertig zu machen. Ähm, ja, natürlich nur, wenn’s dir wieder besser geht. Ich komme dann zu dir“, schlug Jessi verbindlich vor.
Da ich nicht nachtragend war, willigte ich zögernd ein, wechselte aber sofort das Thema. Viel wichtiger waren jetzt die Ereignisse von gestern Nachmittag, die ich eigentlich schon aus meinen Gedanken verbannt haben wollte.
Jessi hörte aufmerksam zu. Auch ihr erschien alles recht merkwürdig. Allerdings bezweifelte sie, dass es einen tieferen Sinn gab und beruhigte mich. Wie so oft nahm sie das Leben viel leichter als ich. Lachend malten wir uns schließlich einige lustige Szenarien zu dem Fremden aus, wie er zum Beispiel eine Bank ausgeraubt hatte und seine Beute in diesem Koffer spazieren trug. Irgendwie war ich jetzt erleichtert.
Die folgenden Tage vergingen nur schleppend. Abwechslung gab es kaum. Genervt machte ich meine Schulaufgaben, beendete mit Jessi das Referat und beschäftigte mich sogar mit der einen oder anderen Hausarbeit, um Mama ein wenig zu unterstützen. Ich sehnte mich nach meinem geliebten Judo, um meine steifen Knochen endlich wieder in Schwung zu bringen. Doch meist kam schon ganz bald die Ernüchterung, wenn mich eine neue Hustenattacke anfiel. Nach einer Woche durfte ich dann endlich wieder zur Schule.
Zusammen mit meiner besten Freundin Jessi, die ich bereits seit dem Kindergarten kannte, ging ich auf das Kestner-Gymnasium. Schon von klein auf waren wir dick befreundet, obwohl wir nicht nur äußerlich, sondern auch von unseren Charakterzügen grundverschieden waren. Vielleicht war gerade dies der Schlüssel zu unserer tollen Freundschaft.
Ich war eher mittelgroß mit schlanker, sportlicher Figur und lebte für meinen Sport. Zweimal wöchentlich stand ich auf der Judomatte und trainierte für die bald anstehende Prüfung zum schwarzen Gürtel. Anstatt stundenlang vor dem Spiegel meine Haare zu frisieren oder ausgiebig meine Fingernägel zu feilen und zu lackieren, nutzte ich lieber meine Freizeit, um zu joggen oder anderen Sport zu treiben. Skaten, Rad fahren oder einfach nur schwimmen.
Zur Entspannung suchte ich, wann immer es möglich war, meinen Lieblingsplatz hoch oben im alten Apfelbaum auf. Von dort konnte ich entspannt das Gartentor, die Straße und die angrenzenden Grundstücke des eher spießigen Wohnviertels überblicken. Auf dem Baum spürte ich Freiheit und ich konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen. Das Zwitschern der Vögel hatte immer eine beruhigende Wirkung auf mich.
Schon als kleines Mädchen interessierte ich mich mehr für Fußball und Autos als für Puppen, Prinzessinnen und Pferde. Mama nannte mich manchmal spaßeshalber „mein kleiner Junge“. Ich mochte keine Kleider und trug lieber Hosen, mit denen ich auf Bäume klettern und mich im Matsch wälzen konnte. Auch jetzt kannte man mich fast nur in sportlicher, eher lässiger Kleidung wie Jeans, Sport-Shirts und Sneakern. Meine mittellangen, hellblonden Haare hatte ich meist praktisch zu einem Pferdeschwanz oder einem geflochtenen Zopf frisiert. Der fransige Pony ragte mir oft bis auf meine etwas dunkleren Augenbrauen.
Bis auf Wimperntusche verzichtete ich, anders als Jessi, ganz auf Kosmetik. Sie hingegen liebte es, stundenlang in Modegeschäften die neusten Trends aufzuspüren und sich, sofern es ihr Geldbeutel zuließ, das eine oder andere extravagante Stück zu kaufen. Stundenlang bearbeitete sie ihre langen, dunkelbraunen Haare, wahlweise mit einem Lockenstab oder einem Glätteisen, bis jedes einzelne Haar perfekt saß. Sie liebte duftende Körperlotions, Lippenstifte und stylische Kleidung. Durch ihren dunkleren Teint, ihre Mutter war Spanierin, hob sie sich von den anderen Mädchen ab und wurde von den Jungs angehimmelt. Sie hatte es perfekt drauf, mit ihren großen, fast schwarzen, von langen dunklen Wimpern umrahmten Augen zu klimpern, wenn es beispielsweise darum ging, eine vergessene Hausaufgabe abzuschreiben oder einen Lehrer bei der Notenvergabe in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und wenn etwas nicht nach ihrem Willen ging, brauste sie schnell auf und ließ die eine oder andere spitze Bemerkung fallen. Und sie tat eigentlich auch nur das, was ihr in den Sinn kam. Man merkte das feurige Blut in ihren Adern.
Trotz unserer Unterschiede waren wir „best friends forever“ und unsere Freundschaft war schon mehrmals auf eine harte Probe gestellt worden.
Die Tage strichen dahin. Ich wurde wieder gesund und die Schule raubte mir kostbare Freizeit. Die heißen Hochsommertage verwandelten sich in kühlere, kürzer werdende Spätsommertage. Der morgendliche Tau auf den Wiesen, die gemähten Kornfelder sowie die sich sammelnden Zugvögel ließen den herannahenden Herbst erahnen. Um die lange Sportpause wieder auszugleichen, trainierte ich nun dreimal wöchentlich, sodass mir kaum Zeit blieb, mich mit Jessi oder anderen Mädels zu treffen. Allenfalls gönnte ich mir ein paar Minuten Entspannung auf meinem geliebten Apfelbaum.
So auch am Samstag vor den Herbstferien nach einer ausgiebigen Joggingrunde. Noch verschwitzt setzte ich mich in eine Astgabel, lehnte mich an einen nach oben gebogenen Ast und ließ die Beine baumeln. Langsam schweifte mein Blick über die gepflegten Gärten der Nachbarschaft, die vereinzelt schon winterfest gemacht wurden.
Und dann hörte ich ihn wieder mal kläffen, den alten, kaffeebraunen Cockerspaniel. Vermutlich war ein Prospektausträger unterwegs, der sich dem braunen Jägerzaun unserer Nachbarn näherte. Ein schreckliches Vieh, dem jegliche Erziehung fehlte. Sein wohlgenährter Bauch schleifte bei jedem Schritt, der meist in Zeitlupe ablief, fast schon auf dem Boden. Eigentlich tat er mir leid, zumal er tägliche Wellness- und Frisierstunden über sich ergehen lassen musste. Welcher Hund hatte schon für jeden Wochentag eine andere Haarschleife, die seine Haare aus den Augen fernhielt oder einen eigenen kleinen, weich gepolsterten Fernsehsessel, in dem er spezielle Hundeprogramme zur Förderung seiner angeblich so hohen Intelligenz sehen musste?
Minutenlang sinnierte ich über das eintönige und wenig artgerechte Leben dieses verwöhnten, über alles geliebten Tieres.
Dann riss mich das Piepsen einer SMS aus meinen Gedanken. Die Info „Unbekannt“ weckte meine Neugierde. Und schon erschien auf dem Display folgende Nachricht:
HEY SUSAN, TREFFEN
GLEICH IM PARK AN
DER GROSSEN WEIDE.
IST DRINGEND! J.
Irgendetwas stimmte nicht. Eine unterdrückte Nummer. Die Anrede mit „hey“, eine SMS statt einer WhatsApp. Völlig untypisch für Jessi. Warum ein Treffen im Park und nicht in einem der Cafés in der Hauptstraße? Das wäre doch Jessis erste Wahl, ganz nach dem Motto „sehen und gesehen werden“.
Es war klar, im Moment wollte sie von niemandem gesehen werden. Also konnte es sich nur um Liebeskummer handeln. Anscheinend lief es mit Marek doch nicht so gut. Ich seufzte, denn es war wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung, Jessi zu trösten. Ich stellte sie mir schluchzend und verheult mit verlaufener Wimperntusche vor, wie sie mit angezogenen, fest umklammerten Beinen am Stamm der Weide kauerte. Ein Fünkchen Mitleid regte sich in mir. Ich musste zu ihr. Doch bevor ich mich geübt vom Apfelbaum herunter schwang, versuchte ich sie zurückzurufen. Fehlanzeige. Bestimmt war ihr Akku leer. Im Haus tauschte ich meine verschwitzte Sportkleidung gegen eine Jeans und eine Sweatshirt-Jacke. Nach einem großen Glas Apfelschorle schrieb ich meinen Eltern noch eine kurze Notiz, wohin ich fuhr. Dann raste ich los.
Zur Sicherheit schloss ich mein Fahrrad an den schwarzen, geschwungenen Eisenzaun, der den gesamten Park umgab. Den Weg zur Weide am Rande des Sees hätte ich blind gefunden, da ich ihn schon unendlich oft gegangen war, seit Jessi und ich dort vor vielen Jahren unseren Freundinnenschwur abgelegt hatten.
Als Kindergartenkinder entdeckten wir die uralte Trauerweide mit ihren langen, teils ins Wasser, teils auf die Wiese herabhängenden Zweigen, während unsere Mütter plaudernd auf einer Parkbank saßen. Damals liebten wir es, uns hinter dem dichten, bis auf den Rasen reichenden Zweiggewirr zu verstecken oder Ketten aus den dünnen, biegsamen Zweigen zu flechten. Ganz besondere Abenteuer bot uns der bereits recht schiefe Stamm, der mehr als einen Meter breit und im Inneren hohl war. Damals konnten wir uns durch einen Spalt hineinzwängen, wo wir für andere unsichtbar Geheimnisse miteinander teilten oder uns phantasievolle Spiele ausdachten.
Ich schmunzelte, als ich daran dachte, wie wir als Sechsjährige eng im Baum beieinandersitzend ein Picknick mit sauren Gurken, Lakritz-Schnecken, Knoblauchpastillen und Salamicräckern veranstaltet hatten. Mit ausgedachten Zauberformeln versuchten wir verzweifelt, Waldgeister und Elfen anzulocken. Trotz all unserer Bemühungen mussten wir jedoch enttäuscht feststellen, dass, außer ein paar Ameisen, keine weiteren Gäste an unserem Essen teilnahmen.
Ein andermal, als wir schon etwas älter waren, hatten wir uns in der Weide getroffen, um uns als „feine Damen“ herauszuputzen. Hierzu hatte ich hochhackige Schuhe, zwei kleine Handtaschen sowie ein bunt gestreiftes Strand- und ein schwarzes Abendkleid aus Mamas Kleiderschrank stibitzt. Jessi steuerte einen nicht allzu kleinen Fundus an Kosmetikutensilien und Haarspangen bei. Trotz der Enge im Stamm schafften wir es, uns mit Taschenlampen und Handspiegeln in zwei „ansehnliche“ Damen zu verwandeln. Beide hatten wir uns die viel zu weiten Kleider der Größe 38 angezogen, die uns bis über die Fesseln reichten und eher an Kartoffelsäcke als an elegante Kleider erinnerten. Dazu hatten wir uns selbstgemachte hölzerne Perlenketten umgehängt und uns in den schrillsten pink-violetten Tönen Lidschatten, Rouge und Lippenstift aufgetragen. Auf meinem Kopf thronte ein Sonnenhütchen mit Werbeaufdrucken einer Bank, das ich beim Schulfest als Hauptpreis gewonnen hatte. Jessi hingegen hatte ihre langen, dunklen Haare schräg zur Seite als hohen Zopf über dem linken Ohr zusammengebunden und mit rosafarbenen, viel zu langen Mandelblütenzweigen aus Plastik sowie einer Pfauenfeder geschmückt. Als elegante Damen stolzierten wir schließlich mit Handtäschchen, rosa Sonnenbrillen und Sonnenschirmen, einer bedruckt mit den Schlümpfen, der andere mit kleinen Tigern, die sandigen Wege entlang. Immer wieder mussten wir anhalten, um unsere hochhackigen, mehrere Nummern zu großen Abendschuhe richtig anzuziehen. Was mussten wir für ein komisches Pärchen abgegeben haben. Wie peinlich!
Wären wir nicht zufällig Jessis Nachbarin begegnet, die unseren außergewöhnlichen Aufzug sofort Jessis Mutter berichtet hatte, hätten wir uns noch im Eiscafé eine Limo von unserem mühsam ersparten Taschengeld gekauft. Allerdings machte Jessis Mutter, die aufgeregt in den Park gerannt kam, uns einen dicken Strich durch unsere tollen Pläne. Wie hätte es auch anders sein sollen, auch Mama traf wenig später im Park ein und wir erhielten einen ordentlichen Anschiss. Und Fernsehverbote. Damals konnten wir ihren Ärger nicht verstehen, schließlich hatten wir uns die größte Mühe gegeben, uns perfekt zu stylen. Bei dem Gedanken an damals musste ich grinsen.
Fast hatte ich jetzt die alte Weide erreicht, doch durch die lang hinunterhängenden, stark beblätterten Zweige konnte ich nicht erkennen, ob Jessi irgendwo auf mich wartete. Tief sog ich den altvertrauten, wunderbaren Geruch des Baumes ein. Mit meinen Händen bahnte ich mir schließlich einen Weg durch die sich seicht bewegenden Zweige bis dicht an den tief gefurchten Stamm. Wahrscheinlich lehnte Jessi auf der anderen Seite. Um sie nicht zu erschrecken, rief ich leise: „Hi Jes, ich bin’s. Schneller ging’s nicht. Sorry. Bist du da? Ist alles okay?“
Ein Rascheln hinter dem Stamm. Es klang ähnlich dem Zusammenknüllen einer Brötchentüte. Ich war sicher, in wenigen Sekunden einer verheulten Jessi gegenüberzustehen.
Es kamen alles aber ganz anders.
KAPITEL 3
SUSAN
Ein ungepflegter Mann in einem ausgewaschenen, rotblauen Jogginganzug trat langsam hinter dem alten, windschiefen Stamm hervor. Vielleicht ein Landstreicher?
Vom ersten Moment an fühlte ich mich in seiner Gegenwart unwohl. Abgesehen von seinem abstoßenden Äußeren war irgendetwas an ihm anders. Er starrte mich an. Eine große, dunkle Sonnenbrille, ein Dreitagebart sowie eine tief in die Stirn gezogene, rote Baseballkappe mit dunkelgrauer Aufschrift „Champion“ verdeckten fast sein ganzes Gesicht. Die wenigen sichtbaren Hautpartien erschienen mir erschreckend blass. Bläulich schimmerten Adern durch. War er krank?
Sein Aussehen wirkte gespenstisch, fast wie aus einem Gruselfilm. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dem Mann schon mal begegnet zu sein, wusste aber nicht wo. Es ratterte in meinem Kopf. Während der Fremde einen steif wirkenden Schritt auf mich zumachte, winkte er mich mit einer ungelenken Handbewegung zu sich heran. Ich starrte auf seine abgebrochenen und vergilbten Fingernägel, die so aussahen, als ob sie seit Monaten nicht mehr gepflegt worden waren. Es war eklig.
„Komm her!“, forderte er mich mit tiefer Stimme auf.
Ich war irritiert und wusste nicht, was ich tun sollte. Mama und Papa hatten mir schon von Kindesbeinen an beigebracht, sofort wegzulaufen und Hilfe zu holen, wenn mich ein Fremder anquatschte. Blitzschnell wog ich ab, ob ich es wagen sollte fortzurennen, der Aufforderung des Fremden zu folgen oder einfach nur abzuwarten.
Vielleicht wurde Jessi aber auch von dem Mann festgehalten und war in Gefahr? Kidnapping?
Fürchterliche Vorstellungen schossen mir durch den Kopf, die mir Angst machten. Und wenn dies tatsächlich so war, musste ich meiner besten Freundin beistehen. Das war klar.
Ohne mich dem Fremden auch nur einen Schritt zu nähern, wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Wozu hatte ich denn schließlich seit Jahren Judotraining, wenn ich es nicht in solch einem Fall zum Einsatz bringen konnte. Zudem sah der Typ so unsportlich aus, dass ich mit keiner Silbe daran zweifelte, ihn nicht mit Leichtigkeit auf den Boden werfen zu können. Da hatte ich schon ganz andere Gegner bezwungen. Was aber, wenn er eine Waffe hatte?
Ungefähr vier Meter standen wir voneinander entfernt. Ein leiser Windstoß ließ die Weidenzweige sanft hin und herschaukeln. Meine Muskeln spannten sich, alle Antennen waren auf Aufnahme gestellt. Ich war bereit, wegzurennen oder auch im Notfall einen Judogriff anzuwenden, falls er sich mir weiter nähern sollte.
„Wo ist Jessi? Ist sie bei Ihnen?“, kam es mir mutig, doch ein wenig zitternd über die Lippen. Dabei ließ ich ihn nicht aus den Augen und registrierte jede seiner Bewegungen. Er stand dicht am Stamm. Regungslos. Nur seine rechte Augenbraue zuckte in unregelmäßigen Abständen. Er schien nervös zu sein. Gab es dafür einen Grund?
Dass ich mich unwohl fühlte, durfte ich ihn nicht spüren lassen. Ich fragte erneut, jetzt ein wenig fordernder: „Ist Jessi hinter dem Stamm?“
Wieder keine Reaktion. Wie gerne hätte ich seine Augen gesehen. Sie hätten mir ganz sicher verraten, ob Jessi in der Nähe war. Denn Augen lügen nicht. Doch die dunkle Pilotenbrille ließ keinerlei Schimmer durch.
Der Unbekannte schien zu ahnen, was in mir vorging. Langsam hob er seine rechte Hand und griff an den goldenen Bügel seiner Sonnenbrille. Gespannt hielt ich den Atem an und starrte erwartungsvoll in sein Gesicht. Während er mit einem Ruck die Brille runterzog, machte er einen großen Schritt nach vorne. Das, was ich jetzt sah, verschlug mir die Sprache. Ich fühlte mich wie gelähmt und war nicht in der Lage, einen einzigen Judogriff zur Verteidigung anzuwenden. Mir wurde schlagartig klar, wer er war: Der unsympathische Typ neulich im Parkcafé. Was mich so sicher machte war nicht sein Aussehen, sondern seine unverwechselbar starren und unglaublich eiskalten, blutunterlaufenen Augen, die ich damals nur durch die Sonnenbrille hatte erahnen können. Jetzt aber zeigten sie sich in ihrer ganzen Deutlichkeit. Sie fixierten mich und bohrten sich in meinen Blick. Das Besondere an den Augen war aber nicht nur die außergewöhnliche Starrheit und Kälte, sondern die Augenfarbe an sich: Eisblaue Augen, die mit smaragdgrünen Adern durchzogen waren. In meinen Kopf drehte es sich. Meine Knie begannen zu zittern und sackten plötzlich unter meinem Körper wie Pudding zusammen. Alles um mich herum wurde schwarz. Pechschwarz.
Als ich wieder zu mir kam, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie lange ich weggetreten war. Sekunden? Minuten? Stunden?
Ich wusste es nicht. An das, was passiert war, konnte ich mich nur schemenhaft erinnern. Ich bemerkte, dass ich ausgestreckt auf kaltem, unebenem Erdreich lag. Vorsichtig streckte ich mich und bewegte meine Glieder. Zum Glück tat mir nichts weh, daher stand ich vorsichtig auf. Definitiv war dies nicht der Stadtpark. Aber wo war ich?
Irritiert blickte ich mich um. Die weite, ebene Landschaft um mich herum wirkte wenig einladend. Hier und da stand eine kleine, windschiefe Birke auf trockener, braunroter Erde. Das spärlich wachsende, meist vertrocknete Gras war braun, ein paar in Altrosa blühende Heidepflanzen lockerten den trostlosen Anblick auf. In wenigen Metern Entfernung stand ein hoher, nahezu abgestorbener Baum. Vielleicht eine Erle?
Von Baumarten hatte ich kaum Ahnung. Ich schaffte es gerade, ein Gänseblümchen von einer Tulpe sowie einen Apfelbaum von einer Weide zu unterscheiden. Davon gab es hier weit und breit nichts.
Die wenigen kahlen Äste des Baumes neigten sich leise raschelnd im Wind. Eine stärkere Böe würde es nicht schwer haben, die Äste oder vielleicht sogar den ganzen Baum zu Fall zu bringen. Ganz in der Nähe entdeckte ich einen kleinen Tümpel, dessen modriges, braungrünes Wasser einen intensiven, nach faulen Eiern riechenden Gestank ausströmte. Erst jetzt bemerkte ich, wie bestialisch es stank. Trotzdem starrte ich gebannt auf die kleinen Luftbläschen, die sich an der Wasseroberfläche bildeten, bis sie nach wenigen Sekunden unhörbar zerplatzten. Weder eine Ente, noch ein Fisch, eine Libelle oder gar ein Frosch waren zu sehen. Solch einen trostlosen und sonderbaren Ort hatte ich noch nie gesehen. Kein Vogel zwitscherte, kein entfernter Autolärm oder Geschrei von spielenden Kindern war zu hören. Bis auf das Pfeifen des Windes durch die Äste war alles still. Das Ganze wirkte unnatürlich. Fremd. Irreal.
Da ich fror, zog ich die Hände in die Ärmel meiner Sportjacke. Irgendwas stimmte nicht. Ob ich entführt worden war? Oder hatte ich ganz plötzlich Fieberträume? War ich tot?
Mir wurde schlagartig heiß. Nur wenn ich Mama oder Jessi anrief, konnte ich mir Gewissheit verschaffen, dass alles in Ordnung war. Ich kramte in meiner Jackentasche nach meinem Handy. Sicherlich gab es eine ganz einfache Erklärung für diesen seltsamen Ort. Auch würde es sich aufklären, was es mit der erneuten Begegnung mit dem unheimlichen Fremden, an den ich mich zunehmend deutlicher erinnern konnte, auf sich hatte. Hatte er etwas damit zu tun, dass ich jetzt hier war? Was war bloß mit seinen Augen?
Nachdem ich mein Handy aus der apfelgrünen Schutztasche aus Filz herausgezogen hatte, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass es zwar voll aufgeladen war, aber keinen Empfang hatte. Wütend kickte ich gegen ein Steinchen.
„Verdammter Mist!“, fluchte ich laut, während ich das Gerät mit weit ausgestrecktem Arm im Kreis um mich herum bewegte. Immer noch kein Netz. Genervt lief ich mal in die eine, mal in die andere Richtung.
„Was für ein Scheiß! Warum muss ich auch gerade in dieser Wildnis hocken, wo es keinen Empfang gibt?“, schrie ich wütend. Derartige Ausraster waren für mich eher untypisch.
Bei meiner Netzsuche entfernte ich mich von der Stelle, an der ich wieder zu mir gekommen war. Planlos irrte ich durch die steppenartige Landschaft bis mir auffiel, dass ich die Orientierung zu dem hohen, fast toten Baum verloren hatte. Egal. Das Wichtigste war, dass ich irgendwie Handyempfang bekam. Vielleicht würde ich auf eine Straße treffen. Oder einen Wanderweg, der mich zurück in die menschliche Zivilisation bringt, falls dies alles kein Leben nach dem Tod war.
Lange ging ich weiter in der Gegend umher. Mein Magen begann zu knurren. Meine Zunge klebte trocken am Gaumen, denn das Joggen steckte mir noch in den Knochen. Doch in dieser tristen Einöde gab es weder einen Obstbaum noch eine Wasserquelle, die mich in diesem Moment gerettet hätten. Nur ein paar dieser stinkenden, unbrauchbaren Tümpel. Immer wieder drehte ich mich suchend um, da ich ständig das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Bis auf einen größeren Raubvogel, der ruhig seine Kreise am Himmel drehte, konnte ich niemanden sehen. Weit und breit war nichts als triste Natur. Mutlos sank ich auf einen umgefallenen, bemoosten Baumstumpf. Auch das rettende Mobilnetz war ausgeblieben. So etwas war mir noch nie passiert. War ich vielleicht irgendwo in Afrika, wo es keine Netzabdeckung gab?
Meine Gedanken rasten wild in meinem Kopf herum. Im Augenblick wusste ich einfach nicht weiter. Tränen stiegen mir in die Augen und rollten über meine erhitzten, geröteten Wangen. Ich begann zu schluchzen. Innerlich spürte ich, dass dieser Ort irgendein Geheimnis verbarg, in dem ich mitten drinsteckte.
Ich war verzweifelt. Es dauerte, bis ich mich wieder einigermaßen eingekriegt hatte. Mittlerweile war es schon spät geworden, sodass es langsam zu dämmern begann. Bald würde es dunkel sein und ich hatte kein Abendessen, kein Wasser und auch kein Dach über dem Kopf. Sehnsüchtig dachte ich in diesem Moment an mein Zimmer, das abends immer besonders gemütlich war. Die zwei Lichterketten, eine hing über meinem Bett, die andere über meinem Drachenbaum, gaben ein wunderschön warmes, schummriges Licht. Unendlich traurig stellte ich mir meine Eltern vor, die sich sicherlich langsam über meine Abwesenheit sorgten. Wie gerne würde ich jetzt zu Hause bei ihnen sein. Vielleicht sogar den Müll raustragen oder mich mit kniffligen Mathehausaufgaben beschäftigen, nebenbei Musik hören und dabei Kakao trinken. Alles schien so unwirklich, so unsagbar weit entfernt.
Warum?
Eine neue Flut von Tränen strömte mir über das Gesicht, bis ich mich irgendwann selber zurechtwies, dass diese Heulerei nichts bringen würde. Ich setzte mich gerade hin, atmete dreimal tief durch, so hatte ich es zur mentalen Vorbereitung auf Judowettkämpfe von meinem Trainer erlernt und begann, die Ereignisse ein weiteres Mal zu durchdenken. Ich war mir nun ziemlich sicher, dass der Unbekannte mich, vielleicht zusammen mit einem Helfer, in die Falle gelockt hatte, um mich aus einem unerfindlichen Grund an diesen Ort hier zu entführen. Vielleicht hatte Jessi sogar das gleiche Schicksal ereilt und auch sie irrte hier irgendwo herum?
Ich verspürte eine dunkle Ahnung, dass dieses ungewollte Abenteuer noch nicht so bald zu Ende sein würde.
KAPITEL 4
SUSAN
Ganz in der Nähe hatte ich eine kleine, auf einer Anhöhe stehende Baumgruppe erspäht, auf die ich nun durch die karge, eintönige Heidelandschaft zusteuerte. Unbedingt wollte ich auf einen der Bäume klettern, um nach einer Ortschaft, einer Straße oder einem Parkplatz Ausschau zu halten. Sicherlich gab es dort oben auch Handyempfang. So war jedenfalls meine Hoffnung.
Mit Anbruch der Dämmerung erreichte ich erschöpft das kleine Wäldchen, das aus ungefähr drei Duzend Laub- und Nadelbäumen verschiedener Art und Größe bestand. Ein intensiver, wohltuender Tannenduft stieg mir in die Nase. Er erinnerte mich an den Geruch in dem Naturholz-Möbelhaus, in dem wir vor ein paar Wochen Schränke für mein Zimmer angesehen hatten. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Schlange wartender Kunden einreihen und mir von einem genervten Berater die Vor- und Nachteile von lasiertem und unlasiertem, gepresstem und geklebtem Holz erklären lassen.
Am liebsten hätte ich eine Pause eingelegt, doch musste ich erst einen geeigneten Kletterbaum finden. Nach kurzer Suche entschied ich mich für einen hohen, am Rande des Wäldchens stehenden, kräftigen Laubbaum, dessen Äste eng aneinander lagen und bis dicht an den Boden reichten. Mit einem Aufschwung schwang ich mich auf einen der unteren, dickeren Äste. Da das Geäst überwiegend trocken war, fand ich guten Halt. Problemlos erreichte ich schon nach kurzer Zeit eine Astgabel, die sich wunderbar als Aussichtspunkt über das Gelände in nördlicher und westlicher Richtung eignete, also die entgegengesetzte Richtung, aus der ich gekommen war.
Auch hier oben war der Blick auf mein Handy ernüchternd. Wieder keine Netzabdeckung. Wütend stopfte ich es in meine Jackentasche zurück und zog den Reißverschluss zu. Also blieb mir nur noch, nach Zivilisation zu suchen.
Trotz des Dämmerlichtes ließ sich die Umgebung noch genau überblicken: Eine weite Ebene mit den mir bekannten Birken und Heidepflanzen, vereinzelt ein Tümpel, fern am Horizont ein Laubwald. Im Hintergrund eine langgezogene Bergkette. Die einzelnen Berge waren auffallend spitz und regelmäßig angeordnet, die wie das Gebiss einer Raubkatze oder eines Hais wirkten. Angsteinflößend. Gefährlich.
Ich ließ meinen Blick weiter schweifen. Nichts. Kein Fluss. Keine Tiere. Kein Haus. Nur der Raubvogel, der weiterhin von oben herab die Landschaft zu beobachten schien. Nichts als Einöde. Auch fehlte jeder Hinweis auf Jessi, falls sie das gleiche Schicksal ereilt hatte. Wie unendlich enttäuscht war ich. Tränen standen mir in den Augen. Erst als es fast ganz dunkel war, kletterte ich wieder runter. Die weitere Suche musste nun bis zum Morgen warten.
Unten angekommen durchbrach das Knurren meines Magens die Stille, an eine Suche nach Essbarem war nun nicht mehr zu denken. Einen geeigneten Schlafplatz zu finden, war jetzt wichtiger. Falls es hier doch nachtaktive Tiere gab, musste ich vor diesen sicher sein. Vor allem aber benötigte ich einen Platz, der mir vor der nächtlichen Kälte Schutz bot. Durch die Aufregung hatte ich nicht bemerkt, wie kalt es bereits geworden war. Ich fror. Eine feuchte Kälte stieg vom Erdreich auf. Daran, wie bitterkalt es voraussichtlich in der Nacht werden würde, durfte ich nicht denken. Ändern konnte ich ja im Moment eh nichts.
Schon bald entdeckte ich ein breites Gestrüpp, das mir auf den ersten Blick geeignet erschien. Die dünnen, mit kleinen, dunkelgrünen Blättern besetzten Äste waren dicht ineinander verwoben, wodurch sie einen gewissen Schutz boten. Auf dem Bauch robbend zwängte ich mich vorsichtig durch ein unauffälliges Loch direkt über dem Boden. Es ging einfacher, als ich anfangs gedacht hatte, dennoch blieb ich mehrmals mit meiner Kleidung an Dornen hängen. Es war mir egal, ob meine Sportjacke Löcher bekam.
Das Innere des Gestrüpps war gerade mal so groß, dass ich mich eingerollt hinlegen konnte. Der Boden der „Dornenhöhle“, wie ich meinen Unterschlupf in Gedanken nannte, war mit weichem Moos ausgepolstert. Für eine Nacht reichte es. Bei jeder Bewegung musste ich jedoch aufpassen, nicht von den kleinen, spitzen Dornen zerkratzt zu werden. Mit einem einigermaßen sicheren Gefühl rollte ich mich schließlich ein, lauschte noch lange der unglaublichen Stille, bis ich völlig erschöpft in einen tiefen, traumlosen Schlaf sank.
Mit Tagesanbruch erwachte ich. Es war eiskalt, mein Rücken schmerzte. Doch das Wichtigste war: Ich hatte die Nacht lebendig überstanden. Weder war ich erfroren noch von einem wilden Tier gefressen worden. Es brauchte einige Sekunden, bis ich die Ereignisse des letzten Tages rekapituliert hatte. Heute ging es jedenfalls wieder nach Hause. In Gedanken sah ich schon meine Eltern, unser Haus und meinen geliebten Apfelbaum. Da mein Magen noch lauter als gestern knurrte und brennender Durst mich plagte, kroch ich vorsichtig aus der Höhle. Einige Dehnungsübungen taten meinen steifen Gliedern gut. Dann brach ich auf in Richtung des dichten Waldes, den ich am vorherigen Abend gesehen hatte. Wo Bäume wuchsen und es bergig war, würde es bestimmt auch Wasser geben. So hoffte ich jedenfalls. Ich stellte mir einen bläulichschillernden Bergsee mit eiskaltem, kristallklarem Wasser vor. Drumherum bunte, duftende Pflanzen, tanzende Schmetterlinge, kleine Vögel. Eine heile, paradiesische Natur. Diese Vorstellungen gaben mir bei meiner quälenden Suche Kraft.
Meinem Gefühl nach dauerte es eine Ewigkeit, bis ich die ersten Ausläufer des Waldes erreicht hatte. Das Handy steckte weiterhin in meiner Jackentasche. Ausgeschaltet, um bei Empfang auf eine möglichst volle Ladekraft zurückgreifen zu können. Erst während einer kurzen Verschnaufpause am Rande des Waldes schaltete ich es wieder ein. Erneut ergebnislos. Anderes hatte ich irgendwie auch nicht erwartet.
Ich marschierte weiter. Der Boden war nun nicht mehr sandig, sondern glich einem normalen Waldboden. Herabgefallene Tannennadeln, altes Laub, Moos, Farne sowie verschiedene Arten von Pilzen deuteten auf ein mehr oder weniger gesundes Ökosystem hin. Ich entdeckte sogar einzelne Ameisen und kleine Käfer. Der Gedanke „wo Leben ist, ist auch Wasser“ motivierte mich bei meiner Suche. Dann passierte ein Wunder: Kleine, braune Nüsse, teils noch in ihre hellgrüne Schale verpackt, lagen direkt vor mir auf dem Waldboden. Ich traute meinen Augen nicht.
Ich bückte mich. Eigentlich mochte ich keine Nüsse, aber jetzt konnte ich mein Glück kaum fassen. „Eine Nuss!“, jubelte ich begeistert und knackte sie auf einem Felsen mit Hilfe eines dicken Steins. Sie schmeckte himmlisch. Süß und keineswegs bitter, so wie ich den Geschmack von Nüssen in Erinnerung hatte. Es dauerte, bis ich endlich satt war und einen Vorrat für später gesammelt hatte. Jetzt brauchte ich noch Wasser. Ich war überzeugt davon, dass mir auch dies ganz bald gelingen würde. Ein erstes Lächeln huschte mir über die Lippen, seit ich mich in dieser schrecklichen Wildnis befand.
Um den Rückweg zum Nussbaum zu finden, markierte ich einige markante Bäume mit einem spitzen Stein. Ich musste die Orientierung behalten, da der Baum bislang meine einzige Nahrungsquelle war.
Langsam wanderte ich weiter. Hinweise auf Wasser gab es nirgends. Kein Plätschern. Keine Pfützen. Je mehr ich mich dem Bergmassiv näherte, um so lichter wurde die Bewaldung, bis sie sich schließlich in trockene Grasflächen mit großen Felsblöcken verwandelte. Die wenigen knorrigen Bäume und niedrigen Büsche waren vom Wind gezeichnet. Auch jetzt wehte ein frischer, kalter Wind. Ich fror und mir war schwindelig. Ich brauchte dringend eine weitere Pause, um mich zu erholen.
Ich wählte eine Stelle direkt an der Felswand, die mit trockenen Büschen umgeben war und mich ein wenig vor dem auskühlenden Wind schützen würde. Erschöpft sank ich nieder. Meine Zunge klebte mir weiterhin am Gaumen und meine Lippen waren trocken, an einer Stelle sogar aufgeplatzt. Erste Anzeichen des Dehydrierens, würde Mama sagen. Ich brauchte Wasser. Und das ganz schnell, lange würde ich es so nicht mehr aushalten. Aber wo sollte ich es herbekommen?
Ich war verzweifelt. Zum Glück war die Luft kühl, sodass mein Körper keine übermäßige Flüssigkeit verlor. Langsam knabberte ich meine restlichen Nüsse. Das half ein wenig, zumindest bildete ich mir das ein.
Und da bemerkte ich ihn plötzlich wieder. Den Raubvogel. Es schien, als ob er mir gefolgt war. Elegant zog er seine Kreise, allerdings weniger hoch als am Tag zuvor. Ab und an gab er schrille, fast gespenstisch klingende Schreie von sich. Ich mochte ihn. Seine Lebendigkeit wirkte eher beruhigend und ich schaute ihm eine Weile zu, bis ich für einen kurzen Moment vor Erschöpfung einnickte.
Als ich erwachte, war mein erster Gedanke: Wasser! Alle Glieder erschienen mir schwer wie Blei, in meinem Kopf hämmerte es wie auf einer Großbaustelle. Es fühlte sich so an, wie als ob ich eine Grippe ausbrüten würde. Doch jetzt war es die bloße Erschöpfung. Fehlende Flüssigkeit. Mich aufgeben, das durfte ich jetzt nicht. So viel hatte ich noch vor in meinem Leben. Eigentlich war es ja gerade noch am Anfang. Ich dachte an meine Eltern. Noch nicht einmal weinen konnte ich mehr. Als das Pfeifen des Windes für einen Moment nachließ, wurde ich schlagartig aus meiner Hoffnungslosigkeit gerissen. Neben dem Rauschen der Blätter vernahm ich ein kaum hörbares, plätscherndes Geräusch. Sofort spürte ich so etwas wie neuen Lebensmut. Oder fantasierte ich etwa schon? War es schon so weit gekommen?
Angestrengt lauschte ich dem Plätschern, ohne es aber genau orten zu können. Mit letzter Kraft stand ich auf. Langsam drehte ich mich im Kreis und untersuchte den Boden. Links, rechts. Vorne, hinten. Nichts. Doch dann, gerade als ich frustriert meine Suche aufgeben wollte, entdeckte ich ihn. Schräg über mir in einigen Metern Höhe. Aus einer Spalte in der senkrecht nach unten verlaufenden Felswand entsprang ein kleiner Wasserfall. Das klare Wasser glitzerte im fahlen Licht der Sonne. An der Stelle, wo es wenige Meter unterhalb auf einen Felsvorsprung wieder auftraf, spritzten zu allen Seiten tausende kleine Wassertröpfchen. Dort schien es irgendwo in das Innere des Berges hineinzulaufen. Genaueres konnte ich von hier unten nicht erkennen.
Es war einfach unfassbar: Zum Greifen nahe war das Wasser, aber doch so unendlich weit entfernt. Mehr als 20 Stunden hatte ich jetzt keinen einzigen Schluck Flüssigkeit getrunken. So musste sich ein hungriges Kind fühlen, das vor dem Schaufenster eines verschlossenen Süßigkeitenladens stand und die wundervoll dekorierten Bonbons, Schokoriegel, Kekse und bunten Lollis betrachtete. Wütend trat ich, so doll ich konnte, gegen die Büsche neben mir. Am liebsten hätte ich alles um mich herum zerstört. Dann sackte ich schließlich kraftlos in mich zusammen und begann bitterlich zu schluchzen.
Es dauerte, bis ich mich wieder beruhigt hatte. Gab es nicht doch eine Möglichkeit, gefahrlos an den steilen, aufeinander geschichteten Felsbrocken hochzuklettern? Konnte ich vielleicht an einer anderen Stelle auf die Felsen steigen und das Wasser von oben erreichen? Oder würde ich es schaffen, eine Leiter zu bauen?
Beim besten Willen fiel mir keine brauchbare Lösung ein. Doch eins war mir klar: Wenn ich nicht verdursten wollte, musste ich auf die Felsen klettern, doch ohne dabei waghalsig zu werden. Ein gebrochenes Bein, Schürfwunden oder gar eine Kopfverletzung durfte ich hier in der Einöde keinesfalls riskieren. Was für einen qualvollen Tod würde das bedeuten. Doch auch ohne Wasser schwanden meine Überlebenschancen von Stunde zu Stunde. Ich musste es einfach versuchen. Schließlich konnte ich immer wieder umdrehen, wenn der Weg zu gefährlich wurde. Zumindest stellte ich mir das so vor.
Nachdem ich die Felsen genau studiert hatte, entschied ich mich schließlich für eine Kletterstrecke, die im Anfangsteil weniger steil war. Weiter oben gab es viele kleinere Felsvorsprünge, auf denen man gut Halt finden konnte. Darüber, ob die Steine auch wirklich fest waren, durfte ich mir jetzt keine Gedanken machen. Fest entschlossen kraxelte ich los. Da die Steine anfangs nicht größer waren als Schuhkartons, kam ich zügig voran. Doch schon nach einigen Höhenmetern wurden sie größer und das Klettern kostete zunehmend mehr Kraft. Kleine Ritzen und winzige Vorsprünge gaben mir Halt, langsam zog ich mich höher und höher. Ich wusste nicht, woher ich die Kraftreserven nahm. Vermutlich irgendwelche biochemischen Prozesse die einsetzten, wenn man in Not war und um sein Leben kämpfte. So eine Theorie hatte ich mal in einer Frauenzeitschrift beim Zahnarzt gelesen. Doch nach und nach merkte ich, wie meine eh schon schwachen Kräfte schwanden. Meine Finger taten entsetzlich weh und wurden steif. Doch mir war klar: Das Wasser war jetzt meine einzige Chance zum Überleben.
„Nicht nach unten schauen“, wies ich mich immer wieder an. „Gleich kannst du trinken, trinken, trinken. Das Gesicht waschen. Die Hände kühlen. Trinken, trinken, trinken.“
An den Rückweg, falls ich diesen überhaupt schaffen würde und nicht mausetot unten auf den Steinen lag, durfte ich nicht denken. Zwar standen mir nur noch wenige Höhenmeter bevor, doch es war das steilste und gefährlichste Stück. Ein gewaltiger, senkrecht nach oben ragender, dunkelgrauer Felsblock. Eine Hand nach der anderen, einen Fuß nach dem anderen. Tapfer erkämpfte ich jeden Zentimeter. Niemals vorher hätte ich geglaubt, trotz meiner Fitness, solch eine steile Bergwand hochklettern zu können. Mama hätte das niemals zugelassen. Ein einziger Fehltritt oder ein paar lockere Steine, dann wär’s das gewesen. Aus. Für immer.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















