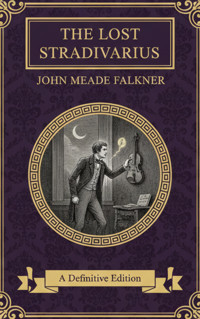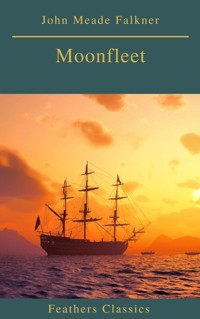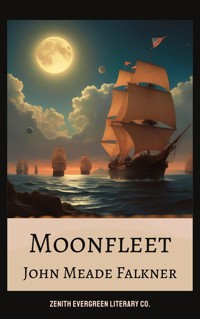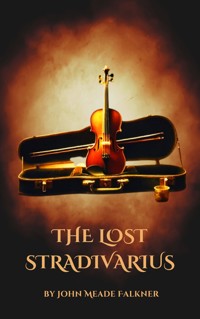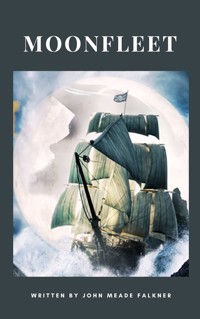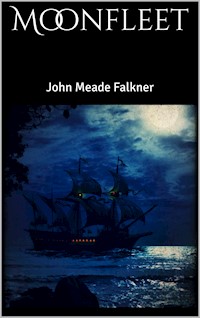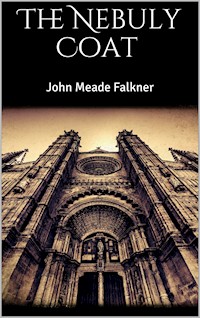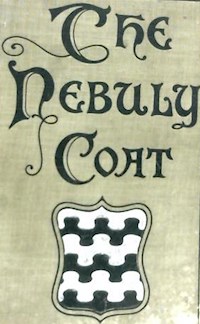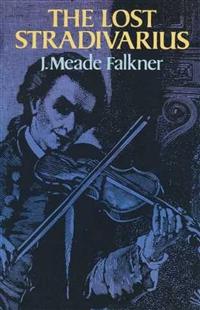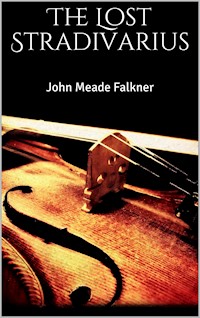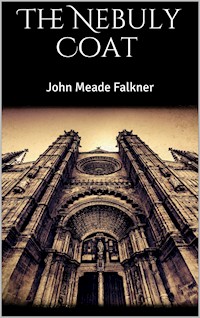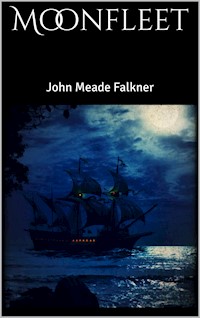3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: kontrabande Verlag, Köln
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Wind fegt über die grauen Mauern der Kirche von Moonfleet, peitscht gegen die Grabsteine, unter denen mehr Geheimnisse ruhen, als es dem kleinen Küstendorf guttun kann. Als der fünfzehnjährige John Trenchard in der Gruft unter der Kirche einen verschollenen Hinweis auf das sagenumwobene Diamanten-Erbe des Colonel Mohune entdeckt, beginnt eine Geschichte, die sein Leben für immer verändern wird. Was als kindliche Neugier beginnt, weitet sich rasch zu einer gefährlichen Reise aus. Durch dunkle Gänge unter dem Friedhof, über die Klippen der englischen Küste, in die Welt der Schmuggler, der Gesetzlosen und derer, die sich selbst über das Gesetz stellen. Moonfleet ist kein einfacher Abenteuerroman. Es ist die Geschichte eines Jungen, der zu früh erwachsen wird, einer Freundschaft, die Prüfungen standhält, und einer moralischen Entwicklung, die aufzeigt, was Anstand bedeutet, wenn das Gesetz versagt. John Meade Falkner erzählt mit lakonischer Klarheit und psychologischem Gespür. Sein einziger Roman hat Generationen geprägt – als Lehrstück über Verantwortung, Schuld und die Suche nach dem eigenen Kompass in einer Welt aus Nebel, Meer und Schweigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum:
Erschienen im kontrabande Verlag, Köln.
Landsbergstraße 24 . 50678 Köln
Ungekürzte Neuausgabe © 2025 John Meade Falkner
Erstmals 1898 erschienen bei Edward Arnold Publishers Ltd., London unter dem Titel ‚Moonfleet‘.
Umschlagbild & Umschlaggestaltung: kontrabande Verlag, Köln.
Titelgeneration unter Verwendung von Teilen von midjourney.
Übersetzung: Mac Conin, kontrabande Verlag, Köln.
Von Hand übersetzt – keine KI-Übersetzung.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkungen nicht erkennbar. eBook-Herstellung im Verlag.
ISBN 978-3-911831-29-1 E-Book
ISBN 978-3-911831-30-7 Paperback
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.kontrabande.de
Viel Spaß beim Lesen.
Über dieses Buch
Moonfleet
Ein abgelegener Küstenort im südlichen England, Mitte des 18. Jahrhunderts. Der junge John Trenchard stößt auf ein Geheimnis, das tief in die Geschichte seines Heimatdorfes reicht – und mitten hinein in das gefährliche Geschäft des Schmuggels führt. Zwischen Gräbern, Höhlen und stürmischer See gerät er in ein Netz aus Gier, Loyalität und Verrat. Doch am Ende steht nicht das Gold, sondern eine Entscheidung über Mut und Gewissen.
Ein Klassiker der englischen Literatur – atmosphärisch dicht, spannend erzählt und voller moralischer Zwischentöne.
John Meade Falkner
John Meade Falkner (1858–1932) war ein englischer Schriftsteller, Buchhändler und Industriemanager. Sein literarisches Werk ist schmal, aber prägnant – und Moonfleet, erschienen 1898, bleibt bis heute sein bekanntestes Buch. Die Geschichte des jungen John Trenchard, der in den Schmugglerkreisen von Dorset nach einem besseren Leben sucht und zwischen Loyalität, Schuld und moralischer Reifung seinen Weg sucht, gehört zu den Klassikern der englischen Abenteuerliteratur.
Falkner war kein Berufsschriftsteller. Nach seinem Studium in Oxford arbeitete er zunächst als Hauslehrer, später als Bibliothekar und Direktor eines Rüstungsunternehmens. Seine schriftstellerische Tätigkeit blieb ein Nebenweg – aber einer mit nachhaltiger Wirkung. Moonfleet zeichnet sich durch eine klare Sprache, psychologische Tiefe und eine fein austarierte Spannung aus, die das Buch weit über das Genre des Jugend- oder Abenteuerromans hinaushebt.
Das kontrabande-Verlagsprojekt versteht Moonfleet als literarisch wertvollen Text mit bleibender Relevanz: als Erzählung über Freundschaft, Verrat, Selbstfindung – und über die Suche nach dem richtigen Maß zwischen Gesetz und Gewissen.
Wir dachten, dahinter käme nichts mehr
Als ein Tag wie dieser Morgen.
Und ewig Junge zu sein.
— Shakespeare —
Gewidmet allen Mohunes,
von Fleet und Moonfleet
im Umkreis von Dorchester,
lebend oder tot
Sagt der Käpt’n zur Crew:
Wir haben dem Zoll getrotzt,
ich seh Dovers Klippen an Backbord.
Gebt das Signal an die Swan,
jetzt vor Anker, Breitseite gen Land,
und über die Fässer Eau-de-Vie,
sagt der Käpt’n:
Und über die Fässer Eau-de-Vie.
Sagt der Schleuser zu den Männern:
Legt die Leinen bereit,
draußen brennt ein Licht auf See.
Die Anker treiben nach Luv,
der Kontrolleur schläft tief,
lasst die Fässer tanzen, eins, zwei, drei,
sagt der Schleuser:
Lasst die Fässer tanzen, eins, zwei, drei.
Doch der kühne Zollmann
spannt den Hahn auf seinem Gewehr
und ruft dem Trupp: Mir nach!
Wir schnappen diese Schmugglerbande,
wer sich wehrt, der hängt,
baumelt, baumelt am Galgenbaum,
sagt der Kontrolleur:
Baumelt, baumelt im bleichen Mondschein.
Im Dorf Moonfleet
So schläft der Stolz
vergangener Tage
— More —
Das Dorf Moonfleet liegt eine halbe Meile vom Meer entfernt, am rechten oder westlichen Ufer des Fleet-Bachs. Dieser kleine Wasserlauf ist so schmal, dass ich Leute kannte, die ihn ohne Sprungstange überspringen konnten, doch unterhalb des Dorfs weitete er sich zu Salzwiesen, ehe er schließlich in einen Brackwassersee mündete. Der See taugte zu nichts als für Seevögel, Reiher und Austern und glich jenen Gewässern, die man in den Kolonien eine Lagune nannte, abgeschirmt vom offenen Kanal durch einen gewaltigen Kiesdamm, über den ich später noch mehr erzählen werde.
Als Kind dachte ich, der Ort heiße Moonfleet, weil bei ruhigem Wetter, sei es Sommer oder frostiger Winter, der Mond so hell auf diese Lagune schien. Später lernte ich, dass es nur eine verkürzte Form von ‚Mohune-fleet‘ war, benannt nach den Mohunes, einer bedeutenden Familie, die einst hier das Sagen hatte.
Mein Name ist John Trenchard, und ich war fünfzehn Jahre alt, als diese Geschichte begann. Mein Vater und meine Mutter waren schon seit Jahren tot, und ich wohnte bei meiner Tante, Miss Arnold, die auf ihre eigene Art gut zu mir war, aber viel zu streng und pedantisch, als dass ich sie je hätte lieb gewinnen können.
Zuerst will ich von einem Abend im Herbst des Jahres 1757 erzählen. Es muss, auch wenn ich das genaue Datum vergessen habe, Ende Oktober gewesen sein. Ich saß nach dem Tee in dem kleinen vorderen Wohnzimmer und las. Meine Tante besaß nur wenige Bücher, eine Bibel, ein Gebetbuch und ein paar Predigtbände, an mehr erinnere ich mich nicht mehr. Aber der Reverend Mr. Glennie, unser Dorfschullehrer, hatte mir ein Buch geliehen, das voller Abenteuer und Wunder war: die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht.
Schließlich wurde das Licht zu schwach zum Lesen, und ich war aus mehreren Gründen nicht unglücklich darüber, aufhören zu müssen. Erstens war das Wohnzimmer kalt, mit steifen Möbeln aus Rosshaar und einem Papierschirm im Kamin, denn meine Tante erlaubte vor dem ersten November kein Feuer. Zweitens roch es stark nach heißem Talg, da sie in der Hinterküche Winterkerzen zog. Und drittens war ich an einer Stelle im Buch angekommen, die mir fast den Atem nahm. Ich musste einfach eine Pause machen, so gespannt war ich.
Es war der Moment in der Geschichte von ‚Aladdin und die Wunderlampe‘, in dem der falsche Onkel einen Stein über den Eingang zur unterirdischen Kammer fallen ließ und Aladdin in völliger Dunkelheit einsperrte. Dieser will ihm die Lampe nicht überlassen, bevor er wieder sicher an der Oberfläche steht. Diese Szene erinnerte mich an einen dieser schrecklichen Träume, in denen man sich in einem winzigen Raum eingeschlossen sieht, dessen Wände immer näher rücken. Sie brannte sich so tief in mein Gedächtnis, dass sie mir später noch als Warnung diente.
Also legte ich das Buch beiseite und trat hinaus auf die Straße. Es war eine armselige Straße, selbst zu besten Zeiten, jetzt lebten keine zweihundert Seelen mehr in Moonfleet. Dennoch zogen sich die wenigen Häuser, die sie beherbergten, rechts und links der Straße verteilt, traurig über eine halbe Meile hin. Nichts wurde im Dorf je neu gebaut. Wenn ein Haus dringend repariert werden musste, riss man es einfach ab. So klafften gleich fehlenden Zähnen Lücken in der Straße, Gärten wucherten verwildert vor sich hin, Mauern zerfielen, und viele der noch stehenden Häuser sahen aus, als könnten sie nicht mehr lange der Zeit widerstehen.
Die Sonne war bereits untergegangen. Tatsächlich war es schon so dämmerig, dass man das untere, zum Meer hin gelegene Ende der Straße nicht mehr erkennen konnte. Ein leichter Nebel oder Rauch hing in der Luft, der nach verbrannten Unkräutern roch. Es war diese erste herbstliche Kühle zu spüren, die uns an flackernde Feuer und die Behaglichkeit langer Winterabende denken ließ.
Alles war sehr still, doch ich hörte weiter unten in der Straße das Klopfen eines Hammers. Ich ging nachsehen, was dort vorging, denn bei uns in Moonfleet gab es keinen anderen Beruf als den der Fischerei. Es war Ratsey, der Totengräber, der in einem zur Straße hin offenen Schuppen arbeitete, wo er mit Hammer und Gravierstichel einen Grabstein beschriftete. Er war einst Steinmetz gewesen, bevor er Fischer wurde, und ging geschickt mit seinem Werkzeug um, sodass jeder, der einen Grabstein im Kirchhof aufstellen wollte, sich an Ratsey wandte.
Ich lehnte mich über die halb offene Tür und sah ihm einen Moment zu, wie er im schlechten Licht einer Laterne Stücke aus dem Portlandstein schlug. Dann blickte er auf, sah mich und sagte: „He, John, wenn du grad nichts vorhast, komm rein und halt mir die Laterne. Es dauert nicht mehr als eine halbe Stunde, bis ich fertig bin.“
Ratsey war immer freundlich zu mir gewesen und hatte mir oft einen Meißel geliehen, mit dem ich Boote schnitzen konnte. Also trat ich ein und hielt ihm die Laterne. Ich schaute ihm zu, wie er die Steinsplitter mit dem Stichel herausschlug. Ich musste blinzeln, wenn sie mir zu nahe ans Gesicht flogen. Die Inschrift war bereits fertig, aber er arbeitete noch an einem kleinen Seemotiv, das den oberen Teil des Steins zieren sollte. Es zeigte eine Schaluppe, die ein Zollboot entern wollte. Damals hielt ich das für großartige Arbeit, auch wenn ich heute weiß, dass sie ziemlich grob war. Tatsächlich kann man sie noch heute auf dem Kirchhof von Moonfleet sehen und auch die Inschrift lesen, wenn auch vom Moos gelblich überzogen und nicht mehr so klar wie in jener Nacht. So lautet sie:
Geweiht dem Andenken an David Block
15 Jahre alt, der am 21. Juni 1757 durch
einen Schuss der Schaluppe Elector getötet wurde.
Durch bösen Plan des Lebens beraubt
Misch ich mich nun zur Erde ein.
Gott schütz mich, dass ich Gnade find
Am Tag des Jüngsten Gerichts allein.
Auch du, oh Mensch, musst einst bestehn.
Bedenk dich, eh’s zu spät geschieht,
Sonst wirst du einst im Urteil sehn,
Wie Gott an mir Rache übt im Gericht.
Der Reverend Mr. Glennie hatte die Verse geschrieben, und ich konnte sie auswendig, denn er hatte mir eine Abschrift geschenkt. Ja, das ganze Dorf sprach noch von Davids Tod, und die Geschichte war in aller Munde. Er war das einzige Kind von Elzevir Block, dem Wirt des ‚Why Not?’, das am unteren Ende des Dorfs lag, und er war in jener Juninacht bei den Schmugglern, als deren Kutter von der Staatsschaluppe des Zolls aufgebracht wurde.
Man sagte, es sei Magistrat Maskew von Moonfleet Manor gewesen, der die Zollleute auf die Spur gesetzt habe. Jedenfalls war er an Bord der ‚Elector‘, als sie den Kutter stellten. Es kam zu einem kurzen Gefecht, als die beiden Schiffe nebeneinander lagen, und Maskew zog eine Pistole und feuerte sie dem jungen David aus kurzer Distanz direkt ins Gesicht, nur die beiden Bordwände trennten sie.
Am Nachmittag des Mittsommertags brachte die ‚Elector‘ den Kutter nach Moonfleet, und ein Trupp von Polizisten stand bereit, die Schmuggler nach Dorchester ins Gefängnis zu führen. Die Gefangenen marschierten paarweise in Ketten durchs Dorf, während die Leute in den Türöffnungen standen oder ihnen folgten. Die Männer grüßten sie freundlich, denn wir kannten die meisten, sie kamen aus Ringstave oder Monkbury, und die Frauen weinten um ihre Männer. Aber Davids Leichnam ließen sie im Kutter zurück. Der Junge hatte teuer bezahlt für seinen nächtlichen Übermut.
„Ja, es war eine grausame, grausame Tat, auf so einen jungen Burschen zu schießen“, sagte Ratsey, während er einen Schritt zurücktrat, um die Wirkung einer Flagge zu prüfen, die er gerade auf die Zollschaluppe meißelte, „und für die anderen armen Kerle wirds wohl auch noch schlimm, denn Anwalt Empson sagt, drei von ihnen sollen beim nächsten Gerichtstag sicher hängen. Ich erinnere mich“, fuhr er fort, „vor dreißig Jahren, als es ein kleines Handgemenge zwischen der ‚Royal Sophy‘ und der ‚Marnhull‘ gab, da haben sie vier Schmuggler gehängt. Mein alter Vater hat sich damals fast den Tod geholt, weil er unbedingt dabei sein wollte, wie die armen Kerle in Dorchester hingerichtet wurden. Er stand knietief im Fluss Frome, um einen Blick zu erhaschen. Das ganze Umland war auf den Beinen, und es war so ein Gedränge, dass es an Land keinen Platz mehr gab. So, das reicht jetzt“, sagte er und wandte sich wieder dem Grabstein zu. „Am Montag mal ich die Fenster schwarz aus und hol mir einen Pinsel und rote Farbe, um die Flagge hervorzuheben. Und jetzt, mein Junge, du hast mir gut mit der Laterne geholfen, also komm mit runter ins Why Not? Ich will mit Elzevir ein Wort reden, er braucht dringend ein paar freundliche Stimmen, um ein wenig Trost zu finden. Und für dich findet sich sicher ein Gläschen Holländischer, gegen die Herbstkälte.“
Ich war noch ein Junge und fühlte mich ungemein geehrt, ins Why Not? eingeladen zu werden. War das nicht gleichbedeutend mit dem Eintritt ins Mannesalter? Ach, süße Knabenzeit, wie sehr sehnen wir uns danach, sie loszuwerden, und mit welchem Bedauern blicken wir auf sie zurück, wenn unser Lauf als Mann kaum zur Hälfte getan ist! Doch war mein Vergnügen nicht ganz unbeschwert, denn ich fürchtete allein schon den Gedanken, was Tante Jane sagen würde, wenn sie erfuhr, dass ich im Why Not? gewesen war. Und dazu kam noch, dass ich vor dem grimmigen Elzevir Block Ehrfurcht hatte, der seit Davids Tod tausendfach finsterer und trauriger geworden war.
Why Not? war nicht der eigentliche Name des Gasthauses. Offiziell hieß es ‚Mohune Arms‘. Die Mohunes hatten, wie ich schon sagte, einst das ganze Dorf besessen, aber ihr Glück hatte sich gewendet. Und mit ihrem Niedergang war auch der von Moonfleet besiegelt. Die Ruinen ihres Herrenhauses lagen grau am Hang über dem Dorf, ihre Armenhäuser standen auf halber Strecke die Straße hinunter, mit einem verlassenen, überwucherten Hof. Das Wappen der Mohunes prangte überall, von der Kirche bis zur Schenke, und alles, was es trug, war zugleich gezeichnet vom Siegel des Verfalls.
Und hier muss ich ein paar Worte zu diesem Familienwappen sagen, denn, wie sich zeigen wird, sollte es mein ganzes Leben lang mit mir gehen, ich werde seinen Abdruck bis ins Grab tragen. Das Schild der Mohunes war schlicht weiß oder silbern und trug nichts außer einem großen schwarzen Y. Ich nenne es ein Y, obwohl Reverend Mr. Glennie mir einmal erklärte, es sei gar kein Y, sondern das, was die Heraldiker eine Deichsel nennen. Deichsel hin oder her, es sah aus wie ein schwarzes Y, mit zwei breiten Armen, die in die oberen Ecken des Schildes liefen, und einem Schweif, der zur unteren Spitze zog. Dieses Zeichen konnte man am Herrenhaus sehen, in der Stein- und Holzarbeit der Kirche, und an Dutzenden von Häusern im Dorf, und es hing auch über der Tür des Gasthauses. Jeder kannte das Mohune-Y in weitem Umkreis, und weil ein früherer Wirt das Gasthaus scherzhaft Why Not? genannt hatte, war der Name geblieben.
Mehr als einmal hatte ich an Winterabenden draußen gestanden, wenn drinnen im Why Not? gesungen wurde. Lieder wie ‚Entensteine‘ oder ‚Fässer tanzen, eins, zwei, drei, oder andere Seemannslieder, wie sie im Westen gesungen werden. Solche Lieder hatten weder Anfang noch Ende, und kaum einen verständlichen Sinn in der Mitte. Einer summte die Melodie, und die anderen fielen in einen feierlichen Chor ein. Hier wurde wenig hart getrunken, denn Elzevir Block trank selbst nie zu viel und wollte auch nicht, dass seine Gäste das taten.
An Singabenden wurde der Raum heiß, und der Dunst stand so dicht an den Fensterscheiben, dass man von draußen nichts sehen konnte. Doch zu anderen Zeiten, wenn niemand da war, hatte ich schon durch die roten Vorhänge gespäht und gesehen, wie Elzevir Block und Ratsey am Bocktisch beim Feuer Backgammon spielten. Auf ebendiesem Tisch hatte Block später den Leichnam seines Sohnes aufgebahrt, und manche behaupteten, sie hätten in der Nacht durchs Fenster gesehen, wie der Vater versuchte, das Blut aus Davids gelbem Haar zu waschen und dabei stöhnte und mit dem leblosen Körper sprach, als könne er ihn verstehen.
Wie dem auch sei, seit jener Zeit wurde im Why Not? kaum noch getrunken, denn Block wurde immer schweigsamer und verschlossener. Er hatte nie um Kundschaft geworben, und jetzt vergraulte er jeden, der kam. So galt das Why Not? bald als verfluchter Ort, und die Männer gingen lieber ins ‚Three Choughs‘ in Ringstave.
Mir schlug das Herz bis zum Hals, als Ratsey den Riegel hob und mich in die Wirtsstube schob. Es war ein niedriger, mit Sand gestreuter Raum, ohne anderes Licht als dem eines Feuers aus Seetreibholz im Herd, das klar und flackernd mit blauen Salzwasserflammen brannte. An jedem Ende des Raumes standen Tische, ringsum an den Wänden Holzbänke, und am Bocktisch beim Kamin saß Elzevir Block, rauchte eine lange Pfeife und blickte ins Feuer.
Er war ein Mann von fünfzig Jahren, mit struppigem, ergrautem Haar, einem breiten, aber nicht unfreundlichen Gesicht, mit regelmäßigen Zügen, buschigen Brauen und der eindrucksvollsten Stirn, die ich je gesehen habe. Seine Gestalt war stämmig und noch immer von gewaltiger Kraft. In der Gegend erzählte man sich zahllose Geschichten über seine erstaunliche Stärke und Ausdauer. Die Blocks waren seit Generationen Wirte im Why Not?. Doch Elzevirs Mutter stammte aus den Niederlanden, daher sein fremdartiger Name und seine Kenntnis der niederländischen Sprache.
Nur wenige kannten ihn wirklich, und die Leute wunderten sich oft, wie er das Why Not? mit so wenig Kundschaft überhaupt halten konnte. Doch es schien ihm nie an Geld zu fehlen. Und wenn man schon gern von seiner Stärke erzählte, so sprach man ebenso von Witwen, denen geholfen wurde, von Kranken, die durch anonyme Gaben Trost fanden. Man deutete an, dass manches davon wohl von Elzevir Block kam, so schweigsam und finster er auch war.
Er drehte sich um und stand auf, als wir hereinkamen, und meine Angst ließ mich glauben, sein Gesicht habe sich verfinstert, als er mich sah. „Was will der Junge hier?“, fragte er scharf an Ratsey gewandt.
„Er will dasselbe wie ich, ein Glas Milch mit Ararat-Brandy, um der Herbstkälte zu trotzen“, entgegnete der Totengräber, während er einen weiteren Stuhl an den Bocktisch zog.
„Kuhmilch ist besser für Kinder wie ihn“, war Elzevirs Antwort, während er zwei glänzende Messingleuchter vom Kaminsims nahm, sie auf den Tisch stellte und die Kerzen mit einem glimmenden Span vom Herd entzündete.
„John ist kein Kind mehr, er ist im selben Alter wie David und hat mir geholfen, Davids Grabstein fertigzustellen. Er ist nun fertig, abgesehen von der Farbe auf den Schiffen, und, so Gott will, steht er am Montagabend ordentlich und gerade auf dem Kirchhof. Dann kann der arme Junge in Frieden ruhen, denn über ihm ist das beste Werk von Master Ratsey, samt den Versen des Pfarrers, die erzählen, wie schmählich er ums Leben kam.“
Ich glaubte, dass Elzevir ein wenig weicher wurde, als Ratsey von seinem Sohn sprach, und er sagte: „Ja, David ruht in Frieden. Doch die, die ihn ins Grab brachten, die werden keinen Frieden finden, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und vielleicht kommt sie eher, als sie denken“, fügte er hinzu, mehr zu sich selbst sprechend als zu uns.
Ich wusste, dass er Mr. Maskew meinte, und erinnerte mich, dass manche den Magistrat gewarnt hatten, sich lieber aus Elzevirs Weg zu halten. Denn man wusste nie, was ein verzweifelter Mann tun könnte. Und doch hatten die beiden sich seitdem im Dorf auf der Straße begegnet, und nichts war geschehen, außer einem finsteren Blick von Block.
„Ach, Mann!“, unterbrach ihn der Totengräber, „es war die schändlichste Tat, die je ein Mensch begangen hat. Aber quäl dein Herz nicht länger damit und denk nicht daran, wie du dich rächen könntest. Überlass das der Vorsehung, denn der, dessen Weisheit solche Dinge geschehen lässt, wird gewiss auch dafür sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe finden. ‚Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.‘“ Er nahm seinen Hut ab und hängte ihn an einen Haken.
Block antwortete nicht, sondern stellte drei Gläser auf den Tisch, nahm dann aus einem Schrank eine kleine, bauchige Flasche mit langem Hals und schenkte ein Glas für Ratsey und sich selbst ein. Dann füllte er das dritte Glas nur zur Hälfte und schob es mir mit den Worten über den Tisch zu: „Da, nimm’s, Junge, wenn du willst. Es wird dir nichts nützen, aber schaden wird’s dir auch nicht.“
Ratsey hob sein Glas fast, noch bevor es ganz voll war. Er roch an dem Getränk und schnalzte mit der Zunge. „Oh du köstliche Milch vom Ararat!“, sagte er, „sie ist süß und stark und macht das Herz ruhig. Und jetzt hol das Backgammon-Brett, John, und stell es für uns auf den Tisch.“
So begannen sie ihr Spiel, und ich nahm einen verstohlenen Schluck von dem Schnaps, verschluckte mich aber fast, da ich keine starken Getränke gewohnt war und ihn brennend und scharf im Hals fand. Keiner der Männer sprach, und außer dem ständigen Klackern der Würfel und dem Schieben der Steine über das Brett war kein Laut zu hören. Ab und zu hielt einer inne, um seine Pfeife neu zu stopfen, und am Ende einer Runde notierten sie die Punkte mit Kreide auf dem Tisch.
So sah ich ihnen eine Stunde lang zu, denn ich kannte das Spiel selbst und war neugierig, Elzevirs Backgammon-Brett zu sehen, von dem ich schon oft hatte reden hören. Es war seit Generationen Teil des Inventars im Why Not? gewesen und hatte vielleicht sogar einst den Kavaliersoffizieren der Bürgerkriege die Zeit vertrieben. Alles daran war aus Eichenholz: Brett, Würfelbecher und Spielsteine, schwarz und poliert. Am Rand lief eine lateinische Inschrift in hellem Holz eingelegt, die ich an jenem Abend zum ersten Mal las, aber nicht verstand, bis Mr. Glennie sie mir später übersetzte. Ich hatte noch Anlass, mich ihrer zu erinnern, darum will ich sie hier in Latein wiedergeben für die, die der Sprache kundig sind:
Ita in vita ut in lusu alae pessima jactura arte corrigenda est
Und wie Mr. Glennie es übersetzte:
So wie im Leben, so auch im Würfelspiel:
Der schlechteste Wurf muss durch
Geschick ausgeglichen werden.
Schließlich blickte Elzevir auf und sprach mich an, nicht unfreundlich: „Junge, es wird Zeit, dass du heimgehst. Die Leute sagen, dass Blackbeard in den ersten Winternächten umgeht, manche sind ihm sogar schon von Angesicht zu Angesicht begegnet zwischen diesem Haus und deinem.“
Ich merkte, dass er mich loswerden wollte, verabschiedete mich also von beiden und lief heim, eher den ganzen Weg gerannt, allerdings nicht aus Angst vor Blackbeard, denn Ratsey hatte mir oft gesagt, dass man ihm nur begegnen könne, wenn man nachts am Kirchhof vorbeigeht.
Blackbeard war einer der Mohunes, der vor einem Jahrhundert gestorben war und mit anderen seiner Familie in der Gruft unter der Kirche begraben lag, aber dort keine Ruhe fand. Ob nun, wie manche sagten, weil er ständig nach einem verlorenen Schatz suchte, oder wie andere sagten, wegen seiner übergroßen Bosheit im Leben. Wenn Letzteres stimmte, musste er wirklich ein übler Mensch gewesen sein, denn vor und nach ihm sind Mohunes gestorben, die schlimm genug waren, ihm in der Gruft oder sonstwo Gesellschaft zu leisten.
Man behauptete, dass man Blackbeard an dunklen Winternächten mit einer altmodischen Laterne im Friedhof graben sehen könne. Wer ihn je gesehen habe, sagte man, erkenne ihn an seiner riesenhaften Gestalt, dem dichten schwarzen Bart, dem kupferfarbenen Gesicht und so bösen Augen, dass jeder, der ihnen einmal ins Auge sah, binnen Jahresfrist sterben müsse.
Wie dem auch sei, in Moonfleet gab es kaum jemanden, der nicht lieber zehn Meilen Umweg ging, als nachts am Friedhof vorbeizukommen. Und als man eines Sommermorgens Cracky Jones, einen armen, wirren Kerl, tot im Gras liegend auf dem Kirchhof fand, meinten viele, er habe in der Nacht Blackbeard getroffen.
Mr. Glennie, der mehr über solche Dinge wusste als jeder andere, sagte mir, dass Blackbeard niemand anders sei als ein gewisser Colonel John Mohune, gestorben vor etwa hundert Jahren. Mr. Glennie erzählte auch, dass Colonel Mohune in den schrecklichen Kriegen gegen König Karl den Ersten dem Haus seiner Vorfahren untreu geworden sei und sich auf die Seite der Rebellen geschlagen habe. So wurde er vom Parlament zum Gouverneur von Carisbrooke Castle ernannt und zum Kerkermeister des Königs, aber er betrog sein Amt.
Denn der König trug ständig ein großes Juwel bei sich, einen Diamanten, den ihm einst sein Bruder, der König von Frankreich, geschenkt hatte. Mohune kam dem Geheimnis auf die Spur und versprach, wenn man ihm den Diamanten gäbe, würde er über die Flucht Seiner Majestät hinwegsehen. Doch dieser ruchlose Mann, nachdem er den Schatz genommen, verriet den König erneut. Er erschien mit einer Abteilung Soldaten zur Stunde der geplanten Flucht, entdeckte den König am Fenster, nahm ihn fest, überstellte ihn in eine strengere Haft und meldete dem Parlament, dass nur seine Wachsamkeit die Flucht des Monarchen verhindert habe.
Doch wie wahr ist, was Mr. Glennie sagte: „Wir sollen den Gottlosen nicht beneiden, den Mann nicht achten, der nach bösem Rat wandelt.“ Der Verdacht fiel auf Colonel Mohune. Er wurde seines Amtes enthoben und kehrte nach Moonfleet zurück, wo er in Abgeschiedenheit lebte, von beiden Parteien verachtet, bis er etwa zur Zeit der glücklichen Wiederherstellung der Monarchie durch König Karl den Zweiten starb.
Aber selbst nach seinem Tod fand er keine Ruhe. Man sagte, er habe den Schatz, den er als Preis für die Flucht des Königs erhalten hatte, irgendwo versteckt. Da er sich nicht getraute, ihn wieder an sich zu nehmen, starb das Geheimnis mit ihm, und nun müsse er eben aus dem Grab steigen, um ihn wiederzufinden.
Mr. Glennie wollte nie sagen, ob er die Geschichte glaube oder nicht. Er verwies darauf, dass sowohl gute als auch böse Geister in der Heiligen Schrift erwähnt würden. Er meinte, der Kirchhof sei ein unwahrscheinlicher Ort für Colonel Mohune, um dort seinen Schatz zu suchen. Hätte er ihn dort vergraben, hätte er zu Lebzeiten hundert Gelegenheiten gehabt, ihn zu heben.
Wie dem auch sei, bei Tag war ich mutig wie ein Löwe und ging sogar gern auf den Kirchhof, weil man von dort aus den besten Blick auf das Meer hatte. Aber kein Geld der Welt hätte mich je dazu gebracht, nachts dorthin zu gehen. Und auch ich selbst hatte einen Beleg für die Wahrheit der Geschichte: Als ich in der Nacht, in der sich meine Tante das Bein brach, nach Ringstave gehen musste, um Dr. Hawkins zu holen, nahm ich den Weg über den Höhenzug, der in einer Meile Entfernung auf den Kirchhof hinabblickt. Und da sah ich von dort ganz deutlich ein Licht, das um die Kirche herumschwirrte, wo zu dieser Stunde – es war zwei Uhr morgens – kein ehrlicher Mensch mehr zu tun haben konnte.
Die Fluten
Dann stürzten die Deiche mit Toben und Grauen,
Dann peitschte der Schaum in gewaltig’n Brauen,
Dann brachen die Wasser mit mächtigem Dröhnen,
Und die Welt versank in des Meeres Zonen.
— Jean Ingelow —
Am dritten November, wenige Tage nach meinem Besuch im Why Not?, begann der Wind, der schon vom Südwesten her wehte, gegen vier Uhr nachmittags in heftigen Stößen aufzubrausen. Die Saatkrähen waren schon den ganzen Morgen tief und unruhig geflogen, also wussten wir, dass schlechtes Wetter bevorstand. Und als wir vom Unterricht heimkamen, den Mr. Glennie uns in der Halle der alten Armenhäuser gab, flogen bereits Strohbüschel und sogar einzelne Dachziegel von den Häusern, und die Kinder sangen:
Weh Wind, wachs Sturm,
Schiff am Morgen auf der Flur.
Ein heidnischer Reim, der aus dunkleren Zeiten stammte. Denn auch wenn ich nicht behaupten will, dass ein Schiffsbruch an der Küste von Moonfleet nicht manchmal als ein beinahe göttliches Geschenk betrachtet wurde, so hoffte ich doch, dass keiner von uns so gottlos war, sich eine solche Katastrophe zu wünschen, nur um an der Beute teilzuhaben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Männer von Moonfleet hundertmal ihr eigenes Leben aufs Spiel setzten, um das von schiffbrüchigen Seeleuten zu retten. So etwa, als die ‚Darius‘, ein Ostindienfahrer, an Land getrieben wurde. Ja, sogar namenlose Leichen, die angeschwemmt wurden, erhielten ein christliches Begräbnis, oder vielleicht gar einen von Master Ratseys Grabsteinen, auf dem Geschlecht und Todesdatum eingraviert waren, wie man es heute noch auf dem Kirchhof sehen kann.
Unser Dorf liegt nahe dem Zentrum der Bucht von Moonfleet, einer gewaltigen Einbuchtung von zwanzig Meilen Breite, die für Seeleute, die in Richtung Kanal unterwegs sind, bei Südweststurm zur Todesfalle wird. Denn wenn bei solcher Windrichtung ein Schiff das Snout Vorgebirge nicht mehr umrunden kann, läuft es fast unweigerlich auf Grund. So manch gutes Schiff, das den Punkt nicht geschafft hat, hat den ganzen Tag über auf der Bucht gekreuzt, nur um am Abend am Strand zu stranden.
Und einmal gestrandet, zeigt das Meer keine Gnade. Das Wasser ist bis ans Land tief, die Wellen brechen mit voller Wucht über das Kiesufer. Eine Gewalt, der kein Schiffsrumpf standhält. Versuchen dann arme Seelen, sich zu retten, so werden sie vom tödlichen Sog wieder zurückgerissen, jenem Rückstrom des Wassers, der sie von den Füßen reißt und unter die donnernden Wellen schleudert.
Dieser Kieselsog ist es auch, den man meilenweit ins Landesinnere hören kann, in stillen Nächten sogar bis nach Dorchester. Lange nachdem der Wind, der ihn verursacht hat, sich gelegt hat. Dann wenden sich die Leute unruhig in ihren Betten und danken Gott, dass sie nicht draußen am Strand von Moonfleet gegen das Meer kämpfen müssen.
Doch an diesem dritten November gab es keinen Schiffsbruch, nur einen Wind, wie ich ihn nie zuvor erlebt hatte und nur ein einziges Mal seither. Die ganze Nacht über tobte der Sturm schlimmer und schlimmer, und ich glaube, niemand in Moonfleet ging zu Bett. Es krachte und splitterte an Dächern und Fenstern, Türen schlugen, Läden klapperten – an Schlaf war nicht zu denken. Und wir fürchteten zudem, dass die Schornsteine einstürzen und uns erschlagen könnten.
Am heftigsten blies der Wind gegen fünf Uhr morgens, und da rannten einige durch die Straße und riefen eine neue Gefahr aus. Das Meer schlage über den Strand, und alles drohe überschwemmt zu werden. Manche Frauen wollten sofort fliehen und den Hügel hinaufsteigen. Doch Master Ratsey, der mit anderen durchs Dorf ging, um die Leute zu beruhigen, zeigte uns bald, dass der obere Teil des Dorfes so hoch lag, dass, wenn das Wasser wirklich bis dorthin vordringen sollte, auch der ganze Höhenrücken von Ridgedown unter Wasser stünde.
Aber da es gerade Springflut war und das Meer über den äußeren Kieselwall schlug, etwas, das seit fünfzig Jahren nicht mehr vorgekommen war, staute sich so viel Wasser in der Lagune, dass es über ihre Ufer trat und die Seeweiden und sogar das untere Ende der Straße überflutete.
Als der Tag anbrach, stand der Kirchhof unter Wasser, obwohl er auf höherem Gelände lag, und die Kirche selbst ragte wie eine steile kleine Insel aus der Flut heraus. Auch vor der Tür des Why Not? stand das Wasser, aber Elzevir Block rührte sich nicht vom Fleck und meinte nur, es wäre ihm gleich, wenn das Meer ihn mit sich nähme.
Es war nur ein neun Stunden währendes Wunder, denn der Wind legte sich ganz plötzlich. Das Wasser begann zurückzugehen, die Sonne schien hell, und noch vor Mittag kamen die Leute vor ihre Türen, um sich das Hochwasser anzusehen und über den Sturm zu reden. Die meisten meinten, solch einen heftigen Wind habe es noch nie gegeben, doch die ältesten im Dorf erinnerten sich an einen aus dem zweiten Jahr der Königin Anne und behaupteten, er sei ebenso schlimm oder noch schlimmer gewesen.
Doch ob schlimmer oder nicht, dieser Sturm war bedeutend genug für mich, denn er veränderte mein Leben, wie ihr noch hören werdet. Ich sagte bereits, dass das Wasser so hoch stieg, dass die Kirche wie eine Insel dastand, aber es ging schnell zurück, und Mr. Glennie konnte am nächsten Sonntagmorgen wieder Gottesdienst halten.
Schon sonst kamen nur wenige Leute zur Kirche von Moonfleet, aber an jenem Morgen waren es noch weniger, denn die Wiesen zwischen Dorf und Kirchhof waren vom Wasser durchweicht und schlammig. Seetang hing in Bändern selbst an den Grabsteinen, und außen an der Kirchhofsmauer hatte sich ein großer Haufen davon angesammelt, von dem ein salziger, ranziger Geruch ausging, wie ein stinkendes Ei einer Trottellumme, der noch lange nach einem Südweststurm in der Luft lag, wenn das Ufer mit Wrackgut bedeckt ist.
Diese Kirche ist so groß wie jede andere, die ich je gesehen habe, und wird durch eine steinerne Trennwand in zwei Teile geteilt. Vielleicht war Moonfleet früher einmal ein großer Ort, und damals mögen genug Leute da gewesen sein, um so eine Kirche zu füllen, doch seit ich sie kenne, hat nie jemand in dem Teil Gottesdienst gehalten, der das Kirchenschiff heißt.
Dieser westliche Abschnitt war völlig leer, bis auf ein paar alte Grabmäler und ein Wappen der Königin Anne. Der Steinboden war feucht und moosig, und an den weißen Wänden zogen sich grüne Streifen entlang, wo Regen eingedrungen war. So waren die wenigen, die zur Kirche kamen, froh, sich auf die andere Seite der Trennwand im Chorraum zu setzen, wo zumindest die Böden der Bänke mit Brettern belegt waren und eichene Paneele vor Zugluft schützten.
An jenem Sonntagmorgen waren es nur drei oder vier, denke ich, außer Mr. Glennie und Ratsey und uns sechs Jungen, die wir die matschigen, mit ertrunkenen Spitzmäusen und Maulwürfen übersäten Wiesen durchquerten. Selbst meine Tante war nicht zur Kirche gekommen. Sie sagte, sie habe eine Migräne. Aber auf die, die kamen, wartete eine Überraschung: Denn dort, ganz allein in einer Bank, saß Elzevir Block.
Die Leute starrten ihn an, als sie hereinkamen, denn niemand hatte ihn je zuvor in der Kirche gesehen. Manche im Dorf sagten, er sei Katholik, andere nannten ihn einen Ungläubigen. Wie dem auch sei, an diesem Tag war er da, vielleicht um dem Pfarrer seine Anerkennung zu zeigen, der die Verse für Davids Grabstein geschrieben hatte.
Er schenkte niemandem Beachtung, grüßte auch nicht, wie es sonst in der Kirche von Moonfleet üblich war, sondern hielt die Augen fest auf ein Gebetbuch gerichtet, das er in der Hand hielt, obwohl er dem Pfarrer nicht folgen konnte, denn er blätterte nie um.
Die Kirche war noch feucht von der Flut, und Master Ratsey hatte ein Feuer im Kohlenbecken am hinteren Ende entfacht. Etwas, das gewöhnlich erst geschah, wenn der Winter richtig Einzug hielt. Wir Jungen setzten uns so nah wie möglich an das Becken, denn die nasse Kälte stieg vom Steinboden auf. Außerdem saßen wir so weit vom Prediger entfernt und so gut von den hohen Eichensitzlehnen abgeschirmt, dass wir problemlos einen Apfel backen oder eine Kastanie rösten konnten, ohne erwischt zu werden.
Doch an jenem Morgen gab es etwas anderes, das uns ablenkte. Denn noch ehe der Gottesdienst richtig begonnen hatte, vernahmen wir ein seltsames Geräusch unter der Kirche. Das erste Mal hörten wir es gerade, als Mr. Glennie mit seinem „Geliebte Brüder“ zu Ende war, und dann erneut vor der zweiten Lesung.
Es war kein lautes Geräusch, eher so, wie wenn ein Boot auf See gegen ein anderes stößt. Nur war da etwas Tieferes, dumpf hallendes darin. Wir Jungen sahen einander an, denn wir wussten, was sich unter der Kirche befand, und dass dieses Geräusch nur aus der Gruft der Mohunes kommen konnte.
Niemand in Moonfleet hatte je das Innere dieser Gruft gesehen; doch Ratsey hatte von seinem Vater, der vor ihm Küster gewesen war, gehört, dass sie sich unter dem halben Chorraum erstreckte und dort mehr als zwanzig Mohunes begraben lagen.
Die Gruft war seit über vierzig Jahren nicht mehr geöffnet worden, seit Gerald Mohune dort beigesetzt wurde, jener, der sich beim Trinken auf dem Rennen in Weymouth ein Blutgefäß zerriss. Aber es ging die Geschichte, dass vor vielen Jahren an einem Sonntagnachmittag aus der Gruft ein so fürchterlicher, unirdischer Schrei ertönte, dass Pfarrer und Gemeinde aus der Kirche flohen und wochenlang niemand mehr zum Gottesdienst kam.
Wir dachten an diese Geschichten, rutschten näher ans Kohlenbecken und waren durch das Geräusch so verängstigt, dass wir nicht sicher waren, ob wir nicht doch davonlaufen sollten. Denn es war sicher, dass sich etwas in der Gruft der Mohunes bewegte. Jener Gruft, zu der es keinen Zugang gab außer durch einen gerillten Stein im Fußboden des Chorraums, der seit vierzig Jahren nicht mehr angehoben worden war.
Doch wir überlegten es uns anders und blieben sitzen, auch wenn ich sehen konnte, als ich aufstand und über die Sitzlehnen blickte, dass auch andere unruhig wurden. Granny Tucker zuckte so sehr zusammen, als sie das Geräusch hörte, dass ihr zweimal die Brille von der Nase in den Schoß fiel. Und Master Ratsey versuchte offenbar, das eine Geräusch durch ein anderes zu übertönen, sei es durch das Scharren seiner Füße oder durch das kräftige Zuschlagen seines Gebetbuchs.
Am meisten überraschte mich jedoch, dass selbst Elzevir Block, von dem es hieß, er fürchte weder Gott noch Teufel, unruhig wirkte und bei jedem Geräusch einen raschen Blick zu Ratsey warf.
So saßen wir, bis Mr. Glennie mit seiner Predigt gut vorangekommen war. Seine Rede interessierte mich, obwohl ich noch ein Junge war, denn er verglich das Leben mit dem Buchstaben „Y“ und sagte, dass in jedem Menschenleben ein Punkt komme, an dem sich zwei Wege wie die Arme eines Y teilten, und dass jeder für sich entscheiden müsse, ob er den breiten, sanft abfallenden Weg zur Linken oder den steilen, schmalen Pfad zur Rechten wähle.
„Denn“, sagte er, „wenn ihr in eure Bücher schaut, seht ihr, dass das Y nicht so ist wie das der Mohunes, mit gleich langen Armen, sondern dass der linke Arm breiter und schräger ist als der rechte. Daher hielten es die alten Philosophen für ein Symbol: Der breite linke Arm steht für den leichten Abstieg ins Verderben, der schmale rechte für den mühsamen Anstieg des Lebens.“
Da begannen wir alle, in unseren Gebetbüchern nach einem großen „Y“ zu suchen; und Granny Tucker, die nicht A von B unterscheiden konnte, tat sich groß, blätterte umständlich und ließ alle glauben, sie könne lesen.
Doch gerade in diesem Moment ertönte ein Geräusch von unten, lauter als alle zuvor, dumpf und kreischend, wie das Stöhnen eines alten Mannes in Schmerzen. Da sprang Granny Tucker auf und rief laut mitten im Gottesdienst zu Mr. Glennie: „Oh Herr Pfarrer, wie könnt Ihr da noch predigen, wenn die Mohunes aus ihren Gräbern steigen?“, und rannte hinaus aus der Kirche.
Das war zu viel für die anderen, und alle flohen. Mrs. Vining schrie: „Ach du liebe Zeit, wir werden alle erwürgt wie der arme Cracky Jones!“
Und so war binnen einer Minute niemand mehr in der Kirche, außer Mr. Glennie, mir, Ratsey und Elzevir Block. Ich lief nicht weg, erstens, weil ich nicht als Feigling vor den Männern dastehen wollte. Zweitens, weil ich dachte, sollte Blackbeard erscheinen, würde er sich wohl eher auf Männer stürzen als auf einen Jungen. Und drittens, weil ich glaubte, dass Block stark genug sei, es selbst mit einem Mohune aufzunehmen.
Mr. Glennie setzte seine Predigt fort, als hätte er weder das Geräusch gehört noch gesehen, wie die Leute die Kirche verließen. Und als er fertig war, ging Elzevir hinaus, aber ich blieb stehen, um zu hören, was der Pfarrer wohl zu Ratsey über die Geräusche in der Gruft sagen würde.
Der Totengräber half Mr. Glennie aus dem Messgewand, und als er mich daneben stehen und zuhören sah, sagte er: „Der Herr hat uns böse Engel geschickt. Es ist ein schreckliches Ding, Herr Pfarrer, zu hören, wie sich die Toten unter unseren Füßen regen.“
„Ach was“, antwortete der Pfarrer, „es sind nur ihre eigenen Ängste, die dem einfachen Volk solche Geräusche furchtbar erscheinen lassen. Was Blackbeard betrifft, ich will nicht sagen, ob schuldige Geister manchmal keine Ruhe finden und den Menschen erscheinen. Doch was diese Geräusche betrifft, so sind sie sicher das Werk der Natur, wie das Brausen der Wellen am Strand. Die Fluten haben die Gruft mit Wasser gefüllt, und so sind die Särge in Bewegung geraten, treiben in Strudeln, von denen wir nichts wissen, und stoßen gegeneinander. Da sie hohl sind, geben sie jene Töne von sich, die ihr hört. Das sind eure bösen Engel. Es ist sehr wohl wahr, dass die Toten sich unter unseren Füßen bewegen, aber nur, weil sie es nicht verhindern können, vom Wasser hin- und hergetragen zu werden. Und pfui, Ratsey, mein Lieber, du solltest es besser wissen, als einen Jungen mit dummem Gerede über Geister zu erschrecken, wenn die Wahrheit schon schlimm genug ist.“
Des Pfarrers Worte hatten für mich den Klang der Wahrheit, und ich zweifelte keinen Moment daran, dass er recht hatte. So war das Rätsel zwar erklärt, und doch war es ein grausiger Gedanke, der mir einen Schauder über den Rücken jagte: Die Mohunes, alle generationsweise, in ihren Särgen umhertreibend, gegeneinander stoßend im Dunkel.
Ich stellte sie mir vor, die vielen Generationen: alte Männer und Kinder, Männer und Frauen, nun alle nur noch Gebein, jeder in seiner morschen Holzkiste treibend. Und Blackbeard selbst in einem riesigen Sarg, größer als alle anderen, der durch das Dunkel krachte wie ein Schiff in schwerer See, das auf ein kleines Boot niedergeht, das es zu entern versucht. Und dann war da noch die äußere Finsternis der Gruft, die stickige Luft und das schwarze, faulige Wasser, das fast bis zur Decke reichte, über dem diese kläglichen Schiffe dahinzogen.
Ratsey sah ein wenig kleinlaut aus nach Mr. Glennies Worten, doch erfasste sich rasch und entgegnete: „Nun, Herr Pfarrer, ich bin nur ein schlichter Mann und weiß nichts von Fluten und diesen Strudeln und geheimen Wirkungen der Natur, von denen Ihr sprecht. Aber, verzeiht mir, ich halte es für töricht, solche Warnzeichen zu belächeln, wie sie uns gegeben werden. Es heißt immer: ‚Wenn die Mohunes sich regen, dann trauert Moonfleet.‘ Und ich habe meinen Vater erzählen hören, dass sie sich das letzte Mal in Königin Annes zweitem Jahr regten, als der große Sturm den Leuten die Häuser über dem Kopf wegriss. Und was das Erschrecken von Kindern betrifft, es ist gut, wenn hitzige Jungen lernen, Ehrfurcht zu haben und sich nicht in Dinge mischen, die sie nichts angehen, sonst könnte ihnen Unheil drohen.“
Die letzten Worte sagte er mit einem Blick, der ganz klar mir galt, auch wenn ich damals noch nicht verstand, was er damit meinte. Dann ging er verärgert hinaus, wo Elzevir schon auf ihn wartete, und ich begleitete Mr. Glennie, trug ihm das Messgewand zurück in seine Wohnung im Dorf.
Mr. Glennie war immer sehr freundlich zu mir, machte viel aus mir und sprach mit mir, als sei ich ihm ebenbürtig, was wohl daran lag, dass es in der Gegend sonst niemand gab, der auf seinem Wissensstand war, und ihm also ein unwissender Junge lieber war als ein unwissender Mann.
Nachdem wir das Drehkreuz am Kirchhof hinter uns gelassen hatten und über die schlammigen Wiesen gingen, fragte ich ihn erneut, was er über Blackbeard und seinen verlorenen Schatz wisse.
„Mein Sohn“, antwortete er, „alles, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass dieser Colonel John Mohune, den man fälschlich Blackbeard genannt hatte, der Erste war, der das Vermögen der Familie durch seine Ausschweifungen ruinierte. Er ließ sogar die Armenhäuser verfallen und jagte die Bedürftigen fort. Wenn man den Berichten glauben darf, war er ein böser Mensch, der neben zahllosen kleineren Vergehen auch das Blut eines treuen Dieners an den Händen hatte, den er aus dem Weg räumen ließ, weil dieser zufällig ein schuldiges Geheimnis seines Herrn belauscht hatte.
Dann, am Ende seines Lebens, von Furcht und Reue erfüllt, wie es bei bösen Menschen zuletzt immer kommt, ließ er den Rektor Kindersley aus Dorchester kommen, um ihm zu beichten, obwohl er Protestant war.