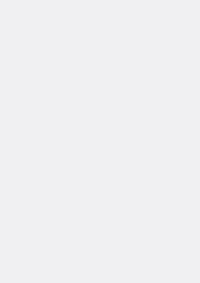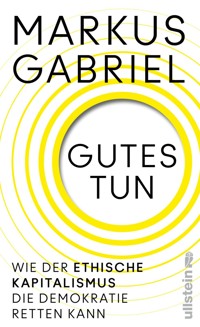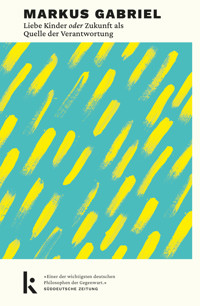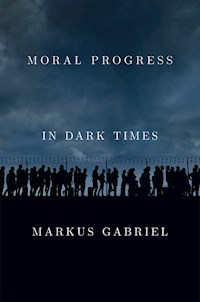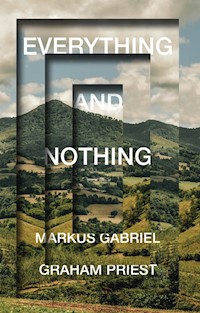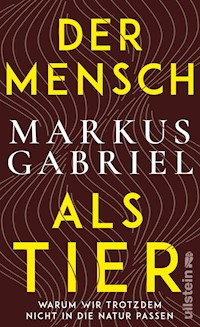30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer uralten Disziplin wie der Moralphilosophie geschehen mitunter noch Überraschungen. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt erfreut sich neuerdings eine lange vergessene Position großer Beliebtheit: der moralische Realismus. Der Starphilosoph und Bestsellerautor Markus Gabriel zeigt uns in seinem neuen Grundlagenwerk, dass sich daraus eine neuartige Ethik ableiten lässt, die genauso universalistisch wie konkret ist und sich als einzige auf der Höhe unserer Zeit bewegt.
Anhand zahlreicher Beispiele – vom Pazifismus und der Pandemie über den Klimawandel bis zum Moralismus und zur Geopolitik – führt uns Markus Gabriel in den moralischen Realismus ein. Der Hauptgedanke ist so einfach wie revolutionär: Es gibt moralische Tatsachen über das, was wir unbedingt zu tun und zu lassen haben. Wie ganz normale Tatsachen finden wir sie in der Wirklichkeit vor – sofern wir Menschen sind, die ihr Leben im Licht einer Vorstellung davon führen, wer oder was sie sind. Diese Tatsachen handeln von uns als freien geistigen Lebewesen. Deshalb können wir auch gar nicht anders, als in einer moralischen Wirklichkeit zu leben. Markus Gabriel verknüpft auf zugängliche Weise Beobachtungen über das Wesen der Moral mit Beobachtungen über das Wesen des Menschen und wendet diese auf die spezifische, globale Situation der Menschheit im 21. Jahrhundert an. Eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre, die sich gleichermaßen an Einsteiger und Experten richtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Markus Gabriel
Moralische Tatsachen
Warum sie existieren undwie wir sie erkennen können
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
I Moralische Tatsachen – Die Ontologie der moralischen Wirklichkeit
§ 1. Über den Begriff der Tatsache
§ 2. Moralische Tatsachen als Zielsystem der Ethik
§ 3. Das Begründungsproblem der Ethik, realistisch gelöst
§ 4. Die Konsistenz des Guten: Es gibt keine moralischen Dilemmata
§ 5. Der ethische Situationismus
§ 6. Komplexe moralische Tatsachen
II Praktische Erkenntnis – Die Epistemologie der moralischen Wirklichkeit
§ 7. Wie wir moralische Tatsachen erkennen, Teil I: Das Gewissen
§ 8. Das Wir der moralischen Wirklichkeit
§ 9. Wie wir moralische Tatsachen erkennen, Teil II: Die gelebte Erfahrung
§ 10. Anthropologische Diversität
§ 11. Universalisieren
§ 12. Konkrete Ethik
III Moralischer Fortschritt – Die Geschichtlichkeit der moralischen Wirklichkeit
§ 13. Der Begriff des Fortschritts
§ 14. Der Begriff des moralischen Fortschritts
§ 15. Der freie Wille
§ 16. Nicht-linearer Fortschritt
IV Die Verdunkelung und die Neue Aufklärung – Politik für eine moralische Wirklichkeit
§ 17. Kant und die Neue Aufklärung
§ 18. Was ist Neue Aufklärung?
§ 19. (Faule) Kompromisse
§ 20. Die Unverzichtbarkeit des politischen Liberalismus
§ 21. Ethischer vs. autoritärer Kapitalismus: Wem gehört die Zukunft?
§ 22. Ökosozialer Liberalismus: Wer wir sind und wer wir sein wollen
§ 23. Progressive Politik und rationaler Widerstand
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
Einleitung
I Moralische Tatsachen Die Ontologie der moralischen Wirklichkeit
II Praktische Erkenntnis Die Epistemologie der moralischen Wirklichkeit
III Moralischer Fortschritt Die Geschichte der moralischen Wirklichkeit
IV Die Verdunkelung und die Neue Aufklärung Politik für eine moralische Wirklichkeit
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
Die Menschheit befindet sich in einer verzwickten Lage. Schwelende Krisen schlagen allerorts in spürbare Katastrophen um, Interessenkonflikte verwandeln sich in handfeste kriegerische Auseinandersetzungen, der techno-wissenschaftliche Fortschrittsmotor überdreht, während bei alledem die ökologische Krise ein planetarisches Ausmaß annimmt, welches längst schon nicht mehr kontrollierbar zu sein scheint.1 Die Quantität der Krisen türmt sich zur Qualität einer Untergangsstimmung auf.
Während ich diese Zeilen schreibe, die sich beliebig um schlecht stimmende Zeitdiagnosen ergänzen ließen, stehen schon die nächsten technologischen Revolutionen vor der Tür – wie der massentaugliche Einsatz von Quantencomputern, der mit KI-Systemen gepaart in derzeit noch nicht vorstellbaren Dimensionen soziale, politische und ökonomische Disruptionen verursachen wird, deren Kollateralschäden und sonstigen Nebeneffekte nicht vorhersagbar sind. Einmal mehr findet keine real wirksame Technikfolgenabschätzung statt, stattdessen stürzen wir uns ins Fahrwasser der Innovation, ohne auch nur einen Funken rational begründeter Hoffnung, dass das schon gut gehen wird.
In dieser in den Augen vieler aussichtslosen Lage findet ein rasanter Wertewandel statt. Die digital und sozioökonomisch hochvernetzte Menschheit des 21. Jahrhunderts beginnt, sich des Umstandes bewusst zu werden, dass ihr Handeln von Werten geleitet wird, ohne dass sie bereits wüsste, wie sie diese so aufeinander abstimmen könnte, dass deren Vernetzung in Zukunft systematisch Frieden, Kooperation und Fortschritt fördert.2
Trotz der düster wirkenden Lage bin ich weiterhin zuversichtlich, dass wir in einem Zeitalter des moralischen Fortschritts leben.3 Die Menschheit befindet sich dabei auf einem selbstgemachten Prüfstand. Was auf dem Spiel steht, ist dabei nicht nur das Überleben unserer Spezies, sondern insbesondere das gute Leben. Das gute Leben unterscheidet sich vom schieren Überleben nicht nur im Hinblick auf die Lebensqualität, die längst auch wieder ein Thema der Ethik ist.4 Das gute Leben ist nämlich ein Leben, das sich dem Guten widmet, ein Leben also, das den Unterschied von Gut und Böse sowie die vielfältigen Wertenuancen wahrnimmt, dank derer uns die moralische Wirklichkeit, in der wir als freie geistige Lebewesen koexistieren, zugänglich ist.
Ein freies geistiges Lebewesen, d.h. ein Mensch zu sein, bedeutet, sein Leben im Licht einer Vorstellung seiner selbst zu führen.5 Diese Vorstellungen entstehen dadurch, dass wir die sich ständig verschiebenden Handlungssituationen, in denen wir uns vorfinden, bewusst oder unbewusst, explizit oder implizit, reflektiert oder unreflektiert bewerten. Als Handelnde betrachten wir die Wirklichkeit niemals nur als den Ort, an dem wir uns nun einmal vorfinden (das Universum, die Natur, die Welt, das Sein), sondern erfahren sie als etwas, das so sein soll, wie wir es vorfinden – oder eben auch nicht.
Kurzum: Die Wahrnehmung unserer Handlungssituation ist wertegeladen. Wir können nicht handeln, ohne zwischen einem Verlauf des Geschehens zu unterscheiden, den wir begrüßen (der so sein soll), und Verläufen, die wir verändern oder vermeiden wollen (die mithin nicht so sein sollen). Das Sein wird somit im Handeln auf das Sollen überschritten.
Die Wirklichkeit lässt sich vom Werturteil nicht so unterscheiden, dass es eine wertfreie Wirklichkeitsschicht (die ‹Natur›, das ‹Universum›) gibt, die wir dann durch unsere Praktiken allererst mit Wert ausstaffieren. Diese Wirklichkeit wäre schlichtweg nicht diejenige, in der wir leben. Sie wäre vielmehr ein schlechtes Abstraktionsprodukt. Vor diesem Hintergrund entstand das alte und, wie ich zeigen werde, in der Sache überholte (mit dem Namen David Humes verbundene) Dogma, Sein und Sollen seien ebenso wie Theorie und Praxis konstitutiv verschieden. Aus einem Sein, so glaubte man, ließe sich kein Sollen ableiten, und das Sollen könne seinerseits auch kein Sein haben.
Das Sein durch das Sollen zu überschreiten, zu transzendieren, schien dann darin zu bestehen, dem Sein den Stempel unseres Wollens aufzudrücken. Die Transzendenz über das Sein ist ein Wollen, das sich dem Sollen stellt. Dieses Sollen soll dem Wollen immanent sein, so der Eröffnungszug der modernen Moralphilosophie, wie sie von Kant und Fichte auf die Spitze getrieben wurde:
Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch ausser derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. […] Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d.i. an sich gut.6
Diese bei genauerer Betrachtung abwegige Auffassung, die das Gute in die Verfügungsgewalt des Wollens stellt, das sich durch die Form seiner Selbstbehauptung für gut erklärt, ist der Sündenfall der Moderne. Kant hat damit wider Willen den voluntaristischen Positionen von Nietzsche bis in die Untiefen vulgärer Relativismen der Gegenwart Tür und Tor geöffnet.
Doch Voluntarismus hin oder her, das Hauptproblem besteht darin, dass die hier nur angerissenen Eröffnungszüge der modernen Moralphilosophie nachweisbar falsch sind, sodass auf diesem Acker kein Kraut und schon gar keine blühenden Landschaften wachsen. Wir müssen die Position hinter uns lassen, dass das Sein an sich wertfrei (oder gar wertlos) ist und Wert nur durch das Wollen ‹in die Welt›7 kommt, dem wir dann notdürftig noch ein Sollen anheften, damit wir wenigstens noch eine formale Normativität aufrechterhalten können. Die Wirklichkeit, in der wir uns vorfinden, erleben wir vielmehr zu Recht immer schon als wert- und bedeutungsvoll. Die vermeintliche Demaskierung unserer Werte, hinter denen sich irgendeine an sich wertlose Wirklichkeit (der Materie, der Interessen, eines blinden Willens zur Macht oder was auch immer) verbergen soll, ist ethisch fehlgeleitete Metaphysik.
Die mit der modernen Willensmetaphysik verbundene formale Normativität entlarvte sich wohlgemerkt schon in der ersten Welle der Kantkritik – man denke hier an Jacobis begründeten Nihilismusvorwurf und Hegels überzeugenden Nachweis, dass der Formalismus des kategorischen Imperativs dazu führt, dass dieser keine Anwendungsbedingungen in realen Situationen haben kann – als illusionär, geistert aber immer noch in der Ethik herum. Die gegenwärtig herumspukenden Kantianismen scheitern jedoch allesamt daran, dass sie uns keinen Anhaltspunkt dafür liefern, was wir in den konkreten Situationen, in denen die Ethik gefragt wäre, tun sollen.8
Der andere Hauptstrang der modernen Moralphilosophie, der Utilitarismus, versuchte diese Verlegenheit zu kompensieren, indem nach Regeln, Prinzipien, Kalkülen und Algorithmen Ausschau gehalten wurde, die imstande sein sollten, unsere prätheoretischen Werturteile (unsere ‹Intuitionen›) quantitativ zu fassen. Wer wollte denn bestreiten, dass es besser ist, viele als wenige zu retten, die Lebensumstände vieler statt weniger zu verbessern usw.? Doch spätestens das Paradoxon der Weichenstellerfalle – das «Trolley-Problem» (§ 4, S. 92–94) – hat gezeigt, dass sich unsere erfolgreichen Werturteile nicht utilitaristisch modellieren lassen, während der immer noch einflussreiche Vorschlag eines «effective altruism» in seinen extremistischen Auswüchsen des «long-termism» oder gar des Anti-Natalismus in die Falle eben dieser Paradoxien getappt sind.9 Wenn Utilitaristen zu dem Ergebnis gelangen, dass wir beinahe die gesamte derzeit lebende Menschheit dem Fernziel einer interplanetarischen Zivilisation opfern sollen oder sich an irgendeinem anderen Science-Fiction-Szenario abarbeiten, ist dies längst schon kein überraschendes ‹Forschungsergebnis› einer rationalen Ethik mehr, sondern eine fortlaufende reductio ad absurdum des letztlich theorieunfähigen Utilitarismus. Es gibt eben kein stabiles utilitaristisches Kalkül, das sich algorithmisch auf die konkreten Situationen zuschneiden ließe, in denen wir das Gute tun und das Böse unterlassen sollen.
Deontologie und Utilitarismus – beide sind falsch. Sie verhalten sich zur moralischen Wirklichkeit wie schlechte Modelle zu einem Zielsystem, das sich einfach nicht fügen will. In solchen Fällen besteht aus wissenschaftlicher Sicht dringender Anlass zu fundamentalen Reformen. Ein Paradigmenwechsel tut not, zu dem das folgende Buch einen Beitrag leisten will.
Sein spezifischer Beitrag besteht in einer neuartigen Version des moralischen Realismus. Im Allgemeinen ist der moralische Realismus die Auffassung, dass es moralische Tatsachen gibt, die das Zielsystem der Ethik als Wissenschaft sind.10 Die Ethik versucht dann, mittels eigener Methoden und Heuristiken herauszufinden, was wir in konkreten Situationen tun bzw. unterlassen sollen.
Als ontologische These behauptet der moralische Realismus, dass es moralische Tatsachen gibt, die der Grund dafür sind, dass unsere moralisch relevanten Werturteile objektiv sind. In unserem Handeln sind wir einer von uns (partiell) unabhängigen Wirklichkeit gegenüber verantwortlich, die darüber bestimmt, ob wir das Gute, das Böse oder irgendetwas tun, was sich auf einem moralisch bedeutsamen Spektrum befindet.
Als epistemologische These behauptet der moralische Realismus, dass wir die moralischen Tatsachen auch erkennen können. Dass im Folgenden beide Dimensionen bearbeitet werden, drückt der Untertitel aus. Es gibt sie also, die moralischen Tatsachen, und wir können sie erkennen.
Die in Anspruch genommene Innovation besteht nun darin, zu zeigen, dass die moralischen Tatsachen einen Adressaten haben, nämlich (menschliche) Personen. Personen sind Subjekte von Handlungen, die sich in konkreten Situationen vorfinden, die vieles von ihnen verlangen. Was sie tun, lässt sich aufgrund der Struktur der Situationen daraufhin bewerten, ob es etwa gut oder böse ist.
Freilich verwenden wir statt der umfassenden Titel «Gut» und «Böse» ein weitaus ausdifferenzierteres Vokabular, um der feinkörnigen Struktur der moralischen Wirklichkeit gerecht zu werden. Was jemand tut oder wie jemand ist, wird als grausam, liebevoll, zärtlich, verächtlich, gastfreundlich, zuvorkommend, brutal, gewalttätig, heroisch, aufopfernd, egoistisch usw. beschrieben, womit wir Bewertungen vornehmen, die jeweils für die Ethik von Belang sind. Der damit begrifflich eröffnete Werteraum ist ein komplexes Kraftfeld, das den vielen Einzelentscheidungen, die in einer Situation stattfinden, jeweils einen Wert zuschreibt, dank dessen wir als Akteure überhaupt handlungsfähig sind.
Wir sind in die moralische Wirklichkeit eingeschrieben, sie handelt von uns, oder, wie ich mit einem geflügelten Wort sagen werde: tua res agitur, es geht um Dich (und mich und uns).11 Die Menschheit ist als die Reihe von Personen und damit in ihrer Geschichte dasjenige, worum es in der Ethik geht, weil es der Sinn und Zweck unseres Daseins ist, moralische Tatsachen zur Grundlage unserer Kooperation zu machen.12 Jede:r von uns ist Teil der geschichtlichen Entfaltung der moralischen Wirklichkeit, die kein großes Anderes ist, dem wir gegenüberstehen, sondern vielmehr etwas, dem wir auf allen Skalen unseres Handelns – von alltäglichen, individuellen Mikroentscheidungen bis hin zu den größten vernetzten sozialen Formationen, den Gesellschaften – entsprechen.13 Wir entrinnen unserer Verantwortlichkeit in keinem Moment unseres Lebens. Ja, man könnte im Ton des Existenzialismus sagen: Verantwortlichkeit ist das entscheidende moralische Existenzial (und nicht etwa Geworfenheit oder, menschenfreundlicher formuliert, Natalität).14 Nennen wir dies in Abgrenzung vom düsteren «Sein zum Tode»15 unser Sein zum Guten. Mit diesem Sein wird der Nihilismus verabschiedet und eine Neue Aufklärung eingeläutet, die sich zutraut, der «Souveränität des Guten» eine geschichtsphilosophische und soziopolitische Rolle zuzuschreiben.16
In diesem Rahmen entfaltet die hier vorgelegte Ethik eine Position, die ich als «ethischen Situationismus» (§ 5) bezeichne: Personen sind in den Situationen, in denen sie sich faktisch vorfinden, verantwortlich für das, was sie tun. Es kommt also darauf an, vor Ort (in situ) aufmerksam für das zu werden, was aus moralischen Gründen von uns verlangt ist. Diese Auffassung knüpft ebenfalls an einen Gedanken Iris Murdochs an, den sie als «attention» bezeichnet.17 Diese «Zuwendung», wie ich den Ausdruck übersetze, besteht darin, dass Personen die normativen Leitplanken der Wirklichkeiten, in denen sie leben, erkennen, um sich nach ihnen zu richten. Nur in Situationen können wir moralische Tatsachen erkennen, auf deren Grundlage wir dann fortschreiten, um ähnliche Situationen identifizieren zu können. Das dadurch allmählich – bottom-up – entspringende Universale ist weder vorgängig gegeben noch transzendent ungreifbar, sondern eine Aufforderung zum Universalisieren. Und dieses Universalisieren (vgl. ausführlich § 11) besteht darin, Äquivalenzklassen zu finden, die über verschiedene Situationen hinweg Gültigkeit beanspruchen. Was in einer Situation zu tun ist, gilt mithin mutatis mutandis auch andernorts – die Umkehrung von «andere Länder, andere Sitten». Zuwendung wendet sich dem Positiven zu – und Murdoch spricht gar von «love», um den Geist auszudrücken, der in dieser Ethik weht.
Allerdings bleibt die Position Murdochs individualistisch, weil sie Ethik primär als Verhältnis eines Individuums zu einem anderen Individuum konstruiert und dies überdies auf ein Verhältnis zwischen Menschen (und Gott bzw. dem Göttlichen) beschränkt.18 Demgegenüber entwickele ich eine umfassendere Ethik, welche die ökosoziale Integration des Menschen in Systeme berücksichtigt, die nur teilweise menschlich sind. Wir leben immer sowohl mit Anderen als auch mit Anderem zusammen. Ohne dieses Zusammenleben kollabierte sowohl die menschliche Lebensform als auch dasjenige Leben und Nicht-Lebendige, mit dem wir untrennbar verwoben sind.19
Diese Erweiterung der Ethik ist ihrerseits das Ergebnis eines Akts des Universalisierens und darin Ausdruck eines moralischen Fortschritts, der mit dem lebenswissenschaftlichen Fortschritt sowie der Erweiterung unserer ethnologischen und allgemeiner anthropologischen (Selbst-)Erkenntnis zusammenhängt.
Um diesen Gedankengang einzulösen, schreitet das Buch in vier Schritten voran, denen jeweils ein Kapitel gewidmet ist.
Das erste Kapitel entwickelt die Ontologie der moralischen Wirklichkeit, deren Hauptbegriff die titelgebenden moralischen Tatsachen sind. Es zeigt, warum sie existieren und welche Struktur die Sinnfelder der Ethik aufweisen. Auf diese Weise geht der hier entwickelte neue moralische Realismus weit über eine Verteidigung des handelsüblichen moralischen Realismus hinaus. Jeder Paragraph führt eine weitere begriffliche Komponente ein, welche die Feinauflösung des Begriffs der moralischen Tatsache erhöht.
Das zweite Kapitel widmet sich sodann der Epistemologie der moralischen Wirklichkeit und beantwortet damit die Frage, wie wir moralische Tatsachen erkennen können. Denn es reicht nicht hin, sich ihrer Existenz metaethisch zu versichern, wenn sich nicht Verfahren angeben lassen, wie praktische Erkenntnis erlangt und akkumuliert werden kann. Hierbei wird der Begriff einer konkreten Ethik weiterentwickelt, der insbesondere darin besteht, die Ethik als eine praktische Erkenntnis in situ zu erfassen, womit die Kluft zwischen der wissenschaftlichen Ethik einerseits und dem moralischen Alltagsurteil (dem «gemeinen Menschenverstand»20) und seinem «Lebenswandel in concreto»21 andererseits geschlossen wird. Die Ethik als Wissenschaft entwickelt Verfahren des Universalisierens, die nicht mehr auf die Zufälle eines moralischen Fortschritts angewiesen sind, der sich im Erfolgsfall von selbst einstellt. Auf diese Weise akkumuliert sie Wissen, das als moralischer Fortschritt institutionell unterlegt werden kann.
Vor diesem Hintergrund bringt das dritte Kapitel die Ontologie und Epistemologie der moralischen Wirklichkeit über das Scharnier des moralischen Fortschritts zusammen. Es wird gezeigt, dass der neue moralische Realismus das historische Sein unserer mores (unserer immer schon ethisch informierten, synchron und diachron äußerst diversen Werturteile) mit dem überzeitlichen Sein moralischer Tatsachen verbindet und diese Verbindung nachhaltig institutionell verankert.
Dabei entwickele ich Grundlagen einer entsprechenden Geschichtsphilosophie, die – anders als vergangene Wellen der Aufklärung – die Geschichte von jeglichem Automatismus oder dialektischem «Gang des Weltgeistes»22 abkoppelt. Geschichte ist und bleibt das Handeln vieler Einzelner, die jeweils Teil sozialer Systeme sind. Es verbirgt sich nicht mehr (aber auch nicht weniger) hinter ihr als der Auftrag des Menschen, seinem Sein und der darin liegenden Verantwortlichkeit gerecht zu werden. Ob diese Verantwortlichkeit einer höheren Quelle gegenüber Rechenschaft schuldig ist, kann und muss hier nicht beantwortet werden. Dies wäre Aufgabe einer umfangreichen Religionsphilosophie, die nicht vorgängig vorliegen muss, weil Ethik und Religion unabhängig voneinander sind. Damit meine ich nur, dass die Ethik keiner religiösen Quellen bedarf – weil das Gute eben nicht dadurch das Gute ist, dass es von einer weiteren Quelle (sei dies die Evolution, die Vernunft oder eben Gott) validiert wird. Das schließt Religionen als Normsysteme und Wertquellen nicht aus, sondern ein, sofern sie Beiträge zum moralischen Fortschritt liefern, wofür es unzählige Beispiele der menschlichen Bewusstseinsgeschichte gibt.
Die Neue Aufklärung, in deren Geist das Buch verfasst ist, kämpft nicht gegen die Religionen, sie kämpft gegen gar nichts. Das Ziel ist nicht, die Ethik auf eine säkulare Grundlage zu stellen, denn das hat sie gar nicht nötig. Die moralischen Tatsachen sprechen für sich selbst – und damit sicherlich nicht gegen Gott, die Götter oder das Göttliche.
Moralischer Fortschritt, so werde ich argumentieren, ist eine institutionelle Verankerung praktischer Erkenntnis, die über unzählige Erfahrungen akkumuliert wird, die Einzelne in ihren sozialen Formationen machen. Sie geht über die bloße Erkenntnis hinaus, indem Institutionen geschaffen werden, die nachhaltig positiven sozialen Wandel gestalten. Damit wird der Begriff des moralischen Fortschritts über die heute üblichen Fälle hart erkämpfter moderner Emanzipationen hinaus erweitert. Das Modell des moralischen Fortschritts ist nicht mehr der heroische Freiheitskampf oder der Aktivismus der Zivilgesellschaft (deren Wert nicht bestritten werden soll). Vielmehr fließen auch unsere Mikroentscheidungen in das Meer praktischer Erkenntnis ein, dessen wellenförmige Dynamik sich nicht auf einige Höhepunkte des moralischen Fortschritts (wie die Abschaffung der Sklaverei oder die Errungenschaften der Sozialdemokratie und der geschlechtlichen Emanzipation) reduzieren lässt.
In diesem Zusammenhang spielt die Theorie des freien Willens eine entscheidende Rolle. Der freie Wille ist kein übergeordnetes Vermögen des menschlichen Geistes, das mit einem rationalen Vermögen (der Vernunft, dem Verstand, der Intelligenz) kontrastiert. Vielmehr bezieht sich die Rede vom «freien Willen» direkt auf ein Abstraktionsniveau, auf dem wir eine bestimmte Form von geistigen Tätigkeiten zusammenfassen: all diejenigen, die wünschenswerte (sein sollende) von nicht-wünschenswerten (nicht-sein sollenden) Zukünften unterscheiden und herbeizuführen. Der freie Wille antizipiert Zukünfte und bewertet sie. Da die Zukünfte noch nicht eingetreten sind, trägt er kausal zu ihnen bei, indem er sich als Selbstbestimmung von Personen realisiert. Was jemand in diesem oder jenem Fall, auf dieser oder jener Ebene (Mikro-, Meso-, Makro-) tut, ist dann Ausdruck des freien Willens, wenn Alternativen erwogen wurden. Eine Alternative zu bevorzugen und zu verfolgen, ist das Tätigsein des freien Willens, der frei insofern ist, als er ein Fall von Selbstbestimmung ist.
Freiheit kontrastiert nicht mit Determination, und sie nimmt auch keinen Indeterminismus in Anspruch. Die Theorie des freien Willens muss auch nicht das Hindernis eines physikalischen Determinismus aus dem Weg räumen. Denn das Universum als kausales Gesamtsystem (sofern sich dieser Begriff sinnvoll bilden lässt) schließt Selbstbestimmung nicht aus. Es unterminiert sie mithin auch nicht. Das Universum als physikalischer Verlauf erschöpft die Wirklichkeit ohnehin nicht. Wer erklärt, was jemand tut, verfehlt sein Zielsystem (die Handlung), wenn er nicht berücksichtigt, dass jemand etwas tut, weil er es will. Und dass jemand etwas tut, weil er es will, ist kein Thema der Physik, auch keiner künftigen.
Die Ethik der moralischen Tatsachen ist kein ‹weltfremdes› Projekt, das sich von der Wirklichkeit ab- und Höherem zuwendet. Deswegen endet die Darstellung mit einem vierten Kapitel, das eine Neue Aufklärung als politische Heuristik fordert. Diese politische Heuristik ist grundlegend (und damit in einem philosophischen Sinne) liberal. Denn es geht ja darum, Handlungsspielräume zu erweitern, indem erkannt wird, was wir aus moralischen Gründen tun bzw. unterlassen sollen. Politik soll stets mehr, nie weniger Freiheit wollen. Die Erweiterung besteht konkret darin, dass moralische Tatsachen anzeigen, was für das Zusammenleben von Menschen von Bedeutung ist, deren Handlungen koordiniert werden müssen, damit sie sich überhaupt sozial formieren können.
Freiheit ist dadurch konstitutiv sozial, dass die meisten Handlungen, an denen wir interessiert sind, voraussetzen, dass mehrere Akteure kooperieren. Man spielt nicht sinnvoll allein Tennis oder Schach; man gründet kein Unternehmen, ohne dass es Abnehmer gibt; man fährt nicht U-Bahn, ohne dass unzählige andere die sozialen Systeme aufrechterhalten, ohne die es keine U-Bahn gibt. Nur wenige Handlungen sind von der Form, dass man sie besser von anderen ungestört (ontologisch privat) ausübt. Somit entfällt der Kontrast von individueller Freiheit und sozialem Zwang, der die Handlungswirklichkeit des prosozialen Säugetiers Mensch völlig verfehlt. Wir sind in jeder Lebenslage auf andere angewiesen, und es gäbe niemanden von uns, wenn wir nicht auf irgendeine Weise liebevoll in die Gemeinschaft der Menschheit eingeführt worden wären.
Freilich werden ausgerechnet diejenigen Menschen, die unsere Unterstützung am meisten bedürfen, wozu vor allem Kinder gehören, allzu häufig nicht angemessen geschützt und sogar brutal misshandelt. Solche Gräueltaten wiegen gerade dadurch besonders schwer, dass sie ein wichtiges Prinzip der Ethik verletzen, das u.a. an Hans Jonas anknüpfen kann: Dasjenige (was menschliche Personen ebenso wie nicht-menschliche Tiere, andere Lebensformen und unsere geteilten Lebensgrundlagen einschließt), worüber jemand Macht hat, ist ipso facto etwas, demgegenüber er Verantwortung hat.23 Macht impliziert Verantwortung, nicht ausnutzbare Überlegenheit.
Der Zweck und damit das Ziel von Politik ist eine gute Gesellschaft.24 Politik kommt dann ins Spiel, wenn Ethik und andere Normsysteme allein nicht hinreichen, um in einer komplexen Lage Entscheidungen zu treffen. Politik ist eine normative Praxis sui generis, die mit anderen Normsystemen – auch mit der Ethik – verwoben ist. Politik ist dann progressiv, wenn sie moralischen Fortschritt zum Programm macht. Auf diese Weise reichen sich der politische Begriff der Güter und der ethische des Guten die Hand, weil politische Ressourcenverteilung immer auch daran bemessen werden kann und soll, ob sie moralisch erfolgreich ist.
Die Ethik ersetzt die Politik nicht. Denn Politik ist überhaupt nur dort sinnvoll, wo eine ungewisse Zukunft des sozialen Wandels auf mehrere prima facie gleich gute Weisen gestaltet werden kann. Politische Zukunftsgestaltung gibt dem sozialen Wandel eine bestimmte, aber stets noch weiter zu bestimmende Richtung vor, indem sie versucht, konkrete normative Leitplanken zu setzen, welche die Entwicklung des sozialen Wandels lenken, insbesondere durch das Erlassen von Gesetzen.25
Gesetze stellen den Rahmen dafür zur Verfügung, wie Institutionen gestaltet werden können – Institutionen, die imstande sind, praktische (und somit auch ethische) Erkenntnis gesellschaftlich zu implementieren. Im Sinne einer Kombination aus ethischer Erkenntnis und institutioneller Anerkennung, die gesellschaftlich großflächig skaliert werden kann, kann moralischer Fortschritt auf diese Weise nachhaltig erreicht, dokumentiert und reproduziert werden. Dadurch ist es möglich, ethische Erkenntnis zu akkumulieren und generationenübergreifend durch Tradition nachhaltig zu verankern.
Progressive Politik ist somit trivialiter mit der Bewahrung des erreichten Guten beschäftigt und mündet nicht in eine maoistische oder sonstige (etwa anarchokapitalistische) Dauerrevolution. Moralischer Fortschritt ist nur dann disruptiv (bis hin zur Revolution), wenn seine institutionellen Grundlagen gefährdet sind. Aus Dissentierenden werden dann Dissidenten, die Opposition wird zum Feind und hört auf, fallibele Wissensansprüche und Entscheidungen herauszufordern – im Rahmen des historisch offenen Ringens darum, wie möglichst viele Probleme der Menschheit durch Wertschöpfung, faire und geschickte Ressourcenallokation gelöst werden können.
Progressive Politik ist deswegen in dem Maße parteiübergreifend, wie sie die Politik selbst als Teil einer Heuristik moralischer Tatsachen auffasst. Eine Heuristik zu haben bedeutet im Allgemeinen, über Methoden darüber zu verfügen, wie sich relevante Tatsachen feststellen lassen. Progressive Politik greift durch Kompromissbildung, Diplomatie, Debatte und den Streit um umsetzbare Lösungen auf die ethische Methode des Universalisierens zurück, die wiederum durch politische Zeitdiagnose und politische Partizipation imstande ist, die situationale Feinabstimmung zu verbessern. Auf diese Weise wird Politik – darin anderen Sektoren der Gesellschaft verwandt, auf die ich zu sprechen kommen werde – zu einem Verfahren, moralische Tatsachen zu entdecken, die teils verborgen waren.
Im abschließenden Kapitel werden Politik und Wirtschaft vor diesem Hintergrund als Labore moralischer Innovation verstanden, ohne dass sie deswegen moralistisch auf diesen Zweck reduziert werden. Die Normsysteme der Ethik, Politik und Ökonomie sind verschieden, überschneiden sich aber in bedeutsamen Zonen des menschlichen Zusammenlebens. In der Kooperation erfahren wir Menschen mehr darüber, wer wir faktisch sind und wer wir eigentlich sein wollen – was zur Grundlage weiterer Akte der Selbstbestimmung werden kann. Denn erst, wenn wir im sozialen und politischen Austausch mit echter Diversität in Berührung kommen, erlangen wir ein angemessenes Bild davon, wer wir sein sollen. Die Anderen sind Alternativen für uns – nicht, weil wir alle (oder gar alles) auch anders sein könnten, sondern weil wir nur durch Austausch von Alternativen korrekturoffen sind.
Moralische Tatsachen stellen dabei ein gewichtiges Korrekturmaß zur Verfügung. Sie greifen oft weiter in die Zukunft ein, als das politische und wirtschaftliche Tagesgeschäft der beschäftigten Problemlösung (das sprichwörtliche business of usual) es zulässt. Ethik ist deswegen visionär: Sie beschreibt einen Aspekt einer zukunftsorientierten Tiefeninnovation, die sich wohlgemerkt in die Naherwartungen einer konkreten Ethik übersetzen lässt.
Die Zeitform der Normativität (gleich welcher Spezies) ist die Zukunft. Die Praxis betrachtet die Gegenwart stets im Hinblick auf mögliche Zukünfte. Welche Zukünfte dann realisiert werden, ist eine Funktion eben solcher Betrachtungen. Wie sie realisiert werden, erschöpft sich nicht in der Betrachtung. Der Übergang ins Handeln ist eben nicht nur die Konklusion eines Syllogismus – die Schlussfolgerung aus gedanklich erwogenen Prämissen –, sondern immer auch die Antizipation einer besseren Zukunft, die ihre Qualität erst unter Beweis zu stellen hat. Da moralische Tatsachen immer ein Hinweis darauf sind, was das Gute konkret (in situ) ist, bestimmen sie die Struktur wünschenswerter Zukünfte maßgeblich mit. Keine Zukunft kann wünschenswert sein, die moralische Auflagen verletzt. Die politische Funktion von Dystopien sollte eigentlich sein, sie zu verhindern, während wir freilich in der derzeitigen Welle autoritärer Spielarten des Kapitalismus (die seine freiheitliche Grundlage gefährden) – ob sie sich politisch links oder rechts gebärden – eine unheimliche Abkehr von dieser elementaren Spielregel erleben. Was dann «dark enlightenment» heißt, ist schlichtweg Verdunkelung und somit das kontradiktorische Gegenteil der Aufklärung.26
Deswegen bedarf es einer Neuen Aufklärung und keiner Verdunkelung. Diese Neue Aufklärung knüpft dabei keineswegs nahtlos an diejenigen Aufklärungen an, die im 18. Jahrhundert von einigen europäischen Nationen ausgegangen sind. Dafür sind die epistemischen, technowissenschaftlichen und ökonomischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts viel zu verschieden von der Ausgangslage der alten Aufklärung. Die digitale Revolution und ihre Beschleunigung durch KI-Systeme – sowie in naher Zukunft durch Quantencomputer – und eine damit zusammenhängende Infrastruktur haben völlig neuartige Formen der Vernetzung und Vergesellschaftung geschaffen. Demokratietheoreme, die sich auf rationale Deliberation oder die Mechanismen der «wisdom of crowds»27 stützen, können digital konterkariert und als Waffe der Selbstzerstörung eingesetzt werden – was sich z.B. im gegenwärtigen digitalen Cyberangriff auf die liberale Ordnung manifestiert. Das Rennen zwischen verschiedenen Spielarten des Kapitalismus oder einer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die ebenfalls entstehen könnte, ist offen. Der Mensch ist und bleibt frei.
Der ökosoziale Liberalismus (§ 22), den die Neue Aufklärung anbietet, ist weder bloßer Zeitgeist noch gar Parteipolitik, sondern die Formulierung eines Rahmens zur Orchestrierung moralischen Fortschritts. Dieser folgt keiner gegebenen Blaupause. Er ist vielmehr heuristisch offen in der Frage, was konkret zu tun ist. Nur so kann die transkulturelle Aufgabe ernstgenommen werden, soziale Formationen als Labore moralischer Innovation zu verstehen – was gerade bedeutet, dass jegliche Form von Zentrismus (sei es ein Euro-, Sino- oder Amerikanozentrismus etc.) oder «X first»-Ideologie aus der Ethik herauszuhalten sind. Ethik ist nicht Kampf, sondern Frieden, sie richtet sich gegen keine wohlumgrenzten Gruppen, sondern gegen das Böse, das so diffus wie menschlich ist.
Das Gute und Böse sind Gestalten der Freiheit und keine ‹Volksgeister›. Weder sind die ‹europäischen› Werte (was auch immer diese genau sein sollen) immer schon gut noch sind die ‹russischen›, ‹chinesischen›, ‹amerikanischen› oder sonstigen Regionalgestalten von ethischem Belang. Sie besitzen an sich keine moralische Qualität. Das Gute ist ebenso wie das Böse niemandes Privileg, alle sind zu beidem imstande, und die Staatszugehörigkeit ist sicherlich kein Indikator von Tugend oder Laster. Die heute grassierenden Nationalismen sind auch Formen des Moralismus – selbst dann, wenn sie diesen in der Gestalt ihrer Feindbilder gerne den anderen in die Schuhe schieben, was ein Symptom der Polarisierung ist (§ 17, S. 309–311). Moralismus können wir fürs erste als einen ethischen Kategorienfehler verstehen: Soziale Normen, die verhandelbar und gerade darin keine moralischen Tatsachen sind, werden zu moralischen Tatsachen umgemünzt, was den Akteuren einen Reputationsgewinn im Spiel des ‹virtue signalling› gibt. Dem ‹linken› folgt das ‹rechte› ‹Sprechverbot›, während sich alle darin einig werden, dass Meinungs- und Redefreiheit ein hoher Wert ist – solange die Anderen nichts sagen. Dieser Schlagabtausch bedient sich des Moralismus. Im Fall der grassierenden Nationalismen wird die Nation als kultureller Werteblock verstanden, den es gegen einen Wertefeind oder eine vage Wertebedrohung durch irgendeine die Sicherheit gefährdende Gruppe zu verteidigen gilt. Aus nationalen Sicherheitsinteressen – die oftmals völlig legitim und übrigens auch moralisch einwandfrei sein können – wird auf diese Weise eine Frage der moralischen Haltung, was aber wiederum ein Kategorienfehler ist, der nicht-moralische Normen pseudo-moralisch auflädt.
Die brandgefährliche Konstellation der Polarisierung ist keineswegs zufällig ein Kollateralschaden der Digitalisierung, die weitgehend unkontrolliert – ohne wirkmächtige Technikfolgenabschätzung sowie ohne ethisch durchdachte Regulierung – auf die Menschheit losgelassen wurde. Die Folgen sind verheerend, auch wenn die positiven Kräfte der Emanzipation durch digitale Vernetzung und neue Wertschöpfungsketten nicht in Abrede gestellt werden sollten.
Mit der Digitalisierung siegt sich die alte Aufklärung paradoxerweise zu Tode. Die am weitesten entwickelten Wissensgesellschaften aller Zeiten setzen ihre avanciertesten Technologien und Wissenschaften ein, um ihr eigenes Fortschrittsversprechen zurückzunehmen. Aus Erkenntnis- werden Überwachungsinstrumente, aus dem Wissen über die Funktionsweise sozialer Formationen werden ausbeuterische Geschäftsmodelle, die unsere Aufmerksamkeit und damit auch unsere neuronale Energie derart anzapfen, dass es vielen Zeitdiagnostikern zunehmend schwerfällt, den Vergleich mit den Matrix- und sonstigen dystopischen Szenarien zu vermeiden.28 Dadurch wird Geist an seiner Wurzel angegriffen: indem unsere Selbstbildfähigkeit umprogrammiert wird, um die Kontaktzeit mit digitalen Plattformen zu erhöhen, die sich diese Aufmerksamkeit durch verstecktes digitales Kleingeld in barer Münze (oder gerne auch in einer Kryptowährung) auszahlen lassen.
Die Neue Aufklärung ist deswegen freilich kein technikfeindlicher Entwurf, sondern umgekehrt eine Aufforderung dazu, die Methoden der Moderne auch während der digitalen Revolution den Umständen anzupassen. Andere, moralisch bessere Formen der Digitalisierung sind möglich: moralisch bessere KI-Systeme, moralisch bessere soziale Netzwerke, moralisch bessere digitale Wertschöpfungsketten auch, wofür es zahlreiche Beispiele gibt, weil (noch?) nicht jedes digitale Geschäftsmodell einem der bekannten Tech-Monopolisten gehört.
Dieser Umstand der faktisch offenen Zukünfte wird durch die geschichtsphilosophische Fehlkonstruktion unserer «breiten Gegenwart» vernebelt.29 Das «postmoderne Wissen»30 war keines, weil es sich vorgaukelte, dass der historische Zustand der Menschheit in der europäisch-amerikanischen Nachkriegszeit das Muster für die erreichte Ewigkeit gefunden hat und dass die Menschheit nun endlich in eine zeitlose Gegenwart schreiten konnte. Doch Geschichte ist und bleibt immer offen, und was unsere Jetztzeit angeht, so ist der moralische Fortschritt weit von seinem Ende entfernt– wie jeder erkennt, der die schrecklichen Gräueltaten, die täglich stattfinden, und die prekären Umstände berücksichtigt, unter denen viele Millionen Menschen und wohlgemerkt Milliarden von nicht-menschlichen Lebewesen leiden, die zu den wirklichen Opfern der Moderne gehören.
Umso mehr tut eine neue Ethik not, die an das Erreichte anknüpft und das Gute bewahrt, ohne die Zukunft zu verstellen. Sie begibt sich nicht in Opposition zum Geschehen, sie flieht die Wirklichkeit nicht und sie zieht sich auch nicht in irgendeinen vermeintlichen Elfenbeinturm oder ein gemütliches Wolkenkuckucksheim zurück, sondern sucht in den indefinit ausdifferenzierten Lebensformen des Menschen nach gelungenen Modellen der Selbstbestimmung, die sich universalisieren lassen. Es kommt also wirklich darauf an, moralisch voneinander zu lernen, statt die Menschen in Blöcke (‹Identitäten›) einzuteilen. Voneinander lernen können wir nur, wenn wir die Objektivität unserer Werturteile anerkennen. Denn Objektivität heißt Fallibilität, nicht unerschütterliche Gewissheit, weil die ethisch noch unbeantworteten Fragen komplexe moralische Tatsachen betreffen.
Ein letzter Hinweis sei noch gegeben, ehe wir medias in res gehen. Dass Ethik objektiv und mithin fallibel ist, heißt nicht, dass es keine offensichtlichen moralischen Tatsachen gibt. Diese stehen nicht zur Disposition, sie sind erkannt und laufen im Hintergrund unserer weiteren Verständigungsversuche mit. Der nächste Schritt des moralischen Fortschritts kann weder die Wiedereinführung von Menschenopfern zur Besänftigung der Götter noch die Rückabwicklung moderner emanzipatorischer Prozesse wie der (allzu unvollendeten) Gleichberechtigung der Geschlechter sein. Fortschritt kann nicht um den Preis der Dekonstruktion von Erkenntnis errungen werden. Dass Mädchen denselben Zugang zu Schul- und Hochschulbildung haben sollen wie alle anderen, darf nicht zur Debatte stehen, wenn wir uns fragen, welcher kommende soziale Wandel moralisch wünschenswert ist. Es ist ebenso moralisch offensichtlich wie es mathematisch offensichtlich ist, dass 7+5=12 oder dass a2+b2=c2 ist. Dass es alternative formale Systeme, andere Logiken und mathenatische Wissenschaften gibt, widerspricht dem nicht, da in anderen Systemen andere Theoreme gelten, ohne dass die Systeme sich widersprechen.
Genau das gibt es in der Ethik wohlgemerkt nicht: Die moralischen Tatsachen bleiben sich über alle Moralen (alle faktischen Werturteilssysteme) hinweg gleich. Die verschiedenen Moralen haben dennoch einen ethischen Eigenwert, indem sie jeweils andere Methoden und Heuristiken entwickeln, die sich aus der gelebten Erfahrung von Personen ergeben – weswegen wir ja auch alle voneinander lernen können.
Anders als etwa die Physik, an der sie von den frühesten Anfängen des wissenschaftlichen philosophischen Nachdenkens immer wieder gemessen wurde, ist die Ethik nach wie vor weit davon entfernt, Symmetrien über verschiedene soziale Formationen und ihre faktischen Werturteile hinweg angemessen zu modellieren. Die Äquivalenzklassen der moralischen Wirklichkeit sind uns bisher sehr viel unbekannter als diejenigen des Universums, welche Hinweise darauf geben, wann eine physikalische Theorie gelingt.
Nur über die Erforschung von Äquivalenzklassen ließe sich eine Heuristik der Ethik methodisch angeleitet entwickeln, die systematisch zu neuer praktischer Erkenntnis führt. Diese Heuristik muss dabei selbst bereits praktisch sein, damit sie als konkrete Ethik vor Ort wirken kann. Die Ethik beginnt in Situationen gelebter und sozial geteilter Erfahrung. Dort zeigen sich moralische offensichtliche Tatsachen, dank derer weitere Fragen und Probleme auftauchen, die sich nur unter veränderten Bedingungen in ähnlichen Situationen bearbeiten lassen. Bisher wird dieses Vorgehen an die Weisheit und Urteilskraft der Einzelnen delegiert, was dann in moralischen Traditionen mündet, die solche Einzelerfahrungen aggregieren und in meistens unsystematischer Weise überliefern. Die Neue Aufklärung dockt dort an und entwickelt Verfahren, wie wir dieses gelebte Wissen der Moralen in ein Selbstbewusstsein verwandeln – was überraschend nahe an Luhmanns Ansatz ist, die Ethik als «Reflexionstheorie der Moral»31 zu verstehen.
Allerdings drückt sich diese Reflexionstheorie, anders als Luhmanns geschlossenes Systemdenken dies anerkennen könnte, auch als Moral aus: Sie entwickelt Vorschläge zum moralischen Fortschritt in einem seit Jahrtausenden stattfindenden Kreislauf zwischen Tun und Reflexion, aus dem unzählige Maximen, Prinzipien und Regelsysteme entstanden sind.
Das zu bewältigende Pensum einer Neuen Aufklärung bestünde darin, mithilfe der im Folgenden zu beschreibenden methodischen Grundpfeiler Prozesse des Universalisierens einzuleiten, wofür auf den wissenschaftlichen und technologischen Stand der Menschheit zurückgegriffen werden kann. Es ist möglich, dass der moralische Fortschritt zum selbstbewussten Motor institutioneller Selbstbestimmung wird, indem wir ihn explizit machen und die Normsysteme der Gesellschaft – die sich eher überlappen, als dass sie in getrennten Systemen verlaufen – in Verhältnisse der Kooperation versetzen.
Das 21. Jahrhundert denkt entsprechend bereits in Vernetzungen, in Verwobenheit und Verschränkung. Es beginnt damit, die wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts allmählich in die Selbsterkenntnis des Menschen zu überführen. Dafür reichen die Werkzeuge der Natur- und Technowissenschaften allein nicht hin. Sie müssen vielmehr mit den Methoden der Geistes- und Sozialwissenschaften verschränkt werden, um in neuen Formaten transsektoraler Kooperation zur Geltung zu kommen.
Damit verfolgt die hier vorgelegte Ethik das moderne Ziel, unter Rekurs auf die historischen Errungenschaften, für die zu viele Menschen sterben mussten und weiterhin in Freiheitskämpfen, Aufständen und zivilgesellschaftlichem Widerstand gegen das Böse verschlissen werden, neue, konkrete und realistische Visionen eines künftigen Guten zu entwickeln. Fortschritt bleibt bestimmend, aber nur, wenn er auch moralischer ist, weil nur so positiver sozialer Wandel gelingt. Das setzt voraus, dass wir uns für die Möglichkeit einer Tiefeninnovation öffnen, deren Ziel nicht Revolution und damit Zerstörung des Bewahrenswerten, sondern teils radikale Reformen sind, die Akteurskonstellationen zugunsten einer besseren Zukunft verschieben.
Konkret bedeutet dies etwa, für den KI-Gebrauch und entsprechende ethische und juristische Reformen (die sich in Selbst- und Fremdregulierung niederschlagen) auf transkulturelle Forschung zu setzen.32 Jede vertretbare Ethik wird die regionalen, immer auch religiösen Wertkulturen und ihre Quellen integrieren müssen, um herauszufinden, was wir uns wirklich zu sagen haben. Toleranzgrenzen sind dabei durch moralisch offensichtliche Tatsachen gesetzt, zu denen gehört, dass man im Krieg (Verteidigung hin oder her) etwa keine zivile Infrastruktur, schon gar nicht an religiösen Feiertagen, angreifen soll. Die Liste solcher Tatsachen ließe sich beliebig erweitern, ohne dass damit die Ethik erschöpft wäre.
Ethischer Dissens findet somit stets vor einem massiven Hintergrund transkulturell geteilter Überzeugungen und Handlungsmuster statt, dank derer es eine geteilte moralische Wirklichkeit gibt. Dissens setzt ohnehin voraus, dass es etwas gibt, worüber Uneinigkeit besteht. Wenn es also ethischen Dissens gibt, dann folgt daraus, dass es eine moralische Wirklichkeit gibt, deren Existenz man jedenfalls nicht dadurch erfolgreich in Frage stellt, dass man auf kulturelle Differenzen als Quelle moralischer Diversität hinweist.
Es gibt keinen Grund, Verletzungen offensichtlicher moralischer Tatsachen gegenüber ‹tolerant› zu sein, ganz gleich, unter welchem Vorwand und Deckmantel sie uns aufgetischt werden. Es wäre heute schon moralischer Fortschritt, elementare moralische Tatsachen anzuerkennen, anstatt nationalstaatliche Interessen mit einer Identitätspolitik zu verschmelzen, die ‹befreundete› Staaten und ihre Regierungen von der notwendigen moralischen Verurteilung ausnimmt, wenn sie – aus welchem Grund auch immer – das Böse praktizieren.
Dieser Hinweis gilt für alle – ich habe bewusst kein Beispiel aus den tagesaktuellen Entwicklungen ausgewählt, um den Gedanken zu illustrieren. Es spielt keine Rolle, wer gerade ein Kinderkrankenhaus, eine Universität, eine Schule oder einen heiligen Ort bombardiert, wer sich für oder gegen wen gerade in die Luft sprengt, wer wem in wessen Namen ein Messer in den Hals sticht, wer welche Frau oder welches Kind für welchen Zweck auch immer misshandelt: Das Böse ist ebenso universal wie das Gute. Die Erste Allgemeine Verunsicherung macht ihrem Bandnamen mit ihrer Kultzeile von 1986: «Das Böse ist immer und überall» somit alle Ehre. Auch das Komische, nicht nur das Tragische ist ein Spiegel der sozialen Konflikte.
Ethik ist stets eine normative Beobachtung, eine Ausübung praktischer Erkenntnis. Daher wird im Folgenden auch Geschichte daraufhin lesbar gemacht, inwiefern sie einen Beitrag zum moralischen Fortschritt leistet. Die Theorie der Praxis ist die Ethik, der dies nur dadurch gelingt, dass sie bereits praktisch ist. Was die Ethik erkennt, das tut sie auch, und daran lässt sie sich bemessen. Daher ist der Wahlspruch der Neuen Aufklärung auch: agere aude! – habe Mut, Dich Deiner Verantwortlichkeit zu stellen, denn sie entspricht der Wirklichkeit, in der wir alle leben, weben und sind. Sie ist das universale Band einer Menschheit, dem wir uns nun zuwenden wollen.
I Moralische Tatsachen
Die Ontologie der moralischen Wirklichkeit
Viele sinnvoll gestellte Fragen lassen sich beantworten. Eine Frage ist dabei insbesondere dann sinnvoll gestellt, wenn wir sie durch Angabe von Tatsachen beantworten können. Wer auf eine entsprechende Tatsachenfrage richtig antwortet, kennt die Wahrheit. Denn die Wahrheit lautet dann, dass es sich soundso verhält, und dass es sich soundso verhält, ist der Inhalt einer Tatsache.
Unsere epistemologischen Begriffe – vor allem Wissen, Erkenntnis, Rechtfertigung und Glauben bzw. Fürwahrhalten – sind mit diesem elementaren Tatsachenbegriff verwoben. Er besagt lediglich, dass es (d.h. die Wirklichkeit) sich soundso verhält, soundso ist. Die klassische griechische Philosophie bringt dies seit Parmenides lakonisch auf den Punkt und spricht kurzerhand vom Seienden oder Sein (τὸ ἐόν), womit der Umstand bezeichnet ist, dass Sein und Wahrheit untrennbar verwoben sind.1 Das Seiende ist, wie es ist, d.h. soundso.
In diesem Zusammenhang ist die wirkmächtige Idee aufgekommen, die Wirklichkeit sei der Raum der Tatsachen, den Parmenides selbst sich wiederholt als Kugel ausmalt.2 Das hallt bis heute in der weitverbreiteten Vorstellung nach, die Wirklichkeit sei insgesamt mit dem Universum identisch, das die Physik auf verschiedenen Skalen (vom heute bekannten Kleinsten auf der Planck-Skala bis zum heute bekannten Größten, dem beobachtbaren Universum als Gegenstand der Kosmologie) vermisst. Demnach befinden wir uns immerhin epistemisch noch im Zentrum des Universums, dessen Ausdehnung von hier aus vermessen wird, sodass das Universum (Stand heute) unüberschreitbare «anthropische» Anteile aufweist (d.h. sich selbst im und durch den Menschen erkennen kann). Dass wir nichts erkennen können, was wir nicht erkennen können, ist jedenfalls keine Tautologie oder sonstige unerhebliche Trivialität – auch wenn wir nicht wissen, inwiefern dieser Umstand unsere Beobachtungen und damit auch das Universum selbst prägt.3
Welche Antworten die Naturwissenschaften, in diesem Fall paradigmatisch die Physik, auch immer auf die Beschaffenheit der Wirklichkeit gibt: Sie erschöpfen weder faktisch noch prinzipiell die Gesamtheit des Wirklichen. Faktisch ist unser physikalisches sowie im weiteren Sinne naturwissenschaftliches Wissen auf vielfältige Weise begrenzt. Insbesondere wissen wir auch nicht, wie begrenzt unser Wissen gerade ist, da dies einen unabhängigen Zugriff auf das physikalische Ganze des Universums voraussetzte, mit dem wir unseren Forschungsstand vergleichen könnten.
Für unsere Zwecke interessanter ist allerdings, dass es prinzipielle Grenzen des naturwissenschaftlichen Wissens gibt – eine Tatsache, die sich daraus ergibt, dass sich unzählige sinnvoll gestellte Fragen formulieren lassen, deren Antwort nicht sinnvoll naturwissenschaftlich gegeben werden kann. Das ist keine unzulässige Begrenzung naturwissenschaftlichen Wissens, sondern eine nur um den Preis des Unsinns zu verletzende Auflage, der die Naturwissenschaften ihre spezifische Objektivität verdanken. Weil es zumindest verschiedene Diskursbereiche gibt, denen verschiedene Methoden und damit Rechtfertigungsstandards angemessen sind, wäre es vollkommen vermessen, wollte man alles Wissen auf naturwissenschaftliches reduzieren. Ist aber nicht alles Wissen naturwissenschaftlich – was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber im Geiste des (logischen) Positivismus auch in der Philosophie allzu lange bestritten wurde –, stellt sich die Frage, welche Tatsachen es gibt, die nicht in den Untersuchungsbereich der Naturwissenschaften, das Universum, fallen.
Gegen den Ungeist des (logischen) Positivismus hat der späte Derek Parfit in seiner Verteidigung der Objektivität der praktischen Erkenntnis daran erinnert, was es alles so gibt. Er führt ohne Anspruch auf Vollständigkeit an:
Facts, meanings, laws of nature, the Equator, philosophical theories, nations, wars, famines, overdrafts, prizes, constellations, metaphors, symphonies, fictional characters, fashions, literary styles, problems, explanations, numbers, logical truths, duties, and reasons.4
Entsprechend gibt es neben den sinnvoll gestellten naturwissenschaftlichen Fragen solche, die danach fragen, welche mathematischen Sätze wahr sind, sowie – und darum geht es in diesem Buch –, was wir aus moralischen Handlungsgründen tun sollen. Der ontologische Pluralismus der Tatsachenarten unterstützt die Ethik dadurch, dass wir moralische Tatsachen und damit wahre Antworten auf sinnvolle ethische Fragen nicht auf Gedeih und Verderb ins Universum pressen oder an irgendeinem Naturbegriff ausrichten müssen, der ein metaphysisches Primat genießt.
Wer sich eine Frage mit moralischem Inhalt («Was soll ich bloß tun!?») stellt, erwartet eine Antwort, die ihn über seine Pflichten und Rechte in einer üblicherweise mit anderen Personen geteilten Situation aufklärt. In der technischen Sprache der Metaethik ausgedrückt, ist der ethische Diskurs – das Reden und Nachdanken darüber, was jemand aus moralischen Handlungsgründen tun bzw. unterlassen soll – kognitiv verfasst. Wir reden zumindest so, als ob es in ethischen Fragen darum ginge, herauszufinden, was wir tun sollen. Da wir uns darüber mit anderen beraten und durch Schlussfolgerungen und das Sammeln von Lebenserfahrung weiter kommen können als durch das jeweils spontane Handeln, ist dieses moralische Spiel des Gebens und Verlangens von Gründen etwas, das wir auch ernst nehmen sollten.
Die Ethik ernst zu nehmen, bedeutet, ihr zuzutrauen, alltägliche, spontane moralische Werturteile daraufhin zu prüfen, ob es denn auch so ist, wie jemand urteilt. Wer auf die Frage, «was soll ich hier und jetzt, in dieser vertrackten Situation, bloß tun!?», eine Antwort erhält, die er für wegweisend halten oder mit ihr ins Gericht gehen kann, steht damit vor den moralischen Tatsachen. Die moralischen Tatsachen geben an, was jemand in einer bestimmten Situation tun bzw. unterlassen soll. Das werde ich im Folgenden als «φ» symbolisieren, wobei man noch ein Ausrufezeichen («φ!») ergänzen kann, um den Aufforderungscharakter moralischer Tatsachen zu bezeichnen.5
Jemand fragt sich also, «φ?», und erhält darauf etwa die Antwort «φ!». Wer wissen will, was er bloß tun soll, und sich zu einer Antwort durchringt, weiß ipso facto, was zu tun ist. Dass dies und jenes zu tun ist, bedeutet dann ohne weiteren Aufwand, dass es wahr ist, dass dies und jenes zu tun ist, was äquivalent dazu ist, dass die Tatsache besteht, dieses und jenes sei zu tun.
Nun hat es sich freilich in der Moderne allmählich eingebürgert, die angestellte Überlegung für ontologisch verdächtig zu halten. Es scheint viel zu einfach zu sein, dem Diskurs ontologische Verpflichtungen abzulesen, was in unüberwindliche Probleme führt, da man das Sein (die Wirklichkeit) in der Tat rasch überbevölkert, wenn man die ontologischen Verpflichtungen jedes x-beliebigen Diskursbereichs ernst nimmt. Vor diesem Hintergrund erschien es lange Zeit sinnvoll, sinnvolle Aussagen auf das kognitive Mindestmaß der naturwissenschaftlichen Forschung zu reduzieren, was dazu führte, dass alle anderen Aussagen unter Verdacht gerieten, nur oberflächengrammatisch von Tatsachen zu handeln bzw., wie ich sagen werde, Tatsachen auszudrücken. Dieses Projekt erwies sich bereits im letzten Jahrhundert als undurchführbar, weil die dafür in Anspruch genommenen Sinnkriterien, die a priori über Sinn und Unsinn aller anscheinend tatsachenorientierten Aussagen richten sollten, selbst nicht sinnvoll angegeben werden konnten. Wittgenstein ahnte dies bereits im Tractatus, während Carnap noch händeringend an seinem Projekt eines Reime dich, oder ich fresse dich-Positivismus festhielt.6
Insbesondere generierte der Positivismus eine nachweislich inakzeptable Metaphysik: den Naturalismus bzw. Physikalismus, worunter hier eine Theoriefamilie verstanden sei, die Wirklichkeit mit demjenigen identifiziert, was sich naturwissenschaftlich (bzw. physikalisch) erkennen lässt. Der metaphysische Naturalismus ist ein Relikt der Vergangenheit. Er hat immer noch Anhänger, wurde aber aus guten Gründen schon lange nicht mehr ernsthaft verteidigt. Er leidet insbesondere darunter, dass die Naturwissenschaften konstitutiv empirisch und damit gar nicht zu einem Weltbild abschließbar sind, dem man entnehmen könnte, was es (wirklich) gibt und worüber Menschen nur irrtümlicherweise so reden, als ob es wirklich wäre. Wie avanciert die physikalische Forschung auch immer sein mag, sie wird uns keinen Aufschluss darüber geben, ob unsere ethischen Fragen beantwortbar sind oder nicht. Genauer gibt sie uns nur den wenig informativen Hinweis, dass sie jedenfalls nicht umstandslos naturwissenschaftlich beantwortbar sind, weil sich die moralischen Tatsachen nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden vermessen lassen. Ethik ist nicht Physik – das hätte man auch vorher wissen können.
Wenn Ethik nicht Physik ist, ist es a limine ein Irrtum, sie an den Methoden der Physik zu messen. Wenn «kognitiv» bedeutete, dass mathematische Modellierung und geschickte Experimente, die zusammen zu arbeitsteilig erwerbbarem, kumulativem Wissen führen, zum Einsatz kommen, um festzustellen, was der Fall ist, dann besitzt die Ethik keinen kognitiven Charakter. Doch das ist wenig spektakulär, bedeutet es doch allenfalls, dass es diesen oder jenen spezifischen Unterschied des ethischen und des physikalischen Wissens gibt.
Freilich wurden in der Moderne (und Antike) viele andere moralkritische Manöver ruchbar, die sich allesamt darum drehen, dem (moralischen) Sollen ein Sein prinzipiell abzusprechen. Gemeinsam ist diesen Manövern der Gedanke, dass normatives Denken praktisch ist und mithin gar nicht darauf aus sein kann, festzustellen, wie es (die Wirklichkeit) ist, sondern vielmehr darauf zielt, sie zu verändern. Die Wirklichkeit wäre für das Sollen nie genug, sodass Tatsachen und Werte (Vorstellungen davon, was getan werden soll, auch wenn es nicht getan wird) kategorial verschieden seien.
Wie besonders das moralische Sollen auch immer sein mag: In diesem Kapitel werde ich dafür argumentieren, dass es zu den Tatsachen gehört. Was wir tun sollen, ergibt sich aus einer Situation, sofern wir die Handlungsoptionen, die einem Akteur zur Verfügung stehen, berücksichtigen. Abstrahieren wir von der Anwesenheit der Handelnden in moralisch aufgeladenen Situationen, führt dies zu einem Beschreibungsfehler: Wir stellen uns die Wirklichkeit so vor, als ob sie von den moralischen Ansprüchen bereinigt werden könnte, vor die uns unser Gewissen stellt. Dann mag es so aussehen, als ob aus den Tatsachen doch nicht abgeleitet werden könne, was zu tun sei, weil ein «is» eben kein «ought» enthalte.7
Allerdings bedeutet dies in der Sache lediglich, dass die Form des Werturteils und damit auch die durch es ausgedrückte Tatsache einem anderen Bereich angehört als Tatsachenbehauptungen, deren Inhalt nicht-normativ ist. Dass dies und jenes zu tun sei (getan werden soll), gehört zum Inhalt der moralischen Tatsachen. Der Ausdruck der Wahrheit, dass φ wahr ist, man also soundso handeln soll, unterscheidet sich demnach von der üblichen Auffassung einer Tatsache, deren Gehalt mit der Formel «dass p» dargestellt wird. Betrachtet man diese Formel in Hinsicht auf moralische Tatsachen, dann wird «p» in der Regel so verstanden, dass dasjenige, was getan werden soll, allein dadurch, dass es noch zu tun ist, nicht zur Wirklichkeit gehört. Denn die ausgezeichnete Temporalität der Ethik ist die Zukunft: So, wie die Dinge liegen, sollen sie nicht sein, will sagen, dass sie in Zukunft anders sein können.
Längst wurden entsprechende temporale und deontische Logiken entwickelt, die dem Formunterschied des theoretischen und praktischen Denkens in gewissem Maß Rechnung tragen. Damit wurde deutlich, dass ein Kognitivismus in der Werttheorie nicht darauf verpflichtet ist, das moralische Denken der theoretischen Beobachtung zu assimilieren. Ethik ist, wenig überraschend, sui generis. Was mit dem Naturalismus gescheitert ist, sind alle Spielarten eines antirealistischen Reduktionismus, der moralische Aussagen kognitiv entleert und sie für Gefühlsausdrücke hält, die nichts darüber aussagen, wie es wirklich ist, sondern lediglich bekunden, wie jemand dasjenige, was ist und was geschieht, bewertet.
In der Gegenwartsphilosophie floriert der moralische Realismus, der grundlegend annimmt, dass es moralische Tatsachen gibt, die wir erkennen können. Über seine weiteren Festlegungen besteht Uneinigkeit, die Hauptvarianten können in ihren Konturen allerdings inzwischen als bekannt gelten.8
Im folgenden Kapitel stelle ich eine innovative Konzeption des moralischen Realismus vor. Diese dreht sich um die Idee, dass moralische Tatsachen konstitutiv auf Adressaten bezogen sind: Sie handeln von uns, wir sind Teil ihres Inhalts. Dass sie bestehen, ist aber nicht Ergebnis oder Produkt unserer Handlungen, wie kleinteilig oder großflächig wir uns diese auch ausschmücken mögen. Wir bringen das Gute und das Böse weder durch individuelle Werturteile noch durch soziale Praktiken irgendeiner Form hervor. Dass dieses oder jenes zu tun gut, böse oder moralisch neutral ist, ist ebenso unabhängig von unserer Willkür wie die Wahrheit der zum Ausdruck kommenden Propositionen φ (praktischen Inhalts) vom Fürwahrhalten unabhängig ist.
Die für den Realismusbegriff relevante Unabhängigkeit ist in diesem Fall nicht nach dem Modell des sogenannten ‹Platonismus› zu verstehen, der wohlgemerkt zu Unrecht Platon in die Schuhe geschoben wird, was aber auf einem anderen Blatt steht. Die Sorge, die Moralkritiker mit dem ‹Platonismus› verbinden, besteht darin, dass es mysteriös wirkt, wie moralische Tatsachen, die völlig ‹metaphysisch unabhängig› von uns bestehen, uns überhaupt angehen können. Nähert man die moralischen Tatsachen hingegen unserer Lebensform oder gar Personen an, die sich in konkreten Handlungssituationen vorfinden, scheint dies die Objektivität der Tatsachen zu mindern, indem sie nicht mehr so recht von uns unabhängig zu sein scheinen.
Doch über diese Alternative der metaphysisch von uns abhängigen und metaphysisch von uns unabhängigen Tatsachen ist der Neue Realismus, in den sich die vorliegende Ethik einfügt, längst hinaus.9 Der Realismus impliziert keine Festlegung darauf, dass dieses und jenes (und sei es die ganze Welt) von uns (unserem Denken, Handeln, Reden usw.) unabhängig ist, sodass alles, was von uns abhängig ist, einer antirealistischen Darstellung bedarf. Wenn der Realismus im landläufigen Sinne eine These der «mind-independence» enthielte, wäre er allzu beschränkt. Insbesondere ist unklar, wie genau seine Kontrastklasse zu verstehen ist, was also einen Antirealismus ausmacht, den man dann sicherlich in der Ethik zu vertreten hätte, wenn wirklich nur dasjenige ist, was nichts mit uns zu tun hat. Doch ein solches Wirklichkeitskriterium wirkt abenteuerlich willkürlich und lässt sich jedenfalls durch keine von ihm unabhängige Beobachtung begründen. Ontologisch hat es eigentlich immer schon, d.h. seit die Frage nach dem (Sinn von) Sein überhaupt gestellt wurde, ausgedient. In der jüngeren Philosophie wurde es erfolgreich von Quine in die Schranken gewiesen, der völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass «Existenz» (und verwandte Ausdrücke) nicht die Funktion hat, dem von uns Unabhängigen einen Sonderstatus einzuräumen.10
Lassen wir dieses Gespenst des vermeintlichen ‹Platonismus› sowie seines Gegenspielers, des Antirealismus, hinter uns, dann stellt sich die Aufgabe neu, wie genau wir moralische Tatsachen auffassen. Insbesondere steht uns die Option zur Verfügung, ihren Aufforderungscharakter (das moralische Sollen) als irreduzibel wirklich zu betrachten, ohne das theoretische Sein von «p» mit dem praktischen Sollen von «φ» zu vermengen. Dies impliziert nicht, dass wir uns letztendlich doch wieder auf die Sein-Sollen-Dichotomie festlegen. Denn das theoretische Sein wirft ein Licht auf das praktische Sollen und dieses wiederum verändert im Endeffekt diejenigen Teile der nicht-moralischen Wirklichkeit, die mit unseren Handlungen verwoben sind. Denn man kann eben auch tun, was man soll. In diesem Fall des guten Handelns ist die Erklärung dafür, dass etwas soundso ist (p), unvollständig, wenn man φ nicht berücksichtigt. Das Universum ist aus praktischer Sicht somit keineswegs kausal geschlossen, wie man sagt, wobei die Annahme der kausalen Geschlossenheit – in jüngster Zeit wissenschaftstheoretisch und durch die Quantenmechanik längst auch wissenschaftlich – fragwürdig geworden ist.11 Doch selbst wenn das Universum kausal, epistemisch oder ontologisch geschlossen wäre, wirft dies noch lange kein schlechtes Licht auf die moralischen Tatsachen, da diese in den Bereich der Handlungen und nicht in denjenigen der Beobachtungen fallen.
In diesem Kapitel wird zunächst (§ 1) ein Begriff der Tatsache eingeführt, der erlaubt, Tatsachen als wahre Antworten auf sinnvoll gestellte Fragen zu verstehen und dabei die Wahrheit an den Ausdruck bindet. Wenn wir von Wahrheit sprechen und damit auf eine diskursive Norm Bezug nehmen (die wir erfolgreich erfüllen oder verfehlen können), darf man dies nicht als eine Repräsentationsbeziehung zwischen satzförmigen Entitäten und einer Wirklichkeit verstehen, die nicht satzförmig ist. Dies lässt sich verallgemeinern, sodass es sich bei Wahrheit prinzipiell nicht um ein Repräsentationssystem handelt, das eine ‹unabhängige› Tatsachen- und eine ‹abhängige› Geistseite aufweist, wobei die Geistseite von allerlei eingenommen werden kann (mentalen Zuständen, neuronalen Zuständen, Symbolen, Bildern, Sätzen, Propositionen, Gedanken usw.).12
Nachdem auf diese Weise das Gespenst des Naturalismus einmal vertrieben worden sein sollte (was leider nicht ausschließt, dass es die Philosophie einst wieder heimsuchen wird, da es im Zeitgeist fröhlich weiterspukt), widmen wir uns den moralischen Tatsachen als Zielsystem der Ethik (§ 2). Insbesondere werde ich dafür plädieren, moralische Tatsachen als solche zu verstehen, die davon handeln, was Menschen in Situationen tun sollen, in denen auch andere stecken könnten. Moralische Tatsachen beinhalten in dieser Optik Menschenpflichten und Menschenrechte, die wohlgemerkt nicht mit ihrer politischen Implementierung unter nationalstaatlichen Bedingungen identifiziert werden dürfen.13
Sodann wenden wir uns dem Begründungsproblem der Ethik zu (§ 3), das darin gesehen wird, dass die Ethik als Diskurs einer irgendwie gearteten zusätzlichen Absicherung bedarf. Insbesondere wird diese Zusatzversicherung regelmäßig entweder darin gesehen, dass sie (i.) Verdikte des Göttlichen (Gebote) kodifiziert; dass sie (ii.) den Richterspruch der (reinen praktischen) Vernunft oder irgendeiner anderen diskursiven Rationalität darstellt; oder dass sie (iii.) in der evolutionären Vorgeschichte von Homo sapiens gründet. Jede solche Zusatzbegründung teilt mit der Moralkritik von Nietzsche, Marx und Freud bis Foucault und darüber hinaus die Auffassung, dass das moralische Sollen, an seinen eigenen unbedingten Ansprüchen gemessen, ohnmächtig ist. Deswegen wird ihm eine anerkannte Macht beigesellt, die gleichsam die polizeilichen Aufgaben übernimmt, mit dem Schwert der Sanktionen in der Hand darüber zu wachen, ob denn auch wirklich getan wird, was getan werden soll. In blumigeren Versionen werden die Seligen und Heiligen belohnt (und sei es mit Seligkeit und Heiligkeit), während die Bösen verdammt und mit ewiger Pein bestraft werden. Gibt es hingegen moralische Tatsachen im hier entwickelten Sinn, erübrigt sich die Suche nach einer Zusatznormativität oder Autorität ebenso wie in anderen Sachlagen, in denen Tatsachen bestehen. Das Begründungsproblem lässt sich deswegen durch einen geeigneten Realismus auflösen, der danach zu beurteilen ist, wo genau er die Reißlinie der Begründungsbedürftigkeit zieht.
Der Hinweis, etwas sei sui generis, reicht allein nicht aus, um die Moral vor reduktionistischen Überfällen zu retten. Insbesondere stützt sich die Moralkritik gerne darauf, dass moralische Tatsachen spätestens an der Klippe moralischer Dilemmata zerschellen, die die Widersprüchlichkeit moralischer Werturteile und damit die rationale Hinfälligkeit der Ethik als rigoroser Wissenschaft offenzulegen scheinen. Dagegen hält § 4 an der Konsistenz der Ethik (als Wissenschaft) fest. Diese ist eine Ausübung der praktischen Vernunft, was nicht bedeutet, dass die moralischen Werturteile, die in den Gegenstandsbereich der Ethik fallen, automatisch widerspruchsfrei wären. Die moralische Urteilspraxis wird an Konsistenzkriterien bemessen, was natürlich bedeutet, dass sie in ihrer bunten Vielfalt längst nicht konsistent, ja nicht einmal kohärent ist. Dennoch gilt für die Ethik, dass sie dasjenige Urteil, das sie auf seinen wissenschaftlichen Begriff zu bringen sucht, d.h. das moralische Werturteil, niemals vollständig überschreiben darf. Die mores gehören zum Phänomenbestand der Ethik und die Gesellschaft (in ihrer gesamten synchronen und diachronen Bandbreite) ist ihre unüberwindliche Quelle – weswegen die Ethik auch nicht a priori ist, ohne deswegen gleich ‹empirisch› zu werden. Solche Unterscheidungen (wie diejenige zwischen informativen synthetischen und bloß formalen analytischen Urteilen) sind obsolet bzw. genauer: Sie stellen keine alternativlose und vollständige Disjunktion von Theorieoptionen dar, zwischen denen man zu wählen hat. Es geht hier wie sonst eben auch anders, als die Hauptströmung des Wiener Kreises sich dies in ihrem logisch-semantischen und erkenntnistheoretisch engstirnigen Horizont vorstellen mochte.
Dies leitet zu einer weiteren Modifikation des Prämissenrahmens des moralischen Realismus über, die ich als ethischen Situationismus (§ 5) bezeichne. Dieser führt zunächst den Begriff einer Situation ein. Unter einer Situation werde ich ein Sinnfeld verstehen, in dem sich Personen befinden, an die normative Erwartungen adressiert werden. In Situationen ist einiges erkennbar geboten, anderes ebenso erkennbar verboten. Situationen sind in der Regel und jedenfalls paradigmatisch sozial dadurch, dass die Normierung unseres Handelns und Denkens stets dadurch zustande kommt, dass andere unsere Abläufe korrigieren. Jemand tut und handelt geradeaus, eine andere weist eine Alternative auf, die sich als besser herausstellt. Situationen sind dadurch geprägt, dass Andere anwesend sind, die insofern anders sind, als sie andere Wege beschreiten. Wir können nun einmal nicht in jeder Hinsicht buchstäblich auf demselben Standpunkt stehen, weshalb Situationen entstehen, die Handlungskonflikte dadurch lösen, dass wir einander aus dem Weg gehen können. Was für soziale Situationen ziemlich offensichtlich ist, gilt im Moralischen auch, ohne dass dieses auf soziale Normen reduzierbar wäre. Die Situationen enthalten spezifische Anforderungsprofile, wobei die moralischen Tatsachen Aussichten darauf eröffnen, situationsübergreifend (universal) urteilen zu können. Doch ist dieser Aufstieg vom moralisch Einzelnen zu etwas, was über die Situation hinaus auch für alle anderen vergleichbaren Personen gilt, nur aus den konkreten Situationen heraus zu bewältigen. Er besteht nicht darin, dass wir – etwa dank eines kategorischen Imperativs, der uns gleichsam in einer noumenalen Strafkolonie vorgeburtlich in die Seele tätowiert wurde (wie man Kant mit Kafka kreuzend vermuten könnte) – über alle Situationen immer schon hinausragen und aus der noumenalen Außenperspektive in die Situation zurückkehren. Was wir tun sollen, ergibt sich aus der Situation; es kann ihr nicht von außen aufgepfropft werden.
Nachdem die Beispielpalette sich bewusst an offensichtlichen moralischen Tatsachen, die oftmals an Plattitüden grenzen (was sie nicht falsch macht), orientiert hat, leitet § 6 mit dem Begriff komplexer moralischer Tatsachen in die Epistemologie über. Während das Begründungsproblem der Ethik unter Rekurs auf die Ontologie der moralischen Wirklichkeit prinzipiell überwunden ist, muss man dennoch anerkennen, dass das moralische Werturteil nicht nur in abstracto fallibel ist (weil eine Negation von «φ» auch dann denkbar ist, wenn jemand φ zu Recht für wahr hält), sondern vor dem prinzipiellen Problem steht, dass unsere Handlungssituationen entlang verschiedener Dimensionen komplex sind.
Damit eröffnet sich die folgende Theoriealternative. Einerseits könnte man die Komplexität der Situation für einen Störfaktor halten, der die Sicht auf die an sich und damit insgesamt offensichtlichen moralischen Tatsachen trübt. Andererseits könnte man die moralischen Tatsachen selbst um die Dimension komplexer moralischer Tatsachen erweitern, was die moralische Irrtumsanfälligkeit genuin moralisch machte. Es reicht mithin nicht einmal prinzipiell hin, alle nicht-moralischen Tatsachen einer Situation zu kennen, um auf diese Weise freie Sicht auf die moralischen zu erhalten. Die moralischen Tatsachen sind vielmehr von sich her herausfordernd, sie sprechen in vielen Fällen in Rätselworten, weswegen das Gewissen in schwierigen Situationen keine eindeutigen Verdikte verkündet, sondern uns in unserer Freiheit adressiert.
Ich ergreife die zweite Option, die der Phänomenologie der gelebten moralischen Erfahrung näherkommt. Letztere scheut sich deswegen vor der Anerkennung offensichtlicher moralischer Tatsachen, weil wir insbesondere dann nach ethischer Aufklärung unserer Urteilspraxis verlangen, wenn wir nicht klarsehen. Entsprechend sind die komplexen moralischen Tatsachen der Anlass dafür, dass die Ontologie der moralischen Wirklichkeit auf eine besondere Weise nach einer Epistemologie verlangt. Es kann den moralischen Tatsachen nicht gleichgültig sein, ob und wie sie Personen erfassen. Denn ob und wie Personen sie erfassen, bestimmt darüber, wie eine Situation und damit auch das Handeln einer Person moralisch zu bewerten ist.
§ 1. Über den Begriff der Tatsache
Wir verdanken dem ersten Aufschlag der später so genannten analytischen Philosophie – vor allem Gottlob Frege, Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein – die Einsicht, dass die Existenz von Tatsachen nicht sinnvoll bestreitbar ist. Dieser Gedanke ergab sich zunächst aus der Erkenntnis, dass unsere Denkvorgänge die Wirklichkeit, wenn überhaupt, nur unwesentlich modifizieren. Damit wendete man sich bekanntlich gegen den Psychologismus im Sinne einer Familie von Auffassungen, die glauben, etwas sei deswegen wahr, weil wir es durch Denkvorgänge hervorbringen und durch diese Akte wahr machen.14 Unsere internen Denkvorgänge, so die Erkenntnis, tragen allenfalls unwesentlich zur Wirklichkeit bei, namentlich in dem Maße, in dem sie selbst etwas Wirkliches sind, das sich als Teil der Wirklichkeit erfassen lässt. Sie konstituieren die Wirklichkeit aber nicht in irgendeinem anspruchsvollen transzendental-psychologischen Sinn. Die Wirklichkeit ist vielmehr, was sie ist, auch unabhängig davon, dass sie uns als soundso erscheint, solange es unsereiner gibt – «das ist ihre Definition», wie Jocelyn Benoist in seinen Beiträgen zum Neuen Realismus eingeschärft hat.15