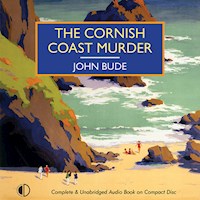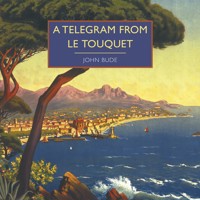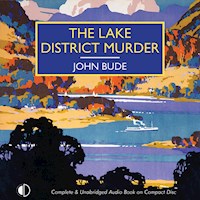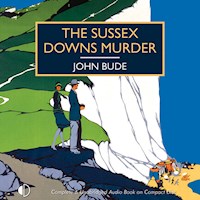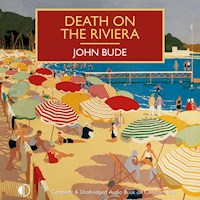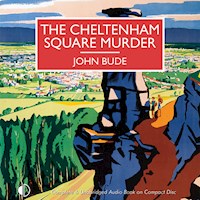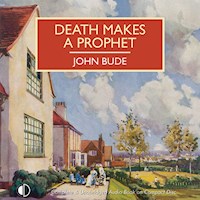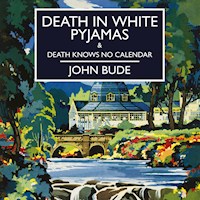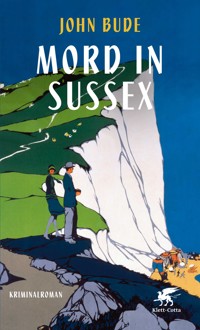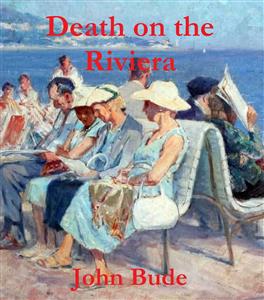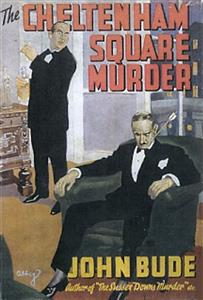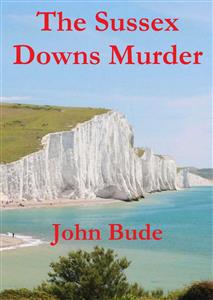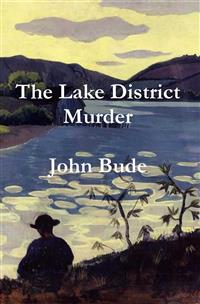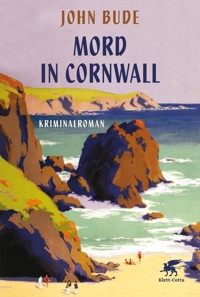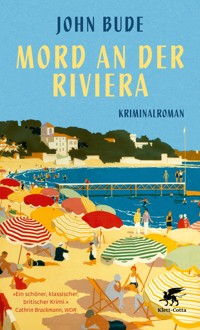
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Krimi
- Serie: British Library Crime Classics
- Sprache: Deutsch
Der legendäre britische Inspector Meredith tauscht das neblige London gegen die strahlend blaue Côte d'Azur. Denn dort treibt ein berüchtigter Geldfälscher sein Unwesen, den er vor Jahren schon einmal hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Doch nicht nur das: Auch ein Mord unter Palmen will aufgeklärt werden – ausgerechnet in der mysteriösen Villa Paloma, die einer steinreichen britischen Witwe gehört ... Für Inspector Meredith geht es in diesem Kriminalfall aus dem Londoner Nebel an die glitzernde Côte d'Azur. Denn seit Kurzem wird die französische Küste mit gefälschten Tausend-Franc-Noten überschwemmt und die lokale Polizei vermutet einen englischen Drahtzieher als Kopf der Falschgeldtruppe. Und tatsächlich: Offenbar stammen die Banknoten von Chalky Cobbett, einem englischen Fälscher von berüchtigtem Talent. Doch nicht nur das Falschgeld bereitet Meredith Sorgen, auch eine reiche englische Witwe, die in ihrer Villa im malerischen Menton eine ganze Reihe an mysteriösen Hausgästen beherbergt, weckt sein Interesse. Nicht ganz unbegründet, wie sich herausstellt, denn kurz nach dem Eintreffen eines weiteren Gastes aus dem britischen Königreich geschieht ein Mord ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
John Bude
Mord an der Riviera
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Mit einem Nachwort von Martin Edwards
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die englische Originalausgabe erschien 1952 unter dem Titel
»Death on the Riviera« bei Macdonald & Co., London.
2016 wurde der Roman von der British Library,
London, wiederveröffentlicht.
© 2016 by Estate of John Bude
Nachwort © 2016 by Martin Edwards
Für die deutsche Ausgabe
© 2022, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Science Museum Group
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98765-2
E-Book ISBN 978-3-608-11837-7
Inhalt
Kapitel 1
Mission im Midi
I
II
III
Kapitel 2
Die Villa Paloma
I
II
Kapitel 3
Das Mädchen in der Galerie
I
II
III
Kapitel 4
Zweite Begegnung
I
II
III
IV
V
Kapitel 5
Ominöses Treffen
I
II
III
IV
V
Kapitel 6
Meredith in Monte Carlo
I
II
III
IV
Kapitel 7
Karten auf den Tisch
I
II
III
Kapitel 8
Colonel Malloy
I
II
III
IV
Kapitel 9
Das Maison Turini
I
II
III
Kapitel 10
Bilderrätsel
I
II
III
Kapitel 11
Beweis in der Mansarde
I
II
III
Kapitel 12
L
’
Hirondelle
I
II
III
IV
Kapitel 13
Indiz am Cap Martin
I
II
III
IV
Kapitel 14
Blüten im Umlauf
I
II
Kapitel 15
Der schlurfende Cockney
I
II
III
Kapitel 16
Der vermisste Playboy
I
II
III
Kapitel 17
Tödlicher Sturz
I
II
III
Kapitel 18
Die abgestellte Vedette
I
II
Kapitel 19
Wessen Leiche?
I
II
Kapitel 20
Die Bar St. Raphael
I
II
Kapitel 21
Das Rätsel des Rucksacks
I
II
III
IV
Kapitel 22
Mordmotiv
I
II
III
Kapitel 23
Fall abgeschlossen
I
II
Kapitel 24
Au revoir
I
Martin Edwards
Nachwort
Kapitel 1
Mission im Midi
I
Bill Dillon schlug den Kragen seines Tweedmantels hoch und schob die Hände tiefer in die Taschen. Fünf Uhr an einem frostigen Februarmorgen, dachte er, war eine elende Zeit, um von einem Schiff auf einen derart zugigen Kai gekippt zu werden. Auf dem Zollhof wartete eine Schlange von ungefähr einem Dutzend Autos auf die Aufmerksamkeit der Beamten, die unter einer nackten Glühbirne die Papiere kontrollierten. Die Nachtfähre, aus deren Maul der Zug Richtung Paris bereits ausgestoßen worden war, ragte sanft schwojend vor dem sternbesäten Himmel auf. Einige Straßenlampen und ein paar erhellte Fenster, mehr war nicht zu sehen von der zerschossenen, gemarterten Stadt jenseits des ölschwarzen Hafenwassers.
Bill zündete sich eine Zigarette an und begann, mit hallenden Schritten auf dem pavé hin und her zu tigern. Auch seine Gedanken schweiften, er dachte wieder an jene Nacht vor beinahe zehn Jahren, als er Dünkirchen zuletzt gesehen hatte; so viele zersplitterte Eindrücke, die in seiner Erinnerung wie Geschützblitze herausstachen. Das rote, brüllende Inferno, das die Stadt damals gewesen war, das glitzernde Netz der Leuchtspurgeschosse über Meer und Stränden, das orangefarbene Aufblühen der Bomben, der Lärm, die Hitze, die Missachtung der Gefahr aus einer Erschöpfung heraus, die die Angst nahezu betäubt hatte. Im Strudel der Niederlage war er kein Individuum mehr gewesen, nur noch ein abgenutztes, gehorsames Rädchen in einer gnadenlosen Maschinerie – Lance-Corporal Dillon von den 6th Southshires –, eines jener Staubkörnchen, die zusammen das Wunder von Dünkirchen bewirkt hatten.
Schritte näherten sich, gefolgt von einem diskreten Hüsteln.
»Etwas zu verzollen, M’sieur?«
Bill schreckte aus seinen Träumereien.
»Nein – nichts.«
Der verschlafene Beamte steckte den Kopf ins Wageninnere und leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein. Dann öffnete er die hintere Tür der Limousine, ließ die Schlösser von Bills Koffer aufschnappen und tastete mit geübten Händen darin herum, bevor er ums Auto ging und am Griff des Kofferraums zerrte.
»Bitte, M’sieur.«
Bill zog einen Schlüsselbund hervor und schloss auf. Der Kofferraum enthielt den üblichen Kram – ein Paar Schuhe, die nicht mehr in den Koffer gepasst hatten, einen Rucksack, ein altes Gas-Cape vom Militär, einen Zwei-Liter-Kanister Öl, Staubtücher, Putzlappen und eine Luftpumpe. Der douanier beäugte die Sammlung, nickte und schloss sorgfältig den Deckel. Alles ging sehr höflich und routiniert vonstatten.
»Merci, M’sieur.«
»O. k.?«, fragte Bill.
Der Franzose strahlte.
»Oui, oui, M’sieur. O. k.! O. k.!« Er zeigte in Richtung des unsichtbaren französischen Hinterlands. »En avant, M’sieur! Et bon voyage.«
»Danke«, sagte Bill.
Innerlich seufzte er erleichtert auf. Nicht, dass er etwas zu verzollen gehabt hätte, aber ein Gegenstand war im Wagen, der vielleicht zu Bemerkungen Anlass gegeben hätte. Und wäre das Interesse erst einmal geweckt worden, konnte eventuell auch eine Erklärung verlangt werden. Und um diese unchristliche Zeit war Bill nicht geneigt, mit einem Mann, dessen Englischkenntnisse offensichtlich begrenzt waren und der die näheren Einzelheiten seiner Erläuterung wohl kaum verstanden hätte, Detailfragen zu erörtern.
II
Gleich hinter dem Kai merkte Bill, dass die frühen Morgenstunden eines bitterkalten Februartags nicht die ideale Zeit waren, um sich aus Dünkirchen hinauszuschlängeln. Die Straßen, die es hier zweifelsohne einmal gegeben haben musste, hatten vor der Feuersbrunst sicherlich auch irgendwohin geführt. Jetzt aber war da nichts als ein Labyrinth tückischer Pfade voller Schlaglöcher, die ziellos zwischen einem Netz aus Gleisen und zerbombten Gebäuden mäanderten.
Schon bald hatte Bill vollkommen die Orientierung verloren, also hielt er an und befragte seine Landkarte. Die erste größere Ortschaft auf der Strecke war Cassel. Aber wie zum Teufel sollte er die richtige Straße finden? Bislang hatte er keinen einzigen Wegweiser gesehen. Die Straße selbst hatte er noch gut in Erinnerung. Diese lange höllische Pflasterpiste, auf der das aufgelöste, aber unverdrossene Britische Expeditionskorps sich zur Rettung durchgeschlagen hatte. Und wie er so in seinem Stanmobile Ten saß, einem Vorkriegsmodell, das aber immer noch seinen Dienst tat, kehrte etwas von der verzweifelten Hoffnungslosigkeit jenes Albtraums zurück. Die Narben der Erinnerung verheilten doch nie ganz, dachte er.
Bremsen kreischten, und ein kleiner schwarzer Sportwagen kam quietschend neben ihm zum Stehen. Darin ein Kopf, der sich zu ihm herneigte.
»Pardon, M’sieur … à Cassel?«
Bill, obwohl kein Linguist, erkannte sogleich einen Mitleidenden. Er kicherte:
»Fragen Sie mich nicht! Dort will ich ja selbst hin. Nirgends ein verdammtes Straßenschild.«
»Engländer, wie? Haben Sie eine Karte?«
»Klar«, sagte Bill.
»Ich auch. Werfen wir doch mal zusammen einen Blick drauf.«
Bill betrachtete den Mann, der sich da zu ihm gesellt hatte – hochgewachsen, sportlich, Adlerzüge, etwas Entschiedenes in der Sprache wie in den Bewegungen, das ihn als Mann der Tat auswies. Ein Bursche, auf den Verlass war, wenn man in der Klemme steckte, dachte er. Sein Begleiter, ohne Hut, in einem Regenmantel mit Gürtel, um den Hals einen Schal, war weit jünger, wenngleich ebenso gut gebaut. Er schien dem Älteren den Respekt entgegenzubringen, den der Untergebene dem Vorgesetzten schuldet.
Kaum hatten sie sich über die Karte gebeugt, als ein früher Arbeiter in einem abgewetzten Mantel und mit dem allgegenwärtigen blauen Barett von seinem Fahrrad sprang und zu ihnen trat.
»Est-ce que je vous aide, Messieurs?«
Bill erklärte in stockendem Französisch, dass sie die Straße nach Cassel suchten.
»Ah, das ist einfach, M’sieur. Folgen Sie mir, ich fahre voraus.«
Zehn Minuten später wurde der gutmütige Bursche, nachdem er wie ein Wilder in die Pedale getreten hatte, langsamer und zeigte mit einem heftigen Schwung des Arms in die Richtung, die sie einschlagen sollten. Bill lehnte sich aus dem Fenster, brüllte Dankesworte und schaute sogleich nach hinten, ob der andere ihm noch folgte. Ein paar hundert Meter weiter schloss dieser auf, und für kurze Zeit fuhren die beiden Wagen nebeneinander her.
»Alles o. k?«, schrie Bill.
»Ja, danke.«
»Wohin geht’s denn?«
»Paris!«, kam die gebrüllte Antwort. »Und Sie?«
»Erst mal nach Reims. Dann weiter durchs Rhonetal an die Riviera.«
»Na, dann hoffe ich, es läuft weiterhin gut für Sie. Weidmannsheil!«
»Danke. Ihnen auch.«
Mit einem anschwellenden Dröhnen setzte sich der kleine schwarze Sportwagen ab und verschwand wenige Sekunden später hinter einem riesigen camion, der mit aufreizender Behäbigkeit mitten auf der Landstraße dahinrumpelte.
III
Detective-Inspector Meredith vom CID wandte sich an seinen Beifahrer und bemerkte sarkastisch:
»Um Himmels willen, Junge, entspannen Sie sich mal. Ich bau schon keinen Unfall.«
»Das ist diese verdammte Rechtsfahrerei, Sir. Kann mich einfach nicht dran gewöhnen.«
»Das wird schon … dauert nur noch achthundert Meilen.«
»Übrigens, Sir – was hatte das zu bedeuten, dass Sie dem Kerl sagten, wir wollten nach Paris?«
»Diskretion, Strang. Wir sind zum Arbeiten hier, falls Sie sich erinnern. Da ist es nicht klug, unser Ziel auszuplaudern.«
»Aber Sir, der fährt doch auch an die Riviera. Wenn wir ihm dort nun über den Weg laufen, das würde doch ein bisschen verdächtig wirken, meinen Sie nicht?«
Meredith lachte.
»Diese goldene Küste ist knapp fünfzig Meilen lang, Strang. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir dem noch mal begegnen. Wahrscheinlich würde er uns sowieso nicht wiedererkennen.«
»Anständiger Bursche, Sir. Nützlich in einem Rugby-Gedränge. Ich wette, den würde ich sogar in der Menschenmenge beim Epsom Derby erkennen.«
»Sie würden achtkantig rausfliegen, wenn Sie das nicht könnten«, versetzte Meredith trocken. »Vergessen Sie nicht, man hat Ihnen das Beobachten beigebracht. Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich habe so eine Ahnung, dass Sie ein überdurchschnittliches Auge für Gesichter haben. Deshalb hat der AC Sie ja auch von der Leine gelassen.«
»Danke, Sir. Aber mir wäre verdammt wohler, wenn …«
Meredith unterbrach ihn:
»Sie fragen sich, was das alles soll, stimmt’s? O. k., Sergeant, wird wohl wirklich allmählich Zeit, dass ich Sie ins Bild setze.« Meredith nahm eine Hand vom Steuer, zog aus der Innentasche seines Sportsakkos eine Brieftasche und klatschte sie Strang auf die Knie. »In der ersten Lasche ist ein Foto. Nehmen Sie’s raus und schauen Sie’s sich gut an.« Strangs Neugier war geweckt, er tat, wie ihm geheißen, und betrachtete den Abzug genau. Er erkannte ihn sogleich als offizielles Bild aus dem Verbrecheralbum des Yard – die üblichen zwei Profile und die Frontalaufnahme. »Kennen Sie den?«
»Nein, Sir.«
»Tja, diese wenig anregende Visage gehört einem Knirps namens Tommy Cobbett – Chalky für seine Freunde, wegen seines leichenblassen Teints. Einer der größten Künstler der Welt, Strang.«
»Ein Maler, Sir?«
»Nicht ganz. Er ist Graveur, Junge – er sticht Scheine.«
»Sie meinen, er ist ein Geldfälscher?«
»Allerdings. Und einer der Besten, mit denen wir’s je zu tun hatten. Kurz vor dem Krieg haben sie ihn eingebuchtet, nachdem er das West End mit falschen Fünfern überschwemmt hatte. Er hat sechs Jahre gekriegt und ist vor rund vier rausgekommen. Eine Zeit lang hat er sich in seinem alten Kiez im East End rumgetrieben, und optimistisch wie wir sind, dachten wir schon, er sei solide geworden. Doch dann hat er sich vor anderthalb Jahren plötzlich in Luft aufgelöst.« Meredith schnippte mit den Fingern. »Wusch! Einfach so. Uns war sofort klar, dass Chalky nicht einfach so untergetaucht ist. Wir waren uns absolut sicher, dass er wieder ›arbeitete‹. Die Frage war nur, wo und für wen.«
»Und jetzt haben Sie die Antwort, Sir?«
»Vor sechs Wochen bekamen wir von der Polizei in Nizza die Nachricht, dass eine erstklassige Fälscherbande in den Städten der Côte d’Azur ihr Unwesen treibt. Sie wissen, wie das läuft: englische Urlauber, die ihre erlaubten hundert Pfund Reisegeld erweitern wollen, und Gauner, die ihnen nur zu gern aushelfen. Der normale Umtauschkurs liegt bei rund neunhundertachtzig Franc fürs Pfund. Der Schwarzmarktkurs bei siebenhundertachtzig. Der Profit der Gauner beträgt also knapp zweihundert Franc pro umgetauschtes Pfund. Leicht verdientes Geld, Strang, auch wenn die Marge nicht gerade spektakulär ist.«
»Und Chalky Cobbett?«, fragte Strang, noch immer im Dunkeln tappend. »Wo kommt der ins Spiel? Das kapier ich nicht.«
Meredith kicherte.
»Zu dem komme ich noch. Erst muss ich Ihnen noch ein paar andere Details erklären. Diese Währungskerle nehmen Schecks von Londoner Banken an. Das müssen sie, weil man nur fünf Pfund in Scheinen außer Landes bringen darf. Daher haben die Gauner eine ausgefeilte Methode entwickelt, mit der sie die Schecks so schnell wie möglich nach London schmuggeln und einlösen. So viel dazu. Aber die französische Polizei ist unlängst auf einen neuen Kniff gestoßen. Die gesamte Côte d’Azur wurde von einer Flut gefälschter Tausend-Franc-Scheine überschwemmt, und schon bald konnten sie einige dieser Scheine zu unseren ahnungslosen Landsleuten zurückverfolgen, die den Fiskus mit dem Kauf von Schwarzmarkt-Francs behumpsten. Kurz, die Währungsgauner hatten die siebenhundertachtzig Franc pro Pfund in Blüten ausgezahlt. Ergebnis: neunhundertachtzig Franc pro Pfund Profit, abzüglich der allgemeinen Unkosten sowie vermutlich des Anteils von Chalky Cobbett.«
»Aber wie zum Teufel wussten die Franzosen, dass Chalky für die falschen Scheine verantwortlich war, Sir?«
»Das wussten sie gar nicht. Und auch wir zunächst nicht. Aber unsere Falschgeldexperten haben Chalkys Stil sofort erkannt – an mikroskopisch kleinen Details seiner Handwerkskunst. Und deswegen düsen wir gerade an diesem bitterkalten Morgen gen Süden, mein Junge. Auf Bitten der französischen Polizei. Wir werden herumschnüffeln und Augen und Ohren weit offen halten, bis wir auf eine Spur von Chalkys Unterschlupf stoßen. Also schauen Sie sich das Foto gut an, Sie müssen sich Chalkys Fresse fest in Ihr Hirn einprägen, Strang. Für mich ist es einfacher. Ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Tatsächlich war ich sogar derjenige, der ihn ’39 eingebuchtet hat.«
Acting-Sergeant Freddy Strang steckte das Foto sorgsam in die Brieftasche seines Vorgesetzten zurück. Das also war der rätselhafte Auftrag, der ihn so wundersamerweise aus der Londoner Düsternis herausgezogen hatte und in die flimmernde Wärme der Mittelmeerküste befördern sollte. Verdammt anständig vom Inspector, ihn als seinen Assistenten auszuwählen. Im CID gab es keinen, mit dem er lieber zusammenarbeitete. Er sagte feierlich:
»Ich tue mein Bestes, um Sie nicht zu enttäuschen, Sir.«
»Da bin ich mir sicher, Sergeant. Aber ich habe Ihnen noch nicht alles erzählt. Chalky ist nicht unser einziges Anliegen. Die Franzosen haben nämlich den sehr schlauen Verdacht, dass das Blütengeschäft von einer englischen Gang oder jedenfalls unter englischer Leitung betrieben wird. Sprich, sie könnten uns bereits bekannt sein. Das ist der zweite Grund, warum sie unsere Unterstützung brauchen.«
Freddy pfiff.
»Da haben wir ja ganz schön was vor der Brust, wie, Sir?«
Meredith nickte.
»Jedenfalls genug, damit Sie gar nicht erst auf die Idee kommen, Unfug zu treiben, junger Mann. Was genau ist denn Ihre Schwäche – Wein, Weib oder Gesang?«
»Gesang, Sir. Das ist das einzige Laster, das ich mir bei meinem jetzigen Gehalt leisten kann. Möchten Sie mal meine Version von Night and Day hören, Sir? Beim letzten Polizeikonzert hat das eingeschlagen wie eine Bombe.«
»Gott bewahre!«, hauchte Meredith inbrünstig.
Kapitel 2
Die Villa Paloma
I
Nesta Hedderwick lag in einem verschossenen rosa Kimono auf einer Korb-Chaiselongue auf der Terrasse der Villa Paloma und schlürfte Tomatensaft. Die Wände hinter ihr, ebenfalls in einem verschossenen Rosa, waren mit den Schatten der Wedel dreier mächtiger Palmen gemustert, die aus der üppigen Vegetation des steil abfallenden Gartens aufragten. Die funkelnde Luft war angereichert vom Parfüm der Sonnenwenden und Mimosen, der Himmel wolkenlos, das Meer, das sich jenseits der Dächer der darunterliegenden Stadt erstreckte, ein unfassbar blaues Tuch.
Doch diese verschwenderische Schönheit ließ Nesta unbeeindruckt. Sie war zu vertraut, zu konstant. Ihre leicht vorstehenden Augen waren mit tiefer Abscheu auf den Inhalt ihres Glases gerichtet. Mit Schaudern dachte sie daran, wie viele Liter dieses üblen Zeugs sie ihrer Figur zuliebe bereits in sich hineingeschüttet hatte. Aber von den nörgelnden Vorwürfen ihrer Waage abgesehen, war ihr Leben perfekt. Sie hatte Geld, eine der reizendsten Villen von Menton, einen großen, schillernden Freundeskreis, war bei bester Gesundheit, mit Humor gesegnet und überaus genussbereit. Ihr Mann, ein erfolgreicher, aber magenkranker Börsenmakler, war zwischen den Kriegen an einer Leichenvergiftung gestorben. Und so hatte Nesta ihr Leben während der letzten zwölf Jahre zwischen Larkhill Manor in Gloucestershire und ihrer Villa in Menton aufgeteilt, und ihr einziges Unglück war gewesen, stetig zuzunehmen. Sie hatte alles versucht – von Vibromassage bis zu Eurhythmie, von Seilhüpfen bis zum schwedischen Drill, von türkischen Bädern bis zu den makabersten Diäten. Aufgeregt war sie von einer Kur zur nächsten getappt, ohne dass ihr Glaube dabei gelitten hätte. Doch es war sinnlos. Unerbittlich wie der Lauf der Zeit kroch der Zeiger ihrer Badezimmerwaage immer weiter nach oben. Im Eiltempo näherte sich der Augenblick – und Nesta war inzwischen sehr bereit, dies zuzugeben –, da sie alle Hoffnung fahren ließ. Von da an konnte ihre Figur zum Teufel gehen!
Gleichwohl war sie immer noch eitel genug, um ihre Nichte Dilys zu beneiden, als diese durch die Verandatür zu ihr an den Frühstückstisch kam. Denn Dilys’ schlanker, gerader, braungliedriger Körper wurde zusätzlich perfekt betont durch die teure Schlichtheit ihres Kleids. Nesta hob eine Hand zum Gruß.
»Morgen, Darling. Gut geschlafen?«
»Ja, danke, Tantchen. Aber leider komme ich scheußlich spät.«
»Da bist du nicht die Einzige!«, schnob Nesta finster, und als Dilys begann, ihre Grapefruit mit Zucker zu bestreuen, beugte sie sich zu ihr und setzte vertraulich hinzu: »Weißt du, Darling, sie muss weg! Wirklich. Sie ist schon viel zu lang bei mir. Sie nutzt mich aus. Meinst du nicht auch?«
Dilys seufzte. Die Gesellschafterin ihrer Tante, Miss Pilligrew, war ein alter Zankapfel – ein holziger, ziemlich jämmerlicher kleiner Apfel, der Dilys zutiefst leid tat. Ihrer Ansicht nach hatte sich jeder, der das stürmische Temperament ihrer Tante fünfzehn Jahre lang ertragen hatte, eine Goldmedaille verdient. Besänftigend sagte sie:
»Ach, die arme kleine Pilly – sie tut doch, was sie kann. Ich finde, sie ist einfach ein Schatz. Ohne sie wärst du doch völlig verloren.«
»Ich persönlich«, antwortete Nesta, »glaube ja, dass sie trinkt!« Und weiter, indem sie heftig den Kopf umwandte: »Ah! Da bist du ja endlich. Gerade habe ich Dilys gesagt, dass du trinkst. Stimmt das, Pilly?«
Miss Bertha Pilligrew gewährte ihrer Dienstherrin ein zittriges Lächeln und trippelte seitwärts wie eine verschreckte Krabbe zu ihrem Korbstuhl. Sie kicherte mit schmeichlerischer Heiterkeit:
»Ah, gönnst du dir wieder einen kleinen Scherz, Liebes?« Und setzte fröhlich hinzu: »So ein himmlischer Morgen. Es ist wirklich eine große Sünde, dass ich so spät herunterkomme.«
»Ungehörig ist es, sehr ungehörig«, korrigierte Nesta. »Ich wollte den Tatler. Ausdrücklich wollte ich den Tatler. Und war Pilly da und hat mir den Tatler gebracht? Nein, natürlich nicht! Sie hat die Nachwirkungen ihrer nächtlichen Sauferei ausgeschlafen!« Miss Pilligrews ledriges, scharf geschnittenes Gesicht zerknitterte vor Freude über diese bösartige Neckerei, während Nesta fortfuhr: »Wo ist Tony? Hat heute schon jemand Tony gesehen?«
»Ich glaube, ich habe ihn mit seinem Wagen wegfahren hören«, meinte Dilys.
»Ach wirklich! Wie lange ist das her?«
»Nach meiner Uhr war das um halb sieben. Ich glaube, der Motorenlärm hat …«
Nesta unterbrach sie ungeduldig:
»War Kitty bei ihm?«
»Nein!«, sagte eine zarte Stimme hinter ihr. »Kitty wurde ausnahmsweise mal nicht gefragt.« Eine dunkeläugige junge Frau mit rabenschwarzen Haaren, provokanter Figur und beträchtlicher Anmut kam auf die Terrasse geschlendert. Sie trug eine vorteilhaft geschnittene Hose, einen allzu engen Seidenpullover und scharlachrote Schuhe mit Keilabsatz. »Morgen, Mrs. Hedderwick. Morgen allerseits. Komme ich zu spät?«
»Scheußlich zu spät!«, rief Nesta. »Es ist ganz allein Ihre Schuld, wenn der Kaffee kalt geworden ist.« Sie griff nach ihrem Feuerzeug und zündete sich eine Zigarette an, die schon in einer Chagrinspitze steckte. »Pilly, hol mir doch jetzt meinen Tatler. Du hast genug gefrühstückt.«
»Aber … aber, Nesta, Liebste …«
»Keine Widerrede. Du isst zu viel.«
»Na gut«, murmelte Miss Pilligrew, würgte großmütig den letzten Bissen Croissant hinunter und erhob sich fügsam. »Du weißt nicht zufällig, wo …«
»Nein. Er kam gestern mit der Post, er muss also irgendwo im Haus sein. Sei nicht so verflixt hilflos.«
»Nein, Liebste.«
Kaum war Miss Pilligrew davongeflattert, wandte sich Nesta an Kitty.
»Was ist denn nur in Tony gefahren? Wirklich seltsam, um das Mindeste zu sagen. Woher diese plötzliche Leidenschaft, so früh aufzustehen?«
»Nächste Frage, Mrs. Hedderwick. Das ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche, dass er sich noch vor dem Frühstück mit dem Wagen verdrückt hat.«
»Pff! Verstohlen. Das gefällt mir nicht. Tony ist ein Rohling. In letzter Zeit sagt er mir gar nichts mehr. Sie haben einen schlechten Einfluss auf ihn, Kitty.«
Dilys lächelte in sich hinein. Die arme Tante Nesta. Tony Shenton war einer der zahlreichen achtlosen jungen Männer, denen sie seit dem Tod ihres Gatten ihre mütterliche Fürsorge angedeihen ließ. Einer ihrer »lieben Jungs«, wie sie sie kollektiv nannte. Vor einem halben Jahr war Tony von weiß der Himmel wo für ein langes Wochenende aufgetaucht und nicht mehr gegangen. Dilys verachtete seinen schmierigen Charme und sein erdrückendes Geprahle. Offenbar hatte er in der Zuneigung ihrer Tante die Stelle eingenommen, die von Rechts wegen ihr zustand, denn nachdem ihre Eltern im Krieg bei einem Luftangriff ums Leben gekommen waren, war Tante Nesta ihr Vormund geworden. Und seit Dilys nicht mehr auf das Mädchenpensionat in der Schweiz ging, war die Villa Paloma praktisch ihr Zuhause.
Eigenartigerweise wusste niemand, warum Tony überhaupt eingeladen worden war. Als Dilys ihre Tante fragte, wo sie ihn kennengelernt hatte, wurde sie verschlossen wie eine Auster. Dabei gab sie sich keine Mühe, ihre Schwärmerei für Tony zu verhehlen. Dilys, noch Opfer einer konventionellen Erziehung, fand diese Beziehung ungesund. Sie war schockiert von der lockeren Vertrautheit, den schamlosen, wenngleich spielerischen Liebkosungen, den neckischen Zärtlichkeiten. Tony war achtundzwanzig. Ihre Tante mindestens dreißig Jahre älter. Überdies machte die verachtenswerte, beiläufige Art, in der Tony die nicht nachlassende Freigebigkeit ihrer Tante annahm, Dilys wütend. So wie er Nesta behandelte, musste jeder denken, dass sie sich geehrt fühlte, ihn im Haus zu haben, dass er ihr, indem er sie ins Casino oder gelegentlich einmal ins Ballett oder Theater begleitete, einen Gefallen erwies. Wohl war ihre Tante schroff bis zur Grobheit, schwierig und unberechenbar, im Herzen aber war sie nett und großzügig, und Dilys fand es schlimm, wenn jemand seinen Vorteil daraus zog.
Drei Wochen davor war dann auch noch Kitty Linden in der Villa aufgetaucht, offenbar auf Tonys Einladung hin. Ob er das mit seiner Gastgeberin abgesprochen hatte, wusste Dilys nicht genau. Eines aber stand fest – Tante Nesta war verärgert. Und das nicht ohne Grund, denn von Anfang an hatte Tony aus seiner Haltung Kitty gegenüber keinen Hehl gemacht. Soweit Dilys wusste, waren er und Kitty sich während des Krieges begegnet, als er Flying-Officer bei der Air Force war und sie Corporal beim weiblichen Fliegerkorps. Offenbar hatten sie sich seitdem mehrmals gesehen und sporadisch miteinander korrespondiert. Am Abend vor Kittys Eintreffen hatte Tony ihr erzählt:
»Das arme Ding hat eine schwere Zeit hinter sich. Deshalb dachte ich, eine Luftveränderung täte ihr gut. Geht doch nichts über ein bisschen dolce far niente, wenn die Nerven blank liegen. Sie ist ein liebes Mädchen. Glauben Sie mir, die ist nicht ohne. Hat mal auf der Bühne gestanden.«
Während dieser letzten drei Wochen hatte Dilys eine lebhafte Bewunderung für ihre Tante entwickelt. Wie sie ihre wahren Gefühle verbarg und Kitty wie jedes andere Mitglied des Zirkels in der Villa behandelte, war beeindruckend. Herrlich direkt, wie immer, aber nie auch nur ein Wort oder ein Blick der Eifersucht, die sie doch verzehren musste.
Und Kitty … Nun, eine Frau ihres Alters und mit ihrer Erfahrung hätte nicht so dumm sein dürfen. Wie sie sich Tony an den Hals warf, war nachgerade unanständig und töricht. Sollte Dilys sich je verlieben, dann würde sie sich ganz sicher nicht wie eine närrische Sechstklässlerin aufführen, die hoffnungslos in ihren Musiklehrer verknallt ist!
II
An dieser Stelle in Dilys’ Reflexionen kam Tonys karmesinrote Vedette (ein Geburtstagsgeschenk von Nesta) auf dem Garagenhof hinter der Villa brummend zum Stehen. Ihr entstieg ein breitschultriger, blonder junger Mann in einem hellblauen Trikothemd und dunkelblauen Shorts. Beim ersten Hinsehen wirkte Tony wie einer jener anständig lebenden, wohl proportionierten jungen Engländer, die die Seiten von Frauenzeitschriften schmückten oder muskelbetont in Anzeigen für Herrenunterwäsche posierten. Eine eingehendere Musterung jedoch hätte diese Illusion Lügen gestraft. Wie immer Tonys Konstitution mit einundzwanzig gewesen war, mittlerweile befand sie sich eindeutig auf dem absteigenden Ast. Gutes Leben, kräftiges Trinken, lange Nächte und mangelnde Bewegung hatten sich in den sonnengebräunten Körper eingeschrieben. Seine Gesichtszüge offenbarten deutlich die Verheerungen seiner Zügellosigkeit. Dennoch hatte Tony fraglos etwas Besonderes. Wenn er sich anstrengte, konnte er ebenso kenntnisreich wie unterhaltsam sein. Seine Technik bei reichen Frauen mittleren Alters war eine Offenbarung. Bei Nesta Hedderwick jedenfalls wirkte sie perfekt, denn obwohl sein Charme gekünstelt war, hatte er ihm bei ihr eine sehr ordentliche Dividende eingetragen.
Als er nun auf die Terrasse geschlendert kam, saß Kitty allein am Frühstückstisch. Sie schaute auf und lächelte.
»Hallo, Darling. Netten Ausflug gehabt?«
»Und ob, danke.«
»Schon gefrühstückt?«
»Nein – ich bin am Verhungern.« Er warf einen gefräßigen Blick auf den Tisch. »Großer Gott! Zwei Brötchen, ein Klacks Butter und ein Schälchen Marmelade. Nur weil Nesta auf Diät ist, müssen wir anderen doch nicht hungern. Wie ist der Kaffee?«
»Lauwarm, Darling.«
»O. k. Da kümmern wir uns drum.« Er drückte einen Klingelknopf neben der Verandatür und ließ sich mit einem Seufzer der Verzweiflung auf Nestas Chaiselongue fallen. Die Armlehne tätschelnd schnurrte er: »Du siehst dort auf der anderen Tischseite nicht gerade anschmiegsam aus, Süße. Kommst du rüber zu mir?«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Kitty langsam.
Tony setzte sich ruckartig auf und sah sie verblüfft an.
»Hallo. Was ist denn mit dir los? Hat etwa jemand dein süßes Köpfchen gegen mich aufgehetzt?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Was ist denn dann, verdammt?«
»Tony?«
»Ja?«
»Wohin bist du heute früh geschlichen? Du könntest mir gegenüber schon ehrlich sein. Schließlich habe ich …«
Lisette, das Dienstmädchen, erschien in der Verandatür. Tony drehte sich mit einem Ausruf der Befriedigung zu ihr.
»Hören Sie, Lisette, seien Sie ein Engel und machen Sie eine frische Kanne Kaffee, ja? Die Plörre hier kann man ja nicht trinken. Und vielleicht auch noch zwei Spiegeleier und etwas dünnen, knusprigen Toast. Sie wissen doch, wie ich’s mag. Geht das, chérie?«
»Aber selbstverständlich, M’sieur.«
»Großartig!«
Als Lisette sich zurückgezogen hatte, meinte Kitty:
»Also wirklich, Tony, man könnte grad meinen, das alles hier gehört dir, so wie du das Personal rumscheuchst. Dass Nesta das mitmacht.«
Tony kicherte.
»Ein Wunder, wie? Man muss eben nur nett sein. Aber lassen wir Nesta da raus. Du wolltest mich gerade zur Minna machen. Dann bring’s auch zu Ende.«
»Diese Ausfahrten frühmorgens – was hat’s damit auf sich, Darling?«
»Angeln«, sagte Tony knapp.
»Das glaube ich dir nicht!«
»O. k., dann eben nicht.«
»Du bist sicher … du bist ganz sicher, dass du nicht bei einer anderen Frau bist?«
»Großer Gott! Vor dem Frühstück? Sei doch nicht verrückt.«
»Warum hast du mich dann nicht gefragt, ob ich mitkommen will?«
»Weil ich nie gedacht hätte, dass dich Angeln interessiert. Normalerweise langweilen sich Frauen dabei zu Tode.«
»Stimmt. Aber so eine Frau bin ich nicht. Wenn du dich also das nächste Mal in aller Früh davonschleichst, Darling, nimmst du mich mit. Versprochen?«
»Tut mir leid, mein Engel. Daraus wird nichts.«
»Aber Tony …«
»Ach, Himmelherrgott!«, rief Tony, plötzlich verärgert. »Lassen wir das jetzt bitte. Wenn ein Mann angeln geht, will er sich konzentrieren. Und wie zum Donner soll ich mich konzentrieren, wenn du dabei bist? Können wir’s dabei belassen und uns nicht die Laune verderben?«
»Na gut, wenn du’s so haben willst«, sagte Kitty mürrisch. »Entschuldige, dass ich so ein Mühlstein um deinen Hals bin. Mir war nicht klar …«
»Ach, hör doch auf damit! Du bist kein Mühlstein. Sei jetzt mal vernünftig und gib mir einen Kuss.«
»Eventuell«, sagte Kitty, etwas erweicht.
»Nichts da ›eventuell‹«, beschloss Tony nachdrücklich. »Du tust es!«
Kapitel 3
Das Mädchen in der Galerie
I
Der verbleibende Gast in der Villa Paloma war nicht zum Frühstück erschienen, denn wenn Nesta einen Künstler im Haus hatte, erwartete sie von ihm auch das entsprechende Benehmen. Paul Latour mühte sich jedenfalls nach Kräften, dem Bild der fin de siècle-Bohème zu entsprechen, auf dem sie ihre romantischen Vorstellungen des Genres errichtet hatte. Ihm kam entgegen, dass er mit seiner hochgewachsenen, leicht gebeugten Gestalt, den ungebärdigen dunklen Haaren, dem struppigen Bart und den schmalen, hungrigen Zügen diesem Bild ohnehin exakt entsprach. Und ansonsten achtete er sorgfältig auf einen gänzlich überzeugenden Auftritt. Er kleidete sich nachlässig in kupferrotem Kord, weiter blauer Bluse, gepunktetem Halstuch und Sandalen. Er stand spät auf, legte sich im Morgengrauen schlafen, flirtete mit den Hausmädchen, schnippte Asche auf den Teppich, strafte die Philister mit Verachtung und zersetzte den Ruf seiner Künstlerkollegen mit der Säure seines Tadels.
In die Villa eingeführt hatten ihn Nesta Hedderwicks alte Freunde, Colonel und Mrs. Malloy. Die Malloys lebten ein Stück weiter die Küste entlang in Beaulieu und kamen einmal die Woche zum Bridge – ein Spiel, bei dem Nesta mehr Begeisterung als Können an den Tag legte. Der Colonel war in einem Café in Nizza mit Paul über gemeinsame Interessen ins Gespräch gekommen und hatte ihn zum Abendessen zu sich nach Hause eingeladen. Als er erfuhr, dass Paul mehr oder weniger pleite war, reichte er ihn eiligst an Nesta weiter, da er deren Vorliebe für romantische junge Männer mit mehr Charme als Geld nur zu gut kannte. Wie erwartet, verfiel Nesta ihm auf der Stelle. Sie ließ eines der Mansardenzimmer zum Atelier umbauen, gab Paul eine kleine, aber angemessene Dotation und langweilte ihre einflussreicheren Freunde mit verquasten Erklärungen seines besonderen Genies. Sie hoffte, sie würden seine Bilder kaufen. Einer oder zwei taten es auch und versteckten diese Meisterwerke heimlich im Keller.
Seit einem halben Jahr machte Paul es sich nun schon in der Villa Paloma bequem. Er war sozusagen der zweitälteste Bewohner. Vielleicht nicht ganz so fest etabliert wie Tony Shenton, aber beschweren konnte er sich nicht. Spielte er seine Karten klug aus, gab es keinen Grund, warum ihm die Villa nicht zum Dauerwohnsitz werden sollte. Oder wenigstens so lange, bis er finanziell unabhängig war und sich eine eigene Villa leisten konnte.
II
An jenem Vormittag lag er noch auf seinem ungemachten Diwan in einer Ecke des Ateliers und betrachtete voller Widerwillen eine große, eindrucksvolle Leinwand, die mitten im Zimmer auf einer Staffelei stand. Während der letzten zwanzig Minuten hatte er sich mit der Frage gequält, was das Bild eigentlich darstellen sollte. Nestas Forderungen, sein neuestes Meisterwerk zu sehen, wurden immer drängender, und er konnte sie nicht länger vertrösten. Und wenn Nesta ein Bild betrachtete, wollte sie als Erstes wissen, was es aussagte. Ihrer Meinung nach erzählten die besten Bilder eine Geschichte oder trugen wenigstens ein klares und angemessenes Etikett.
Aber mon Dieu!, ein Kabeljaukopf, der auf einem nackten Frauentorso hockte, der auf zwei Kaktusblättern balancierte, garniert mit einem motif aus Zitronen und Spaghetti … Paul zuckte hoffnungslos die Schultern.
Dann sprang er auf eine plötzliche Eingebung hin auf, schnappte sich sein Barett von einem Wandhaken, schlich sich die Hintertreppe hinunter und durch ein Tor in der Gartenmauer auf die Straße. Fünf Minuten später bog er nach der Hälfte der Avenue de Verdun in die Rue Partouneaux ein. Dort erklomm er die Stufen zwischen den engen, krummen Gässchen der Altstadt und lief gebückt unter einem mächtigen Torbogen hindurch in einen kleinen Hof, der von verschlungenem Rebengewirr beschattet wurde. Ohne zu klopfen, stieß er eine wacklige grüne Tür auf und stieg eine ebenso wacklige Treppe hinan, die direkt in ein Zimmer führte.
Als sich seine Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, erkannte er eine trollartige Gestalt, die vor einer grob gezimmerten Staffelei auf einer umgedrehten Kiste kauerte. Als der Zwerg Paul sah, sprang er mit einem Schrei der Verblüffung auf.
»M’sieur Latour!«
Paul lächelte boshaft.
»Mich hast du jetzt nicht erwartet, wie, Jacques?«
»Nein, M’sieur. Ihr Bild ist noch nicht fertig. Ich habe Ihnen doch gesagt, nächste Woche. Davor ist es unmöglich. Sie müssen verstehen, ich bin keine Maschine …«
Paul unterbrach ihn brüsk:
»Eh bien! Kein Grund zu jammern, du Trottel. Ich bin nicht wegen des Bildes da.«
»Nicht, M’sieur?«
»Nein, mein Freund. Ich wollte nur mit dir reden.«
»Sie sind mit meiner Arbeit nicht zufrieden – ist es das, M’sieur?« Der kleine Kerl schlug sich auf die deformierte Brust und platzte zornig heraus: »Sogar für mich gibt es Grenzen des Erträglichen, M’sieur. Sie verstehen nicht. Der Wert dessen, was ich Ihnen gebe …«
»Mir geben!« Paul lachte sarkastisch. »Sag, Jacques, wie viel habe ich dir für dein letztes unvergleichliches chef-d’œuvre gezahlt?«
»Zweitausend Franc, M’sieur.«
»Genau. Zweitausend Franc für ein grauenhaftes Bild, das keine zwei Sou wert ist. Wer zum Teufel würde dein Zeug schon kaufen, wenn nicht ich?«
Der Bucklige zuckte verzweifelt die Achseln.
»Hélas, M’sieur … es ist nicht einfach heutzutage …«
»Eben. Wenn ich also weiter von dir kaufen soll, dann keine Grausamkeiten mehr. Verstehst du, du Idiot? Nichts mehr von diesem abstrakten, surrealistischen Quatsch. Von jetzt an will ich Bilder, die auch ein Kind verstehen kann. Keine Kabeljauköpfe und Spaghetti mehr.«
»Nein, M’sieur.«
Paul zeigte auf die Leinwand, die vor ihm auf der selbst gebastelten Staffelei stand.
»Das neue Bild da … was soll das darstellen?«
»Das ist eine Landschaft, M’sieur.« Unterwürfig trat er beiseite. »Gefällt es Ihnen?« Er gestikulierte. »Die Komposition, M’sieur?«
Paul betrachtete das halb fertige Gemälde mit kritischem Blick.
»Das ist schon besser. Ich kann Zypressen, eine Kirche und eine Steinmauer erkennen.«
»Das ist Le Monastère de l’Annonciade, M’sieur.«
»Schön. Bei so einem Bild weiß ich, woran ich bin. Aber das andere … dieses Grauen … was soll das bedeuten? Was soll ich den Leuten sagen, wenn sie mich fragen, was das sein soll? Kannst du mir das verraten, du Knallkopf?«
Der Bucklige überlegte kurz, kratzte sich in den dunklen, fettigen Haaren und spuckte kräftig durch das offene Fenster auf den Hof. Dann dehnten sich seine bräunlichen Züge unter der Hakennase zu einem breiten Grinsen.
»Das ist einfach, M’sieur. Nennen Sie’s Le Cauchemar, der Albtraum. Denn als das wird es den Unwissenden und Dummen zweifellos erscheinen. Sagen wir vielleicht, Ihren Freunden, M’sieur? Für diejenigen unter uns aber, die die Vision besitzen …«Jacques Dufil schüttelte traurig den Kopf. »Wegen Ihres neuen Bildes kommen Sie nächste Woche?«
»Ja, nächste Woche«, nickte Paul.
Der Bucklige hob drei Finger in die Luft und blickte Paul fragend an. Der schüttelte finster den Kopf und hielt dem kleinen Burschen mit einer beleidigenden Gebärde zwei Finger vors Gesicht.
Mit einem aus viel Ungemach entstandenen Fatalismus hob Jacques Dufil die gequälten Schultern und breitete die Arme aus. Das unterwürfige Lächeln war wieder in seine verzerrten Züge zurückgekehrt, doch als er an die ignoranten Bemerkungen dieses Hampelmanns über seine schönen Bilder dachte, war in seinem Herzen nur schwarzer Hass!
III
Da Paul bei dem Buckligen war, erhielt Dilys keine Antwort, als sie an die Ateliertür klopfte. Sie hatte für den Vormittag einen Besuch der Exposition de Peinture Méditerranéenne geplant und wollte in der Annahme, Pauls professionelle Kritik werde lehrreich sein, dass dieser sie begleitete. Dilys wusste nur wenig über Malerei, da sie aber eine ernste junge Frau war, wollte sie ihr Wissen unbedingt erweitern. Nur weil ihre Tante sie partout ihrem Müßiggang überlassen wollte, sah sie keinen Grund, ihren Horizont nicht zu erweitern.
Die Galerie, die auf Mentons gepflegte, exotische Parkanlagen blickte, war nicht besonders voll. Ein paar wenige Urlauber schlenderten mit jenem frömmelnden Blick umher, der zumeist Kirchen und historischen Stätten vorbehalten war. Ein Wächter saß auf einem Louiss-Quinze-Stuhl und beobachtete das Geschehen mit der luchsäugigen Sorge eines Privatdetektivs, der über eine wertvolle Sammlung von Hochzeitsgeschenken wacht. Dilys begriff nicht ganz, warum, denn die meisten Gemälde hätte man ohne die Hilfe einer Handkarre niemals aus dem Gebäude gebracht.
Sie kaufte einen Katalog und studierte die Bilder mit der für sie typischen Gewissenhaftigkeit in der richtigen numerischen Reihenfolge. Ein paar Namen waren ihr bekannt – darunter Matisse, Bonnard, Dufy und Utrillo. Das waren die Starkünstler, vor deren Werken sie ernst und feierlich beeindruckt stehen blieb. Aber was sollte sie von den kleineren Lichtern halten? Sollte sie Belustigung, Zorn, Entsetzen oder Freude zeigen? Das alles war sehr schwierig, und sie wünschte, Paul wäre dabei, um sie sicher durch dieses ästhetische Labyrinth zu leiten. Besonders geschätzt hätte sie seine Kommentare zu diesem riesigen, lebhaften Fiesta-Bild, auf dem eine Schar Wasserspeier mit magentaroten Fratzen in einem Hain aus monströsen smaragdgrünen Kohlköpfen vor einem wilden purpurnen Himmel tranken und tanzten. Da bemerkte sie plötzlich einen hochgewachsenen, breitschultrigen Mann, der über ihre linke Schulter hinweg verständnislos die Leinwand anstarrte. Er war es auch, der ihre eigene instinktive Reaktion auf das Werk mit bewundernswerter, kraftvoller Kürze in Worte fasste.
»Mein Gott!«
Nur das – klar und energisch in einem Englisch ausgesprochen, das gemeinhin als »gebildet« bezeichnet wurde. Erfreut drehte sie sich um.