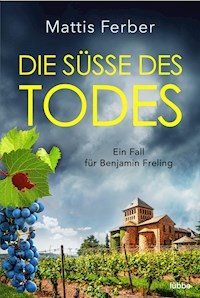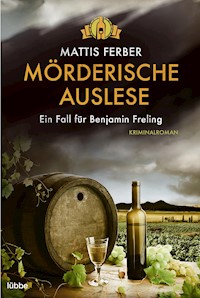
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Benjamin Freling
- Sprache: Deutsch
Als Benjamin Freling, begnadeter Sommelier eines Luxushotels am Kaiserstuhl, ein Skelett in der aufgeschlagenen Wand seines geliebten Weinkellers entdeckt, ist er fassungslos. Dabei wollte er nur mehr Raum für seine Weinraritäten erschließen. Der Sommelier hat jedoch eine Vermutung, wen er da gefunden hat: sein ehemaliges Kindermädchen, das vor zwanzig Jahren spurlos verschwand. Benjamin beginnt zu recherchieren und muss sein feines Gespür als Sommelier einsetzen, um in dem Gespinst aus Lügen, Vertuschung und Verrat den Mörder zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil IEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnSechzehnTeil IIEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnSechzehnSiebzehnAchtzehnDanksagungÜber dieses Buch
Band 1 der Reihe »Benjamin Freling«
Als Benjamin Freling, begnadeter Sommelier eines Luxushotels am Kaiserstuhl, ein Skelett in der aufgeschlagenen Wand seines geliebten Weinkellers entdeckt, ist er fassungslos. Dabei wollte er nur mehr Raum für seine Weinraritäten erschließen. Der Sommelier hat jedoch eine Vermutung, wen er da gefunden hat: sein ehemaliges Kindermädchen, das vor zwanzig Jahren spurlos verschwand. Benjamin beginnt zu recherchieren und muss sein feines Gespür als Sommelier einsetzen, um in dem Gespinst aus Lügen, Vertuschung und Verrat den Mörder zu finden.
Über den Autor
Mattis Ferber ist ein Pseudonym des Autors Hannes Finkbeiner. Er ist Journalist und studierte an der Hochschule Hannover, wo er heute auch als Dozent tätig ist. Finkbeiner schrieb u. a. für die FAZ, Spiegel Online oder das RedaktionsNetzwerk Deutschland und ist für HAZ als Kolumnist tätig.
MATTIS FERBER
MÖRDERISCHEAUSLESE
Ein Fall für Benjamin Freling
KRIMINALROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Copyright © 2021 by Hannes Finkbeiner
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ilse Wagner, München
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverdeunter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Miiisha | etraveler
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0392-5
luebbe.de
lesejury.de
Teil I
Eins
Benjamin Freling atmete ein, atmete aber nicht mehr aus. Es ging nicht. Er war erstarrt, und nur sein Herz pumpte weiter das Blut durch seine Adern. Mörtelstaub flirrte vor dem Lichtkegel der Taschenlampe. Hinter seinen Augen pochte ein nervöser Puls, brachte das Bild zum Zittern – oder war er es selbst, der zitterte?
Ohne seinen Blick abzuwenden, tastete er ins Leere, griff zweimal daneben, beim dritten Mal bekam er den Stiel des Vorschlaghammers zu fassen. Er brauchte Halt, stellte ihn auf den kleinen Schutthaufen neben sich und stützte sich darauf ab. In diesem Moment löste sich ein letzter Klinkerstein. Er fiel in Zeitlupe durch den luftleeren Raum, der urplötzlich sein ganzes Leben ausfüllte. Dabei wollte er doch nur einen Raritätenkeller haben. Nicht mehr. Er sah zu, wie der Stein durch den Lichtstrahl fiel. Nein. Falsch. Der Stein fiel nicht. Er rieselte hernieder. Schwebte. Langsam wie eine Feder. Und krachte berstend wie ein Fels auf den Haufen anderer Steine. Die Welt krampfte um sein nervöses Herz.
Es war einer dieser Augenblicke, dachte der Sommelier, in denen sich das ganze Leben schlagartig veränderte. Von jetzt auf gleich. Eine Sekunde, und alles war anders. Ticktack. Ein einziger Schritt und dazwischen nur eine unsichtbare Linie, über die man ging, und erst im Nachhinein bemerkte man, dass sie da gewesen war. Augenblicke. So einprägsam, dass sie für ewig ein Loch ins hauchdünne Seidentuch der Seele stanzten und den Lebensweg in eine andere Richtung lenkten.
Bei Benjamin war es auch so eine wundersame Winzigkeit wie der wahrscheinlich hundertste Wein, den er probierte. Ein Fingerhut voll Flüssigkeit stellte vor zehn Jahren sein ganzes Leben auf den Kopf: ein Pinot Noir aus dem Burgund, der ihm einmal in Oberbergen eingegossen worden war. Ein Clos Saint-Denis Grand Cru aus dem Jahr 1999 von der Domaine Dujac. Ein redseliger Connaisseur faselte bei der Verkostung pausenlos etwas von einer völligen Harmonie aus Säure, Frucht und Tanninen, von Würze, Wärme, Komplexität, von Aromen nach Himbeeren, Kakao und Zedernholz, von sehnigem Körper, stabiler Säure und was ihm sonst noch so in den Sinn kam. Stimmte ja auch alles, aber Benjamin mochte dieses überzeichnete Gerede nicht. Schon damals nicht. Ganz im Allgemeinen.
Im Speziellen hatte er das Gefühl, dass jedes weitere Wort diesen einmaligen Moment zerstört hätte. Der Wein war pure Magie. Benjamin nippte, schnupperte, beschwor dabei die Einmaligkeit des Daseins und der Schöpfung an und für sich. Er war vom Bouquet des Weins so verzaubert, regelrecht benommen, dass er kurz die Augen schloss, um einen Moment damit allein zu sein. Wäre es nicht unhöflich gewesen, dann hätte er sich die Finger in die Ohren gesteckt, um das Geschwätz nicht mehr hören zu müssen und ganz und gar seine Ruhe zu haben, ach was, er hätte am liebsten die ganze Flasche geschnappt und wäre damit im Kamelsgalopp getürmt. Raus aus dem legendären Adler. Rein ins Rebendickicht und hoch in die Bassgeige, dorthin, wo ihn niemand finden würde, ihn und seine hundert Fingerhüte.
Hatte er zu dieser Zeit nicht eigentlich gehörig die Schnauze voll von dem ganzen Gastrowahnsinn gehabt?
Spielte er nicht sogar mit dem Gedanken, seine Kellnerlehre endgültig an den Nagel zu hängen?
Und dennoch stand er jetzt schnappatmend in einem Weinkeller, aufgestützt auf einen Vorschlaghammer, mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Sommelier-Schürze. Er hatte fünfzehntausend Flaschen gehortet, über die er wachte wie der Drache über sein Gold – und schuld war ein Schlückchen Burgunder.
Benjamin Freling biss sich auf die Unterlippe, knipste die Taschenlampe aus und warf einen Blick in die selige Dämmerung des Weinkellers, der nur durch wenige Deckenstrahler erleuchtet wurde.
Was sollte er tun?
Was gebot die Stunde?
Die Klimaanlage brummte leise und beständig. Vorn, verdeckt durch das Regal mit den Überseeweinen, hörte er die gedämpften Stimmen zweier oder dreier Gäste. Mehrmals täglich, bei einem Rundgang durchs Hotel, drückten sie ihre Nasen an der gläsernen Eingangstür platt. Wortwörtlich. Er hatte sogar Glasreiniger und ein Baumwolltuch in einem Sideboard, um das Geschmiere bisweilen sauber zu machen. Der Sommelier atmete leise und flach, stand völlig still, als wäre er ein Einbrecher, nein, als wäre er ein Mörder, der eigenhändig die Leiche in der Zwischenwand versteckt hatte und nun fürchtete, entdeckt zu werden. Denn das war es, was vor ihm in der Dunkelheit lag: eine mumifizierte Leiche.
Staub kribbelte in seiner Nase. Kurz schwollen die Stimmen an, entfernten sich dann langsam, und Benjamin überkam der Drang, erneut die Taschenlampe anzuknipsen. Er konnte einfach nicht anders. Er blickte noch einmal durch das Loch in der Wand, sah die verkrümmten Gliedmaßen, sah die Haut wie vergilbtes, sprödes Pergament, sah den deformierten Schädel, die schwarzen Augenhöhlen, den aufgeklappten Kiefer und den lippenlosen Mund, der sich wie das kalte Grausen um einen Reigen blanker Zähne schloss.
Nein, das war nicht das Gerippe eines Hundes oder sonst eines Tiers.
Der Sommelier konnte es nicht glauben.
Wie auch?
Wochenlang hatte er Baupläne studiert. Wobei. Richtig war: Vor mehreren Wochen hatte er sich die Baupläne besorgt und sie einfach im alltäglichen Trubel wieder vergessen. Erst vorgestern hatte er sie dann unter die Lupe genommen. Da das Hotel seiner Familie auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblickte, gab es einiges übereinanderzulegen. Aber es war, wie er vermutet hatte. Irgendwie konnte er sich ja auch trübe daran erinnern, an damals, vor über zwanzig Jahren, als er zehn Jahre alt war, damals, als überall Planen hingen, ein steter Wind durch den entkernten Altbau blies, damals, als ihm an jeder Ecke ebenso viele Gäste wie Bauarbeiter entgegenkamen. Damals. Als seine Eltern starben. Knack. Ins Seidentuch der Seele.
Er erinnerte sich jedenfalls, dass es hier einen Durchgang zum alten Festsaal, den heutigen Boutiquen, gegeben hatte, der infolge des großen Umbaus zugemauert worden war. Und dieser Hohlraum war exakt das, was er brauchte. Auf den Plänen entsprach die Baulücke einer Länge von zwei und einer Breite von eineinhalb Metern. Das war genau das richtige Ausmaß für sein Unterfangen: einen Keller in den Keller zu bauen. Ja. Es war Irrsinn. Weinliebhaber waren eben nicht selten Romantiker. Freaks. Besessene. Irrationale. Allesamt unzurechnungsfähig, denn wenn der Stoff einmal von ihnen Besitz ergriffen hatte, dann waren sie unweigerlich verloren. Und Benjamin Frelings neue Stufe des Irrsinns war eben der Raritätenkeller. Er musste ihn einfach haben. Irgendwie hatte er das Gefühl, wenn es ihn nur gäbe, sanft beleuchtet, stabil temperiert, mit verzierter, gusseiserner Gittertür verschlossen, zu der nur er einen Schlüssel hatte – ein Raum, in dem sich das ganze Jahr hindurch nichts veränderte –, dann hätte er ein seelisches Gegengewicht zur Unbeständigkeit seines Arbeits- und Privatlebens. Immer wieder malte er sich die Flaschen darin aus. Kein Margaux, Petrus oder Romanée-Conti, nicht ausschließlich jedenfalls. Die großen Namen brauchte er nur für die Snobs dieser Welt, die Etikettentrinker, die dachten, Genuss steigere sich proportional zum Investment. Nein, er würde hier Weine mit Geschichte sammeln, echte Schönheiten mit Aura, die in seiner Gesellschaft würdevoll altern konnten.
Er seufzte so laut, dass es von einem Schnauben nicht zu unterscheiden war.
Es stand außer Frage.
Die Leiche musste weg.
Kurz wurde er sogar wütend auf dieses Ding da drinnen, das ihm an diesem Vormittag einen Strich durch die Rechnung machte. Sein Raritätenkeller war ganz offensichtlich eine Grabkammer. Er wurde mutig, stützte seine Ellenbogen wie ein hemdsärmeliger Archäologe auf den Rand des Lochs und schob den Kopf hindurch. Er rümpfte die Nase. Es roch muffig. Nach altem Mauerwerk. Sonst nichts. Da fiel sein Blick auf einige dicke, stillgelegte Rohrleitungen, die rechts unten am Boden ins Leere liefen und anscheinend einmal durch die Wand hindurchgeführt hatten. In diesem Moment fielen ihm auch die drei wuchtigen Waschmaschinen wieder ein, die früher im Weinkeller gestanden hatten – alte Dinger, die im Schleudergang das Hotel kurzzeitig zu einem Erdbebengebiet gemacht hatten. Vor dem großen Umbau wurde hier nämlich noch tagtäglich die Hotelwäsche gewaschen. Er dachte an die duftenden, feuchten Bettlaken, die hier einmal Bahn um Bahn hingen. Er sah sich selbst als Kind, wie er dazwischen durchgelaufen war, mit weit ausgestreckten Armen. Er hatte es geliebt, mit …
Der Sommelier machte intuitiv einen Schritt rückwärts.
Es wurde enger in seiner Brust.
Das Licht der Taschenlampe streifte diffus durch den Raum.
Er wusste, wer hier eingemauert worden war.
Im Weinkeller war es die meiste Zeit still und andächtig wie in einer Kathedrale. Benjamin Freling bemerkte dieses Detail immer dann, wenn er nach ein, zwei Stunden wieder in den Hotelbetrieb zurückkehrte. An diesem Tag war es sogar noch extremer. Sein Fund hatte die Zeit scheinbar aufgebläht, gedehnt, ausgewellt in die Unendlichkeit. Ihm kam es so vor, als sei er wochenlang in einer Isolationskammer in Einzelhaft gewesen, als er in den Küchen- und Servicetrakt lief. Es war laut. Die Servicekräfte brachten gerade die Reste des Frühstücksbüfetts herein, Geschirr klapperte, Wurst- und Käseplatten wurden abgeräumt, Obst- und Müslischüsseln umgeschüttet. Personal wuselte umher, und über alldem lag das ewige Rauschen der Spülstraße, das ganztags den Küchentrakt ausfüllte, und erst spät am Abend, wenn dem Ungetüm endlich der Stecker gezogen wurde, wurde einem der fortwährende Lärmpegel bewusst. Dieser Moment der Ruhe war auch immer exakt der Moment, in dem der Sommelier müde wurde, als sei seine innere Uhr über Funkverbindung mit einer Spülstraße verbunden.
Der Weinkellner machte kurz Platz, Marc Dupont, eine Reinigungskraft, rollte eine schwere Mülltonne durch den Gang. Freling ging weiter, er spürte seine schlottrigen Knie, entweder das, dachte er, oder jemand hatte den Fliesenboden mit Luftpolsterfolie gekachelt. Charlotte, seine Halbschwester und Küchenchefin des Hotels, stand am Pass, einem acht Meter langen Metallblock, der den Küchen- vom Servicebereich trennte. Die Speisen wurden hier getauscht: Bon gegen Essen. Darüber baumelte die Wärmebrücke, unter der die Gerichte warm gehalten wurden. Das Gerät konnte man an feinmaschigen Ketten in der Höhe verstellen. Charlotte ließ sie vormittags immer etwas herunter und funktionierte die Fläche zu einer Art Stehtisch um. Sie hatte natürlich auch ein eigenes Büro, das sie lediglich hin und wieder für Vorstellungsgespräche nutzte. Oder wenn sie die aktuellen Menüs anderer Spitzenköche im Internet ausspionierte. Charlotte brauchte einfach die Küchenluft, sie war durch und durch Handwerkerin, konnte dieses Schreibtischdasein nicht ausstehen. Außerdem war sie ein Kontrollfreak.
Benjamin lehnte sich wortlos an eine Arbeitsstation ihr gegenüber und betrachtete sie. Es dauerte keine zehn Sekunden, da blickte sie ihn an. Wobei sie ihn garantiert schon vorher bemerkt hatte. Seine Schwester bekam einfach alles mit. Eine beängstigende Gabe. Sie blickte also auf, ihren Kopf bewegte sie dabei keinen Millimeter, er war gesenkt auf die Unterlagen, aber ihre blutgeäderten Augen klappten mechanisch nach oben und durchbohrten ihren Bruder – sie war die Horrorpuppe, die plötzlich im Wandschrank zum Leben erwachte, sobald das Licht im Kinderzimmer aus war. War irgendetwas vorgefallen? Hatte er etwas vergessen? Erst da fiel Benjamin die Party der letzten Nacht wieder ein.
Die vergangenen Monate waren keine leichte Zeit gewesen. Früher erschienen die wichtigen Restaurantführer noch im Spätsommer und Herbst in wenigen Wochen Abstand zueinander. Man machte ein Häkchen dran, und dann ging es weiter im Programm. Das hatte noch Anstand, war erträglich. Heute bloggten Blogger in Endlosschleife, jede Woche drehte ein neuer Trend auf dem Themenkarussell seine Runden, auf dass es niemals stehen blieb. Um in diesem medialen Overload noch etwas zu bedeuten, schraubten die Medien ihre Schlagzeilen immer steiler in die Höhe. Es wurde der Koch der Köche gekürt, der Restaurantleiter der Restaurantleiter, der Sommelier der Sommeliers, dazu wurde das Restaurant des Jahres oder der Weinkeller des Jahres gewählt. Es gab Bestenlisten, Awards, Rankings, und um in diesem ganzen Tohuwabohu nicht die Übersicht zu verlieren, gab es am Ende noch Rankings der Rankings, damit endgültig alle Klarheiten beseitigt wurden. Das mediale Dauerbombardement war nicht weit von Terrorismus entfernt.
Der Guide Michelin, die wichtigste Publikation im heiligen Fressuniversum, hatte sein Veröffentlichungsdatum obendrein verändert. Der Führer kam jetzt Anfang März auf den Markt. Obwohl Charlotte taff war, wurde ihr Nervenkostüm nach Neujahr poröser. Gut, sie war sicherlich auch ausgelaugt von den Feiertagen und konnte die Anspannung nicht mehr von sich fernhalten. Schon seit der Eröffnung vor über acht Jahren wurde das Gourmetrestaurant, in dem Benjamin seit vier Jahren als Restaurantleiter und Sommelier arbeitete, für einen zweiten Stern gehandelt. Kurz vor der Bekanntgabe der Ergebnisse stieg die Spannung ins Unermessliche. Das bekamen in den letzten Wochen dann auch die Angestellten zu spüren. Seine Schwester steckte in jeden Soßentopf dreimal ihren Löffel und schnauzte Köche wegen Kleinigkeiten an. Eigentlich überhaupt nicht ihre Art. Gestern Abend war das Fass dann endgültig übergelaufen.
Arthur, der als Poissonnier arbeitete, also den Fischposten kochte, wurde gerüffelt, weil er angeblich die Gelbflossen-Makrele ein paar Sekunden zu spät nach vorn zum Anrichten gab. Der arme Kerl hatte in den Tagen zuvor ohnehin schon ständig die schlechte Laune der Küchendirektorin zu spüren bekommen, seit sie ihn dabei erwischt hatte, wie er im Kühlhaus eine Auszubildende bei einer Kaviarverkostung zu bezirzen versuchte. Er hatte sogar Blinis und Sauerrahm mitgenommen. Nur der Champagner fehlte. Wer so viel Risiko einging, der musste dumm oder schwer verliebt sein, dachte Benjamin, der erst am Abend danach von der Geschichte erfuhr und sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Als seine Schwester die Kühlhaustür aufzog, öffnete der junge Koch gerade eine Dose mit gereiftem Kaluga-Kaviar. Selten. Teuer. Was in den folgenden Minuten im Detail geschah, war Spekulation, aber die Herzen der Turteltauben dürften nicht mehr wegen alter Fischeier oder junger Liebe gepocht haben. Eine Woche lang war der Koch Prellbock gewesen, gestern hatte er dann offensichtlich genug von Strafe und öffentlicher Demütigung. Charlotte zischte ihn an, da zog er seine Schürze aus, warf sie der Küchendirektorin vor die Füße und legte sich mit verschränkten Armen vor dem Herd auf den Fußboden, sodass kein anderer Koch mehr an seine Seite des Küchenblocks herankam, vor allem nicht an die hinteren Herdplatten.
»Hast du einen Vollschaden«, bellte Charlotte, »steh gefälligst auf!«
»Erst, wenn Sie wieder lieb sind«, quietschte Arthur.
Die hektischen Bewegungen des Küchenteams erstarben. Alle blickten erschrocken zu Charlotte. Man konnte dabei zusehen, wie die Köche und Köchinnen blass wurden, als hätten sie einen kollektiven Blutsturz erlitten.
»Du …«, brüllte Benjamins Schwester, »steh auf! Los!«
»Nein.« Arthur drehte demonstrativ seinen Kopf weg. »Erst, wenn Sie wieder lieb sind.«
Benjamin blickte zu Charlotte. Ihr Gesicht und Hals waren rotfleckig, ein eindeutiges Warnsignal, unverzüglich in Deckung zu gehen. Ihre smaragdgrünen Augen lagen tief in den Höhlen, er konnte den blanken Zorn hinter ihren Schläfen pulsieren sehen. Der Sommelier fasste unter dem Küchenpass hindurch und schob die Fleischgabel aus ihrer Reichweite. Sicher war sicher. »Arthur!«, schrie sie.
Der Patissier René Claus kam aus seiner Konditorei. Horst Sammer, der stellvertretende Küchenchef, rüttelte apathisch am Griff einer leeren Pfanne.
»Du hörst jetzt mit dem Scheiß auf, zum Teufel! Die Muscheln brennen an, das höre ich schon am Geräusch! Steh auf, verdammt – aufstehen!«
»Ich stehe auf, wenn Sie wieder lieb sind.«
In diesem Augenblick kam auch noch Gustav Freling durch die Schiebetüren. Er war ihr beider Onkel, Patron und Hoteldirektor in Personalunion. Er bemerkte sofort, dass hier etwas Eigentümliches in Gang war, verstand nur nicht, was. Ein Küchenteam funktionierte zu den Servicezeiten schließlich wie eine Fußballmannschaft während eines Spiels. Oder ein Orchester während eines Konzerts. Wenn einer ausscherte, von dieser Choreografie abwich – ein böses Foul, eine gerissene Saite –, dann sah oder hörte man das sofort, auch ohne die Details zu erfassen. Der Hoteldirektor blickte umher, überhaupt blickten alle umher. Köche zu Köchen, Kellner zu Kellnern, Kellner zu Köchen. Es musste Pantomime sein. Erstes Semester, Schauspiel: Erstarrung in Tatenlosigkeit. Gustav wirkte völlig verunsichert, er schüttelte kurz seine Fönfrisur, rückte seine schwarz gerahmte Rundbrille zurecht und begann, nervös an seinem Einstecktuch zu nesteln. Eine fürchterliche Marotte, wie Benjamin fand. Erst dann sah er den Koch auf dem Boden liegen.
»Um Himmels willen!«, rief er. »Brauchen wir einen Arzt?«
»Ein Psychiater wäre gut«, blaffte Charlotte über den Küchenpass.
Arthur regte sich nicht, seine Miene verhärtete sich nur noch mehr.
Die Jakobsmuscheln brutzelten in der Pfanne.
Es zischte und dampfte.
Charlotte sprach in ruhigem, aber spitzem Ton, ihre Stimme zitterte. »Würdest du jetzt bitte aufstehen, Arthur, b-i-t-t-e.«
»Das war noch nicht lieb genug.«
Charlotte atmete tief ein, dann sah es der Sommelier in ihren Augen blitzen.
War das etwa ein Anflug von Humor?
Ein letztes Stückchen Grün auf der verbrannten Erde ihrer leistungsgetriebenen Seele?
Ihre Nasenflügel samt dünnem Silberring zuckten. Sie befeuchtete ihre Lippen, wischte sich eine Strähne ihres pechschwarzen langen Haars aus der Stirn und klemmte sie hinter ihrem Ohr fest – eine Bewegung, die Benjamin schon Tausende Male bei ihr gesehen hatte. Die Strähne blieb nämlich nur dort, bis sie sich über den nächsten Teller beugte. Also nicht lang.
»Lieber Arthur«, sagte sie schließlich ruhig und gelassen, »ich weiß, ich bin in den letzten Wochen sehr angespannt gewesen, und das ist eine Belastung für uns alle. Es tut mir leid! Würdest du jetzt trotzdem aufstehen, bitte?«
Arthur überlegte kurz. »Okay«, antwortete er, erhob sich und band sich wieder die Schürze um.
Er nahm die Jakobsmuscheln aus der Pfanne, er legte sie auf einen Teller mit Küchentuch, er gab sie Charlotte: Sie waren perfekt.
Nach dem Service, die ersten Köche begannen mit dem Aufräumen ihrer Posten, beschlossen Charlotte und Benjamin, dass ein spontaner Umtrunk dem Team guttäte. Bei diesem Druck, der sich in den letzten Wochen aufgebaut hatte, musste Dampf abgelassen werden. Der Sommelier gab eine Kiste Champagner und zwei Kisten Bier frei. Später noch mal zwei Kisten. Gegen halb eins verließ er das Hotel, aus dem Personalraum ertönte lautes Gelächter. Als er gegen halb neun morgens wieder im Hotel ankam, lagen zwei Köche und ein Kellner auf den Bänken und schliefen. In einem Aschenbecher qualmte noch eine Zigarette. Wie lange war Charlotte bei der Party gewesen? Benjamin wusste es nicht. Nach ihren Augenringen zu urteilen, länger, als es ihr mit ihren achtundvierzig Jahren noch gutgetan hätte. Spontanpartys am Anfang der Arbeitswoche waren ab einem gewissen Alter einfach keine gute Idee mehr, auch wenn sie dafür bekannt war, dass sie so manchen standhaften Koch unter den Tisch getrunken hatte. Schnaps um Schnaps. Bier um Bier. Bis ihr Gegenüber in Einzelteile zerfallen war.
Verkatert stand Charlotte nun also vor Benjamin. Im Hintergrund plätteten zwei Jungköche Kalbsschnitzel im Akkord. Metall klatschte auf rohes Fleisch. Sie blickte ihn zerknirscht an, musterte seine staubige Schürze. Erst langsam schien ihr klar zu werden, dass mit ihrem Halbbruder etwas nicht stimmte. »Du bist ganz schön blass, Benny.« Ihre Stimme klang belegt. Sie räusperte sich und fuhr fort: »Ich hatte heute Morgen schon zwei Krankmeldungen, muss wohl das letzte Bier schlecht gewesen sein – sag jetzt nicht, dass es dir auch nicht gut geht.«
Benjamin schüttelte den Kopf. »Mit mir ist alles okay«, sagte er.
»Gut, kannst du mir dann mal erklären, wieso wir über zweihundert Gäste im Haus haben, nur eine Handvoll Kinder dabei, aber heute Abend haben wir noch drei freie Tische im Gourmet? Das ist ja wohl ein Witz.« Sie hielt ihm ein Blatt entgegen, wahrscheinlich die Reservierungsliste. »In so einem Fall müssen wir eben massivere Werbung in den hausinternen Medien schalten, in der Morgenpost, den Hotelfernsehern oder …« Charlotte stockte. »Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung? Und warum bist du so verdreckt?«
»Ich habe Zuzanna gefunden«, entgegnete der Sommelier.
»Was ist los?«
»Zuzanna Bednarz. Ich habe gerade Zuzanna Bednarz gefunden.«
Zwei
Die letzte Nacht. Sie steckte Charlotte mehr in den Knochen, als Benjamin zunächst gedacht hätte: Seine Schwester übergab sich. Vor seine Füße. Kaum hatte er die Taschenlampe angeknipst und sie einen Blick in den Hohlraum geworfen. Dabei würgte Charlotte nicht einmal. Ihr fiel einfach eine Pfütze aus dem Gesicht. Der Sommelier war von der Reaktion seiner Schwester so überrascht, dass er erst realisierte, was passiert war, als es schon wieder vorbei war. Er ging auf Abstand. Doch Charlotte rannte unvermittelt los, ohne weitere Worte. Sie sprintete zur Seitentür hinaus, die zum Wirtschaftstrakt des Hotels führte, zu den Kühlhäusern und Magazinen, den Umkleiden oder der Kantine. Benjamin vermutete, dass die Toiletten ihr Ziel wären. Er blieb im Dämmerlicht des Weinkellers zurück. Hörte die Gäste und die brummende Klimaanlage. Alles wie gehabt. Der Sommelier knipste mehrmals die Taschenlampe an und wieder aus, überlegte, wie er die nächsten Minuten überbrücken sollte. Doch wider Erwarten stolperte seine Schwester auch schon wieder herein.
»Das ging ja schnell, was ist denn los?«, fragte Benjamin erstaunt, erst jetzt entdeckte er Eimer und Putzlappen in der Hand seiner Schwester.
»Willst du meiner Kotze etwa beim Trocknen zusehen?«, fragte Charlotte unwirsch und begann aufzuwischen.
»Nein«, antwortete Benjamin und ahnte, dass es ihr peinlich war. Sie gestand sich nur ungern Schwächen zu und mimte sogar vor ihm die autoritäre Küchenchefin.
Erst als sie Eimer und Lappen weggebracht hatte, schien sie bereit, sich der Situation anzunehmen. Eine Weile standen die Geschwister schweigend nebeneinander, als würden sie auf eine Regieanweisung warten. Es geschah nichts. Sie starrten auf die Kleinbaustelle neben dem leeren Riesling-Regal, das Benjamin abgeschraubt hatte, um an die dahinterliegende Wand zu kommen. Er hatte es vollständig ausgeräumt und zwischen zwei andere Regale geschoben. Hinter ihnen, auf der großen Holztafel, die das Zentrum des Weinkellers bildete und die Benjamin einmal in der Woche für Weinverkostungen oder Mitarbeiterschulungen nutzte, standen die gut fünfhundert Weinflaschen, aufgereiht wie beim Morgenappell. Fast synchron ließen die Geschwister sich auf zwei Stühle sinken und blickten auf das schwarze Loch in der Wand. Benjamin sah zu Charlotte, die unendlich müde zu sein schien. Als könnte sie seine Gedanken erraten, sagte sie: »Ich weiß gar nicht, wie du es immer schaffst, in dem Halbdunkel hier unten nicht einzuschlafen.«
»Achtzehn Grad und Riesling«, antwortete Benjamin und schmunzelte.
»Mir ist schlecht«, entgegnete Charlotte.
Der Weinkellner griff hinter sich, goss aus einer Karaffe ein Glas Wasser ein und reichte es ihr. »Wie lange warst du bei der Party?«
Auch wenn seine Schwester ihn gehört hatte, ignorierte sie seine Frage. Sie wiegte das Glas eine Weile in der Hand und betrachtete es missbilligend. »Ich dachte, du bist Wein- und kein Wassersommelier«, sagte sie schließlich.
»Es gibt nichts Dümmeres als diese Spezialisierungen«, entgegnete Benjamin lächelnd, als könnte etwas Fachsimpelei die bedrückende, geradezu düstere Atmosphäre aufhellen. »Diese Serie des Absurden setzt sich übrigens fort. Es gibt jetzt nicht nur Kaffee-, Tee-, Wasser-, Bier-, Käse- und Saftsommeliers, sondern, Trommelwirbel, ich habe gestern gelesen, dass es jetzt sogar eine Fortbildung zum Milchsommelier gibt. Hast du so etwas schon mal gehört? Von einem ordentlichen Sommelier kann man ja wohl erwarten, dass er sich mit dem gesamten Getränkeangebot auskennt und auch etwas über den Streuobstsaft aus Hintertupfingen zu erzählen weiß, aber anstatt die Themen dort zu vertiefen und zu verankern, wo sie hingehören, wird mit Pseudo-Spezialisierungen ein ganzes Berufsbild zerschlagen, da müsste man …«
Charlotte sah ihrem Bruder so lange in die Augen, bis er verstummte.
Sie klopfte mit dem Fingernagel ans Wasserglas.
Benjamin lachte bemüht, es half aber nichts, im Gegenteil.
Die düstere Atmosphäre wurde noch düsterer.
»Ich habe deinen Wink schon verstanden, Schwester. Wie lang warst du denn auf der Party, wenn du einen Konterdrink brauchst?«, fragte er, rutschte auf dem Stuhl nach rechts und bemerkte dann, dass sein Arm zu kurz war. Er stand auf, zog einen knochentrockenen Elsässer Gewürztraminer aus dem nächstgelegenen Regal. Wobei ihm der Wein weniger wichtig war als die Verpackung: Er hatte einen Schraubverschluss. Und vierzehn Volumenprozent Alkohol. Er drehte den Deckel ab und drückte Charlotte die Flasche in die Hand. Gläser kamen ihm in dieser Situation irgendwie unpassend vor. Die Sterneköchin kippte sich das Zeug nicht einfach hinunter, sondern schaute zuerst eine Weile auf das Etikett, bevor sie trank. Immerhin. Dann nahm Benjamin einen Schluck. So saßen sie nebeneinander. Eine ganze Weile. Betrachteten den Haufen Klinkersteine. Den Vorschlaghammer, das Loch in der Wand. Die Geschwister reichten sich die Flasche hin und her. Es war ja nicht so, dass Eile das oberste Gebot war, sie sofort den Rettungsdienst verständigen mussten, weil Erste Hilfe noch etwas gebracht hätte.
»Das Ding könnte dort seit Ewigkeiten liegen«, sagte Charlotte plötzlich und setzte die Flasche noch einmal an, »wieso soll das Zuzanna sein?«
»Weil vor zwanzig Jahren der Hohlraum noch ein Durchgang war – erinnerst du dich? Und Zuzanna damals einfach verschwunden ist«, antwortete Benjamin und zuckte mit den Schultern, als sei schon die Frage abwegig.
Zuzanna war eine langjährige Mitarbeiterin gewesen. Sie stammte ursprünglich aus Schlesien, war als junges Mädchen mit ihrer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee vertrieben worden. Das waren zumindest die Bruchstücke, die Benjamin zu wissen glaubte. Die Familie flüchtete an den Kaiserstuhl, weil irgendwelche Freunde oder Verwandten hier als Hilfskräfte bei der Weinlese gearbeitet hatten. So kam Zuzannas Mutter zu einer Anstellung in dem Familienhotel. Damals leiteten noch Benjamins Großeltern den Betrieb. Zuzanna wurde dann in den Sechzigern als junge Frau im Housekeeping engagiert, dreißig Jahre, bevor Benjamin geboren wurde. Irgendwann bekam sie die Verantwortung für den »Lakenkeller« – wie der Keller vor dem großen Umbau genannt wurde, manche der älteren Angestellten nannten ihn immer noch so – übertragen und war nur noch für die Hotelwäsche zuständig. Und weil man der Ansicht war, dass Zuzanna ein zähes Weibsbild sei und ihre Belastungsgrenze noch nicht ausgereizt wäre, wurde sie nach Benjamins Geburt zusätzlich als Kindermädchen beschäftigt.
»Es war eine harte Zeit, für alle«, sagte Charlotte seufzend.
»Das weiß ich, aber ich meine, also … Sie hat sich zehn Jahre um mich gekümmert, Charlotte, sie hat fast vierzig Jahre bei uns gearbeitet, und dann kommt sie nicht einmal zur Beerdigung von Mama und Papa? Verschwindet einfach von heute auf morgen? Ich konnte das nie glauben.«
»Hätte ich eine Wahl gehabt, dann wäre ich auch nicht zur Beerdigung gegangen«, erwiderte Charlotte und fuhr fort: »Wie auch immer, wir sollten jetzt erst einmal überlegen, wie die Sache hier weitergeht. Es hilft ja nichts, ich muss bald zurück in die Küche. Lass uns Gustav anrufen. Er soll runterkommen. Und Stephane soll mitkommen.« Sie machte eine Pause, nahm einen Schluck Wein und zog die Augenbrauen hoch. »Das gibt gleich ein schönes Theater, eieiei.«
»Mir tut sein armes Einstecktuch jetzt schon leid«, entgegnete Benjamin.
Charlotte lächelte entrückt.
Der Sommelier hörte die Stimmen bereits, bevor die Tür aufgezogen wurde. Dann kamen sie hereingerauscht, zwei stattliche Männer, voller Elan, beide über eins neunzig groß, nur Gustav vom zunehmenden Alter leicht gebückt. Beide, wie er selbst auch, mit prachtvollen Adlernasen versehen, die aus ihren Gesichtern wie Klippen im Meer hervorragten. Ihre Augen lagen weit auseinander. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Benjamin schaffte es gerade auf eins achtzig, wenn er aufrecht stand, Schuhe mit hohen Absätzen trug und gewinnbringend lächelte. Stephane war Benjamins Halbbruder, väterlicherseits, und stammte wie Charlotte aus der ersten Ehe seines Vaters. Er war im Haus für die gesamten Finanzen, die Buchhaltung und EDV zuständig. Benjamin mochte ihn, klar, er war sein Bruder, aber es wäre gelogen, wenn er behaupten würde, dass ein inniges Band zwischen ihnen existierte. Die Brüder trennten über zweiundzwanzig Jahre. Als Benjamin begann, sich für Mädchen zu interessieren, wurde Stephane gerade Vater. Einerseits. Andererseits war sein Bruder ein Pedant. Unfassbar penibel und akribisch. Er war auch kein geselliger Typ, kein Genussmensch. Er trank selten Wein, seine Welt waren die Zahlen und Statistiken. Benjamin hasste Zahlen und Statistiken und liebte Wein. Gegensätzlicher konnte man nicht sein.
Schon allein deswegen fühlte Benjamin sich seiner Schwester näher, wobei er auch an sie kaum Kindheitserinnerungen hatte. In seinen ersten Lebensjahren spielte Charlotte keine Rolle, sie hatte damals gerade ihre Kochausbildung beendet und war auf Wanderschaft durch Gourmetrestaurants in Deutschland und Frankreich. Sie stand bei Eric Menchon, Marc Haeberlin, Helmut Thieltges und kurz auch bei Marc Veyrat am Herd. Als Benjamin neun Jahre alt wurde, stieg Charlotte in den Familienbetrieb ein. Sie war damals siebenundzwanzig und sollte drei Jahre später den Küchendirektor beerben, der über dreißig Jahre in dem Hotel gearbeitet hatte. Wie eine Besessene begann sie, Pläne für die Umstrukturierung des Betriebs zu schmieden. Im Grunde hätte sie auf dem Mond arbeiten können, es hätte für Benjamin keinen Unterschied gemacht.
Als Gustav die Geschwister an der Tafel sitzen sah, unterbrach er den angeregten Dialog mit Stephane – sie waren in ihrem Element und diskutierten über die Umstellung auf ein neues Computersystem, das bessere Schnittstellen zwischen Controlling und Einkauf haben sollte – und klatschte aufmunternd in die Hände. »Also, warum ein so spontanes Stelldich…« Dann fiel sein Blick auf das Flaschenmeer, das Regal, das Loch in der Wand. »Was zum …«, entfuhr es ihm.
»Hast du deswegen die Baupläne gebraucht, Benny?«, fragte Stephane emotionslos.
»Herrschaftszeiten!«, zischte Gustav. »Benjamin! Immer deine Alleingänge! Was hast du dir dabei gedacht? Hast du heute Nachmittag nicht das Burgunder-Tasting?«
»Die Verkostung war gestern.«
»Darum geht es hier auch jetzt nicht, es …«, versuchte Charlotte einzulenken.
»Doch, doch, genau darum geht es hier«, unterbrach Gustav sie, seine Stimme schraubte sich nach oben, er konnte sich aus dem Stand in Rage reden, in seiner DNA fand sich das klassische Hoteliers-Gen des Temporär-Cholerikers. »Wozu halten wir denn einmal die Woche ein Führungskräftemeeting ab? Um genau solche Dinge anzusprechen! Ich kann die drei Regeln für einen reibungslosen Ablauf nur immer wieder herunterbeten: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation!«
Charlotte seufzte, stützte ihre Ellenbogen auf den Oberschenkeln ab und ließ den Kopf sinken.
Stephane trat näher und blickte in das dunkle Loch hinein, schien die Leiche aber nicht zu sehen. »Was soll das denn?«, fragte er und wandte sich seinem Bruder zu, der immer noch auf dem Stuhl saß.
»Ich wollte … ich will einen Raritätenkeller bauen«, antwortete Benjamin.
»Einen was?«, zischte Gustav, wedelte anklagend mit der Hand und betonte jede einzelne Silbe, »einen Ra-ri-tä-ten-kel-ler? Jetzt hast du dir schon dieses … dieses Reich hier unten gesichert – wie viele Quadratmeter sind das? Dreihundert? Und wie viele Flaschen lagerst du hier mittlerweile? Fünfzehntausend? Wie viele Positionen hat die Karte? Tausendfünfhundert? Mehr jedenfalls, als für unseren Umschlag nötig wäre, und dann musst du zusätzlich noch ein Loch in die Wand schlagen? Ist das wirklich dein Ernst?« Der Hoteldirektor verstummte kurz, war aber noch nicht ganz fertig mit seiner Schimpftirade und fügte hinzu: »Du lagerst die teuren Weine doch eh schon gesondert in den Regalen da vorn! Was willst du noch? In vierzig Jahren dem Adler Konkurrenz machen?«
Benjamin zeigte mit dem Daumen über seine Schulter, ohne sich umzudrehen. Er deutete zu den beiden kühlschrankgroßen Weinkäfigen, in denen wirklich ein Großteil der Raritäten lag. »Die Weinkäfige sind voll, und sie sind auch nicht ideal für die Raritäten. Und dort drüben liegt eine einzelne Flasche 1971er Scharzhofberger Auslese neben einem Dutzend Flaschen 2018er Kröver Nacktarsch«, erwiderte er trotzig. »Das ist, als würde die britische Königin bei ihren Soldaten in der Kaserne schlafen.«
»Das ist hoffentlich keine tragende Wand, hast du das wenigstens vorher mit Gunter geklärt?«, schnaubte Gustav wütend. Gunter war der Hausarchitekt.
»Das ist alles okay, das war mal der Durchgang zu den Trockenmagazinen.«
Gustav drehte sich orientierungslos im Kreis. »So etwas muss man doch absprechen!«, rief er.
»Gustav!«, brüllte Charlotte. »Es ist Bennys Weinkeller, er soll hier unten machen, was er will, okay? Sein Ding! Es geht jetzt auch nicht um das verdammte Loch in der Wand, sondern um das, was dahinter ist, kapiert?«
Gustav verstummte und begann, sein Einstecktuch zu malträtieren. »Wo dahinter?«
»Was ist denn dahinter?«, fragte Stephane, kniff die Augen zusammen, ging näher heran. »Heilige Scheiße!«
Stephane fuhr zusammen, machte einen Schritt rückwärts, schlitterte förmlich zurück. Benjamin, der ebenso wie Charlotte immer noch saß, die Glieder gelähmt von Leichenfunden und Gewürztraminer, erhob sich, atmete tief durch, knipste die Taschenlampe an und leuchtete in das Loch.
Gustav näherte sich von hinten. »Du lieber Himmel, ist das ein Tier oder ein …?«, fragte er.
»Was davon übrig ist«, knurrte Charlotte.
»Ist das echt, also, ist das auch keine Attrappe oder so?«, fragte Stephane. »Wer ist das?«
»Woher soll ich das wissen«, antwortete Benjamin und murmelte: »Zuzanna Bednarz.«
Stephane schien zu überlegen. »Die Wäschemamsell?«
»Nein, mein ehemaliges Kindermädchen«, fauchte der Sommelier.
»Zumauern«, sagte Stephane knapp, »einfach wieder zumauern.«
»Hast du sie noch alle?«, rief Benjamin, der nicht wusste, ob ihn mehr die Engstirnigkeit seines Bruders oder seine Kaltschnäuzigkeit irritierte.
»Weißt du eigentlich, was das für Schlagzeilen gibt?«, entfuhr es Stephane. »Das solltest du eigentlich am besten wissen, Benny.«
»Ist das jetzt wichtig? Da habe ich noch keinen Moment drüber nachgedacht.«
»Das bereitet mir ehrlich gesagt auch schon die ganze Zeit Kopfzerbrechen«, fiel Charlotte ihm in den Rücken. Sie begann, sich selbst den Nacken zu massieren, und seufzte. »Können wir nicht noch eine gute Woche die Füße still halten, bis der Michelin raus ist?« Sie zeigte auf das Loch in der Wand. »Auf die paar Tage kommt es doch nun auch nicht mehr an, oder?«
»Das Buch ist doch eh schon längst gedruckt, an den Wertungen für dieses Jahr wird sich nichts mehr ändern«, entgegnete Benjamin.
»Darum geht es nicht. Das überschattet alles. Wenn, dann will ich was über den zweiten Stern im Restaurant lesen und nicht über irgendwelche verdammten … Mumien im Weinkeller … Weißt du, wie lange ich … wir … Also, du weißt doch selbst, wie lange wir darauf hingearbeitet haben?«
»Sehe ich genauso«, stimmte Stephane zu. »Erinnert ihr euch an die Kaltabreise in der …«
»Stephane«, zischte Gustav plötzlich, der seit dem Blick durch das Loch keinen Ton gesagt hatte – er konnte den bitterbösen Begriff der Kaltabreise nicht ausstehen, den man in der Hotellerie gerne hinter verschlossenen Türen für einen Gast verwendete, der im Haus verstorben war.
»Gut, gut, dieser Opa eben, der vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt im Restaurant hatte. Erinnert ihr euch? Da war gerade ein Journalist über Nacht im Haus und hat die Sache durch den Dreck gezogen: zu lange Anfahrtswege der Ambulanz … unfähiges Hotelpersonal … unterlassene Hilfeleistung … die Belegungszahlen sanken in den Folgewochen um fast zehn Prozent.« Benjamins Halbbruder fügte zynisch hinzu: »Wir haben schließlich noch ein paar Kredite zu tilgen. So etwas wie das hier können wir nicht brauchen.«
Charlotte blickte Benjamin an. »Du wirst im Restaurant doch auch immer mal wieder auf die Kaltabreise angesprochen, oder?«, sagte sie beschwichtigend. »So etwas hängt einem ewig nach.«
»Willst du jetzt die Wand auch wieder zumauern oder was«, schnaubte Benjamin.
»Zumauern ist natürlich Blödsinn«, entgegnete Charlotte, »wir müssen nur zwei Wochen die Füße still halten. Mehr nicht.«
»Gerade war es noch eine gute Woche.«
»Ruhe«, entfuhr es Gustav. »Ruhe jetzt. Hört auf zu streiten. Wir werden die Sache unter keinen Umständen unter den Tisch kehren.« Er zog sein Mobiltelefon aus der Tasche und reichte es Benjamin. »Mach mir mal ein paar Fotos, bitte. Ich fahre gleich nach Breisach und kläre das weitere Vorgehen direkt mit der Polizei. Das ist der richtige Weg. Wir werden die Sache absolut diskret behandeln. Ich will mir die Pressemeldungen nicht vorstellen, wir sind hier ja kein Spukschloss. Und, Benjamin: Außer uns kommt hier niemand rein. Und nichts dringt nach außen, ist das klar?«
Benjamin blickte argwöhnisch zu Charlotte und Stephane.
Stephane blickte argwöhnisch zu Benjamin und Charlotte.
Charlotte blickte argwöhnisch zu Stephane und Benjamin.
»Ist das klar?«
Drei
Manchmal, wenn Benjamin Freling mit dem Auto aus Schelingen hinausfuhr und das Hotel seiner Familie oben auf dem Hügel sah, kam es ihm wie ein geflügeltes Schloss vor, ein pittoreskes Raumschiff, das am Kaiserstuhl notlanden musste. Nein. Er hatte keine blühende Fantasie. Es war das Ergebnis aus zwei Jahrhunderten eigenwilliger Baugeschichte, deutscher Bürokratie und unbändigen Modernisierungsdrucks. Benjamins Ururururopa Lothar wurde als fünftes Kind einer Försterfamilie geboren. Er stammte aus Bahlingen und wanderte als junger Bursche auf der Suche nach Arbeit ins Elsass aus. Das war im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts. Auf einem Gutshof bei Charmois-l’Orgueilleux bekam er eine Anstellung als Küchenjunge, stieg aber schnell zum Bratenkoch auf, dem Rôtisseur. Mit Wildfleisch kannte er sich schließlich aus. Er heiratete eine Französin, bekam vier Kinder, von denen zwei früh starben. Als infolge der Französischen Revolution das Gebiet an Frankreich angegliedert wurde, zog er mit seiner Familie zurück an den Kaiserstuhl. Mit offenen Armen wurden sie allerdings nicht empfangen. Lothar bekam die ehemalige Jagdhütte seines Vaters zugestanden, die einzige Gefälligkeit, die ihm sein ältester Bruder erwies.
Die Hütte war im Grunde nichts weiter als ein besserer Holzverschlag, der oben auf der Hügelkuppe am Waldrand lag, in der Nähe der Schelinger Höhe. Der Wind heulte unentwegt durch die Bretterwände. Im Gegensatz zu seiner Frau war Lothar jedoch erstaunlich guter Dinge, das ging zumindest aus vergilbten Handschriften hervor, die im Hotel ausgestellt wurden. Benjamins Großvater mochte den inneren Kaiserstuhl, die üppige Hügellandschaft, er liebte den Anblick der Rebenterrassen zu seinen Füßen. Die Vogesen stanzten ihre Umrisse in den Horizont, und manchmal, mittags, sah er den Rhein in der Sonne glitzern. Vielleicht ahnte er auch, dass die Passstraße nach Endingen bald mehr und mehr genutzt werden würde oder dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die ersten Luftschnapper und Sommerfrischler endgültig den Kaiserstuhl entdecken würden. Wie auch immer: Weil er nichts konnte außer kochen, erwarb er das Recht, warme Speisen zu verkaufen. Er riss die Jagdhütte ab, baute an die Stelle eine Gaststätte, die er im Jahr 1799 eröffnete. Beziehungsweise erst einmal eröffnete er eine Stätte, denn es kamen anfänglich keine Gäste – wer, um Himmels willen, sollte zu dieser Zeit die Mühe auf sich nehmen und zum Essen und Trinken auf einen Berg hinauflaufen?
Sein Urahn war aber ein sturer Hund. Und weil er aus irgendeinem Grund eine Leidenschaft für Giebel, Zinnen und Erker hatte, so schrieb es jedenfalls ein Historiker in einer Abhandlung über die touristische Entwicklung des Kaiserstuhls, baute er links an die Hausecke ein monumentales Türmchen. Mit seinen eigenen Händen. Er war also auch ein begabter Handwerker, wenngleich das Konstrukt am Ende viel zu hoch geriet. Es gab Gemälde davon. Das Haus sah aus, als hätte jemand einem Gebäude eine Lanze in die Hand gedrückt. Zu allem Überfluss ließ Lothar das Familienwappen auf eine Flagge sticken und platzierte einen Fahnenmast auf dem Spitzdach. Und siehe da. Wenn heute jemand Benjamin Freling etwas von Intuition erzählte, dann kam ihm immer zuerst sein Großvater Lothar in den Sinn. Nichts hatte sich nämlich nach dem Umbau verändert, der Weg aus dem Ort herauf war genauso lang und beschwerlich wie vorher, aber plötzlich kamen die Leute. Sie reihten sich nebeneinander an den Stammtisch. Wer gern aß und trank und etwas auf sich hielt – und das sind im Badischen bekanntlich nicht wenige Leute –, der kehrte ab sofort im Jagdhaus Freling ein, der Gaststätte mit Türmchen. Kann man sich nicht ausdenken.
Lothars Sohn baute das Ganze mit geradezu hingebungsvoller Leidenschaft und Traditionsbewusstsein im Sinne der Familienhistorie aus. Julien war – schon wegen seiner Mutter – äußerst frankophil und bereits als junger Mann die Loire hinabgefahren. Auf der Reise verlor er sein Herz an den Wein, die Frauen und die Schlösser. Als er zurückkam, waren es ihm nicht genug Türmchen am Jagdhaus. Infolge seines Innovationsdrangs wurde die Gaststätte großzügig unterkellert und außerdem um ein Stockwerk, zehn Fremdenzimmer und drei Türmchen erweitert, eines bekam sogar zusätzlich einen Erker. Julien zeugte zwei Söhne, nannte beide Burschen Ludwig und versah sie mit Nummern, was nicht mangelnder Kreativität, sondern einer ehrfürchtigen Reminiszenz an den französischen Sonnenkönig geschuldet war. Er starb mit neununddreißig Jahren. Der viele Wein.
Kurzzeitig übernahm dann Benjamins Ururoma die Führung. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – das Pingpongspiel mit dem Elsass setzte sich fort, es gehörte gerade wieder einmal zu Deutschland – wurde der größte Teil des bisherigen Betriebs zur Hotelhalle umfunktioniert. Mit Freitreppe auf eine Galerie. Fünfundvierzig Zimmer wurden neu gebaut, das Gebäude maß nun vier Stockwerke. Hinter dem Haus wurde eine Wassertretstelle nach Kneipp eingerichtet, der letzte Schrei in dieser Zeit. Es gab mittlerweile sechs Türmchen und zwölf Erker. Und die Gäste rissen sich um diese Turmzimmer. Es kam sogar allerhand Prominenz: In der Bibliothek des Hauses, in der historische Pläne, Dokumente und Presseartikel über das Hotel ausgestellt wurden und in der alle Details zur Geschichte nachzulesen waren, hingen Fotos von Albert Einstein, Richard Wagner und Heinz Rühmann. Oder von Thomas Mann in einem Liegestuhl auf der Terrasse, eine Decke auf den Beinen und darauf ein Notizbuch, und zwar – hört, hört! – aufgeschlagen und nicht zugeklappt.
Der Erste Weltkrieg zog am Fuße des Hotels vorbei, im Zweiten Weltkrieg wurde der Familie Freling Kollaboration mit den Nazis nachgesagt, was aber nicht stimmte. Man erduldete das Gesindel, das sich im Hotel einnistete, den Weinkeller leersoff und dabei über Endsiege schwadronierte. Was hätte man machen sollen? Alle waren glücklich, als die Schergen Hals über Kopf abreisten und sich stattdessen die Franzosen breitmachten, jedoch nicht allzu lange blieben. Der Wein war ja alle.
Benjamins Großeltern Heinz und Traudel verwalteten in den Folgejahren den Betrieb. Sie investierten viel, keine Frage, jedes Gästezimmer bekam eine Nasszelle, auch ein Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna ging auf sie zurück, aber erst ihr Sohn, Benjamins Vater Lothar, benannt nach dem Gründer des Luxushotels, legte mit seiner zweiten Frau, Benjamins Mutter Caroline, einen echten Meilenstein in der Geschichte des Hotels. Der Entschluss für eine große Umstrukturierung begann in ihm bereits Ende der Achtziger zu reifen, als der Großteil der Umgebung zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurde. Erst zur Jahrtausendwende wurde das Fachwerkschlösschen – womit das Hotel wirklich besser beschrieben war – komplett saniert und umgebaut, ein enormer bürokratischer Aufwand, denn Teile des Gebäudes standen unter Denkmalschutz. Begonnen wurde mit zwei Neubauten, zwei geschwungenen, gläsernen Hotelflügeln mit je vierzig Zimmern, die links und rechts vom Haupthaus abgingen. Erst als die ersten Gäste dort einquartiert werden konnten, wurde das denkmalgeschützte Haupthaus in Teilen geschlossen. Die Zimmer und Restaurants wurden modernisiert, eine Ladenpassage wurde gebaut, es kamen Frisör und Kosmetikstudio hinzu. Der Wellnessbereich wurde dramatisch erweitert. Der Waschkeller war damals schon als Weinkeller vorgesehen, die Planung oblag allerdings Benjamins Mutter, die ursprünglich von einer Kaiserstühler Winzerfamilie stammte und die im Hotel die Weinkarte verantwortete. Benjamin hatte sogar etwa fünfzig echte Juwelen im Keller liegen, die noch seine Mutter gekauft hatte: 1968er Marqués de Murrieta »Castillo Ygay Gran Reserva Especial Rioja«, 1971er Scharzhofberger Auslese von Egon Müller oder ein 1998er Riesling Smaragd Unendlich von F.X. Pichler.
Ja. Auch deswegen gefiel Benjamin der Gedanke eines Raritätenkellers.
Als seine Eltern starben, wurde das Bauvorhaben – wie auch der Außenpool oder das Gourmetrestaurant – vorerst auf Eis gelegt. Das Familienunglück war die offizielle Erklärung. Die inoffizielle Erklärung hatte auch mit einer Kostenexplosion zu tun. Erstaunlich fand Benjamin im Rückblick vielmehr, dass es bei den Bauarbeiten kaum Verzögerungen gegeben hatte. Abgesehen von der Restaurierung der Außenfassade blieben alle Gewerke im Zeitplan. Nach eineinhalb Jahren sah das neue Jagdhaus Freling wie ein geflügeltes Fachwerkschlösschen aus, ein pittoreskes Raumschiff. Es wurden Portiers eingestellt und in pinguingleiche Uniformen gesteckt. Mit weißen Handschuhen öffneten sie fortan die Beifahrertüren der Limousinen, die vorrollten. Es gab einen roten Teppich, Hauschampagner, Duftdesign. Volles Programm. Fünf Sterne hatte das Haus schon vorher, jetzt gönnte man sich den Zusatz Superior. Zum Untergeschoss, wo ehemals der Festsaal lag, gab es jetzt nur noch eine Feuerwehrzufahrt, die manchmal von Weinlieferanten genutzt wurde, aber im Grunde von dem täglichen Hotelbetrieb komplett abgenabelt war. Und exakt über diesen Weg wollte Gustav die Polizisten einschleusen, weswegen er Benjamin schon vor seiner Abfahrt anwies, nach dem Mittagsservice im Weinkeller auf ihn zu warten.
Es wurde Nachmittag, als Benjamin schließlich ein leises Klopfen wahrnahm. Er saß in seinem kleinen Büro im hinteren Teil des Weinkellers, einem Kabuff, das einmal eine Toilette gewesen war. Kloschüssel und Waschbecken kamen beim Umbau raus, ein Tisch und ein Stuhl rein, bitte schön: Büro. Benjamin war rastlos und fahrig. Er versuchte, sich auf einen Fachartikel über die Weinszene Israels zu konzentrieren, was ihm mehr schlecht als recht gelang. Er las ganze Absätze, aber merkte erst am Ende, dass er mit seinen Gedanken ganz woanders war, genauer: Obwohl er die Taschenlampe seit ihrer Besprechung nicht einmal mehr angefasst hatte, fand er sich selbst immer wieder sorgenschwindelnd in einem metergroßen Loch in der Wand stecken, zehn Meter weiter. Er bekam das Bild einfach nicht aus dem Kopf – die Gliedmaßen, die Zähne, die Haut –, und dabei war es ja im Grunde ein Bild, das er schon unzählige Male gesehen hatte, in Filmen, in Büchern, wahrscheinlich auch in allerhand Vitrinen in Museen und in dieser Ecke des Landes sicher auch als Faschingskostüm.
Er ließ trotzdem die Taschenlampe aus, wollte sein Seelenleben nicht weiter auf die Probe stellen. Er beschrieb sogar einen kleinen Bogen um das Loch in der Wand. Er suchte Zerstreuung, sortierte Flaschen, scrollte minutenlang durch die stumpfen Neuigkeiten seiner Facebook-Chronik oder nahm sich eben einen Fachartikel über die israelische Weinszene zur Brust. Er las über das Karmelgebirge, die Negevwüste und die Golanhöhen. Orte, an denen er tausendmal lieber gewesen wäre als in seinem heiligen Weinkeller. Da spitzte er die Ohren. War da ein Geräusch gewesen? Er hielt den Atem an, dann wiederholte sich das Klopfen, es war nicht mehr als eine zarte Schwingung, als würde jemand ganz sachte mit seinen Fingerkuppen einen Trommelwirbel auf den Glastüren im Eingangsbereich vollführen. Der Sommelier ging nach vorn, sein Herz pochte, er dachte sich schon eine Ausrede aus, falls Gäste kurzfristig den Keller besichtigen wollten, aber es war sein Onkel in Begleitung zweier Personen. Mann. Frau. Wenn es Polizisten waren, dann trugen sie Zivil.
Der Mann wirkte auf den ersten Blick unscheinbar, bei jeder Gegenüberstellung hätte Benjamin durch ihn hindurchgesehen. Er schien vorzeitig ergraut, hatte seine weißen Haare zu einem Seitenscheitel gekämmt. In seine Stirn hatten sich vier senkrechte Falten eingegraben. Er stellte sich als Jochen Ehrlacher vor. Benjamin schätzte ihn auf Mitte vierzig. Er trug Jeans, Rollkragenpullover, Anorak, Trekkingschuhe, hatte blaue Augen, war sauber rasiert. Man hätte den Mann mit einem Fahrkartenknipser in einen Zug stellen, ihn mit Arbeitskittel an eine Supermarktkasse oder mit Maßanzug an den Vorstandstisch einer Bank setzen können, alles hätte zu ihm gepasst. Zumindest von den Äußerlichkeiten, denn kaum hatte die Gruppe die Begrüßung hinter sich gebracht – die beiden waren von der Kriminalpolizei Freiburg – und sich in den Schutz der Weinregale zurückgezogen, taxierte der Ermittler den Raum. Besonders genau musterte er Benjamin, betrachtete sogar etwas abfällig seinen Anstecker der Sommelier-Union, eine silberne Weintraube, die er stets am Revers trug – war dem Mann hier alles zu etepetete? Oder lag es an Benjamins Dienstkleidung? Dem Anzug? Der Sommelier fühlte sich sichtlich unwohl unter der Bemusterung des Polizisten, dessen gesamte Art pure Ablehnung signalisierte – oder handelte es sich bei der ganzen Sache um ein Good Cop, Bad Cop-Spielchen?
Seine Kollegin, Luzie Berger, empfand Benjamin nämlich als ungemein sympathisch. Ihre Augen waren hellbraun, hatten die Farbe von Haselnüssen, Herbstlaub, trockener Erde. Ihre dunkelblonden lockigen Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie hatte Eleganz und Schmiss, beides zugleich, wie der Sommelier fand. Allein wie sie sich kurz durch das Loch in der Wand beugte, ihren Unterarm dabei an die Kante lehnte, wahrscheinlich, um keine Spuren zu hinterlassen, und dabei die Taschenlampe mit dem Leuchtkörper am Handballen hielt, erregte seine Aufmerksamkeit. Sie war einsilbig, verlor außer der Begrüßung kein Wort, aber sie hatte ein hellwaches Funkeln in den Augen. Außerdem nahm sie, als Benjamin und Gustav mit Jochen Ehrlacher sprachen, kurz die Rieslinge auf der Tafel unter die Lupe. Der Weinkellner beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Und er konnte es nicht beschwören, aber er hatte das Gefühl, dass sie bei den rund dreißig Positionen besonders bei den spannenden Tropfen – Rangen de Thann Grand Cru von Zind-Humbrecht, Forster Kirchenstück von Bürklin-Wolf oder auch Berg Schlossberg von Breuer – länger verharrte als bei den anderen Weinen.
Ehrlacher begutachtete Loch und Leiche nach ihr, hielt allerdings wesentlich mehr Abstand als sie. Er ging mit der Taschenlampe nur knapp einen Meter heran, stellte sich auf die Zehenspitzen. Dann sprach er mit seiner Kollegin, verstehen konnte Benjamin jedoch nichts. Gustav und er warteten etwas abseits, sie waren in diesem Moment nur zwei belanglose Statisten in der Drehpause. Benjamin spitzte neugierig die Ohren, hielt sogar den Atem an. Zweimal glaubte er, das Wort Umbau zu hören. Luzie Berger lauschte ihrem Kollegen. Sie schaute zum Loch. Überlegte. Ehrlacher redete unentwegt. Sie warf einen Blick in den weitläufigen Keller. Nickte.
»Was war der Grund für Ihren Durchbruch?«, fragte Ehrlacher, als er zu ihnen zurückkam.
»Eine Erweiterung«, entgegnete der Sommelier knapp.
»Er wollte einen Raritätenkeller bauen«, sagte Gustav und fügte belehrend hinzu: »Wissen Sie, so nennt man einen abgetrennten Bereich für die besonders guten Weine.«
»Ach«, entgegnete Ehrlacher leicht spöttisch.
Benjamin konnte es ihm nach dieser unnötigen Belehrung nicht verübeln. Der Beamte sah sich kurz im Weinkeller um. »Von was für einem Wert sprechen wir hier?«
Gustav streckte enthusiastisch sein Rückgrat durch, seine Schultern hoben sich, er legte seine Handflächen ineinander. Jetzt war er in seinem Element. Er ging ans Bordeauxregal. Das tat er auch stets als Erstes, wenn er Stammgäste herunterführte. Benjamin hasste es. Willkürlich holte er bei seinen Hausführungen die Weine aus den Fächern. Wenn er die Burgunder in den Weinkäfigen befingerte, bekam der Sommelier bisweilen sogar Herzrasen – korrekt, auch das war ein Grund für den Bau seines Raritätenkellers. Und Gustav würde keinen Schlüssel dazu bekommen, das war Benjamins insgeheimer Plan. Wie immer zog der Hoteldirektor auch dieses Mal den 1961er Cheval Blanc aus dem Regal. Und wie immer erkundigte er sich bei seinem Neffen nach dem Preis. Obwohl er ihn genau kannte.