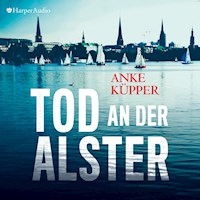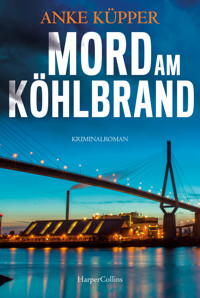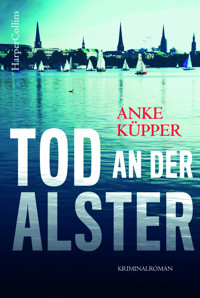10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord unterm Mistelzweig
Mörderische Weihnacht überall,
Kein Retter hier, reinste Qual.
Hört das Flüstern der Nacht,
Der Mörder hat’s vollbracht.
Roter Schnee auf weißem Land,
Tödliche Hände, die ergreifen die Wand.
Geschenke verpackt, doch keine Freude,
Nur Schrecken und Angst und kein Zeuge.
Mit dieser neuen Anthologie wird den Krimi-Fans auch diesen Advent nicht langweilig. Mit packenden, furchteinflößenden und nervenaufreibenden Geschichten verkürzen uns Autorinnen und Autoren wie Franziska Henze, Anke Küpper, Henrik Siebold, Ben Westphal und viele mehr die Weihnachtszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgegeben von Kathrin Hanke und Franziska Henze
Mörderische Weihnacht überall
24 kurze Krimis für eine spannende Weihnachtszeit
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur gsk GmbH, Reinbek
Coverabbildung von Hafen Werbeagentur
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749909537
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Liebe Leserinnen und Leser,
der geschmückte Tannenbaum wartet, die Plätzchen duften, und die Kinderaugen leuchten. Weihnachten ist das Fest der Feste. Doch hinter flackerndem Kerzenschein und glänzenden Christbaumkugeln verstecken sich oft Enttäuschung, Eifersucht und so manches Verbrechen.
Auch in diesem Jahr haben 24 Krimiautorinnen und -autoren spannende Weihnachtskrimis für Sie geschrieben. Es sind Geschichten, in denen Hoffnungen zerbrechen, dunkle Geheimnisse ans Licht kommen – und zuweilen nicht nur die Glocken, sondern auch die Handschellen klingen.
Ich wünsche Ihnen mörderisch spannende Weihnachten – überall.
Ihre Franziska Henze
Für Kathrin
1. Insel der Träume
Fynn Jacob
Es ist unwirklich, nur du und ich allein in der kleinen, einsamen Hütte. Draußen im Dämmerlicht leuchtet eine dünne Schicht frischen Schnees vor den bodentiefen Fenstern. Der Kachelofen strahlt wohlige Wärme in den einzigen Raum aus, neben der Küchenzeile steht der von dir frisch geschlagene, ungeschmückte Weihnachtsbaum. Ich rieche Tannenduft. Auf dem großen Holztisch erinnern die leere Weinflasche und die beiden halb vollen Weingläser an den gestrigen Abend, über der Rückenlehne eines Stuhls hängt, leicht windschief, mein neuer Wollpulli. Noch immer liege ich in deinem Arm, in dem ich zufrieden und erschöpft eingeschlafen bin, meine Hand auf deinem mächtigen Brustkorb, der sich im langsamen Rhythmus hebt und senkt, die Bettdecke über uns. Mein kleines Glück, unverhofft, so schön.
Und ich habe Angst.
»Sie muss sterben.« Du redest im Schlaf. Du wirfst den Kopf hin und her, deine Augen sind geschlossen, aber deine Lippen sind unentwegt in Bewegung, mit fiebriger Geschwindigkeit, leise, fast flüsternd, und mit unbarmherziger Bestimmtheit. »Ich muss es tun. Ich muss sie töten.« Immer wieder.
Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, dich einfach beobachtet. Ich gebe zu, ich fand es sogar ein bisschen amüsant, einen zwei Meter großen Modellathleten zu sehen, der sich wie ein Baby wälzt, weil er von Albträumen geplagt wird. Ich habe kurz überlegt, mich vorsichtig aus deinem Arm zu winden, um das hier ansonsten nutzlose Handy aus meiner Handtasche auf der Kommode neben der Garderobe zu holen, ein Video von dir aufzunehmen und dich morgen damit ein wenig aufzuziehen. Doch das wäre irgendwie mies gewesen, also bin ich liegen geblieben. Ich wollte dich gerade aufwecken, um dich aus deinen Qualen zu erlösen, da sagtest du wieder etwas. Du hattest dich weggedreht, sodass ich deine Worte und ihre Bedeutung erst nach und nach verstand.
»Es tut mir leid. Maria! Es tut mir leid.«
Ich spüre noch immer, wie das Frösteln meine Wirbelsäule entlangwanderte. Wie ich in der Bewegung erstarrte, den Atem anhielt. Maria. Dieser Name hat alles verändert.
Ich kenne nur eine Maria, und ich weiß, du kennst sie auch. Maria studierte wie ich Biologie, und wie ich hing sie einige Semester hinterher. Braunes Haar und Haarnadeln in genau derselben Farbe. Sie und ich waren nicht unbedingt befreundet, aber wir besuchten abends die gleichen Clubs und gelegentlich auch dieselben Partys. So wie auch letztes Jahr im November, als ich zusammen mit ihr unterwegs war und wir dich kennenlernten. Ich habe dich angesprochen, und sie hat sich zu uns gesellt. Um ehrlich zu sein, hast du dich danach ziemlich schnell nur noch für sie interessiert und sie sich offensichtlich für dich. Später habe ich euch aus den Augen verloren wegen irgendeines Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Zu lange her, ein anderes Leben. Als ich Ende September von meiner Auszeit wieder zurückkam, war Maria nicht mehr da. Nicht auf den Partys, nicht in den Clubs, nicht im Hörsaal. Irgendwann schnappte ich auf, dass sie schon seit Längerem verschwunden war, niemand wusste etwas Genaueres.
Und jetzt das. Hier, mitten in der Einsamkeit dieser Insel irgendwo im südschwedischen Schärengarten. Ihr Name. Maria. Aus deinem Mund.
Langsam, Atemzug für Atemzug, dränge ich die Angst zurück. Keine voreiligen Schlüsse, es gibt für alles eine rationale Erklärung. Du bist der netteste und höflichste Mensch, dem ich je begegnet bin. Mit deinem neckischen Grinsen und den hellblauen Augen, die nicht falsch sein können. Es dauert ein paar Minuten, bis ich mich wieder beruhigt habe. Der Schreck geht langsam, aber er geht. Ich habe einfach nur überreagiert. Ganz bestimmt.
*
Erst gegen zehn Uhr hat sich der Morgennebel verzogen. Es ist zwei Tage vor Heiligabend, die Sonne, die nun auch über die Wipfel der Tannen in der Nähe des Ufers linst, hat sich endlich durchgesetzt und den Schnee der Nacht geschmolzen. Nur noch wenige Wolkenreste ziehen Richtung Norden. Die Welt lacht uns an, das Dunkel der Nacht ist verschwunden. Ich kenne meine Diagnose, die Ärzte haben mir gesagt, dass diese Träume wieder auftreten können. Und ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Außerdem haben wir gestern so einige Flaschen Wein geleert.
»Besser als Kaffee, oder? Selbst gemachter Tee, von dem, was uns die Natur hier schenkt. Weckt die Lebensgeister.« Ich nicke, du schenkst mir nach. Zum Frühstück gibt es Schwarzbrot mit gesalzener Butter, dazu Räucherlachs. Es schmeckt großartig. Der Kater lässt nach, und du gerätst ins Plaudern. Im Winter hierherzukommen ist deine Weihnachtstradition. Du erzählst, dass deine Großeltern dieses Häuschen gebaut haben und dass ihr früher mit der Familie immer die Sommerferien hier verbracht habt. Urlaub ohne Handyempfang. Schwimmen, Kanu fahren, Lagerfeuer machen. Es klingt wildromantisch.
»Mein Bruder und ich haben oft im Schlafsack draußen übernachtet. Je länger du nach oben schaust, desto mehr Sterne entdeckst du. Richtig dunkel wird es dann eigentlich gar nicht mehr.«
Ich mag deinen Akzent, der noch immer etwas hölzern klingt. Ich mag dich. Deine Haare sind verwuschelt, man sieht dir an, dass du gerade erst aus dem Bett aufgestanden bist. Es steht dir. Ich weiß, dass ich verknallt bin.
Du schlägst einen Ausflug vor. Deswegen seien wir schließlich hier, wegen der Natur. Wir gehen vor die Tür, du schließt nicht ab, niemand außer uns ist hier. Ich staune über die intensiven Farben. Am Steg schaukelt auf dem glitzernden Wasser dein offenes Motorboot, die Plane, die du gestern über den Steuerstand gezogen hast, glänzt noch feucht. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding fährt, geschweige denn von den Gewässern dieser Gegend. Du hast auf der Überfahrt die tückischen Felsen knapp unter der Wasseroberfläche erwähnt, die für Ortsfremde nur schwer zu erkennen sind. Der Kiesweg hinunter zur Anlegestelle führt über eine sattgrüne Wildwiese, die zum Ufer hin in Fels übergeht.
»Ich zeige dir die ganze Insel. Dauert auch nicht lange.«
Wir gehen dicht am Ufer entlang, über Gras und Felsen. Links, zum Inselinneren hin, wächst wildes Gestrüpp, zwischen Hagebuttensträuchern und Farnen erkenne ich Brennnessel, Barbarakraut, Giersch und andere Wildkräuter, dahinter erheben sich flache Nadelhölzer und ein paar Birken. Ich greife nach deiner Hand, es passiert einfach so, du lächelst mich an. Einen Augenblick lang befürchte ich, rot zu werden, deshalb wende ich den Blick nach rechts in Richtung Meer. Die nächsten beiden Inseln sind nur wenige Hundert Meter entfernt. Auf einer steht ein Haus, im gleichen leuchtenden Rot gestrichen wie das deiner Familie, aber aus dem Schornstein steigt kein Rauch auf. Schweigend gehen wir weiter. Es dauert nur zehn Minuten, dann haben wir die kleine Insel fast umrundet.
»Jetzt kommt mein Lieblingsplatz. Pass auf!«
Wir erklimmen einen letzten Felsen, auf dem malerisch eine kleine Tanne sitzt, dann öffnet sich vor dem nächsten Felsen eine winzige flache Bucht, nur wenige Meter breit.
»Und?«
»Na ja, ganz nett«, versuche ich ihn aufzuziehen. »Wenn jetzt hier noch Sandstrand wäre …«
»Das wirst du noch büßen.« Es soll scherzhaft klingen, aber mir entgeht die darunterliegende echte Enttäuschung nicht.
Wir steigen hinab, ein breiter Stein dient uns als Sitzgelegenheit. Vor uns blaues Wasser wie aus der Werbung, natürlich zieht ein Schwarm Möwen seine Kreise, ab und zu stürzt sich eine von ihnen ins Meer. Zu schön, um wahr zu sein. Auch du schaust ihnen nach.
»Eigentlich seltsam. Menschen lieben Möwen, dabei sind sie äußerst hinterhältige Jäger. Sie können nichts dafür, es liegt nun einmal in ihrer Natur. Sie folgen nur ihrem Instinkt, wie alle Raubtiere.« Du grinst mich an. »Sie bringen den Tod.« Es soll wohl lustig klingen.
Ich erinnere mich an den frühen Morgen. Darauf muss ich dich doch ansprechen, entscheide ich und atme einmal tief durch. »Du, kann ich dich mal was fragen?«
»Klar, was immer du willst.«
Ich suche nach einem Anfang. »Als wir uns kennengelernt haben, du und ich und Maria … Wie ist es eigentlich mit euch weitergegangen? Hast du noch Kontakt zu ihr?«
Es kommt mir vor, als ob ein Schatten über dein Gesicht huscht. Vielleicht ist es der von einer der über uns hinwegfliegenden Möwen.
»Da war nichts«, sagst du. »Nur eine Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen.« Dein Mundwinkel zuckt.
Ich höre förmlich die Lüge heraus. Bitter schlucke ich weitere Fragen mit einem Lächeln herunter.
Wir gehen wieder zur Hütte. Auf der Rückseite erstreckt sich eine freie Fläche bis zum Waldrand, die Bäume werfen noch immer lange Schatten, deshalb ist der Schnee hier noch nicht geschmolzen. Trotzdem kann man noch gut erkennen, dass hier früher ein Nutzgarten war, du erzählst, dass deine Oma ihn damals angelegt hat. Die mit Natursteinen eingefassten Beete sind inzwischen größtenteils überwuchert, dünnes Gras und Pflanzen, die ich nicht kenne, ragen aus den Schneeresten empor. Einige kahle Stängel erinnern mich an die Schwarze Tollkirsche. Ob du weißt, dass sie hochgiftig ist? Schon kleinste Mengen können Halluzinationen auslösen, höhere Dosen zu Lähmung und schließlich zum Tod führen. Wenn jetzt Sommer wäre und ich die Früchte sehen könnte, wäre ich mir sicher.
Ein längliches Beet fällt mir auf, rechteckig, knapp zwei Meter lang, auf dem sich weiße Christrosen gehalten haben. Ein schöner, friedlicher Ort. Ich schüttle den Kopf, um die Assoziationen zu vertreiben. Du gehst weiter zu einer Metalltonne, schöpfst klares Wasser, für den Tee. Kaminholz ist neben einem Grill unter einem schmalen Dach gegen die Hüttenwand gestapelt. Ich freue mich schon darauf, es mir wieder mit dir vor dem Kamin gemütlich zu machen.
*
»Es liegt in meiner Natur.«
Wieder schrecke ich mitten in der Nacht hoch. Deine Augen sind geschlossen. Ich überlege, dich zu wecken, damit dieser Albtraum endet, aber mein Argwohn gewinnt. Vielleicht sagst du noch mehr. Etwas anderes als gestern, etwas, das meine Fantasie wieder einfängt. Mein Herz rast. Du flüsterst etwas, ich verstehe deine Worte nicht. Vorsichtig drehe ich mich zu dir um, warte darauf, dass du wieder etwas sagst.
»Ich muss sie töten.« Leise, aber eindringlich. »Deswegen habe ich sie doch hergebracht.«
Den Rest der Nacht kriege ich kaum ein Auge zu.
*
Irgendwann muss ich dann doch eingeschlafen sein, jedenfalls wache ich auf, als etwas Nasses über meinen Hals kratzt. Mit einem unterdrückten Schrei schnelle ich hoch. Ich schaue in dein irritiertes Gesicht, sehe deinen Dreitagebart, deine noch leicht zu einem Kuss geformten Lippen.
»Keine gute Idee?«, fragst du und wirkst dabei ehrlich bestürzt. Ich muss grinsen. Die verschwommenen Erinnerungen an die Nacht kommen mir absurd vor. Ich habe eindeutig zu viele schlechte Romane gelesen.
Jetzt ist es hell, wir haben wieder ein fantastisches Frühstück, und ich liebe es, dich ganz für mich zu haben. Du bist ein wirklich aufmerksamer Zuhörer und ein mitreißender Erzähler, mit Augen, in denen ich mich verlieren kann, und nicht zuletzt ein leidenschaftlicher Liebhaber.
»Was ist los?« Ich wollte mich gerade wieder an dich kuscheln, da stehst du auf.
»Hast du Lust auf frische Luft?«
»Was hast du vor?«
Ob ich vielleicht angeln gehen möchte? Nein, ich lehne ab, ich verspüre nicht die geringste Lust, länger als notwendig ungeschützt im kalten Wind zu hocken. Deshalb bin ich nicht hier. Wie hattest du es formuliert? Ein paar Tage nur wir und die Natur und unsere geheimsten Fantasien. Aber ich will nicht zu schroff klingen. »Geh ruhig, wenn du magst.«
»Okay.« Du überlegst kurz, nickst dann wie zur Bestätigung. »Dann bis nachher.« Du schnappst dir einen Klappstuhl, eine Decke, die viel zu futuristisch anmutende Angelrute und einen Korb mit Zubehör und gehst hinunter zum Steg, lässt mich tatsächlich einfach sitzen.
Ich schaue dir nach. Gut, dann ist es halt so. Ich bleibe im Warmen. Ziehe mein Buch unter den Kissen hervor. Ein älteres von Mankell, eine Kommilitonin hatte es mir empfohlen, es spielt nicht weit weg von hier. Nach ein paar Zeilen breche ich ab. Mir ist einfach nicht nach Lesen.
Mein Blick schweift durch die Hütte. Keine Fotos, keine Bilder der Familie. Dabei ist das doch das Ferienhaus deiner Eltern? Ich denke an Mama und Papa. Wie wir früher Weihnachten verbracht haben, zusammen mit Onkeln und Tanten, Omas und Opas, mit Cousins und Cousinen, gemeinsamer Kirchgang. Erinnere mich an die gespannte Erwartung in Kindertagen und an Berge von Geschenken unter dem Baum. Jahr für Jahr.
Nicht in diesem Jahr. Morgen Abend wird der Platz unter der kleinen Tanne leer sein. Ich hatte keine Zeit mehr, ein Geschenk für dich zu besorgen, jedenfalls nicht, ohne dass du es gemerkt hättest. Du hattest mich gefragt, ob ich mit dir mitkommen wolle, und ich hatte sofort zugesagt. Für fast nichts war mehr Zeit gewesen, zu schnell musste alles gehen. Meine Eltern wissen gar nicht, dass ich hier bin. Niemand weiß, dass ich hier bin. Meine Therapeutin hatte mich noch gewarnt, ich solle nichts Unüberlegtes tun. Ich bekomme einen trockenen Hals.
Auf dem Tisch steht die Thermoskanne, ich fülle meine Tasse bis zum Rand, trinke einen Schluck, der Tee ist noch warm. Ich wärme mir die Hände daran. Ich gehe zum Fenster, beobachte dich. Die Kälte scheint dir nichts auszumachen, du wirkst entspannt. Sitzt dort unbewegt am Steg, die Angelrute neben dir aufgebaut, den Blick aufs Meer gerichtet. Deine dicke Jacke lässt dich noch mächtiger erscheinen. Das hier ist deine Insel. Deine Hütte. Dein Reich. Mein Blick schweift ab, zum Waldrand. Ein Schatten fällt mir auf. Eine Gestalt? Ich meine einen Menschen zu erkennen, der mir zuwinkt. Maria? Vor Schreck stockt mir der Atem. Im nächsten Moment jagt ein Windstoß durch die Bäume und Sträucher. Nein, nur ein Schatten, nichts weiter. Natürlich. Ich atme wieder aus.
Der Tee hinterlässt ein pelziges Gefühl im Mund. Mir ist nach einem Glas Wein, du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich mich bediene. Ich gehe zum Weinregal, auf der Flasche, die ich auswähle, liegt Staub, dem Etikett nach ist sie vom vorletzten Jahr. Nacheinander ziehe ich die Schubladen in der Küche auf, bis ich den Korkenzieher finde. Als ich nach ihm greife, streifen meine seltsam tauben Finger ein dünnes Stück Metall. Ich hebe es hoch. Mein Herz schlägt schneller, als ich erkenne, was es ist. Eine Haarnadel. Eine dunkelbraune Haarnadel, wie Maria sie stets getragen hat. Mit einem spitzen Schrei lasse ich sie fallen, als wäre sie glühend heiß geworden. Aus der anderen Hand entgleitet mir die Weinflasche, ich realisiere es viel zu spät, greife vergeblich nach ihr, sie fällt auf den Boden, zerspringt mit einem unheilvollen Klirren. Scherben verteilen sich im Raum, der Wein bildet eine schnell größer werdende Lache, sickert in die Dielenbretter.
Ich fluche, dann mache ich mich daran, die Sauerei zu beseitigen. Die halbe Küchenrolle muss dran glauben. Fieberhaft versuche ich nachzudenken, aber ich schaffe es nicht, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Beruhige dich endlich, rede ich mir selbst zu. Es gibt für alles eine normale Erklärung, hör auf, irgendwelche Geister zu sehen. Ein stechender Schmerz im Zeigefinger holt mich in die Realität zurück. Blut quillt aus einem kleinen Schnitt, eine Scherbe, natürlich. Seufzend drücke ich Papier dagegen. Was ist nur mit mir los?
Als du später, nach gefühlten Stunden, endlich wieder hereinkommst, einen weißen Plastikeimer in der linken Hand, in der ein einsamer Fisch schwimmt, zeige ich dir den roten Fleck in der Küche. »Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte«, versuche ich mich an einer Entschuldigung.
»Zeig mal!« Du greifst nach meiner Hand, faltest sie auf. Nimmst den Zeigefinger, führst ihn zum Mund, ein zarter Kuss, ein warmes Lächeln. Albern, aber irgendwie auch süß. »Tut es noch weh?«
Ich weiß nicht, wie mir zumute ist. Mein Herz pocht unnatürlich laut, ich frage mich, ob du es hören kannst. Sekunden vergehen. Dann spiegele ich dein Lächeln, ohne es zu wollen. »Ist schon besser, glaube ich.«
»Gut.« Du lässt meine Hand los. »Ich bereite mal die Meerforelle für unser Abendessen vor.« Noch immer schwimmt der Fisch in seinem Eimer, zieht seine Kreise in dem kleinen Gefängnis, aus dem er nicht mehr lebend entkommen wird. Hofft er noch, oder hat er bereits begriffen, dass sein Schicksal schon besiegelt, dass er eigentlich so gut wie tot ist? Dass der Angler eigentlich nur noch mit ihm spielt? Warum machst du das? Du hättest ihn auch schon unten am Steg töten können.
Du leerst den Eimer ins Spülbecken. Hilflos hüpft der Fisch darin herum, du stehst davor und schaust zu, dein Blick verfolgt jede Bewegung. Du genießt seinen Todeskampf, das kann ich deutlich erkennen. Ich will etwas sagen, aber meine Kehle ist schon wieder trocken, ich bekomme keinen Ton heraus. Die Sprünge in dem Becken werden kleiner, schwächer. Du packst endlich zu und drückst den Fisch zu Boden. Nimmst ein massives Rundholz, ein einziger dumpfer Schlag auf den Kopf genügt. Erst dann holst du ein langes Filetiermesser aus der Schublade heraus, in der ich auch die Haarnadel gefunden habe, und schneidest der Meeresforelle die Kehle durch. Es war ein langes, qualvolles Sterben.
Ich frage mich, warum ich dir dabei zugesehen habe. Dann verstehe ich es. Es ist das Töten. Es fasziniert dich. Das kann ich auf eine mir selbst unheimliche Art sogar nachvollziehen. Es kitzelt etwas Archaisches in uns Menschen hervor, dem wir uns nicht entziehen können.
Du fängst an, den Fisch auszunehmen. Deine Handgriffe sind routiniert, du arbeitest schnell und sicher. Auf eine seltsame Weise bin ich froh, als du das Messer beiseitelegst und dich an die Zubereitung machst. Du bedienst dich aus dem gut gefüllten Kräuterregal, ich erkenne Koriander, Thymian, Schnittlauch, Knoblauch, Basilikum, dazu ein, zwei Wildkräuter, die mir unbekannt sind. Du weißt, was du tust. Du kennst dich aus, liebst dieses Leben in und mit der Natur. Ich komme mir nutzlos vor.
Es dauert, bis wir endlich zu Abend essen können. Der Grill muss noch sauber gemacht werden, die Kohle herunterbrennen, bis die Glut rötlich schimmert. Du kümmerst dich um alles, ich decke den Tisch. Und bin mit meinen Gedanken beschäftigt.
»Wie kommt es, dass du hier eine Haarnadel aufbewahrst?« Ich weiß nicht, was mich dazu verleitet, diese Frage zu stellen. Vielleicht liegt es daran, dass es gerade wieder so schön ist, mit dem leckeren Essen, dem starken Tee, dem Kaminfeuer und der überhaupt so gemütlichen Atmosphäre, dass ich mir einfach wünsche, dass du eine gute Erklärung hast. Nein, weil ich mir sicher bin, dass du eine gute Erklärung für die Haarnadel hast, die genauso aussieht wie die von Maria.
»Wo hast du die denn gefunden?« Du wirkst amüsiert.
»Du weichst aus«, stelle ich fest, und es gelingt mir, selbstsicher zu wirken. Jedenfalls bilde ich mir das ein.
Mit der Gabel spießt du das letzte Stück der gegrillten Forelle auf deinem Teller auf, schiebst es in den Mund. »Wahrscheinlich von meiner Oma. Von der Farbe her könnte das hinkommen.« Du kaust genüsslich, schluckst den Bissen hinunter. »Warum fragst du?«
»Nur so«, versuche ich das Thema wieder zu beenden.
»Bist du eifersüchtig?« Du lachst, aber dieses Mal ist es nicht ansteckend, sondern selbstgefällig. Das passt so gar nicht zu dir. »Hast du Sorge, dass ich vor dir schon einmal Damenbesuch hier hatte?«
»Hey, lass das.« Ich ärgere mich darüber, dass du mich auf den Arm nimmst, und auch über mich selbst. Darüber, dass ich die Frage überhaupt gestellt habe. Über die Gedanken, die ich habe und die ich nicht vertreiben kann. Dass auf einmal alles in sich zusammenfällt. Ich will weg, einfach weg. Nach Hause. In meine eigenen grauen vier Wände, die mich wenigstens nicht auslachen, in denen ich mich verkriechen kann. Die nächsten Worte kommen einfach so aus meinem Mund, ohne dass ich es geplant hätte. »Du, können wir wieder fahren?«
»Warum?«
»Ich weiß nicht. Das hier ist vielleicht doch nichts für mich.« Ich weiche deinem Blick aus. »Ich weiß, wir hatten das anders geplant, aber … ich will nach Hause. Ist das okay für dich?« Ich schaue vom Boden auf und direkt in deine hellblauen Augen.
Du siehst mich lange an. Du bist nicht schockiert, nicht enttäuscht oder traurig, du scheinst einfach nur nachzudenken. »Nein, tut mir leid, das geht nicht mehr.«
»Was?« Meine Stimme klingt heiser.
»Es ist schon zu spät.« Du zeigst zum Fenster, hinter dem nach wenigen Metern nur noch dunkle Schattierungen von der Landschaft zu erkennen sind. »Nachts ist es zu gefährlich.«
Ich weiß, dass du recht hast. Nicke dir zu. Sage, dass es eine dumme Idee von mir war. Nach kurzem Schweigen meinst du, dass wir doch genau das wollten. Einsamkeit. Nur wir beide. Zeit für uns. Dass du mich aber morgen gerne wieder rüber auf das Festland bringst, wenn das Wetter es zulässt.
»Versprochen?« Was soll das heißen, wenn das Wetter es zulässt, frage ich mich insgeheim. Ich hoffe noch.
»Versprochen.« Du lächelst mich traurig an.
»Danke.« Ich spüre meine Erleichterung. Dann sehe ich, dass dein Mundwinkel zuckt. Erkenne dein Spiel. Und komme mir unglaublich naiv vor.
»Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass du es dir vielleicht doch noch anders überlegst.« Du ziehst mich zu dir, unsere Lippen berühren sich. Obwohl ich schwitze, ist mir kalt, mechanisch erwidere ich deine zärtlichen Küsse. Es fällt mir schwer, einen Gedanken zu fassen.
*
Das Mondlicht lässt mich kaum mehr als Umrisse erkennen.
»Sie weiß es.« Du wirfst den Kopf auf die andere Seite des Kissens. »Sie darf nicht weg. Sie weiß alles.«
Ich schaue nach oben, an die Decke der verdammten Hütte, sehe schwarz. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Wieder wirfst du den Kopf herum. Ich erstarre, wage kaum zu atmen.
»Ich muss sie töten.« Dieses Mal sprichst du ganz ruhig. Keine Aufregung mehr, nur eine nüchterne Feststellung.
Dein Atem wird ruhiger, deine Muskeln entspannen sich. Du hast deinen Frieden wiedergefunden. Leise murmelst du Sätze, die ich nicht verstehe, bis du schließlich wieder verstummst. Ein dünner Schweißfilm glänzt in der Dunkelheit auf deinem Arm, erinnert an den Kampf, den du gerade mit dir selbst ausgefochten hast.
Endlich begreife ich, dass ich dir nicht mehr entkommen kann. Ich denke an den Fisch im weißen Plastikeimer. An die braune Haarnadel, an das lange Filetiermesser, an die weißen Christrosen hinter dem Haus. Meine Fingernägel kratzen tief in meinen linken Oberarm, bis der Schmerz mich endlich zur Besinnung bringt. Es hilft. Ich weigere mich, nicht länger zu glauben, dass das alles wahr sein könnte.
Nein. Nein, das darf nicht passieren. Ich werde mich nicht in mein Schicksal ergeben. Ich darf nicht darauf hoffen, dass du mich morgen einfach wieder freigibst. Die Klarheit der Erkenntnis überrascht mich. Du oder ich. Ich treffe die einzig mögliche rationale Entscheidung, die mir bleibt. Es fühlt sich nicht gut an, aber es ist notwendig.
Mir ist klar, dass ich dir körperlich unterlegen bin. Auch wenn du jetzt schläfst, einen Kampf mit dir traue ich mir nicht zu. Ich muss es anders machen. Und ich weiß auch sofort, wie ich es tun werde. Die Tollkirsche. Eine kleine Menge in deinem morgendlichen Tee wird genügen, du wirst sie nicht herausschmecken.
Du oder ich. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Vorsichtig winde ich mich aus dem Bett, stehe auf. Du liegst dort, schläfst wie ein Baby, aber ich falle nicht mehr auf dich herein. Von der Anrichte nehme ich die Dose mit deinem Kaffee-Ersatz, aus einer Schublade ein Küchenmesser. Ich werfe nicht einmal eine Jacke über, als ich leise die Tür öffne und nach draußen schlüpfe. Schnell habe ich im Mondlicht den ersten Strauch gefunden. Ich zerre einen Teil der Wurzel heraus. Während ich die Fasern zerkleinere und direkt in die Teedose schneide, weit mehr, als ich brauche, überlege ich, ob die eine oder andere Beere zufällig schon vorher in deiner Kräutermischung enthalten gewesen sein könnte. Vielleicht zufällig, vielleicht aus Unwissenheit. Was würde das bedeuten?
Aber das ist mir jetzt egal. Ich bin überrascht, dass ich so gut wie keine Skrupel habe. Du oder ich.
*
»Beruhige dich, bitte.«
Grelles Licht, dein besorgtes Gesicht kommt in mein Sichtfeld, dahinter erkenne ich die hölzerne Decke der Hütte. »Was ist …?«
»Du redest im Schlaf, Süße.«
Ich versuche, mich in die Situation hineinzutasten. »Was … was habe ich …?« Alles kommt mir so unwirklich vor.
»Du hast dich aufgeregt.« Deine Hand streicht über meine Wange. »Du wolltest jemanden töten, fürchte ich.« Ein neckisches Grinsen huscht über dein argloses Gesicht.
»Ich … ich weiß nicht.« Ich sehe die nächtlichen Kratzspuren an meinem Arm.
»Alles okay.« Du greifst nach einer Tasse Tee, die halb voll neben dir steht, trinkst. Redest. Du sagst, dass du nachgedacht hast. Dass du es zwar erst nicht wahrhaben wolltest, aber es natürlich respektierst, wenn ich mich hier unwohl fühlen würde. Jedes Mal, wenn du nach Worten suchst, nimmst du einen weiteren Schluck. Ich komme mir vor wie betäubt. Schließlich stellst du die leere Tasse neben dir ab, wischst dir mit dem Handrücken über die Lippen. »Wir haben bestes Wetter, die See ist ruhig. Nach dem Frühstück fahren wir rüber zum Festland, dann sind wir abends wieder zu Hause.«
Deine Stimme klingt belegt, als wäre dir die Zunge zu schwer geworden. Draußen leuchtet frischer Schnee vor den bodentiefen Fenstern. Mir ist kalt, und ich habe Angst.
2. Nachts am Weihnachtsbaum
Heike Denzau
Hach, das Seidenpapier raschelt immer so herrlich, wenn Lily mich auswickelt. Endlich bin ich raus aus der düsteren Enge der IKEA-Kiste. Es gibt nichts Schöneres, als liebevoll betrachtet und dann an den Baum gehängt zu werden. Und spannend ist es natürlich. Wer hängt dieses Jahr wo? Das werde ich erst herausfinden, wenn Lily den Raum verlässt, denn § 1 Absatz 1 Zeile 2 des Spielzeug- und Baumschmuckgesetzes besagt, dass ich mich erst bewegen darf, wenn kein Mensch in der Nähe ist.
Also bleibt mir vorerst nur der starre Blick nach vorn, was auch nicht schlecht ist, denn die Nordmanntanne spiegelt sich im Fernseher. Auf der Baumspitze steckt bereits der Rauschgoldengel. Genau wie ich ist er antik und sehr wertvoll. Mein Holz wurde im Erzgebirge handbemalt, und der Engel hat Flügel aus echten Daunen. Er ist sogar noch zwanzig Jahre älter als ich und hat bereits eine Flucht aus Ostpreußen mitgemacht. Darum ist er auch unser Präsident. Quasi. Natürlich sind wir alle wichtig, aber einige sind nun mal wichtiger. Gäbe es eine Rangfolge, wäre ich hier der Kanzler. Der Bildschirm zeigt, dass bis auf meine rechte Hand alles in Ordnung bei mir ist. Die schwarz-goldene Majorsmütze sitzt perfekt auf meinem braunen Haar, und der Horst-Lichter-Schnauzer ist adrett gezwirbelt und lässt den lockigen Vollbart alt aussehen. Die schwarze Hose unterstreicht in ihrer Schlichtheit die Eleganz meiner roten Jacke mit dem schwarzen Gürtel und den goldenen Epauletten, und das Gewehr an meiner linken Schulter verleiht mir eine Autorität, die mir manchmal ein wenig unangenehm ist. Aber ich kann es nicht anders sagen: Ich bin fesch, attraktiv und …
»He, Großmaul!«, erklingt eine raue Stimme neben mir. »Hast du schon gecheckt, ob der Rest der Truppe vollständig ist?«
Erschrocken blicke ich mich um. Ich habe gar nicht bemerkt, dass Lily den Raum verlassen hat. Also darf ich mich nun bewegen und drehe mich. »Ja, auch schön, dich wiederzusehen«, zeige ich dem Grinch, dass Höflichkeit im vergangenen Jahr nicht aus der Mode gekommen ist. Gegen das Wort Großmaul wehre ich mich nicht mehr. Ein großer, kräftiger Mund ist nun mal das A und O für einen Nussknacker. Ich ignoriere sein hingerotztes »Blablabla« und weise ihn darauf hin, dass er in seiner kurzen Weihnachtsmannjacke über nacktem, grünfelligem Unterkörper und mit dem albernen Adventskranz in Händen mehr als dümmlich aussieht. Daraufhin zielt er fies grinsend mit dem Kranz auf meine Mütze, aber ich weiß, dass er ihn nicht werfen wird, denn die Gefahr, dass Lily zurückkommt, ist zu groß. Nicht vorstellbar, was passiert, wenn sie ihn am Baum ohne den Kranz entdeckt. Oder mich ohne Mütze. Das Gesetz der Spielzeugmagie ist unter allen Umständen zu wahren. § 1 Absatz 1 Zeile 1SBG.
Der Baum erwacht zum Leben. Von allen Zweigen erklingen herzliche Begrüßungen, und der Rauschgoldengel lässt es zu. Er hat von oben den besten Blick und würde sehen, wenn Lily zurückkommt, denn sie hat die Tür offen gelassen. Ich schaue mich um und bin wieder einmal dankbar, dass Lilys Mann ein Faible für originellen Baumschmuck hat – übrigens das Einzige, was mir an dem ständig mies gelaunten Kerl gefällt. Lily hätte den Baum mit weiteren hirnlosen Kugeln vollgehängt, Michael hat über die Jahre Leben hineingebracht. Gut, den Grinch hätte er uns gern ersparen können, aber mit dem knuddeligen Mogwai Gizmo haben wir immer viel Spaß. Miss Piggy, ein rosa Glitzerschwein im blau glänzenden Tutu, mit goldenen Flügelchen und Krone, hängt in diesem Jahr unter mir, neben dem schnittigen Cabrio in Metallicrosa, was ihr sicherlich gefällt. Dass Miss Piggy eigentlich ein Mr. Piggy ist, habe ich entdeckt, als sie im letzten Jahr direkt über mir hing. Ja, wir lieben es bunt, frei und vielfältig, und wenn der Eber lieber eine Sau ist, ist das saugut.
Im unteren Teil des Baumes hängen überproportional viele rot-weiße Zuckerstangen – es ist der Bereich, den Sophie und Natalie erreichen. Mittlerweile müssen sie sechs und drei Jahre alt sein.
»Leute, zwei Neuzugänge!«, röhrt der Grinch aufgeregt neben mir. »Ist das ’ne Gurke?«
Tatsächlich hängt neben der roten Glitzerbohrmaschine, ganz in der hintersten Ecke, ein glänzend grünes, pickliges Ding, das in die gleiche Abteilung gehört wie die Kugeln: Hirnlose.
Der zweite Neuzugang scheint sehr viel aufregender zu sein, denn die Glitzerfee flötet mit hoher Stimme, was sie nur tut, wenn sie gefallen will. »Hallöchen, mein Schöner!«
So spricht sie doch eigentlich nur mit mir! Ich drehe mich weiter, erblicke den Grund für ihr Gesäusel und bin einen Moment lang sprachlos. Ein Zinnsoldat. Ein Exemplar der königlich britischen Garde in schwarz-roter Uniform mit Goldknöpfen und einer Bärenfellmütze, unter der seine Augen verschwunden sind.
Na ja, mir doch egal, hängt eben noch ein schneidiger Kerl am Baum. Völlig egal.
Der Zinnsoldat wendet sich an die Glitzerfee. »Stets zu Ihren Diensten, Verehrteste.«
Was für ein Schleimbeutel!
Dann kommt Lily zurück, und wir alle erstarren wieder. Ich bin dankbar, dass den ganzen Tag über menschliches Leben im Wohnzimmer herrscht. Dann muss ich mir das Geschnatter der Fee nicht anhören. Es reicht schon, den Zinnsoldaten auf der Mattscheibe zu sehen. Er hängt direkt unter dem Rauschgoldengel. Nicht dass das seinen Rang am Baum widerspiegelt, aber … es stört mich einfach. Wenn da einer hängen sollte, dann doch wohl ich.
Am Abend wird es gemütlich. Es ist der Tag vor Heiligabend, und Lily schaltet die elektrische Lichterkette an, die sich den Platz auf den Zweigen mit roten Wachskerzen teilen muss. Die werden aber erst am Heiligabend entzündet. Ich hänge an meinem Mittelzweig mit Blick auf Fernseher und Sofa. Besser geht es nicht, denn dort spielt sich das menschliche Leben ab. Die Griswolds mag ich auch nach zwanzig Jahren noch gucken, und ich genieße es, Lily lachen zu hören. Über diesen Film amüsiert sich normalerweise auch Michael köstlich, doch er wirkt völlig weggetreten. Sind die finanziellen Probleme des Vorjahrs etwa noch nicht gelöst? Man bekommt ja so viel mit in den zwei Wochen, bis man wieder eingepackt wird. Michael hatte sich mit Aktien verspekuliert, wenn ich mich recht erinnere, und hat ständig Telefonate geführt. Zwei, drei krasse Wutanfälle mussten wir auch miterleben.
Wenn ich ihn nun genauer betrachte, fallen mir seine blassen, eingefallenen Wangen auf. Er hat abgenommen. Aus Stress? Vielleicht gibt es auch Eheprobleme, denn Lily und Michael reden kaum miteinander.
Um dreiundzwanzig Uhr steht Lily mit einem kühlen »Gute Nacht« vom Sofa auf.
»Nacht.«
Vor einem Jahr sind sie noch gemeinsam zu Bett gegangen.
Michael steht nun ebenfalls auf, bleibt aber an der geschlossenen Tür stehen und lauscht. Horcht er, ob Lily die Treppe hinaufgeht? Eigenartig. Kurz darauf öffnet er die Tür und verschwindet.
»Alles klar, meine Lieben«, gibt der Rauschgoldengel das Zeichen zum Bewegen. »Ich habe den Flur im Blick.«
Der Grinch seilt sich von seinem Zweig ab und klettert zwei Etagen höher, um mit dem Zinnsoldaten auf Augenhöhe zu sein. Wobei, das ist wohl eher metaphorisch gesprochen, denn die Soldatenaugen sind ja nicht zu sehen. »Coole Mütze, Alter.« Er stupst sie an, und der Rauschgoldengel wird energisch: »Sofort zurück an deinen Platz, Grinch! Das Handy liegt noch auf dem Tisch. Der Blödian kommt also jeden Moment zurück.« Der Rauschgoldengel verabscheut Lilys Mann zutiefst, was auf Gegenseitigkeit beruht. Michael nennt ihn »Viech« und möchte schon seit Jahren lieber eine silberne Spitze auf dem Baum.
Sofort trollt der Grinch sich und wirft dabei in die Runde: »Findet ihr nicht auch, dass Hackfresse Michi dieses Jahr richtig übel aussieht?«
Gizmo antwortet mit einem traurigen »Keine Ahnung«.
Ich verstehe seinen Frust, denn unser Mogwai hängt dieses Jahr mit dem Gesicht zur Wand. Dann müssen wir auch schon wieder erstarren, denn der Rauschgoldengel mahnt: »Still! Er kommt.«
Frustessen, denke ich, als Michael eine Packung Pralinen auf dem Tisch ablegt. Es sind die teuren, die, die Lily zu Weihnachten immer für ihre Mutter kauft.
Will das Ekel etwa Anne die extra für sie besorgten Leckereien wegessen? Tatsächlich nimmt er eine Praline heraus. Aber unerwarteterweise isst er sie nicht, sondern legt sie vor sich ab. Dann verlässt er erneut den Raum.
Sofort wenden der Grinch und ich uns einander zu. »Was tut er da?«, flüstere ich.
»Keine Ahnung, Knacker, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir endlich mal Action erleben werden.«
»Still!«, ertönt es über uns.
Reglos beobachten wir, wie Michael sich mit einem Bier wieder aufs Sofa setzt und einen Schluck aus der Flasche nimmt. Dann zieht er den hübsch gemusterten Weihnachtsteller in Sternform zu sich, nimmt eine Haselnuss heraus und knackt sie – mit dem lächerlichen Nussknacker in Zangenform.
Ich würde jetzt gern den Grinch anschauen. Von wegen Action. Michi snackt und trinkt sich einfach die bevorstehenden anstrengenden Weihnachtstage schön.
Doch dann wird es merkwürdig. Statt sich die Nuss in den Mund zu stecken, zieht er sein Schweizer Messer aus der Hosentasche und teilt die Nuss.
Verwirrt sehe ich zu, wie er mit der linken Hand nach der Praline und mit der rechten nach einer Nusshälfte greift. Dann streicht er mit der Nuss über die Unterseite der Praline, wieder und wieder. Ein Mysterium.
Während ich noch über Sinn und Zweck dieser Aktion nachdenke, legt er die Praline zurück in die Packung und schließt sie mit einem emotionslosen »Guten Appetit, Schwiegermama. Auf dein Erbe«.
Da fällt bei mir der Groschen. Wäre ich nicht an das Spielzeug- und Baumschmuckgesetz gebunden, würde mir jetzt vor Grauen mein mächtiger Kiefer auf- und zuklappen. Michael will Lilys Mutter um die Ecke bringen.
Es dauert endlose Minuten, bis der Mörder in spe das Wohnzimmer verlässt. Die verräterische Nuss samt Schale und die Pralinenpackung hat er mit hinausgenommen.
Statt der gewohnten fröhlichen Bewegung im Baum herrscht sekundenlang Stille. Dann ruft der Grinch aus: »Alter Falter! Der Kerl will Anne killen!«
Wir unterrichten den Baumschmuck, der die Augen nicht nach vorn gerichtet hat, darüber, was sich abgespielt hat. Den Zinnsoldaten klärt der Rauschgoldengel darüber auf, dass Anne Asthmatikerin mit Nussallergie ist und vor fünfzehn Jahren einen anaphylaktischen Schock gerade mal so überlebt hat. Seitdem isst Anne nur noch die handgeschöpfte Weihnachtsschokolade der Manufaktur ihres Vertrauens.
Aufregung pur herrscht. Dem Rauschgoldengel zittert die Stimme, als er zur Ruhe mahnt. Er kennt Anne seit ihrer Kindheit und liebt sie so sehr wie sie ihn. »Was können wir tun?«, fragt er, und wir sehen uns alle verzweifelt an. Die Bohrmaschine brummt, und das Cabrio gibt Gas, aber außer durchdrehenden Reifen hat es nichts zu bieten. Glitzerfee weint still vor sich hin, und Miss Piggy seilt sich ab, um sie tröstend in die dicken Arme zu schließen.
»Heulen bringt uns nicht weiter«, schimpft der Grinch. Er sieht mich an. »Du bist der Einzige mit einer Waffe. Tu was!«
»Witzig. Hast du vergessen, dass die Waffe nicht geladen ist? Doch selbst wenn sie es wäre, könnte ich den Abzug nicht drücken.« Ich schwenke meinen handlosen Arm.
Diesmal ist es die Glitzerfee, die den Zinnsoldaten informiert. Über das zurückliegende Drama, das mich die Hand gekostet hat. »Klein-Sophie hat unseren Nussi vor drei Jahren vom Baum genommen und mit ihm gespielt. Dann hat sie ihn auf dem Wohnzimmerboden liegen lassen, und Annes Chihuahua Lulu hat ihm die Hand abgekaut.«
Ich nicke gelassen. Therapeutische Gespräche mit dem Rauschgoldengel und Miss Piggy haben mich das traumatische Erlebnis gut wegstecken lassen.
»Der Hund ist vielleicht die Lösung«, meint der Grinch. »Wenn die hässliche Töle die Pralinen frisst, wäre die Sache erledigt.«
Alle sind begeistert. Die Vorgehensweise steht schnell fest, denn wir kennen die Abläufe der Familie am Heiligabend genau. Lily und Michael legen die Geschenke unter den Baum, während Oma Anne mit Sophie und Natalie schon Richtung Kirche vorgeht, wo alle gemeinsam den Gottesdienst besuchen. Wenn sie zurückkommen, dürfen die Mädchen im Wohnzimmer die Geschenke bestaunen, die das Christkind in der Zwischenzeit gebracht hat. Wir haben also etwa eine Stunde, um unseren Plan in die Tat umzusetzen: runter vom Baum, das mörderische Geschenk identifizieren, denn es wird wie alle anderen liebevoll in Weihnachtspapier verpackt sein. Wir müssen es aufreißen, die Wohnzimmertür öffnen, damit der Hund hereinkann. Anschließend lassen wir den Dingen ihren Lauf. Schafft Lulu es in der verbleibenden Zeit nicht, alle Pralinen aufzufressen, verstecken wir die tödlichen Leckereien unter dem Sofa.
»Ein guter Plan für den Moment«, sagt der Zinnsoldat. »Aber wird dieser Michael es nicht wieder versuchen? Auf andere Art und Weise?«
Ich verabscheue ihn. Weil er recht hat.
»Scheiße«, fasst der Grinch die allgemeine stumme Zustimmung ins Wort und setzt nach einem Moment des Schweigens hinzu: »Wir müssen ihn abmurksen, um Anne zu retten.«
Die Glitzerfee kreischt vor Entsetzen auf, und im gleichen Moment fällt eine Kugel zu Boden. Das fürchterliche Geräusch des Zerspringens in Dutzende Scherben geht uns durch Mark und Bein. Ein grausiges Schicksal, das außer mir – ich bin ja aus Holz – allen anderen jederzeit widerfahren kann. Ich entsinne mich an den Weihnachtstag vor drei Jahren, als uns die Queen verließ, weil eine depressive Kugel sie im Fall mitriss. Ihr ständiges entrüstetes »Excuse me!« war zwar nervig, aber sie hatte Stil und sah in ihrem glänzenden türkisfarbenen Hut-Mantel-Ensemble edel aus.
Miss Piggy hat das Entsetzen über den Tötungsvorschlag des Grinchs ebenfalls vom Zweig gerissen, doch sie hat den Vorteil, dass sie Flügel hat. Sie sind zwar winzig und halten ihr Gewicht kaum, doch es reicht, um heil neben den Kugelscherben zu landen. Keuchend hangelt sie sich zurück auf ihren Platz.
Alle plappern aufgeregt, doch der Rauschgoldengel sorgt mit einem »Ruhig jetzt!« für sofortige Stille. »Du bist wohl wahnsinnig geworden«, wendet er sich an den Grinch. »Ich verbiete euch, auch nur einen einzigen Gedanken an diesen ungeheuerlichen Vorschlag zu verschwenden.« Mit einem strengen Blick setzt er ein Ausrufezeichen, und niemand widerspricht.
Am nächsten Tag sind wir alle aufgeregt, doch alles geschieht wie erhofft. Als die Geschenke unter dem Baum liegen und die Familie auf dem Weg in die Kirche ist, hangeln wir uns von den Zweigen und betrachten die Päckchen. Von der Größe her kommen drei Geschenke infrage, aber nur auf einem Kärtchen steht »Für Anne«. Mithilfe der Glitzerbohrmaschine lösen wir den Knoten der roten Schleife, zerren zu dritt die Goldfolie von der Packung und heben den Pappdeckel an. Es sind die Pralinen.
Jetzt ist der Rauschgoldengel gefragt, denn nur er kann die Türklinke erreichen, um den Hund ins Zimmer zu lassen, der uns gehört haben muss, denn er kläfft auf dem Flur. Der Rauschgoldengel fliegt los, und im nächsten Moment geschieht das gänzlich Unerwartete. Die Tür öffnet sich, bevor der Engel die Klinke erreicht, und Michael betritt das Wohnzimmer.
Alle erstarren auf der Stelle. Der Engel fällt zu Boden. Ich liege stocksteif neben den Pralinen und sehe, dass Michael zum Sofa geht, zwischen den Kissen wühlt und schließlich sein Handy in Händen hält. Guck nicht zum Baum! Guck nicht zum Baum! Diesen Gefallen tut er uns, aber auf dem Weg nach draußen bemerkt er den Rauschgoldengel am Boden. Er bückt sich und hebt ihn auf. Mit einem verwirrten »Häh?« geht sein Blick zur Baumspitze. Was dann geschieht, ist so grauenhaft, dass ich mir wünschte, ich läge wie die anderen mit dem Gesicht zum Boden. Michael schaut in die Richtung, wo der Kaminofen bollert, dann auf den Engel in seiner Hand.
Als Michael sich in Bewegung setzt, bin ich einfach nur dankbar, dass sich der Ofen nicht in meinem Blickfeld befindet. Ich muss nicht mit ansehen, wie mein längster und innigster Vertrauter, mein Freund seit über vierzig Jahren, in Flammen aufgeht, doch das fachende Auflodern, bevor die Ofentür geschlossen wird, brennt sich in meine Gehörgänge.
Als Michael den Raum verlässt, nutzt Lulu die Gunst der Sekunde und witscht hinein, aber Michael macht sich nicht die Mühe, den Hund wieder hinauszubürsten. Er lässt die Tür einfach offen und eilt seiner Familie hinterher.
Bei Tieren ist das so eine Sache, was das SBG betrifft. Eine gesetzliche Grauzone. Ja, sie sind Lebewesen, aber sie können nichts verraten. Also dürfen wir uns bei Lebensgefahr bewegen. Und genau das tun wir. Schneller, als wir runter sind, sind wir alle wieder auf dem Baum, wobei ich nur reflexhaft handle. In meinem Holzschädel brummt es, und ich höre immer wieder das grausige Auflodern.
»Geil, alles läuft nach Plan«, freut sich der Grinch neben mir. »Seht euch die Töle an!«
Ich schaue nach unten. Lulu frisst wie ausgehungert. Die letzten beiden Stücke in der Packung bekommt sie nicht heraus, aber sie ist schlau, schnappt nach der Packung und schüttelt sie. In null Komma nichts ist die Schokolade weg.
»Super, dass du die Tür gar nicht mehr öffnen musstest, Rauschgoldengel«, erklingt Miss Piggys begeisterte Stimme. »Man muss auch mal Glück haben.« Sie blickt zur kahlen Baumspitze, dann in den Raum. »Wo steckt er denn?« Sie sieht mich an. Ich kann nicht sprechen.
»Rauschgoldengel!«, flötet die Glitzerfee. »Wo bist du?«
Mit einem wilden Aufschluchzen hangele ich mich die Zweige hinauf, vorbei an zwei goldenen Kugeln, den Wachskerzen und dem Zinnsoldaten. Aber ich sehe nicht nach links und nach rechts. Ich klettere bis ganz nach oben, klammere mich an die Baumspitze, wo noch zwei engelige Goldfäden an den Nadeln haften, und weine meinen Schmerz in die Heilige Nacht.
In Gizmos Kuschelarme geschmiegt, erzähle ich nach einer Ewigkeit, was passiert ist. Die Tanne erbebt unter dem Weinen und dem wilden Schluchzen ihres Schmucks, zwei depressive Kugeln zerbersten auf dem Laminat. Und den Grinch mal mit einem Kloß im Hals zu erleben, hätte ich mir nie träumen lassen. Was er schließlich sagt, klingt umso sicherer. »Jetzt ist das Schwein fällig.«
Der Einzige, der nun Einspruch erhoben hätte, ist zu einem Häufchen Asche verbrannt, und wir wollen Sicherheit für Anne und, man muss es beim Namen nennen, Rache.
Ratlos, was den Plan dazu betrifft, erleben wir die Rückkehr der Familie. Die freudig kreischenden Kinder übertönen den Schreckenslaut von Michael, als er sieht, was mit seinen Pralinen passiert ist. Anne ist aufgelöst, weil der Hund die für ihn in der Menge hochgiftige Schokolade gefressen hat, und telefoniert verzweifelt nach einem Tierarzt, während Lily die Scherben unter dem Baum zusammenkehrt und schließlich darüber stolpert, dass der Rauschgoldengel fehlt. Zu Recht verdächtigt sie Michael, der blass auf dem Sofa vor sich hin stiert, gegen die Anschuldigung aber energisch protestiert. Der feige Hund!
In den Tagen nach Weihnachten gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Lulu sind Herzrhythmusstörungen und Koma erspart geblieben, weil ihr rechtzeitig der Magen ausgepumpt wurde. Die schlechte: Michael hat neuen Tannenbaumschmuck gekauft. An der Stelle, an die mein liebster Freund gehört, steckt jetzt eine hirnlose silberfarbene Spitze.
Zwischen ihm und Lily herrscht Eiszeit. Sie weiß, dass er das alte Erbstück hat verschwinden lassen, auch wenn er es nicht zugibt.
Der Grinch schweigt, seit die Spitze auf der Spitze steckt. Was heckt er aus?
Wir erfahren es, als Michael lange nach Lily endlich zu Bett gegangen ist und wir uns auf den ausladenden unteren Zweigen versammeln.
Der Grinch hat mein nutzloses Gewehr genommen und benutzt es als Zeigestock. »Wir müssen es schaffen, den Weihnachtsbaum dorthin zu kippen.« Er deutet mit der Knarre auf Michaels Sofaplatz. Weil uns unser Warum wohl auf die Stirn geschrieben steht, fügt er hinzu: »Wenn er dort sitzt und eingeschlafen ist.« Als spräche er über das Wetter, führt er weiter aus: »Wenn ich mich nicht verrechnet habe, reicht die Länge des Baumes genau, um mit der silbernen Spitze sein Auge zu durchbohren. Ob sie es bis ins Hirn schafft, bleibt abzuwarten.«
Miss Piggy packt geistesgegenwärtig zu, als die Glitzerfee nach dieser Ankündigung einen schrillen Schrei ausstößt und ohnmächtig zur Seite kippt. Der Zinnsoldat bricht einen Zweig ab, was wir eigentlich nicht tun sollten, aber ich will mal gnädig sein, denn er fächelt der Fee damit Luft zu. Dieser charmante Kerl! Warum bin nicht ich auf diese Idee gekommen?
»Wenn das alles nicht hilft, haben wir immer noch ihn.« Der Grinch richtet das Gewehr auf Gizmo.
Der Mogwai begreift schneller als ich, was der Grinch von ihm will, und beginnt heftig zu zittern. »Oh nein, bitte nicht.«
»Willst du, dass Anne stirbt?«, fragt der Grinch und arbeitet dabei mit unlauteren Mitteln. »Dass unser Rauschgoldengel umsonst zu Asche verbrannt ist?«
»Also gut«, lässt sich der Mogwai erweichen. »Aber nur im äußersten Notfall. Für die liebe Anne und unseren Engel.« Tränen kullern dabei über sein süßes Gesicht.
An den nächsten beiden Abenden geht Michael zu Bett, bevor er auf dem Sofa einschläft, und wir werden nervös. Spätestens am 6. Januar wird Lily uns abschmücken. Doch am Silvesterabend ist es so weit. Michael ist betrunken und streitet sich mit Lily, die um ein Uhr nachts weinend nach oben geht. Michael öffnet sich noch ein Bier, das letzte seines Lebens, wenn unser Plan aufgeht, und nach nur drei Schlucken lehnt er sich zurück und beginnt zu schnarchen.
Wir sehen einander an, atmen tief durch, als der Grinch das Go gibt, und hangeln uns vom Baum. Nur die Fee bleibt zurück und löst die Lichterkette bis auf die letzten drei oberen Kerzen und wirft uns die lose Kette zu. Gemeinsam ziehen wir die Kette schließlich Richtung Sofa. Dann beginnt der Kraftakt. Wie ein Galeerentrommler gibt der Grinch den Takt vor: »Hauuu ruck – hauuu ruck – hauuu ruck!« Der Baum schwankt, aber es kommt nicht zum Sturz. Nun feuert Gizmo uns an. »Los, weiter!« Sein viel schnellerer Takt ist aus Angst geboren. »Hau ruck, hau ruck, hau ruck!«
Wieder neigt sich die Nordmanntanne Richtung Sofa. Wir ziehen und zerren, wir geben alles, aber es reicht nicht.
»Stopp, aufhören«, gibt der Grinch keuchend das Kommando zum Aufgeben und schüttelt Gizmo, der als Einziger weiterzieht. »Hör auf!«
Als wir alle einigermaßen wieder bei Atem sind, nimmt der Grinch Gizmo an die Hand wie eine Mutter ihr Kind und bittet die Fee, das Ende der Lichterkette auf den Tisch zu legen. Sie hangeln sich daran empor, und wir ziehen uns an die Wand zurück. Das, was kommt, kann auch für uns gefährlich werden.
Ich bewundere Gizmo für seine Tapferkeit, als er das Nussstückchen nimmt, das der Grinch vom Sternteller fischt. »Für Anne«, sagt Gizmo und isst es, ohne weiter zu zögern. Dann geht er zur Bierflasche, hüpft hoch, erreicht den Bügelverschluss und kippt die Flasche. Das Bier ergießt sich auf den Tisch. Gizmo sieht jeden von uns an. »Ich war gern euer Knuddeltier.« Während uns die Tränen laufen, hüpft er mit einem »Für unseren Engel« in die Lache und wälzt sich darin.
Dann passiert das, was passiert, wenn man einen Mogwai nach Mitternacht füttert und er nass wird. Gizmos Verwandlung in einen Gremlin hautnah mitzuerleben, ist so faszinierend wie grauenhaft. Unser pelziger Freund mutiert zu einem grauschuppigen, rotäugigen Monster mit Reißzähnen.
Der Gremlin macht kurzen Prozess. Blitzschnell wickelt er die Lichterkette um Michaels Hals und zieht mit der Kraft von hundert Mogwais.
Dann beginnt er, das Zimmer zu verwüsten, was Lily auf den Plan ruft, und wir erstarren. Dem Umstand geschuldet, dass ihr Mann mit Lichterkette um den Hals tot auf dem Sofa sitzt, sieht sie nicht zu Boden, was sich für unsere Zukunft als Glücksfall erweist, denn – es knirscht hässlich – sie zertritt dabei den Gremlin. Ihr wildes Schreien geht uns durch Glas und Holz, und wir leiden mit ihr, aber uns ist ein toter Michael lieber als eine tote Anne. Und ihr mit Sicherheit auch – sie weiß es nur nicht.
Zum Glück hat der Gremlin unseren Baum nicht umgestürzt und Lily in den folgenden Tagen andere Sorgen, als uns abzuschmücken. So kommen wir in den Genuss, zu sehen, was abgeht.
Kriminalpolizei, Spurensicherung … die magielosen Menschen werden im Leben nicht darauf kommen, was passiert ist.
Lily zieht mit den Kindern kurzfristig zu ihrer Mutter. Es ist Anne, die Ende Januar mit der Kiste kommt, um uns von der nadelnden Tanne zu pfriemeln. Sie legt uns auf dem Tisch ab und geht noch einmal hinaus, vermutlich, um den Karton für den Tannenbaumfuß zu holen.
Ein letztes Mal in dieser Saison dürfen wir uns bewegen. Ich wende den Kopf – neben mir liegt der Zinnsoldat. Er schiebt die Mütze über den dunklen Schopf nach hinten, und … tannengrüne Augen blicken mich an. Er lächelt, und in meinem Kopf werden imaginäre Geigenklänge von Smooth Jazz abgelöst. Ich schlucke, ohne meinen Blick aus seinem zu lösen.
Noch nie habe ich mich so sehr auf zehn Monate IKEA-Kiste gefreut.
3. Am Meer
Henrik Siebold
Bender mochte das Meer, im Winter sogar noch mehr als im Sommer. Es war kalt, fast null Grad. Der Sand knirschte angefroren unter seinen nackten Füßen.
Er wusste, dass er ein komisches Bild abgab. Ein nicht mehr junger, nicht mehr schlanker Mann von Anfang sechzig, der seine Anzughose hochgekrempelt hatte und nun vorsichtig einen Fuß ins eiskalte Wasser der Ostsee setzte. Dann noch einen und noch einen, bis er knietief in der Flut stand.
Dort blieb er stehen und schaute ins unendliche Grau.
Wolken und Wellen.
Himmel und Meer.
Ein paar spottende Möwen.
Das Wasser war so kalt, dass es schmerzte. Doch es konnte seinem Lächeln nichts anhaben.
Benders Hand glitt in die Tasche seines Jacketts. Ein kurzes Funkeln von Gold und Diamanten. Ohrringe. Bender führte den Schmuck an die Lippen, er küsste ihn und warf ihn in weitem Bogen ins Wasser.
»Für dich, zu Weihnachten, mein Schatz. Ich liebe dich.«
*
Vier Jahre zuvor.
Bender rannte durch die Nacht, die Dienstwaffe in der Hand. Er war schon damals zu alt für solche Sachen, aber darauf nahm er keine Rücksicht. Endlich war es so weit, endlich konnte er Zinar Hossein das Handwerk legen.
»Halt! Stehen bleiben!«, schrie Bender keuchend in die Dunkelheit.
Die Antwort war ein heiseres Lachen. Dann: »Warum sollte ich?«
»Letzte Warnung! Ich schieße!«
»Mach doch, Bulle.«
Bender blieb stehen. Er stützte sich auf die Knie und war kurz davor, sich zu übergeben. Gib nicht auf, nicht jetzt, Bender! Reiß dich zusammen!
Er richtete sich auf und lauschte in die Nacht. Er hörte die fliehenden Schritte. Zinar war auch schon am Ende. Es war noch nicht verloren.
Also los! Jetzt kommt es drauf an.
Zinar Hossein war noch keine dreißig. Ein Berufskrimineller. Einbruch, Raub, schwere Körperverletzung. Mord. Hossein hatte drei Menschen erschossen, einen erstochen. Das Motiv war immer dasselbe: Es galt, die Geschäfte seiner Familie zu sichern.
Wer ihnen dabei im Weg stand, wurde bedroht, zusammengeschlagen, im Zweifel getötet.
Bender rannte weiter. Eine verlassene Einkaufsstraße. Dunkle Geschäfte, irgendwo in der Ferne hörte er eine Kehrmaschine.
Im Eingang einer Bäckerei hatte sich ein Obdachloser niedergelassen. Funkelnde Augen in einem Berg aus Decken und Lumpen.
Bender sah ihn fragend an. Der Mann hob eine schwielige Hand und zeigte stumm zu einer Toreinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Bender nickte dankbar.
Der Obdachlose nickte zurück. Nützlich zu sein, das wärmte für den Rest der Nacht.
Bender überquerte die Straße und tauchte ein in die Dunkelheit der Toreinfahrt ein. Jetzt galt es. Er nahm die Waffe in Anschlag und setzte seine Schritte nun langsamer.
Schatten und Stille. Irgendwo war das atemlose Keuchen eines Mannes zu hören.
»Komm raus, Zinar! Die Hände so, dass ich sie sehen kann!«
Keine Reaktion.
Bender arbeitete sich weiter vor. Schritt um Schritt. Die Hintertür eines Ladens, eine Laderampe, ein Hof mit Tonnen, eine rückwärtige Mauer.
Plötzlich Lärm. Gerumpel, metallisches Klirren.
Zinars schmächtige Figur stand auf einem Müllcontainer, bereit, über die Mauer zu springen.
»Halt!«
Bender war keine fünfzehn Meter entfernt. Er legte an. Zinar drehte sich um.
Ihre Blicke begegneten sich.
Bender hatte den Finger am Abzug. »Komm da runter! Ganz langsam.«
Zinars Gesicht verzog sich zu einer feixenden Grimasse. »Du schießt ja doch nicht, Bender.«
»Lass es nicht darauf ankommen.«
Zinar lachte laut, sein Körper bog sich nach hinten.
Sie wussten es beide.
Bender würde nicht schießen.
Der Junge sprang auf die Mauer, balancierte kurz darauf, hangelte sich dann in die Tiefe und war verschwunden.
»Ich kriege dich, Zinar! Verlass dich drauf!«
»Lass es lieber, Bender.«
»Bestimmt nicht.«
»Ich habe dich gewarnt.«
Schritte, Stille.
Bender schob die Waffe ins Holster. Er stand lange so da und tat nichts anderes, als zu atmen.
Er war zu alt für so etwas.
*
Zinar Hossein hatte es übertrieben, sogar nach den Maßstäben seiner eigenen Familie. Er zockte, er hurte, er nahm Drogen. Das ließ sich hinnehmen. Aber die Gewalt! Er hatte seinen eigenen Cousin ins Krankenhaus geprügelt. Er tötete, weil es ihm Freude machte.
Jedem war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Sogar der Familie. Das war eine Chance.
Bender bat um eine Audienz. Das Familienoberhaupt, Caki Hossein, empfing ihn in einem unscheinbaren Mietshaus im Süden der Stadt. Bender wusste nicht, ob Caki hier wohnte oder ob die Wohnung einem Mitglied der weitverzweigten Familie gehörte. Man hatte Bender einen Treffpunkt genannt, und dort war er von einer Limousine abgeholt worden. Ledersitze, getönte Scheiben, kaum ein Motorengeräusch. Ein Wagen, von dem ein Beamter wie er nur träumen konnte.
Caki Hossein bot Tee an. Er war ein alter Mann mit einem zerfurchten Gesicht. Mächtig, weise und wenn nötig rücksichtslos.
Aber eben nicht, wenn es unnötig war.
»Was kann ich für Sie tun, Kommissar?«
»Es geht um Ihren Neffen Zinar.«
Der Alte hob die Augen zur Decke. »Ich weiß. Ein schwieriger junger Mann. Er bereitet mir nicht weniger Kummer als Ihnen.«
»Das bezweifle ich.«
»Was wollen Sie, Kommissar?«
»Wir können Zinars Verhalten nicht länger dulden, Herr Hossein. Es wird sonst eng für Sie alle.«
»Ich verstehe.«
»Sie sollten ihn überreden, sich zu stellen.«
Sie tranken Tee und tauschten Höflichkeitsfloskeln aus. Bender hatte das Gefühl, dass dem Alten klar war, was auf dem Spiel stand.
»Sind wir uns einig?«, fragte er.
»Ich werde mich beraten, und wir werden eine Entscheidung treffen.«
»Danke.«
Caki Hossein stand zum Abschied nicht auf. Er nickte nur, und ein anderer junger Mann brachte Bender zur Tür. Dort erklärte er: »Mein Onkel wird eine Lösung finden. Sie können sich darauf verlassen.«
*
Die Wochen danach. Caki Hossein hielt Wort. Er schickte eine Nachricht. Er hatte mit Zinar geredet. Es war ein schwieriges Gespräch. Aber am Ende … ja, er würde sich stellen.
Doch es geschah nicht.
Die Familie hatte die Kontrolle über ihn verloren.
Dann eben anders.
Eine Soko unter Benders Leitung. Über dreißig Beamte waren daran beteiligt. Sie überwachten all die Orte, an denen Zinar sich früher herumgetrieben hatte. Ein Bordell, eine Gaststätte, das Casino. Sie machten seine Dealer ausfindig und setzten sie unter Druck. Auch seine Freunde.
Jeder hatte die Nase voll von ihm.
Die Schlinge um Zinars Hals zog sich zu. Nur noch wenige Tage, dann würden sie ihn fassen.