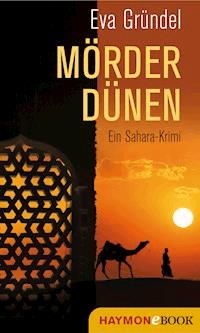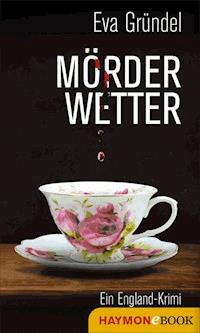
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Reisekrimis mit Elena Martell
- Sprache: Deutsch
Am wolkenverhangenen Himmel Südenglands braut sich etwas zusammen. Eine Reisegruppe findet den Earl of Wharvedale tot in seinem Gartenlabyrinth. Mittendrin: die couragierte Reiseleiterin Elena Martell und ihr Lebenspartner Commissario Giorgio Valentino. Mit Schwung und britisch-trockenem Humor sorgt Eva Gründel vor der beeindruckenden Kulisse der Cotswolds und in den Straßen Londons für First-Class-Krimi-Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Gründel
Mörderwetter
Ein England-Krimi
Inhalt
Titel
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Sieben Monate später
Ein herzliches Dankeschön für Hilfe jeglicher Art an
Eva Gründel
Zur Autorin
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Für meinen Mann
’Tis a vile thing to die, my gracious lord,
When men are unprepar’d and look not for it.
Ein hässlich Ding, zu sterben, gnäd’ger Herr,
unvorbereitet und sich nichts versehend.
William Shakespeare, Richard III., 3. Akt, 2. Szene
Noch einmal blickte er sich um, bevor er ins Dunkel des Gartenlabyrinths tauchte. Wie erwartet war niemand zu sehen – und das war gut so. Seine Verabredung ging niemanden etwas an. Die nächste halbe Stunde würde vermutlich ziemlich unerfreulich werden, aber das musste er in Kauf nehmen. Ein paar unerquickliche Minuten zahlten sich aus, wenn man dafür ein Vermögen einstreichen konnte.
Dabei könnte er sich die bevorstehende Konfrontation eigentlich ersparen. Rechtlich war alles wasserdicht, dafür hatten seine Anwälte längst gesorgt. Zu dumm, dass er sich überhaupt auf dieses Treffen einließ, aber er war überrumpelt worden, was ihm ganz und gar nicht gefiel. Nun erwarteten ihn Anschuldigungen, Vorwürfe, vielleicht sogar Tränen, doch davon würde er sich nicht rühren oder gar umstimmen lassen. Die Sache war gelaufen, Punktum.
Leise knirschte der Kies unter seinen Schuhsohlen, sonst herrschte absolute Stille. Kein Sonnenstrahl verirrte sich zwischen die dichten, grünen Wände. Ganz so, als hielte die Natur den Atem an. Unwillkürlich straffte er die Schultern.
Doch keine Vorahnung von etwas Bedrohlichem, nur ein leises Unbehagen beschlich ihn, als er die Mitte des Irrgartens erreichte.
Prolog
Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mann nach vorne stürzte, auf die Knie fiel und sich gerade noch mit den Armen abstützen konnte. Als er den Kopf hob, wollte er nicht glauben, was er sah. Ein Rhinozeros hatte ihn gerammt – vor der Pestsäule in der Wiener Innenstadt, mitten auf dem Graben. Es gab keinen Zweifel, das wild gewordene Tier hatte umgedreht und kam nun direkt auf ihn zu. Ohne zu überlegen wälzte sich der Mann auf dem regennassen Pflaster zur Seite und lag nun auf dem Rücken wie ein hilfloser Käfer.
Am besten, ich stelle mich tot, dachte er, doch das ließen die aufgeregten Stimmen rund um ihn nicht zu. Jemand beugte sich zu ihm nieder.
„Er atmet. Hat schon jemand die Rettung gerufen?“
„Nicht nötig“, krächzte der Mann. „Aber vielleicht kann mir jemand auf die Beine helfen.“
Hilfsbereite Hände streckten sich ihm entgegen. Kurz darauf stand er – wackelig zwar, aber unverletzt – auf den Beinen und stützte sich an der steinernen Umrahmung der Pestsäule ab.
„Das war ein Nashorn. Ein Nashorn hat mich angegriffen!“
Das Stimmengewirr verstummte.
„Doch die Rettung, er redet wirr. Wahrscheinlich eine Kopfverletzung. Oder er ist betrunken.“ Eine junge Frau griff nach ihrem Handy.
„Warten Sie“, rief der Mann, der sich von einem Dutzend Schaulustiger umringt sah. „Sehen Sie, hier hat das Biest mich getroffen.“ Mit schmerzverzerrter Miene tastete er an seinen Rücken nach einem kleinen Riss in seinem Mantel.
„Das ist passiert, als Sie hingefallen sind“, antwortete die Frau mit dem Handy. „Ein Nashorn! So ein Blödsinn.“
„Kein Blödsinn“, mischte sich ein junger Mann ein, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Mit beiden Händen hielt er ein etwa ein Meter langes Horn, das ohne Zweifel von einem Rhinozeros stammte. Ungläubig starrten ihn die Umstehenden an.
„Das lag da drüben, direkt vor dem Eingang zur Peterskirche.“ Seine Worte gingen in durchdringendem Sirenengeheul unter; irgendwer hatte nicht nur die Rettung, sondern auch die Polizei gerufen. Das rotierende Blaulicht der Einsatzfahrzeuge, die nahezu gleichzeitig eintrafen, ließ die Szene noch bizarrer erscheinen, als sie ohnedies bereits war.
Wenige Minuten später war der Spuk vorbei. Der Gestürzte hatte sich nun doch von der Rettung zur Untersuchung in ein Spital bringen lassen, und die meisten Schaulustigen hatten sich rasch davon gemacht, als die Polizisten anfingen, die Personalien der Passanten aufzunehmen. Letztlich blieben gerade einmal drei Zeugen übrig – und die hatten nichts gesehen. Lediglich der junge Mann, der noch immer das Horn in seinen Händen hielt, bewies, dass an der unglaublichen Geschichte doch etwas dran sein musste.
Als Ilse Hubinek eine gute Stunde später aus der Spiegelgasse auf den Graben trat, verriet nichts mehr, dass sich hier vor Kurzem etwas höchst Merkwürdiges ereignet hatte. Trotz des ungemütlichen Novemberwetters war die Wiener Innenstadt in den frühen Abendstunden voller Menschen, die eilig aneinander vorbeihasteten. Kaum einer blieb vor den schon weihnachtlich geschmückten Schaufenstern stehen. In wenigen Tagen, wenn die allgegenwärtigen Punschhütten Einzug gehalten hatten, würde sich das Bild freilich ändern. Nicht zum Schöneren, dachte Ilse, der vor dem Rummel rund um die rustikalen Buden, die billiges hochprozentiges Gesöff um teures Geld ausschenkten, bereits graute.
Wie automatisch drehte sie den Fernsehapparat auf, nachdem sie kaum eine halbe Stunde später ihre Wohnungstür in der Porzellangasse aufgesperrt hatte. „Wien heute“ versäumte sie selten, auch wenn sie meist nur mit halbem Ohr zuhörte, weil sie zugleich irgendwelche Haushaltsarbeiten erledigte. Diesmal aber ließ bereits die erste Meldung sie in ihren Ohrensessel vor dem Bildschirm sinken. Gebannt lauschte sie den Worten der Moderatorin:
„Zwei Nashorn-Hörner wurden heute am späten Nachmittag aus dem Auktionshaus in der Dorotheergasse geraubt. Zwei englischsprachige Männer hatten sich die mehrere Kilogramm schweren Trophäen, die kurz darauf versteigert werden sollten, für einen Augenschein aus der Vitrine nehmen lassen. Kaum hatten sie zwei der Hörner in Händen, ergriffen sie die Flucht. Die Spur der Räuber verlor sich vor dem Portal der Peterskirche, wo ein Täter seine Beute fallen ließ. Das von der Polizei sichergestellte und dem Dorotheum umgehend übergebene Horn mit einem Rufpreis von 12.000 Euro wurde wenig später um 80.000 Euro versteigert. Von dem zweiten Horn fehlt jede Spur. Die Polizei nimmt an, dass eine organisierte Bande hinter dem Überfall steckt. In China gilt das zu Pulver zerriebene Horn eines Rhinozeros als Potenz- und Heilmittel. Nashörner stehen mittlerweile unter Artenschutz. Auch wenn allein in Südafrika heuer bereits rund 340 Nashörner illegal erlegt wurden, haben es Wilderer immer schwerer. Die steigende Nachfrage treibt nun die Preise für historische Nashörner in astronomische Höhen, was immer mehr Kriminelle anlockt. So verschwanden etwa Anfang Juni aus dem Zoologischen Museum in Hamburg fünf Hörner.“
Als die Moderatorin die nächste Nachricht verlas, stellte Ilse Hubinek den Ton leiser und griff zum Telefon. Dass sie um ein Haar Augenzeugin eines Raubüberfalls geworden wäre, musste sie sofort ihrer Tochter Elena erzählen. Wenn die Zeitangaben stimmten, hatte sie nur wenige Minuten zuvor die Eingangshalle des Dorotheums verlassen. Ilse Hubinek drückte die Taste mit der eingespeicherten Nummer – und ließ den Hörer wieder sinken. Elena würde sich ja doch nur lustig über sie machen. Was war das Beinahe-Erlebnis der Mutter schon gegen die Abenteuer, die ihr selbst widerfuhren.
Wenn überhaupt, würde Ilse die Sache bei ihrem nächsten Telefonat beiläufig erwähnen.
1. Kapitel
„Typisch Mutter! Wenn sie sich einmal in etwas festgebissen hat, lässt sie nicht mehr locker. Was interessiert Giorgio schon ein Raubüberfall in Wien!“ Kopfschüttelnd warf Elena Martell einen kurzen Blick auf die Pestsäule, die an diesem sonnigen Vormittag im April gleichermaßen von Tauben und Touristen umlagert war. „Ein halbes Jahr ist das jetzt her, gesehen hat sie gar nichts, weil sie zu spät gekommen ist, und trotzdem redet sie noch immer von der Nashorn-Geschichte im Dorotheum.“
Erst jetzt fielen Elena die erstaunten Blicke der Passanten auf, die die vor sich hin murmelnde Frau misstrauisch musterten. Schlagartig verstummte sie. Das hatte sie nun von ihren Selbstgesprächen. Die hielten sie sicher für meschugge. Fast hätte sie wieder laut aufgelacht. Aus den tiefsten Tiefen ihrer Erinnerung war plötzlich das jiddische Wort aufgetaucht, das den Nagel auf den Kopf traf. Da lebte sie nun seit mehr als zwanzig Jahren in Italien, erst in Rom und seit 2005 auf Sizilien, doch das gute alte Wienerisch hatte sie nicht verlernt. Auf ihre Umwelt wirkte sie sicherlich nicht wie eine pazza, eine Verrückte, sondern bloß ein wenig närrisch und überspannt. Meschugge eben. Und das konnte man auch werden, wenn vier Wochen Heimaturlaub mit Mutter vor einem lagen. Demnächst würde es zum ersten, aber bestimmt nicht zum letzten Mal krachen.
Ilse Hubinek und ihre Tochter Helene, die nach ihrer Hochzeit mit dem Südtiroler Bildhauer Paul Martell auch den ungeliebten Vornamen abgelegt und nur allzu gern gegen die italienische Variante Elena eingetauscht hatte, waren einander viel zu ähnlich, um sich nicht in kürzester Zeit in die Haare zu geraten. Nichtsdestotrotz liebten die beiden einander sehr, und ihre Versöhnungen waren stets tränenreich, sentimental – und für einen Dritten ziemlich anstrengend. Irgendwann hatte sich Paul bei aller Wertschätzung für seine Schwiegermutter geweigert, die Rolle des Stoßdämpfers zu spielen, und war in Rom geblieben, wenn Elena zu ihren Pflichtbesuchen nach Hause gefahren war.
Auch Giorgio schien seit seinem ersten Weihnachtsurlaub in Wien wenig Lust auf eine baldige Wiederholung zu haben, gestand sich Elena ein. Paul und Giorgio, die beiden Männer ihres Lebens! Sie hätten sich vermutlich sogar gut verstanden. Verstohlen wischte sich Elena über die Augen, die noch immer feucht wurden, wenn sie an ihren Mann dachte, der mit nur 45 Jahren an einem bösartigen Kopftumor gestorben war.
Acht Jahre war das mittlerweile her, und an die erste Zeit danach wollte sie lieber nicht zurückdenken. Nicht an den fassungslosen Schmerz, den sie mit viel zu viel Wein betäuben hatte wollen. Nicht an die Einsamkeit und schon gar nicht an die tiefe Depression, in die sie gefallen war. In Rom würde die Welt für sie für immer dunkel bleiben, das war ihr in einer nüchternen Phase klar geworden. Aber auch nach Wien konnte und wollte sie nicht zurückkehren.
Die Lösung hieß, so stellte sich heraus, Sizilien. Dort hatte Elena gute Freunde. Kurzerhand war sie nach Taormina übersiedelt, um sich dort als Reiseleiterin eine neue Existenz aufzubauen. Als gut versorgte Witwe hätte sie nicht arbeiten müssen, doch mit noch nicht einmal 40 steckte sie voller Tatendrang. Dolce far niente – am Nichtstun konnte sie bis heute nichts Süßes entdecken.
In Gedanken versunken war Elena vor der Pestsäule stehen geblieben und erst eine Taube, die heftig flatternd unmittelbar vor ihren Füßen landete, holte sie in die Realität zurück. Mit einem spitzen Schrei sprang sie zur Seite und trat einem arglosen Touristen, der eben dabei war, ein Foto zu schießen, auf die Füße. Ohne sich dafür zu entschuldigen, drehte sie sich um und ergriff die Flucht. Vor keinem Tier ekelte es Elena mehr als vor den gefiederten Ratten, die ihr den Aufenthalt in Städten seit einem hässlichen Kindheitserlebnis immer wieder vergällten.
„Der hält mich jetzt auch für meschugge“, stellte sie fest, als sie nach wenigen Schritten in die taubenfreie Dorotheergasse bog. Der „Trześnieswski“, ein winziges Lokal, in dem es, seit Elena denken konnte, die besten Brötchen von Wien gab, war bei jedem ihrer Heimatbesuche eines ihrer ersten Ziele. Sollte sie ihrer Mutter ebenfalls welche mitbringen? Später vielleicht, überlegte sie, erst wollte sie dem Dorotheum einen Besuch abstatten.
Noch bevor sie allerdings die wenigen Schritte dorthin gegangen war, läutetet ihr Handy. Giorgio! Für einen Moment war Elena versucht, den Anruf einfach zu ignorieren. Permanente Erreichbarkeit war für sie nach wie vor mehr Fluch als Segen, eine Ansicht, die in ihrem Umfeld zumeist auf Unverständnis stieß. Selbst ihre Mutter liebte ihr Mobiltelefon über alles und ließ sich dieses Vergnügen einiges kosten.
„Was ist passiert, Giorgio?“, meldete sich Elena. Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass sie nicht zum Plaudern aufgelegt war.
„Wieso? Es ist alles in bester Ordnung. Ich wollte nur noch einmal deine Stimme hören, bevor ich ins Flugzeug steige“, antwortete Giorgio pikiert. „Aber wenn ich dich störe ...“
„Sei bitte nicht gleich beleidigt. Wir haben doch erst vor zwei Stunden miteinander telefoniert und ausgemacht, dass du dich meldest, sobald du in London gelandet bist. Also muss ich doch annehmen ...“
„Musst du nicht. Der Flug wird pünktlich starten und mir geht es gut. Stimmt nicht. Es geht mir schlecht, denn du fehlst mir jetzt schon, carissima.“
Diese Sizilianer! In der Kunst, eine Frau zu umgarnen, waren sie Weltmeister. Aber bisweilen konnten diese Charmeoffensiven ganz schön anstrengend sein. Unwillkürlich verzog sich Elenas Mund zu einem Lächeln. Eigentlich sollte ich ihn beim Wort nehmen und ebenfalls nach London fliegen. Aber das wäre ihm vermutlich gar nicht recht. Auch wenn er es nicht zugeben wollte, die Einladung von Scotland Yard zu einem Erfahrungsaustausch hatte ihn ganz schön aus dem Häuschen gebracht. Für einen kleinen Commissario aus Sizilien, der bisher erst wenig von der Welt gesehen hatte, bedeutete das Zusammentreffen mit den renommiertesten Kunstfahndern Europas unendlich viel. Und bestätigte außerdem, dass Mut belohnt wurde.
Vor kaum drei Jahren hatte Giorgio Valentino den Sprung ins kalte Wasser gewagt, seinen Job als Chef der Mordkommission von Trapani an den Nagel gehängt und bei der italienischen Kunstpolizei ganz neu angefangen. Der Liebe wegen. Nach einem Mord an einem Mitglied ihrer Reisegruppe war er Elena Martell begegnet, in die er sich Hals über Kopf verliebt hatte. Sie zu erobern, war nicht einfach gewesen und er hatte sich keine Illusionen gemacht. Sie wohnte in Taormina, er am anderen Ende der Insel, dort, wo sich die Füchse im Winter Gute Nacht sagen. Wenn ihre Beziehung eine Zukunft haben sollte, musste einer von ihnen sein Leben radikal ändern, das war ihm klar. Elena aber würde nie in das verschlafene Provinzstädtchen Trapani übersiedeln. Und als sich dann die Tutela Patrimonio Culturale, die italienische Kunstpolizei T.P.C., in Rom für ihn interessierte, ergriff er kurzentschlossen seine Chance.
Giorgio, der ein Doktorat in Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität von Palermo erworben hatte und mangels anderer Zukunftsperspektiven bei der Polizei gelandet war, gab mit Mitte 40 den Posten als Leiter einer Mordkommission auf und wechselte von der Polizia Statale zu den Carabinieri. Ein ungeheuerlicher Schritt, den ihm seine ehemaligen Kollegen nie verziehen. Und noch weniger gönnte ihm der Vize-Questore, dass sein einstiger Untergebener in Rekordzeit Karriere machte und Leiter der T.P.C.-Filiale von Catania wurde. Eine neue Wohnung brauchte sich Giorgio nicht zu suchen, er zog zu Elena nach Taormina und nahm die halbstündige Fahrt ins Büro bereitwillig auf sich.
„Du gehst mir auch ab“, schwindelte Elena, die seit dem morgendlichen Anruf nicht an Giorgio gedacht hatte. „Wien ist so leer ohne dich ...“ Bei aller Liebe, die sie für den klugen, gut aussehenden Mann empfand, ab und zu sehnte sie sich nach Freiheit und Unabhängigkeit. Sie genoss es, allein durch die Gassen ihrer Heimatstadt zu schlendern und vor niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, wie sie ihre Zeit verbrachte. Aber das konnte sie Giorgio natürlich nicht sagen, schon gar nicht am Telefon. Er würde sie gründlich missverstehen, und Spannungen zwischen ihnen waren das Letzte, was er jetzt brauchen konnte.
„In drei Wochen bin ich ja schon wieder bei dir“, sagte er mit einem zufriedenen Seufzer. „Aber jetzt muss ich aufhören, sie haben den Flug eben aufgerufen. Ciao, amore mio. Ti voglio bene.“
Ihre kleine Notlüge hatte funktioniert, stellte Elena zufrieden fest, doch bevor sie das Handy in ihrer Handtasche verstauen konnte, läutete es erneut. Sie blickte erst gar nicht auf das Display, bevor sie den Anruf annahm.
„Ich liebe dich auch. Hast du das nicht mehr gehört?“
„Habe ich nicht, aber es freut mich von Herzen“, antwortete eine weibliche Stimme, die Elena im ersten Moment nicht zuordnen konnte.
„Ich bin es, Adele. Störe ich?“
„Ganz und gar nicht“, schwindelte Elena erneut. So gern sie auch mit Adele Bernhardt plauderte, im Moment hatte sie nicht die geringste Lust dazu. Im Gegensatz zu Giorgio aber ließ sich die alte Mittelschulprofessorin nicht hinters Licht führen.
„Höre ich da einen leisen Unterton von Unwillen? Du brauchst gar nichts zu sagen, ich weiß alles, ich habe mit Ilse gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass du in der Stadt bist und man dich besser nicht stören soll. Aber es ist dringend und vielleicht auch besser, wenn deine Mutter nicht mithört. Ich will dich nämlich nach England entführen – und das wäre ihr vermutlich gar nicht recht.“
„Was soll ich in England? Besser gesagt: Was machst du dort?“
„Einem Hilferuf von Feli Folge leisten. Aber das ist eine längere Geschichte. Ein Vorschlag: Du suchst dir ein ruhiges Plätzchen auf einer Parkbank und ich rufe dich in einer Stunde wieder an. Bis bald!“
Verdutzt starrte Elena auf ihr verstummtes Mobiltelefon. Adele Bernhardt war immer für eine Überraschung gut, das wusste Elena nur allzu genau. Ihre 78 Jahre sah man der Wienerin, die seit Jahrzehnten in München lebte, nicht an. Es steckte mehr Leben und Unternehmungslust in ihr als in vielen Jüngeren, das hatte sie mehr als einmal unter Beweis gestellt. Zuletzt bei einer Fahrt durch die libysche Wüste im vergangenen Jahr, bei der Elena beinahe ihr Leben gelassen hätte. Gemeinsam mit acht ehemaligen Schülern, die ihr vierzigjähriges Matura-Jubiläum feiern wollten, hatte Adele eine Sahara-Tour geplant und Elena als Reiseleiterin engagiert. Felicitas Cape, verheiratet mit einem Engländer, war ebenfalls mit von der Partie gewesen.
Was um alles in der Welt konnte die kapriziöse Landschafts- und Gartenarchitektin dazu bewogen haben, ihre alte Lehrerin um Hilfe zu bitten? Felis Scheidung war kurz nach Libyen ohne Komplikationen über die Bühne gegangen, erinnerte sich Elena, die von Adele auf dem Laufenden gehalten wurde. Wahrscheinlich langweilte sie sich; finanzielle Probleme konnten jedenfalls nicht der Grund sein. Adele würde sie also in einer Stunde wieder anrufen. Zeit genug, um dem Dorotheum einen kurzen Besuch abzustatten.
Elena liebte die Atmosphäre im ältesten Auktionshaus der Welt, das keineswegs verstaubt vor sich hin dämmerte. Im Gegenteil. Bereits das Foyer begrüßte Besucher mit einem dezenten Ambiente in modernem Design. In kleinen Glasvitrinen lockten schimmernde Perlenketten, rubinbesetzte Ringe und diamantene Ohrgehänge. Ein paar Schritte weiter lag der Raum, der für Elena, die sich nichts aus Schmuck, sehr viel aber aus den praktischen Hinterlassenschaften einer stilvollen Epoche machte, die größte Anziehungskraft besaß. Hier standen kleine Gebrauchsgegenstände und Möbel, die man – ohne darauf zu bieten – zu Fixpreisen erwerben konnte.
Auch das passte zu Wien, zu ihrer Stadt, die weit pragmatischer war, als man ihr zutraute. Ein Auktionshaus mit Waren zu Fixpreisen – ein Widerspruch in sich selbst, der Elena jedes Mal aufs Neue amüsierte. Sofort stach ihr ein schmales Jugendstil-Regal mit zierlichen Messingknöpfen um einen akzeptablen Preis ins Auge. Es würde perfekt in die kleine Nische im Schlafzimmer ihrer Mutter passen.
War es original oder bloß „nachempfunden“, wie es so schön hieß? Elena hatte Kunstgeschichte studiert, zu einer Zeit, als noch niemand auf die Idee gekommen wäre, einen Fälscher als Künstler zu bezeichnen. Aber jetzt? Ihre Sicht auf die Dinge hatte sich eindeutig verschoben, seit Giorgio gegen Betrüger in der Kunstszene ermittelte. Und er nun besser als sie wusste, um welche Summen es ging.
„Kunst ist die neue Währung der Unterwelt“, hatte Giorgio mit bitterem Unterton gesagt, als er nach dem Jobwechsel von seinem ersten Ausbildungskurs in Rom heimgekommen war und ihr damit die Dimensionen klarmachen wollte, die Kunstdelikte angenommen hatten. Wie nie zuvor mischte die Mafia seit geraumer Zeit im internationalen Kunsthandel mit. Aus gutem Grund: Ob Diebesgut oder Fälschung, im Vergleich zum Geschäft mit Rauschgift war das Risiko klein und der Gewinn groß. Einen Drogenhändler steckte man für Jahrzehnte hinter Gitter, einen Hehler für kaum ein paar Jahre.
Nur schwer konnte sich Elena von dem schwarz lackierten Hoffmann-Regal losreißen. Wenn sie noch länger in diesem Raum blieb, würde sie irgendeiner Versuchung erliegen – und sei es bloß der eines eisernen Zeitungsständers in stilisiertem Tulpendekor, den in Wahrheit niemand brauchte.
Elena brachte sich nebenan in Sicherheit vor Spontankäufen. Der großzügig angelegte Ausstellungsraum, der sich über zwei Stockwerke erstreckte, beherbergte ausschließlich Gegenstände, die versteigert werden sollten und nicht sofort gekauft werden konnten. Hier musste sich die Sache mit den Nashörnern abgespielt haben, überlegte Elena, während sie ihren Blick nach oben richtete. Ein frecher Raub direkt vor den Augen der zahlreichen Kaffeehausgäste, die von den Tischen an der Balustrade nur hilflos hatten zusehen können.
Im November, kurz vor der Versteigerung, war das Kaffeehaus des Dorotheums sicherlich gut besucht gewesen, an jenem Vormittag im Mai aber war das Lokal, in das kaum ein Sonnenstrahl drang, gähnend leer. Auch Elena hatte eigentlich nicht vor einzukehren. Nicht hier, sondern draußen fand das Leben statt – ein nach Flieder duftender Frühling, der nirgendwo schöner sein konnte als auf einer Parkbank im Wiener Burggarten. Aber es war bereits später, als sie angenommen hatte. In wenigen Minuten würde Adele anrufen. Kurzentschlossen bestieg Elena den Lift, der sie hinauf zu einem gelangweilt an der Theke lehnenden Kellner brachte. Ein Telefonat würde hier niemanden stören.
Kaum hatte Elena Platz genommen, läutete ihr Handy.
2. Kapitel
Auch in der Münchener Wohnung von Adele Bernhardt hatte der Frühling Einzug gehalten. In den Hängekästen auf ihrem Balkon in Bogenhausen reckten die ersten grünen Blätter irgendwelcher exotischer Blumenzwiebeln, die sie sich leichtfertig hatte einreden lassen, ihre zarten Triebe der Sonne entgegen. Umso üppiger prangten die vertrauten, etwas spießigen Geranien in allen Rottönen, die sie im bereits blühenden Zustand erworben hatte.
Adele, die mit einer Kaktusgießkanne die trockene Erde der interessanten Neuerwerbungen tröpfchenweise begoss, zweifelte, ob sie in der Gärtnerei klug gewählt hatte. Gleichzeitig aber gratulierte sie sich nicht zum ersten Mal zu ihrer Entscheidung, das Haus am Stadtrand von München gegen die 80 Quadratmeter „in bester Lage“, wie es auf dem Immobilienmarkt hieß, eingetauscht zu haben und nicht wie einst einen Garten in Haar bestellen zu müssen.
Es war wirklich schön hier in diesem noblen Wohnbezirk, den sie sich heute wahrscheinlich nicht mehr leisten könnte. Nach dem Tod ihres um einiges älteren Mannes war sie mit ihren kaum 60 Jahren noch nicht pensioniert gewesen, sondern hatte fünf weitere Jahre an einem Münchener Gymnasium Philosophie und Geschichte unterrichtet. Ihr Leben musste sie neu organisieren. Zurückkehren in ihre Geburtsstadt Wien? Damit verband sie nichts mehr als sentimentale Erinnerungen. Ihre zwei Töchter waren in Bayern daheim, ebenso wie mittlerweile auch sie. Einst war sie eher widerwillig übersiedelt, aber ihr Mann, Dozent für altenglische Literatur an der Universität Wien, hatte damals endlich eine Professur angeboten bekommen. Aber eben leider nicht daheim, sondern in München.
Wie lange war das jetzt schon wieder her! Mittlerweile befanden sich die Töchter in den sogenannten gesetzteren Jahren, die älteste Enkeltochter war dem Teenageralter längst entwachsen und der jüngste Enkelsohn durchlitt mit fünfzehn gerade seine hoffentlich letzte Pubertätskrise. Und sie selbst? Unglaublich, aber wahr: In zwei Jahren würde sie ihren 80. Geburtstag feiern.
Adele war nicht besonders eitel, aber sie warf nicht ungern einen Blick in den einstmals in Böhmen gekauften bleigefassten Jugendstil-Spiegel, den sie bei allen ihren Übersiedlungen mitgeschleppt und nunmehr als Blickfang in ihrem Wohnzimmer aufgehängt hatte. Aus dem geschliffenen Glas blickte ihr keine Greisin, sondern eine immer noch hübsche, schlanke Frau aus wachen, violett-blauen Augen entgegen.
Kritisch schob sie ihr kinnlang geschnittenes, silberblondes Haar aus dem Gesicht. Ihre Naturfarbe, für die andere Frauen ein kleines Vermögen ausgeben mussten. Ein Friseurbesuch war dennoch dringend nötig und auch eine Kosmetikbehandlung würde ihrer empfindlichen Haut nicht schaden. Das ist das Schicksal von echten Rothaarigen, sagte sie sich, als sie prüfend ihre farblosen Wimpern betrachtete, die ebenso wie ihre Augenbrauen nach einer Tönung verlangten. Aber sonst konnte sie eigentlich zufrieden mit sich sein. Adele war gut gealtert. Noch immer passte sie mit ihren knapp 1,70 Metern problemlos in Kleidergröße 40, was ihr allerdings einiges an Disziplin abverlangte. Sie kochte und aß für ihr Leben gern gut und kalorienreich und liebte dazu ein gepflegtes Glas Wein.
Dafür war es an diesem sonnigen Vormittag eindeutig noch zu früh, nicht aber für einen Kaffee aus der funkelnagelneuen Espressomaschine, die ihre Töchter ihr zum Geburtstag geschenkt hatten. Keine mit Kapselautomatik, das hatte sie sich ausbedungen, sondern eine mit klassischem Brühkopf. Weil sie nicht einsah, dass sie einer praktischen Verpackung wegen einen vielfachen Kaffeepreis zahlen sollte. Guten Kaffee macht man mit Liebe, dachte sie, als sie das aromatische Pulver nach Augenmaß portionierte und mit sanftem Druck flachpresste. Es ist doch genauso ein Zeremoniell wie die Zubereitung von Tee! Und davon würde sie demnächst mehr als genug bekommen.
In fünf Tagen würde sie nach London fliegen, um einer ehemaligen Schülerin moralischen Beistand zu leisten. Das hatte sie zumindest ihren Töchtern erklärt, die sich von der Aussicht, jeden zweiten Tag ihre Balkonblumen gießen zu müssen, alles andere als begeistert zeigten. Natürlich war der Grund für die spontane Entscheidung, die sie erst gestern Abend getroffen hatte, eine Ausrede. Felicitas Cape würde sehr wohl auch ohne sie zurechtkommen, doch die Aussicht, an einer Gartentour durch das sanfte Hügelland nordwestlich von London teilnehmen zu können, war für Adele so verführerisch gewesen, dass sie zugesagt hatte, ohne lange nachzudenken.
Ihre Spontanität würde sie noch einmal den Kopf kosten, hatte ihr Mann sie nicht nur einmal gewarnt. Und tatsächlich wäre vieles in ihrem Leben bei sorgfältigem Abwägen allen Für und Widers anders gelaufen. Konfliktfreier, einfacher, glatter. Ob aber auch besser, das mag dahingestellt bleiben, dachte Adele, als sie ihre dampfende Kaffeetasse und einen Teller mit ein paar selbstgebackenen Keksen auf dem schmalen Balkontisch platzierte.
Einen Ludwig Jakubowski würde es zum Beispiel in ihrem Leben heute nicht geben, hätte sie nicht bei einer Gruppenreise durch Sizilien spontan seinen Vorschlag zu einer Urlaubsverlängerung in einem Privatquartier bei Taormina angenommen. Die Aussicht, nicht nur Ludwig, sondern auch ihre damalige Reiseleiterin Elena nach London verschleppen zu können, gefiel ihr außerordentlich. In wenigen Minuten würde sie mehr wissen.
„Grüß dich. Du bist pünktlich wie immer“, meldete sich Elena nur Sekunden, nachdem Adele die Wiener Nummer gewählt hatte. „Also, was gibt es?“
„Ich fliege am Samstag nach London, Ludwig kommt ebenfalls. Du wirst es nicht glauben, aber unsere verwöhnte Feli hat einen Job als Reiseleiterin für eine Gartentour angenommen und jetzt hat sie Angst vor der eigenen Courage. Also will sie für Claqueure im Bus sorgen. Und du bist noch dazu ein Profi, der ihr soufflieren könnte ...“
„Stopp, meine Liebe, du brauchst gar nicht weiterzureden. Ich bin gerade erst nach Wien gekommen, meine Mutter hat sich seit einem halben Jahr auf meinen Besuch gefreut, ich kann sie unmöglich gleich wieder allein lassen. Auch wenn ich noch so gerne wollte. Giorgio sitzt nämlich gerade in einem Flugzeug nach London und ...“
„Das ist doch großartig“, unterbrach Adele. „Dann wären wir alle wieder versammelt. Und um deine Mutter mach dir keine Sorgen. Ich werde Ilse überreden, ebenfalls mitzukommen. Wetten, dass mir das gelingt?“
Elena schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen, was ihr einen erstaunten Blick des unterbeschäftigten Kellners eintrug. Ilse Hubinek und Adele hatten einander während eines Weihnachtsurlaubs in Wien kennen gelernt. Dass sie seither in Kontakt standen, war Elena alles andere als recht, denn sie konnte sich unschwer ausmalen, dass sie und ihre Beziehung zu Giorgio für die beiden älteren Damen das Gesprächsthema Nummer eins waren. Aber vielleicht hatte die Freundschaft der beiden nun doch eine gute Seite. Je länger Elena darüber nachdachte, umso lieber wollte sie mit nach England kommen. Zum einen war sie schon lange nicht mehr in London gewesen, zum anderen hatte sie noch nie eine Garten- und Schlösser-Fahrt unternommen.
„Also gut, einverstanden, Adele, aber ich mische mich nicht ein. Du klärst die Sache mit Mutter ab. Wenn sie tatsächlich will, habe ich nichts dagegen. Wohin geht es eigentlich genau?“
„Soviel ich weiß, in die Cotswolds, ins sogenannte Herz Englands. Dort gibt es jede Menge Schlösser und Herrensitze samt Gärten und Parks. Unsere Tour soll fünf Tage dauern und durch die Grafschaften Oxfordshire, Gloucestershire ...“
„Bete mir jetzt bitte nicht das ganze Programm herunter, bevor ich überhaupt weiß, ob es klappt“, fiel diesmal Elena Adele ins Wort. „Ich werde mich schon rechtzeitig einlesen. Was mich weit mehr interessiert: Was soll das Ganze kosten?“
„Flüge nach London sind billig, ich habe mich natürlich informiert. Für die Busfahrt wird uns Feli einen Sonderpreis herausschlagen, das hat sie versprochen. Relativ teuer sind die Hotels in London, aber da habe ich auch schon etwas Passendes gefunden.“
„Im Internet, nehme ich an.“ Unwillkürlich verzog sich Elenas Mund zu einem Lächeln. Niemand sollte alte Damen unterschätzen. Ebenso wie Ilse liebte Adele ihren Computer und verbrachte nicht selten gleich mehrere Stunden vor dem Bildschirm. Im Gegensatz zu ihr selbst. Elena hatte nun einmal ein gestörtes Verhältnis zur Technik und war deswegen auch keineswegs imstande, Flugtickets via Internet zu buchen.
„Wo sonst?“, konterte Adele. „Der Drucker hat meine Flugtickets bereits ausgespuckt. Ankunft Heathrow, Samstag, 28. April, 11:45 Uhr. Rückflug nach München am Montag, 14. Mai, 16:10 Uhr.“
„Das sind ja mehr als zwei Wochen“, stellte Elena irritiert fest. „So lange wird Mutter kaum bleiben wollen und auch ich ...“
„Wenn du dich nur nicht täuschst. Ilse hält außer dir nichts in Wien. Und da du ja mit von der Partie sein wirst ...“
Giorgio würde bis zwölften Mai in London sein, überlegte Elena. „Also gut. Ihr beiden übernehmt die Regie. Ich bin mit allem einverstanden, aber ums Quartier und die Tickets muss sich Mutter kümmern.“
„Klar, du machst busdriver’s holidays und überlässt das Steuer anderen.“
„Wie bitte?“
„Du kennst den Ausdruck nicht?“, lachte Adele. „Was macht ein Buschauffeur in seinem Urlaub? Seine Familie bucht eine preiswerte Pauschalreise – und wo landet er? Im Bus!“
„Und wahrscheinlich kennt er sogar den Fahrer. So wie ich Feli kenne.“
„Mit dem Unterschied, dass sie kein Profi ist und deine Hilfe vielleicht bitter nötig hat, Elena.“
„Den Appell an meine Hilfsbereitschaft kannst du dir schenken. Ich habe doch schon ja gesagt. Außerdem könnte es für mich ausgesprochen lustig werden, einmal als Mitglied der Gruppe und nicht als Reiseleiterin unterwegs zu sein. Gibt es sonst noch etwas?“
„Nicht dass ich wüsste. Außer, dass ich gern mit dir plaudere. Aber dazu haben wir ja demnächst reichlich Gelegenheit. Servus, Elena. Auf bald.“
Mit einem zufriedenen Schmunzeln trug Adele ihre leere Kaffeeschale in die Küche. Das Gespräch war wie erwartet positiv verlaufen. Dass sie längst mit Ilse Hubinek Kontakt aufgenommen hatte, gehörte zu den Dingen, die sie Elena nicht unbedingt auf die Nase binden musste. Adele ging in ihr Arbeitszimmer und schaltete den Computer ein. Sie wollte Ilse die frohe Botschaft zukommen lassen, dass Elena zu allem Ja und Amen gesagt hatte. Doch Ludwig kam ihr mit seiner Mail zuvor.
Betrifft: England mit Dir
Liebe Adele,
natürlich komme ich mit, denn ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr in London, und das Vergnügen, es gemeinsam mit Dir neu zu entdecken, werde ich mir nicht entgehen lassen. Um die Flüge kümmere ich mich selbst. Finde Du bitte ein bequemes Bett für uns. Sei aber bei der Suche nicht allzu sparsam. Es muss ja nicht gleich das Ritz oder das Dorchester sein, aber für durchgelegene Matratzen und ein Bad auf dem Gang bin ich eindeutig zu alt.
In Liebe
Ludwig
Das hatte sie notwendig gehabt, ärgerte sich Adele. Er stellte sie doch glatt als unverbesserlichen Sparefroh hin. Schlimmer noch, als Geizkragen, der jeden Cent zwei Mal umdrehte. Aber schon im nächsten Moment gewann ihr Humor die Überhand und sie lachte laut auf. Er hat ja nicht ganz unrecht, gestand sie sich ein. Auch wenn sie sich dank ihrer durchaus ansehnlichen Pension einiges leisten konnte, für manche Dinge gab sie nun einmal ungern viel Geld aus. Und dazu gehörten die ihrer Meinung nach unverschämten Hotelpreise, die in Weltmetropolen verlangt wurden.
Wie sie bereits herausgefunden hatte, rangierte London bei den Übernachtungskosten in Europa gemeinsam mit Oslo auf Rang drei, lediglich Zürich und Moskau waren noch um einiges teurer. Ob Ludwig das wusste? Garantiert. Der erfahrene Buchhändler, der ihr auf Sizilien auf bezaubernd altmodische Weise den Hof gemacht und sie letztlich erobert hatte, war immer gut informiert. Drei Jahre war das mittlerweile her, und wenn es nach Ludwig ginge, wären sie längst zusammengezogen. Adele hingegen schob eine Entscheidung weiterhin hinaus. Sie war seit nunmehr achtzehn Jahren Witwe – und an ihre Unabhängigkeit gewöhnt.
Ein Argument, das ein Mann wie Ludwig nicht gelten lassen wollte. Auch er lebte seit seiner bald zwei Jahrzehnte zurückliegenden Scheidung allein. „Du bist jünger und flexibler als ich. Du findest rasch eine andere, die nur allzu gern Tisch und Bett mit dir teilen möchte“, hatte Adele erst vor Kurzem gescherzt, was Ludwig jedoch in die falsche Kehle geraten war. „Komm mir nicht mit den lächerlichen zwei Jahren daher, die du früher auf die Welt gekommen bist. Wenn du mich nicht willst, dann sag es, aber mach keine dummen Witze. Was soll ich mit einer Jüngeren? Ich habe mein ganzes Leben auf eine Frau wie dich gewartet. Und ich werde weiter warten.“
Was bist du doch für eine dumme Gans, schalt sich Adele, als sie an das unerquickliche Gespräch zurückdachte. 78 Jahre und kein bisschen weise. Da macht dir ein kultivierter Mann, den du von Herzen magst, in deinem Alter mehr als einmal einen Antrag, und du lässt ihn zappeln. Als wären wir Teenager, die noch das ganze Leben vor sich haben.
Adele griff nach dem silbernen Bilderrahmen, den sie auf ihrem Schreibtisch aufgestellt hatte, und betrachtete das Foto, das ein fröhliches Paar vor dem Hintergrund des majestätischen Ätna unter einem blitzblauen Himmel zeigte. Sie trug eine rote Bluse zu einem cremefarbenen Leinenkostüm, er ein weißes Hemd zu einer sportlich geschnittenen dunklen Hose. Keine Jeans, die zog er selbst auf Reisen nicht an, dafür fühlte er sich zu alt. Trotzdem verweigerte er Krawatten und erschien selbst zu eleganten Anlässen „oben ohne“.
Die Sonne ließ ihren damals ziemlich kurz geschnittenen Pagenkopf hell aufleuchten, während Ludwigs dichte, graubraun melierte Haare auf dem Bild weit dunkler wirkten als in natura. War er seither so stark ergraut? Das hätte ihr eigentlich auffallen müssen, als Ludwig zu Ostern, vor ein paar Tagen, eigens nach München gekommen war, um ihren Geburtstag mit ihr zu feiern. Nur zu gerne wäre er länger geblieben, aber er musste noch den Rest einer Kur absolvieren, die er ihretwegen unterbrochen hatte. Sein kleines Bäuchlein war ein wenig größer geworden, daran erinnerte sie sich deutlich. Aber man konnte ihn noch immer als schlank bezeichnen – und sie beide als gut aussehendes Pärchen, befand Adele nicht ohne Stolz.
Nach der Englandreise werde ich eine Entscheidung treffen, schwor sie sich. Eigentlich weiß ich jetzt schon, wie sie ausfallen wird, doch eine Galgenfrist will ich mir noch zugestehen. Vorerst bekommt er eine Antwort auf seine Mail.
Betrifft: England-Invasion
Lieber Ludwig,
nur ein mutiger Mann traut es sich zu, gleich mit drei Witwen gen England zu ziehen, aber du kannst natürlich immer noch kneifen. Elena hat ihr Okay gegeben, worauf Ilse nur gewartet hat. Die beiden kommen also auch. Was Du noch nicht weißt: Giorgio ist ebenfalls in London, bei einem Seminar von Scotland Yard, und wir werden ihn sicherlich treffen.
Zur Hotelwahl: Mit Dorchester oder Ritz hinkst Du der Zeit und dem Luxus hoffnungslos hinterher. In London gibt es ein Waldorf Astoria mit 6 Sternen, das liegt natürlich zentral und dürfte Deinen Ansprüchen entsprechen.
Wie vereinbart werde ich für uns ein nettes Zimmer buchen.
Umarmung
Adele
Soll er doch glauben, wir steigen im Astoria ab! Nein, das kann er nicht ernsthaft annehmen, aber für eine Sekunde wird er sich schrecken. Recht geschieht ihm. Bevor Adele es sich anders überlegen konnte, drückte sie die Enter-Taste und schickte die Mail auf den Weg.
3. Kapitel
Beschämt blickte Giorgio auf die beiden Stummel, die er in einer Viertelstunde in den groben Sand des Aschenbechers gedrückt hatte. Für unsereins hat man wahrlich nicht mehr viel übrig. Mehr als einen kleinen, ungemütlichen Raum, in dem ein Ventilator vergebens gegen den beißenden Geruch ankämpfte, den hunderte Zigaretten hinterlassen hatten, stellte New Scotland Yard seinen Beamten nicht zur Verfügung. Unwiederbringlich vorbei waren die Zeiten eines pfeifenqualmenden Sherlock Holmes, für immer dahin die Ära kettenrauchender Detektive. Wenigstens sperrt man uns nicht in winzige, gläserne Zellen, wie auf manchen Flughäfen, in denen man als Raucher wie in einem Käfig sitzt und hämischen Blicken ausgesetzt ist. Aber vielleicht gab es das auch hier – irgendwo in diesem zwanzig Stockwerke hohen Glaspalast, den zu erkunden er noch keine Zeit gefunden hatte.
Erst gestern war Giorgio in London Heathrow gelandet und hatte nach einer mehr als einstündigen Odyssee das Hauptquartier der legendären britischen Polizei erreicht. Weiter als bis zur Empfangshalle war er nicht gekommen, denn dort hatte ein eigens abkommandierter Constable ihn an der Rezeption abgefangen und zu dem gleich um die Ecke liegenden Apartmenthaus begleitet, in dem New Scotland Yard seine Gäste unterbrachte. Zu mehr als einem kurzen Spaziergang hatte er sich danach nicht mehr aufraffen können und war bald zu Bett gegangen.
An die bei einem Straßenstand hastig verschlungene Pizzaschnitte, die ihm wie ein Stein im Magen gelegen war, wollte er lieber nicht mehr zurückdenken, auch nicht an den grässlichen Kaffee heute Morgen im nahen Coffeeshop, den man hierzulande Espresso nannte. Unausgeschlafen, aber pünktlich war er um neun Uhr im Hauptquartier erschienen und sogleich in den Seminarraum im zehnten Stock geführt worden.
Nach zwei Stunden Einführungsvorträgen, denen er zu seiner eigenen Überraschung problemlos folgen konnte, hatte man Styroporbecher herumgereicht. Ein Schluck genügte und Giorgio wusste, dass er das schlammfarbene Gebräu nicht trinken würde. Tee mit Milch und Zucker war eindeutig nichts für einen Sizilianer, der nach einem schaumgekrönten Cappuccino und einer Zigarette lechzte. Kurzentschlossen hatte er nach den Toiletten gefragt und sich auf die Suche nach einem Kaffeeautomaten und einem Raucherraum gemacht.
Sollte er sich tatsächlich noch eine dritte Zigarette anzünden, bevor die kurze Pause zu Ende war? Er war eindeutig nikotinsüchtig, darüber machte er sich keine Illusionen. Übers Aufhören aber hatte er bisher nie ernsthaft nachgedacht. Als Giorgio noch zögerte, trat ein Mann in etwa seinem Alter durch die Glastüre. Der ist auch nicht besser dran als ich, dachte Giorgio, als er aus den Augenwinkeln beobachtete, wie der Mann eine Marlboro aus einem zerknautschten Päckchen fingerte und gierig den ersten Zug inhalierte. Automatisch griff Giorgio nach seinen Diana Rossa, von denen er vorsorglich eine Stange mitgebracht hatte. Ein Kollege in Catania hatte ihn vor den exorbitanten Zigarettenpreisen in England gewarnt.
Lange würde der Vorrat nicht anhalten, wenn er so weitermachte. Andererseits war es sicherlich der falsche Zeitpunkt, sich aus Sparsamkeitsgründen einzuschränken. Wenn er auf die denkbar einfachste Weise mit Einheimischen in Kontakt kommen und beim Plaudern sein Englisch verbessern wollte, dann musste er möglichst viele Rauchpausen einlegen. Und tatsächlich konnte es nicht mehr lange dauern, bis der andere, der ihm bereits freundlich zugenickt hatte, ein Gespräch beginnen würde.
Raucher sind nun einmal kommunikativer als Nichtraucher, lautete Giorgios Credo, das sich bisher stets bewahrheitet hatte. Eine Feststellung, die Elena zwar nicht in Zweifel zog, aber kritisch zu kommentieren pflegte. „Ausreden, nichts als Ausreden, auch wenn es stimmen mag. Ihr tratscht nur deswegen so gern miteinander, weil ihr allesamt ein schlechtes Gewissen habt und Spießgesellen wollt. Wenn du Kontakt suchst, dann leg dir einen Hund zu. Das funktioniert mindestens genauso gut und ist gesünder.“ Ihre spöttischen Kommentare, seit denen er das Thema nicht mehr vertiefen wollte, klangen ihm noch in den Ohren.
Aber wo sollte er hier in London einen Hund hernehmen, fragte sich Giorgio. Hätte er vielleicht Ercole mitbringen sollen? Nicht einmal Elena wäre es gelungen, ihren geliebten Köter an den strengen Quarantänebestimmungen der Briten vorbeizuschmuggeln. Der sizilianische Vierbeiner war diesmal nicht mit nach Wien gekommen, sondern in der Obhut von Freunden in Taormina geblieben. Aber sie selbst würde in drei Tagen hier eintreffen, und erstmals gestand sich Giorgio ein, dass er darüber alles andere als erfreut war. Bei aller Liebe, Elena konnte ziemlich anstrengend sein, und im Moment benötigte Giorgio all seine Energie, um bei Scotland Yard eine bella figura zu machen.
Ab Samstag erwartete ihn jedoch geballte Frauenpower. Auch wenn er Elenas Mutter und Adele Bernhardt sehr schätzte, diese beiden Damen waren ebenfalls wahrlich keine Leichtgewichte. Der arme Ludwig Jakubowski, ganz alleine würde er damit zurechtkommen müssen. Wenn sich dann auch noch Felicitas Cape dazugesellte, hatte er vermutlich gar nichts mehr zu melden.
An Feli, die er vor ziemlich genau zwei Jahren in Libyen kennen gelernt hatte, erinnerte er sich nur flüchtig. Wenn er sich recht entsann, war sie eine zierliche, hübsche Person mit einem schmalen Gesicht und hellen, halblangen Haaren. Ein Frauentyp, der sich sein mädchenhaftes Aussehen bis ins Alter bewahrte. Sie musste mittlerweile auch schon an die 60 sein, überschlug er kurz. Erstaunlich, dass sie es sich noch zumutete, ohne jegliche Erfahrung als Reiseleiterin zu arbeiten. So jedenfalls hatte es Elena dargestellt, als sie ihm erklärte, warum sie Feli unbedingt zu Hilfe kommen müsse.
Wie auch immer, die Invasion aus Österreich und Deutschland war nicht mehr aufzuhalten. Glücklicherweise begann die Gartentour, die Feli zu führen gedachte, gleich am Montag, also galt es bloß, das Wochenende zu überstehen. Giorgio erschrak über sich selbst. Erschienen ihm zwei gemeinsame freie Tage mit Elena tatsächlich als etwas, das überstanden werden musste? Hier in London sehr wohl, gestand er sich ehrlich ein. Von all den neuen Eindrücken fühlte er sich zutiefst verunsichert. Schlimmer noch, er kam sich vor wie der letzte Provinzler – und das war er letztlich ja auch. Seine Auslandsreisen konnte er an den Fingern einer Hand abzählen, während Elena an der Seite ihres verstorbenen Mannes die halbe Welt bereist hatte.
Sie kannte London gut, er war zum ersten Mal hier. Für ihn waren selbst so banale Dinge wie die Orientierung in der U-Bahn ein Problem.
Sie sprach fließend Englisch, er hatte es bloß in der Schule gelernt und erst seit der Einladung von Scotland Yard in einem Crash-Kurs mit einem Amerikaner, der bei den American Forces Italy nahe Catania stationiert war, in aller Eile aufpoliert.
Sie musste in England vor nichts und niemandem eine gute Figur machen, während er als Offizier einer international anerkannten Carabinieri-Einheit den Ruf seiner Behörde zu wahren hatte. Tagtäglich, außer an Samstagen und Sonntagen, und das mehr als zwei Wochen lang.
Unbewusst seufzte Giorgio auf, was ihm die Aufmerksamkeit des Marlboro-Rauchers, der sich eben eine weitere Zigarette anzünden wollte, eintrug. Giorgio zückte sein Feuerzeug.
„Danke. Meines macht es wirklich nicht mehr lange.“
„Ich habe ein zweites in Reserve. Wenn Sie wollen ...“
Das längst überfällige Gespräch zwischen zwei Fremden, die dasselbe Laster teilten, war eröffnet.
„Zu liebenswürdig, aber ich muss ohnedies gleich weitermachen. In der Mittagspause besorge ich mir ein neues. Die Zigaretten gehen mir auch bald aus, also muss ich sowieso zum Automaten.“
„Wo ist denn hier der nächste?“, fragte Giorgio, um irgendetwas zu sagen. „Ich bin erst gestern angekommen und kenne mich noch nicht aus.“
Der Engländer musterte Giorgio mit geschultem Blick. Ein Südeuropäer, kein Zweifel. Das verrieten die dichten, schwarz-grau melierten Haare, die dunkelbraunen Augen und der olivfarbene Teint ebenso wie die lässige Körperhaltung, die den viel zu eleganten Anzug nicht overdressed wirken ließ. Der schlanke Mann mit der geradezu klassischen Nase in dem schmalen, gut geschnittenen Gesicht hätte Spanier oder Grieche sein und sein Englisch in Amerika gelernt haben können. Doch sein grässlicher Akzent erinnerte den in legere Jeans und Blazer gekleideten Scotland-Yard-Beamten spontan an den Protagonisten der Mafia-Serie, die derzeit bei BBC lief.
„Sie sind einer der Gäste, die an dem Seminar unserer Kunstfahnder teilnehmen, nehme ich an. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen Sie aus Italien.“
„Stimmt beides. Valentino mein Name, sehr erfreut.“ Ohne nachzudenken streckte Giorgio seine Hand aus, die vom anderen erst nach kurzem Zögern ergriffen wurde. Verflixt, die Engländer halten nicht viel vom Händeschütteln, erinnerte er sich schlagartig, das hatte ihm sein amerikanischer Freund eingebläut. „Ich arbeite für die italienische Kunstpolizei und leite die Abteilung in Catania.“
„Sie sind also Sizilianer. Das habe ich mir fast gedacht.“ Den Grund dafür verschwieg er besser, aber ein verstohlenes Lächeln konnte sich Giorgios Rauchkumpane nicht verkneifen. „Ich kenne Italien leider nur bis Rom, südlicher bin ich nie gekommen. Aber entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sydney Aaron Smith vom Morddezernat. Detective Chief Inspector Smith, um genau zu sein. Ich sage das nur dazu, weil mein Nachname nicht eben selten ist und falls Sie mich einmal in meinem Büro besuchen wollen, ...“
„… könnte ich in diesem riesigen Glaskasten beim falschen Smith landen“, setzte Giorgio fort, der sich über die neue Bekanntschaft mehr freute, als der andere ahnen konnte. Es war noch gar nicht so lange her, dass er selbst als Kriminalkommissar für Gewaltverbrechen zuständig gewesen war. Eine Zeit, der er bisweilen nachtrauerte, was er sich allerdings nicht einmal selbst eingestehen wollte. Er gab sich einen Ruck. Als Commissario würde er jetzt jedenfalls nicht in London mit einem Kollegen plaudern, sondern hinter seinem Schreibtisch in Trapani versauern.
„Auf meinem Türschild steht: Tenente Colonnello Valentino. Falls es Sie einmal nach Sizilien verschlagen sollte, hier ist meine Karte.“ Giorgio zückte seine Brieftasche aus der Brusttasche seines dunkelgrauen Armani-Anzugs, den er eigens für diese Reise erworben hatte. Auch die Visitkarten waren neu, auf den alten stand noch Maggiore, was dem anderen aber vermutlich ebenso wenig gesagt hätte wie sein jetziger Rang.
„Darüber lässt sich reden. Ich halte viel von einem Bier nach Dienstschluss. Kommen Sie doch, wenn Sie hier fertig sind, mit. Sie finden mich nach sechs p.m. im Golden Horse. Das ist ein Pub gleich am Ende von Strutton Ground. So heißt die kleine Straße auf der anderen Seite der Victoria Street. In dem Viertel kann man übrigens auch mittags gut und preiswert essen. The Laughing Halibut ist bekannt für exzellente Fish ’n’ Chips. Ein kleiner Tipp, falls Ihnen die berühmt-berüchtigte Kantine von Scotland Yard nicht zusagen sollte ...“
Das konnte ja heiter werden. Wie sollte ihm etwas schmecken, was nicht einmal die Engländer mochten, fragte sich Giorgio, der wie jeder Italiener gutes Essen nicht nur über alles schätzte, sondern als wesentlichen Bestandteil des nationalen Kulturverständnisses empfand. Auch Bier war nicht unbedingt seine Sache, aber vielleicht gab es ja in englischen Pubs auch einen halbwegs trinkbaren Wein.
Hungrig, durstig und müde betrat Giorgio am Ende des langen ersten Tages bei Scotland Yard das Golden Horse. Das Essen in der Kantine war noch schlimmer gewesen, als er es sich vorgestellt hatte. Eine wässrige Gemüsecremesuppe, danach ein undefinierbares Stück Fisch, dazu zermatschte Kartoffeln und zu Tode gekochte Rüben. Den giftgrünen Pudding zum Nachtisch hatte er gar nicht erst angerührt.
Das Lokal war gesteckt voll, stickig und laut. Um die Theke scharten sich die Gäste in Dreierreihen, die Stehpulte waren allesamt besetzt. In Sizilien galt Giorgio mit seinen 1,82 Metern als groß, aber vor dieser Wand aus ihm zugewandten Rücken nützte ihm das gar nichts. Entschuldigungen murmelnd bahnte er sich eine Schneise zum Hinterzimmer, in dem er zu seiner Erleichterung Sydney an einem der kleinen Holztische entdeckte. Giorgio war sich nicht sicher gewesen, ob er seinen neuen Freund auf Anhieb erkennen würde.
Detective Chief Inspector Smith sah ziemlich durchschnittlich aus. Er trug seine dunkelblonden Haare seitlich gescheitelt und weder auffallend kurz noch lang, es gab keine Vorboten einer Glatze wie Geheimratsecken oder eine hohe Stirn, und auch die hellen Augen unter den ein wenig struppig geratenen Brauen oder die schmale, leicht höckerige Nase ließen sich nur schwer beschreiben. Lediglich der breite Mund mit erstaunlich großen Schneidezähnen, der sich nun zu einem Willkommenslächeln verzog, verlieh dem Gesicht Charakter.
„Nehmen Sie Platz, Tenente Colonnello. Und verteidigen Sie den Sitz daneben. Was soll ich Ihnen bringen? Die haben recht gute Rotweine hier. Wenn mich nicht alles täuscht, auch italienische. Oder wollen Sie vorher einen Blick auf die Karte werfen?“
„Ich hatte vor, es erst einmal mit einem englischen Bier zu probieren, antwortete Giorgio tapfer. „Ich nehme ganz einfach das gleiche wie Sie.“
„Sie wagen sich an ein Ale?“, fragte Sydney gedehnt. „Dann empfehle ich ein Indian Pale Ale, das ist stärker, allerdings auch herber als die anderen Sorten. Ich habe mit einem gewöhnlichen Pale Ale begonnen, einem sogenannten Bitter, aber ich wechsle gerne beim zweiten Glas.“
Giorgio blickte Sydney nach, der sich gekonnt Richtung Barmann drängte. Das nächste Mal würde er an der Reihe sein, dann konnte er sich auch eine Speisekarte besorgen. Vorerst würde er seinen Hunger bezähmen und darauf hoffen, dass sich das Lokal allmählich ein wenig leerte. Die Aussicht, irgendetwas hinunterzuschlingen, während der Ellbogen des Nachbarn beinahe in den eigenen Teller hing, gefiel Giorgio nämlich ganz und gar nicht.
Zwei Stunden später sollte sich seine Hoffnung, in Ruhe essen zu können, erfüllen. Der Ansturm auf das Pub, in dem sich die Angestellten der umliegenden Bürogebäude allabendlich ein Stelldichein gaben, hatte sichtlich nachgelassen. Das von Sydney empfohlene Lamm mit Minzsauce war zu Giorgios Erleichterung schon aus, aber Cornish Pasty gab es noch – und dieses Gericht entpuppte sich als überraschend wohlschmeckende Fleischpastete in Blätterteig. Dazu genoss er sein drittes Glas Barolo.
Zwei hatte er bereits nach seinem ersten und letzten Versuch, dem bitteren Ale etwas abzugewinnen, auf leeren Magen getrunken. Er spürte die Wirkung des Weins, was nicht unangenehm war, da der leichte Schwips sein Englisch deutlich verbesserte. Seine Hemmungen waren gefallen, ungeniert und locker plauderte Giorgio in der für ihn ungewohnten Sprache drauflos.
„Unsere Lebensgeschichten sind fast austauschbar. Auch wenn du Jura studiert hast und ich Germanistik, letztlich sind wir bei der Polizei gelandet. Beide haben wir zwei erwachsene Kinder, sind geschieden, möchten gerne wieder heiraten, nur unsere Freundinnen denken nicht einmal im Traum daran. Weil sie ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wollen.“
„Du lebst mit deiner Elena wenigstens zusammen. Meine Deborah beharrt auf ihrer eigenen Wohnung“, räsonierte Sydney mit schwerer Zunge. „Und das bei den Mieten hier! Ich hätte gute Lust, eine Zwei-Mann-Kommune zu gründen. Damit wären meine finanziellen Probleme gelöst.“
Auch Giorgio war längst alles andere als nüchtern und ebenfalls in weinerlicher Stimmung. „Gute Idee. Wenn Elena mich nicht mehr will, komme ich nach London und wir gehen gemeinsam auf Mörderjagd ...“
„Du bist bei der Kunstpolizei, schon vergessen? Aber es klingt ganz so, als würdest du den Wechsel zu den Fahndern nach gestohlenen Schätzen bereuen. Was ich gut verstehen könnte. Ich möchte mit keinem der Kollegen von der Art Theft Squad tauschen“, stieß Sydney hervor. In unmittelbarere Nähe saß niemand mehr, dennoch senkte er die Stimme. „Unsere Abteilung für gestohlene Kunst und Antiquitäten pfeift finanziell aus dem letzten Loch. Wenn man ihnen noch einmal das Budget kürzt, ist Schluss mit lustig.“
„So schlimm?“