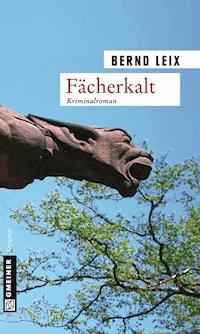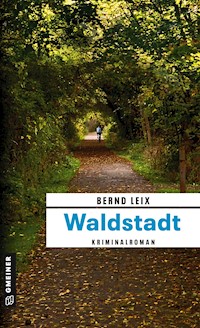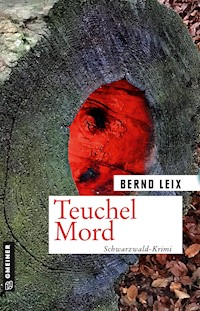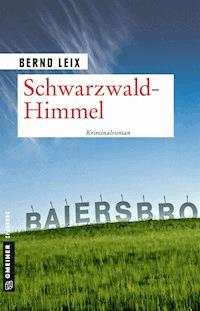Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Gmeiner-VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalhauptkommissar Oskar Lindt
- Sprache: Deutsch
Aufruhr im nördlichen Schwarzwald: Die grün-rote Landesregierung plant einen Nationalpark! Die Bevölkerung zwischen Bad Wildbad und Freudenstadt ist gespalten: Tourismusmagnet oder Ökodiktatur? Befürworter und Gegner des Projekts stehen sich unversöhnlich gegenüber. Als die heftigen Unruhen sich immer weiter ausbreiten, schickt die Landesregierung den erfahrenen Karlsruher Kommissar Oskar Lindt als verdeckten Ermittler in das Krisengebiet …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Bernd Leix
Mordschwarzwald
Oskar Lindts achter Fall
Zum Buch
Schwarzwälder Wutbürger Aufruhr im nördlichen Schwarzwald: Die grün-rote Landesregierung plant einen Nationalpark! Die Bevölkerung zwischen Bad Wildbad und Freudenstadt ist gespalten: Tourismusmagnet oder Ökodiktatur? Pöbeleien bei Informationsveranstaltungen und Leserbriefschlachten in der Tagespresse wechseln sich ab, Befürworter und Gegner des Projekts stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Wut in der Bevölkerung wächst. Risse gehen mitten durch Familien, Rachepläne werden geschmiedet. Als die Unruhen sich ausweiten, beruft die Polizei eine Krisensitzung ein. Da aber auch die örtliche Ordnungsmacht in Befürworter und Gegner gespalten ist, wird auf Geheiß der Landesregierung der erfahrene Karlsruher Kommissar Oskar Lindt mit seinem Team als verdeckter Ermittler in das obere Murgtal beordert.
Bernd Leix ist Schwarzwälder durch und durch. Er hat Forstwirtschaft studiert, lebt und arbeitet in Freudenstadt. Als Revierförster betreute er viele Jahrzehnte die Wälder rings um das Klosterstädtchen Alpirsbach. Zuvor war er einige Zeit im von Kriminalität durchdrungenen Karlsruher Hardtwald tätig. Deshalb machte er anfangs die badische Fächerstadt zum Schauplatz seiner Krimis um den behäbigen, Pfeife rauchenden Kommissar Oskar Lindt. Doch der Mordermittler aus der badischen Großstadt ist schwarzwaldbegeistert und wird geradezu von den dunklen Wäldern und den dort geschehenen Verbrechen angezogen.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Saimen. / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4094-6
1
NEIN
Blut-Rot! Dicke blutrote Buchstaben, jeder einen guten Meter hoch, prangten übereinander an den toten Bäumen. Stellenweise fast schwarz, so dunkel wie geronnenes Blut, dunkelrot und fett, extrabreit hingeschmiert.
Das untere N mindestens drei Meter über dem Boden, das obere N bis zu acht Metern in der Höhe. 24 Mal!
Dunkles Blut auf silbergrauem Totholz. 24 tote Fichten, ohne Rinde, ohne Nadeln, ohne Zweige. Aus dem Stamm ragten nur noch starke, abgebrochene Äste, dick und kraftvoll wie ein Männerarm.
Vor Jahren bereits dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen, dem langsamen Zerfall preisgegeben, trotzdem immer noch stolz und aufrecht. Unbeugsam und aufrecht im Bannwald am Wilden See.
Jetzt zu neuem Leben erweckt, zu blutigem neuen Leben. 24 Stämme, 24 Mahnmale, 24 Zeichen des Widerstandes.
Die Bilder schockierten die Zeitungsleser. ›Kampf um Nationalpark in neuer Dimension‹, titelten die Karlsruher Badischen Neuesten Nachrichten. ›Es wird ernst im Nordschwarzwald‹, schrieb die Stuttgarter Zeitung. Selbstverständlich alles in Farbe.
›Blutiger Bannwald! Nationalparkgegner wehren sich‹, schleuderte sogar Europas größte Tageszeitung ihren Lesern ins Gesicht.
Sieben Fernsehsender schickten Kamerateams in die unwegsame Gegend, filmten abwechselnd Kommentare von Naturschützern, Forstleuten und Lokalpolitikern – dann wieder die beschmierten Fichten.
Wilde Gerüchte machten die Runde. Wer auch immer die Bäume erklettert hatte, für die Bevölkerung im oberen Murgtal gab es tagelang kein anderes Thema. Nach den Tausenden von Autoaufklebern und den riesigen Plakaten, ›Nationalpark‹ in grün, schräg durchgestrichen mit einem dicken roten Balken, war das eine neue, eine spektakuläre Aktion des Widerstandes.
Die Stammtische kochten: »Da stecken fitte junge Kerle aus der Bergwacht dahinter … Wer sonst hat die Ausrüstung, um dort hochzuklettern? … Und das noch bei finsterster Dunkelheit … Nur mit Seiltechnik und Stirnlampen möglich … Einer allein schafft das nie … Alles in einer Nacht! Respekt!«
Unter der Hand wurden Namen gehandelt, doch niemand bekannte sich zu der Tat.
Die Ängstlichen sorgten sich: »Eskaliert der Streit? Was folgt als Nächstes? Wird bald echtes Blut vergossen?«
Die Besonnenen mahnten: »Zurück zur sachlichen Diskussion!«
»90 Prozent der Bevölkerung sind dagegen!«, schleuderte ein korpulenter Gemeinderat in die Fernsehkameras und zeigte auf die roten Buchstaben. »Unsere Bäume wehren sich, sehen Sie doch, wie sie schreien: Kein Nationalpark! Nein! Die Natur sich selbst überlassen, ha, wenn ich das schon höre. Hemmungslos wird sich der Borkenkäfer ausbreiten! Alles wird er fressen!«
Die Argumente der Naturschützer, dass auch sterbende Bäume zum Kreislauf der Natur gehörten und in totem Holz ein immenser Artenreichtum zu finden sei, gingen in den Buh-Rufen der Gegenseite unter.
Die aktiven Waldarbeiter und Förster hielten sich – wie man es ihnen nahegelegt hatte – in der Öffentlichkeit zwar mit wertenden Äußerungen zurück, doch gerade in diesem Berufsstand gärte es besonders. Findige Köpfe fanden problemlos andere Sprachrohre.
Ein Fernsehteam von RTL wurde zu einem abseits gelegenen kleinen Gehöft im Baiersbronner Teilort Mitteltal lanciert, wo zwei alte Frauen bereits auf die Journalisten warteten. Die beiden gebeugten ledigen Schwestern in Kopftüchern, Kittelschürzen und groben Arbeitsschuhen waren total in Rage und schwangen drohend kurzstielige Hacken wie Kriegsbeile: »Damit haben wir Hunderttausende von kleinen Bäumen gepflanzt. Unser ganzes Leben haben wir im Wald gearbeitet und ihn gepflegt. Hier, schauen Sie doch, unser Werk, unser Wald. Grüner Wald, gesunder Wald! Dafür haben wir uns krumm und bucklig geschuftet. Und jetzt? Das alles wird kaputtgehen! Es soll sich bloß keiner von diesen Grünen hier blicken lassen!« Grimmig ließen sie die Hacken niedersausen und kampfeslustig funkelten ihre Augen aus den wettergegerbten Gesichtern.
Ein längst pensionierter Holzhauer in grüner Latzhose und schwarzer Zipfelmütze, der sich bei jedem Schritt schmerzverzerrt seine abgenutzte Hüfte hielt, haute in dieselbe Kerbe. Stolz zeigte er eine lange Handsäge und seine blitzende Axt. »Damit haben wir angefangen. Früher, als es noch keine Motorsägen gab. Trotzdem war der Wald sauber. Nirgends ein dürrer Baum zu sehen. Alle haben wir rausgeschlagen. 20 Mann waren wir damals in einem Revier. Und heute? Kaum noch drei!« Er holte aus und hieb medienwirksam krachend mit einem schmetternden Schlag seiner Axt eine dicke Brennholzrolle entzwei. »Mir kann ja nichts mehr passieren«, schnaufte er. »Ich bin zum Glück schon lange in Rente. Aber unsere Jungen, die haben Angst, die müssen das Maul halten.«
Dem widersprach ein leitender Forstbeamter ganz energisch. »Es gibt keinen Maulkorb. Jeder darf seine Meinung sagen, aber bitte sachlich.« Höhnisches Lachen erschallte aus dem Hintergrund. »Es traut sich ja doch keiner!«
Nach und nach geriet die spektakuläre Aktion vom Herbst des Jahres 2011 wieder in Vergessenheit. Die Leserbriefschlachten in der regionalen Presse flauten ab, es gab kaum noch öffentliche Diskussionsveranstaltungen, und auch die unverhohlenen Drohungen gegen die wenigen sich öffentlich bekennenden Befürworter des Naturschutzgroßprojekts ließen nach.
Nur in manchen Wirtshäusern krachte ab und zu noch eine grobe Faust auf die Tischplatte. »Wir sollten es mal einem von denen so richtig geben. Nachts! Sack über den Kopf und dann alle drauf!« Die Zechkumpane nickten beifällig, aber mehr als Drohungen gab es nie, denn: »Sei lieber still. Wenn wirklich einer mal den Ranzen vollkriegt, dann weißt du ja, dass die Bullen zuerst bei dir vor der Tür stehen.«
Die Beamten der Freudenstädter Polizeidirektion waren natürlich nicht untätig geblieben und hatten die beschmierten Bäume eingehend untersucht. Fassadenfarbe, wetterfest, verbreitetes Baumarktprodukt, Farbton Schwedisch-Rot, abgedunkelt mit schlecht gemischten 20 Prozent Dunkelbraun, aufgetragen mit einer breiten Malerbürste, waren die Ergebnisse der Farbanalyse. Mit Aluleitern, die sie mit stabilen Gurten an den Bäumen festgespannt hatten, waren die Kriminaltechniker hinaufgestiegen, um Proben zu nehmen. Fallsicherungen und Bergsteigerhelme mit Kinnriemen waren Pflicht. Tatsächlich konnten in zehn Metern Höhe Faserspuren auf der Oberseite einzelner Aststümpfe gesichert werden. Dort mussten die Kletterseile befestigt gewesen sein. Ein Vergleich mit dem Material der Bergwachtgruppe Obertal brachte keine Übereinstimmung. Ein hörbares Aufatmen ging durch die Reihen der ehrenamtlichen Bergretter. Zum Glück keiner von ihnen. Daraufhin wurden sämtliche Baumpflegebetriebe im näheren Umkreis untersucht. Tatsächlich verwendeten sieben davon für ihre Arbeit in den Baumkronen Kletterseile der Marke, zu der die gesicherten Fasern passten. Schnell war jedoch klar, dass es sich um Standardseile handelte, die von mehreren Fachversandhäusern vertrieben wurden.
»Keine Chance, einen gerichtsfesten Nachweis zu führen«, resümierte der Leiter der Kriminaltechnik. »Die Farbe ist bei zwei Baumarktketten vorrätig, und die Kletterausrüstung kann sich jeder besorgen. Wir haben sogar die Kundendaten der Versandhäuser überprüft, um herauszufinden, welche ›Eichhörnchen‹ im nördlichen Schwarzwald mit den Seilen beliefert wurden. Keine Chance. Das Material ist seit Jahren bewährt und tausendfach verkauft worden. Sogar Gemeindegärtnereien und Forstbetriebe haben sich damit eingedeckt.«
Die Ermittlungsakten wurden geschlossen, und die Witterung begann an der Farbe der 24 bemalten Fichten zu nagen. Trotzdem pilgerten ganze Scharen von Wanderern an den Wildsee, und selbst als der Winter hereinbrach, stapften Touristen auf Schneeschuhen in den Bannwald, um das nun deutschlandweit bekannte blutrote Kunstwerk des Widerstandes gegen den geplanten Nationalpark zu betrachten.
Erst, als die Schneedecke höher und höher wurde, breitete sich Ruhe über dem Gebiet aus. Ruhe? Trügerische Ruhe!
2
Der nächste Coup geschah in der Nacht zum vierten Januar.
Starker Schneefall war bereits seit zwei Tagen vorhergesagt worden. Ideale Bedingungen, die geplante Tat umzusetzen.
Der letzte Unimog des Räumdienstes hatte den Ruhestein an der Schwarzwaldhochstraße gegen 22 Uhr passiert. Bis mindestens drei Uhr am nächsten Morgen war mit keinem weiteren Schneepflug zu rechnen.
Um ein Uhr kämpfte sich ein dunkelgrauer Subaru–Kombi von Baiersbronn – Obertal her die vielen Kurven der Ruhesteinstraße hinauf. Trotz Allradantrieb brauchte es viel Schwung und fahrerisches Geschick, um mit dem Fahrzeug bei schwerem nassem Neuschnee die Passhöhe zu erreichen. Dicke Flocken, fast waagerecht getrieben von einem starken Südwestwind, blendeten im Fernlicht und erschwerten die Orientierung ungemein. Die beiden Insassen des Wagens kannten sich aber sowohl mit der Strecke als auch mit den Widrigkeiten des Schwarzwaldwinters bestens aus und bogen zielsicher auf den Parkplatz unterhalb des Skiliftes ein. Dort verbargen sie den Wagen im Schatten eines hohen Schneewalles. Dieser Vorsichtsmaßnahme hätte es aber gar nicht bedurft, denn kein weiteres Fahrzeug getraute sich, bei diesem Schneesturm in der tiefen Nacht über den Ruhesteinpass zu fahren.
Ohne Worte stiegen sie aus. Weiße Flecktarnanzüge aus Bundeswehrbeständen machten die zwei Männer in der weißen Hölle nahezu unsichtbar. Sie zurrten die Bänder ihrer Kapuzen fest, der eine nahm einen Kunststoffeimer, der andere einen breiten Pinsel aus dem Kofferraum des Kombis. Dann stapften sie los, durch den nassen Neuschnee im Schutz der aufgetürmten Schneeberge bis zum oberen Ende des langgezogenen Parkplatzes.
Trotz des Schneetreibens war die Nacht nicht völlig dunkel. Das Weiß brachte eine leichte Helligkeit über die Landschaft, woran sich ihre Augen bald angepasst hatten.
Sie brauchten nur fünf Minuten, bis sie vor dem imposanten Gebäude standen.
Die Villa Klumpp, letztes Zeugnis einer längst vergangenen Hotelära, beherbergte seit einigen Jahren das Naturschutzzentrum Ruhestein, kurz NAZ genannt. Mit hohem finanziellem Aufwand verschiedener öffentlicher und privater Geldgeber und enormem persönlichen Engagement der Mitarbeiter war unter dem Dach einer Stiftung diese Einrichtung geschaffen worden. Mit sehenswerten Ausstellungen und einer Vielzahl von Veranstaltungen wurde den Besuchern die Einmaligkeit der Schwarzwaldnatur nähergebracht. Wildniscamps, Schneeschuhwanderungen und geführte Touren über die Grinden gehörten genauso zum Programm wie naturpädagogische Angebote für Kinder. Sehr gefragt waren auch Führungen über den Lothar-Pfad, der mit vielen Auf- und Abstiegen über die umgeworfenen Bäume führte, die der Weihnachtsorkan von 1999 brutal entwurzelt hatte. Auf einer ausgesuchten Fläche neben der Schwarzwaldhochstraße waren sie nicht beseitigt worden, um so die natürliche Dynamik aufzuzeigen. Mittlerweile hatte sich dort im Schutz der vermodernden Baumleichen ohne jegliches menschliches Zutun ein sehr artenreicher Jungwald entwickelt.
Seit Beginn der Diskussion, ob im Nordschwarzwald ein Nationalpark eingerichtet werden soll, wurde das Naturschutzzentrum als Keimzelle dieser Idee angesehen. Die Teile der Bevölkerung, die ein solches Großschutzgebiet rigoros ablehnten und es mit allen Mitteln bekämpften, betrachteten das NAZ und seine Mitarbeiter deshalb mit stetig zunehmender Feindseligkeit.
Was die beiden jungen Männer in ihren Tarnanzügen an die Sandsteine des historischen Gebäudes und an die Umfassungsmauer schmierten, war wieder eindeutig: N E I N
Die Botschaft konnte nicht missverstanden werden: Hände weg von unserem gepflegten Wald, Hände weg von unserer Heimat!
N E I N
Nach einer Viertelstunde war jede vom Erdboden aus erreichbare Fläche rings um die ehrwürdige Villa mit den blutroten Buchstaben beschmiert. Einer hielt den Eimer parat, der andere pinselte im Eiltempo.
Der Sturm jagte heulend dichte Schneeschwaden vor sich her und übertönte jegliches weitere Geräusch. Er hüllte alles knietief in eine schwere feuchte Watte und deckte die Fußspuren der jungen Männer sofort wieder zu – beste Voraussetzungen, um den Plan ungestört zu Ende zu bringen.
Allerdings deckte das Weiß auch die Unebenheiten im Gelände zu. Zwei Mal war der Bursche, der den Eimer trug, schon gestolpert. Mit Mühe und Not hatte er sich noch abfangen können. »Mensch, pass doch uff!«, hatte ihn der andere ungehalten angeraunzt, doch es nutzte nichts. Direkt vor der Haustür glitt der Eimerträger wieder aus. Dieses Mal hatte er keine Chance. Es zog ihm den Boden unter den Füßen weg, der Mann flog rückwärts in den Schnee und der Farbeimer entleerte sich laut polternd gegen die Haustür.
Augenblicklich erschallte von drinnen wütendes Hundegebell. Die beiden Kerle erstarrten vor Schreck. Wenig später flammte im oberen Stock Licht auf.
»Los, nichts wie weg!« In panischer Angst, der Hund könnte ins Freie gelassen werden, rannten die zwei, so schnell es die hohe Schneelage zuließ, zurück zu ihrem Wagen.
Sie rissen die Türen auf und ließen sich auf die Sitze fallen.
»Abfahrt, gib Gas!«
Der Fahrer startete den Motor und trat das Pedal voll durch. Ein kräftiger Ruck am Lenkrad – das Wendemanöver mit ausbrechendem Heck gelang auf Anhieb, doch beim Einfahren in die Straße musste ein Schneepfahl dran glauben. Krachend zersplitterte das Holz. Vor Schreck trat der Fahrer voll auf die Bremse. Der Wagen rutschte quer über die Straße und blieb dort im Schnee stecken. »Mann!«, brüllte sein Kumpan.
Rückwärtsgang rein, raus aus dem Haufen, Glück gehabt. »Allrad«, grinste der Kerl am Steuer. »Mit jedem anderen Karren wären wir stecken geblieben!« Dann wieder Vollgas. Runter ins Tal. Weiterhin dichtes Schneetreiben. Sichtweite maximal 30 Meter. Alle Leitpfosten zugeweht, nur die langen Schneepfosten als Orientierung.
Als Einheimische kannten sie die Strecke in- und auswendig, bei jedem Wetter, zu jeder Jahres- und zu jeder Tageszeit. Doch jetzt waren sie in Panik und die Sicht total schlecht.
Die Linkskurve kam völlig unerwartet. Der Wagen war viel zu schnell, schleuderte mit der Breitseite nach rechts, durchbrach den Schneewall, knallte hart gegen die Leitplanke dahinter und schrammte funkensprühend fünf Meter daran entlang.
Hektisch riss der Fahrer am Steuer. Der Subaru stellte sich quer, drehte einmal um die eigene Achse, brach erneut durch den Schnee und … Abflug!
Direkt nach dem Ende der Leitplanke schoss das Auto den Steilhang hinunter. Schneller und schneller wurde der alte graue Kombi. Nichts, was ihn aufhielt. Knirschend schanzte er über zwei Felsblöcke, dann kam die Tanne.
Ein infernalisches Krachen – Stille! Totenstille!
Bewegungslos hingen die jungen Männer in den Splittern der Frontscheibe. In breiten Bächen rann ihnen das Blut über die kurzgeschorenen Schädel. Scharfer Benzingeruch durchzog den nächtlichen Winterwald. Ein losgerissenes Kabel im völlig zerstörten Motorraum schlug Funken …
Das Feuer erlosch nach einer halben Stunde von selbst, doch erst um halb elf Uhr am folgenden Vormittag entdeckte der Beifahrer eines Lastwagens das bereits wieder schneebedeckte Wrack tief unterhalb der Fahrbahn.
Noch vor dem Rettungsdienst und der Polizei war die örtliche Feuerwehr aus Baiersbronn – Obertal am Unfallort.
Ein Blick von der Straße aus genügte dem Kommandanten. »Unfallfahrzeug im Steilhang. Mit Seilsicherung zur Lageerkundung.«
Er teilte zwei junge sportliche, aber dennoch bereits erfahrene Männer ein. Gehalten durch ihre Kameraden tasteten sie sich an langen Seilen Schritt für Schritt durch das tief verschneite, felsige Gelände nach unten. Immer wieder brachen sie bis zur Hüfte in zugewehte Löcher ein oder sie rutschten ab, weil ihre Sohlen auf der vermoosten Oberfläche eines Felsens keinen Halt fanden. Die letzten zehn Meter waren sogar so steil, dass sie es vorzogen, sich umzudrehen und rückwärts auf allen Vieren weiter hinunterzukrabbeln.
Trotz der Minusgrade waren die Männer vor Anstrengung völlig nassgeschwitzt, als sie endlich am Heck des Fahrzeugwracks ankamen. Der Schweiß tropfte unter ihren Feuerwehrhelmen hervor und lief über die Gesichter.
»PKW hat gebrannt«, gaben sie ihren ersten Eindruck über das Handfunkgerät als Lagemeldung durch. Dann arbeiteten sie sich seitlich am Wagen entlang. Durch die geborstenen Scheiben konnten sie zwar ins Innere des Fahrzeugs sehen, hatten aber große Mühe, etwas zu erkennen. Alles voll mit hereingewehtem Schnee, dickes Weiß bedeckte verkohltes Schwarz.
Vorn am Wagen war das chaotische Bild der Zerstörung besonders unübersichtlich. Durch den Aufprall an dem dicken Baum hatte sich die Motorhaube hoch aufgefaltet. Jetzt, nach Stunden war von dem Blechberg nichts mehr zu sehen, nichts als ein unförmiger Schneehaufen. Genauso auch im Bereich der zersplitterten Frontscheibe. Einer der Feuerwehrleute versuchte mit seinen dicken Handschuhen den Schnee zur Seite zu schieben. Jäh wich er zurück. Was er freigelegt hatte, ergab ein schauerliches Bild: schwarz verbranntes Fleisch, verkohlte Haarstoppeln, aufgeplatzte Kopfhaut, die Augen noch ganz, aber prall und riesengroß aus ihren Höhlen getreten, kurz vor dem Bersten.
Der zweite Feuerwehrmann machte auf der Beifahrerseite des Wagens dieselbe grässliche Entdeckung. »Zwei Personen, tot, verbrannt«, keuchte er in das Funkgerät.
Eine grausige Ahnung durchfuhr ihn. So schnell er konnte, hastete er durch das knietiefe Weiß zurück zum Fahrzeugheck und wischte den Schnee vom Nummernschild. Dann sank er in die Knie.
»Was ist denn?«, rief sein Kamerad, doch er bekam keine Antwort. Dann sah auch er die gerade noch zu entziffernden Reste des von der Hitze verbogenen Kennzeichens. Fassungslos kauerten die zwei Männer hinter dem Wagen und konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.
»Was ist denn los bei euch da unten?«, ertönte die Stimme des Kommandanten aus dem Funk.
Nach endlosen Sekunden kam die Antwort: »Wir kommen hoch.«
Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, kletterten die zwei Feuerwehrmänner in ihren eigenen Spuren wieder nach oben zur Straße. Der Einsatzleiter sah ihre Gesichter und begann zu ahnen, was die beiden gesehen hatten. Er nahm sie zur Seite, weg von den Übrigen.
Kurze Zeit später kehrte er zur wartenden Gruppe zurück. Er trat auf einen älteren Feuerwehrmann zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und schob ihn in Richtung des zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungswagens.
Dann schallte ein markerschütternder Schrei durch den Winterwald: »Mein Bub!« Mit einem schweren Nervenzusammenbruch musste er ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Kommandant versammelte die Mannschaft um sich, doch er brachte kaum einen Ton über die Lippen: »Ziemlich sicher der Frank und der Patrick.« Die bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Toten waren zwei aus ihren eigenen Reihen.
Bei der Obduktion stellte die Gerichtsmedizinerin später lapidar fest: »Todesursache: Genickbruch. Ohne Sicherheitsgurte sind auch die Airbags nutzlos. Aber vielleicht war es besser so. Mit Gurt wären sie bei lebendigem Leib verbrannt, eingeklemmt in ihren Sitzen.«
Das Wehklagen war groß. Entsetzen machte sich im Baiersbronner Teilort Obertal breit, und die Kunde von dem schrecklichen Unfall sprach sich wie ein Lauffeuer herum.
Patrick, ein 20-jähriger Schlossergeselle, und sein bester Freund Frank, 22, Mechaniker in einem großen Freudenstädter Industriebetrieb – fassungslos nahmen die Familien die schreckliche Nachricht auf.
Drei Notfallseelsorger wurden herbeigerufen, um die Angehörigen und die schockierte Feuerwehrmannschaft zu betreuen.
Je mehr Zeit verstrich, umso mehr verwandelten sich in dem kleinen Dorf und im gesamten oberen Murgtal die Fassungslosigkeit und die Trauer in Wut. Blinde brutale Wut. Wer war schuld an allem? Nicht die jungen Männer, die bei ihrer Flucht von der Straße abgekommen waren, nein, schuld war … nur der geplante Nationalpark!
Ohne ihn würden sie noch leben, die Hoffnungen ihrer Familien, die Zukunft von Obertal!
»Zwei Tote wegen Nationalpark!« Eine neue Sensation in fetten Lettern für Deutschlands größte Boulevardzeitung. »Bevölkerung in Aufruhr!« Erbarmungslos druckten die Journalisten Friedhofsbilder von tränenüberströmten Angehörigen, die bei der Beerdigung gebeugt hinter den Särgen hergingen.
»Großvater schwört Rache!« Ein grimmig dreinblickender, graubärtiger Alter wurde mit erhobener Faust groß abgebildet: »Das bleibt nicht ungesühnt! Auge um Auge!«
Mehrere Wochen lang traute sich kaum einer, der sich bereits öffentlich pro Nationalpark ausgesprochen hatte, nachts allein auf die Straße.
Die Amtsträger hüllten sich betroffen in Schweigen und waren heilfroh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht Stellung beziehen zu müssen, wie sie zu den Planungen eingestellt waren.
Auch der vor wenigen Wochen gegründete ›Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald‹ hielt sich mit Aktionen und Pressemitteilungen zurück. Allzu explosiv war die Stimmung in der Bevölkerung.
Einzig der Pfarrer von Obertal bewies Mut. Bei der Beerdigung der jungen Männer hatte Heinrich Wieland in seiner Ansprache am offenen Grab den Zusammenhang mit der Farbattacke zwar bewusst ausgeklammert, und sich Tage später noch geärgert, dass er nicht wenigstens versucht hatte, die pietätlosen Pressefotografen aus dem Friedhof zu verweisen, aber jetzt, im Sonntagsgottesdienst in der kleinen, dunklen, ganz aus Holz gebauten Kirche, gebrauchte er in seiner Predigt deutliche Worte: »Es war ein tragisches Unglück, bei dem zwei junge Menschen aus unserer Gemeinde auf furchtbare Weise zu Tode gekommen sind. Ein Unfall, der uns sprachlos macht und der tiefe Trauer über die Eltern, Geschwister und Verwandten, ja über uns alle gebracht hat.«
Er holte tief Luft, dann fuhr er fort: »Aber wir müssen wissen, es war ein Unfall, nichts als ein Unfall. Kein Außenstehender trägt daran die Schuld.«
Ein Raunen ging durch das Gotteshaus. Offensichtlich wusste die Gemeinde sofort, worauf der Pfarrer hinauswollte. Er bemerkte es, doch unbeirrt machte er weiter: »Es gibt niemanden, der dafür verantwortlich ist. Niemanden, der deswegen zur Rechenschaft gezogen werden kann.«
Die Lautstärke im Kirchenschiff nahm zu.
»Niemandem steht es zu, sich deswegen an irgendjemandem zu rächen.«
Einzelne Zwischenrufe drangen auf die Kanzel: »Es reicht!« »So ein Quatsch!« »Genug jetzt!« »Was soll das?« »Aufhören!«
»Ich sage Euch«, versuchte Wieland mit erhobener Stimme die Störer zu übertönen: »Ich sage Euch, wer Rache schwört, der versündigt sich! Ich appelliere an Euch alle …«
Weiter kam er nicht, denn die ersten Zuhörer standen geräuschvoll auf und verließen lautstark polternd die Kirche. Es traute sich zwar keiner, nach vorn zu kommen, um dem Geistlichen die Meinung zu sagen, aber innerhalb weniger Minuten waren drei Viertel der Gottesdienstbesucher aus der Kirche verschwunden.
Fassungslos hielt sich der Pfarrer am Rand der Predigtkanzel fest. So etwas hatte er noch nie erlebt. Niemals bisher. Und er hatte in den 32 Jahren seines Berufslebens schon oft die Dinge beim Namen genannt.
Doch dann gab er sich einen Ruck: »Wer sich rächt, wird selbst zum Täter. Er ist nicht besser als der andere.« Er schlug die Bibel auf. Diese Stelle hatte er bei seiner Predigtvorbereitung sehr intensiv gelesen: »5. Mose 32, Vers 35«, rief er aus: »Die Rache ist mein, spricht der Herr, Amen.«
Als sich Heinrich Wieland und seine Frau Annerose nach dem Gottesdienst wieder dem Pfarrhaus näherten, erstarrten sie.
R A C H E
Die Quittung für die Predigt.
R A C H E
Übergroß in leuchtendem Rot an der Wand des Pfarrhauses.
Die Polizei stellte später fest, dass es sich um Forstfarbe handelte. Sprühfarbe, wie sie im Wald zum Markieren von Bäumen verwendet wird.
Viele wussten es, aber niemand gab einen Tipp, wer sich das am helllichten Sonntagvormittag getraut hatte. Zwischen der Predigt und der Entdeckung der Schmiererei hatte gerade mal eine halbe Stunde gelegen.
Nach diesem Eklat gingen die Wogen in dem kleinen Schwarzwalddorf noch höher. »Unerhört, dass sich der Pfarrer da einmischt.«
»Denkt er denn gar nicht an die Trauerfamilien?«
»Wie kann er nur so etwas sagen – und auch noch von der Kanzel herunter.«
Einige gaben ihm zwar innerlich recht, aber es traute sich niemand, sich öffentlich auf die Seite des mutigen Geistlichen zu stellen. Stattdessen ballten manche die Faust in Richtung Kirchturm: »Der soll sich bloß da raushalten!«
Tagelang gab es in den Gesprächen der Bevölkerung kein anderes Thema. Auch die Presse bekam Wind von der Angelegenheit, doch die regionalen Zeitungen brachten keinen Bericht darüber.
Deutschlandweit sorgte der Vorfall allerdings für Beachtung. Das bekannte Boulevardblatt trug wie gewohnt dick auf: »Schelte von der Kanzel« »Unsensibler Dorfpfarrer liest die Leviten.«
Mehrere große Nachrichtenmagazine druckten Bilder von Kirche und Pfarrer: »Heinrich W. brüskiert Trauernde.« Sein Foto natürlich mit schwarzem Balken über den Augen.
Besonders groß stellten sie das leuchtende Graffito heraus: »Blutrote Rachedrohung an der Pfarrhauswand.«
Der Dekan bestellte den Pfarrer ein und empfing ihn mit überaus ernstem Gesichtsausdruck. Er wolle sich ja nicht in die Gemeindearbeit seines Amtsbruders einmischen, meinte der Dienstvorgesetzte, aber durch die Veröffentlichungen in den verschiedensten Medien sei die Angelegenheit auch beim Oberkirchenrat in Stuttgart bekannt geworden. »Und dort war man alles andere als begeistert.«
»Was habe ich denn falsch gemacht?«
»Die Gemeinde verlässt während des Gottesdienstes die Kirche und Sie fragen, was Sie falsch gemacht haben?«, gab der Dekan scharf zurück. »Diese Antwort brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu geben.«
»Soll ich vielleicht tatenlos zusehen, was weiter geschieht? Es liegt doch auf der Hand, dass als Nächstes mehr passiert, als nur ein paar Farbschmierereien an den Wänden.«
»Anstatt Seelsorge zu betreiben, haben sie die Kirchenbesucher abgekanzelt. Ich will nicht hoffen, dass Ihre unüberlegte Predigt noch weitere negative Auswirkungen hat. Bitte teilen Sie uns zukünftig an jedem Montag mit, wie viele Ihrer Gemeindeglieder in den Gottesdienst gekommen sind.«
Heinrich Wieland, der Pfarrer des malerischen Schwarzwalddorfes Obertal öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen, doch er unterließ es, denn der Dekan fuhr unwirsch fort: »Und wenn diese Angelegenheit zu einem nachhaltig gestörten Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Gemeinde führt, dann finden wir für Sie auch noch eine andere Stelle. Falls Sie selbst aktiv werden wollen – wo die aktuellen Ausschreibungen zu finden sind, das wissen Sie ja.«
Die Leute, die das guthießen, was an jenem Sonntag in der Kirche gepredigt worden war, trauten sich auch weiterhin nicht, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Manche sagten es dem Pfarrer zwar im persönlichen Gespräch, aber niemand trat für ihn ein.
Der Gottesdienstbesuch ließ stark nach.
3
Die Polizeidirektion Freudenstadt berief aufgrund der Vorkommnisse extra eine Lagebesprechung ein.
»Die Stimmung in der Bevölkerung ist nicht gut«, stellte Polizeidirektor Konrad Hauser fest, »ich bin fast geneigt, sie als explosiv zu bezeichnen. Die Medien heizen das Ganze mit ihren sensationslüsternen Veröffentlichungen ständig an, und ich bin mir wirklich nicht sicher, was noch passieren wird.«
»Wenn tatsächlich etwas Schlimmes vorfällt, steht umgehend die gesamte Presse hier bei uns auf der Matte«, ergänzte Franz-Otto Kühn, der Leiter der Kriminalpolizei. »Dann sind wir dran. Uns wird man fragen, was wir zur Prävention unternommen haben.«
»Also wenn ihr meine Ansicht wissen wollt«, mischte sich Kriminalhauptkommissar Klaus Volz ein, »am besten wäre, diese ganze blöde Nationalparkidee würde schleunigst begraben werden. Dann hätten wir wieder Ruhe im Tal.«
Seine Kollegen betrachteten ihn stirnrunzelnd.
»Nur weil du in Schönmünzach wohnst?«, wollte Kühn wissen. »Von dort unten hört man ja auch nichts Gutes.«
»Was soll das heißen? Jeder darf doch seine Meinung äußern, vor allem, wenn er direkt betroffen ist.«
»Wieso? Wovor haben die Leute denn Angst? Den Borkenkäfer werden die Förster schon in den Griff bekommen.«
»Ha«, lachte Volz trocken. »Das glaubt bei uns da unten niemand. Die Älteren erinnern sich noch, wie diese Viecher in den Nachkriegsjahren zugeschlagen haben. Hek-tarweise haben sie den Wald zerstört. Überall gab es Kahlflächen. Sogar mit ausrangierten Weltkriegspanzern haben die Forstarbeiter damals das Gift ausgebracht. Kalk-Arsen – und alles ohne Schutzbekleidung.«
»Dass du dich da so reinhängst«, wunderte sich Franz-Otto Kühn.
Volz ereiferte sich: »Stell dir doch mal vor, welche Hochwasser es gibt, wenn die großen Wälder im Langenbachtal und in der Schönmünz plötzlich alle absterben.«
»Das kommt davon, wenn man direkt am Bach baut«, witzelte Rainer Rothfuß, der Leiter des Baiersbronner Polizeipostens. »Fließend Wasser vor der Tür und wenn’s dumm läuft, auch im Haus. Ich hab’s dir damals schon gesagt, aber es musste ja unbedingt dieser eine Bauplatz sein.«
Volz ließ sich nicht beirren. »Ich denke da auch an unseren Nachbarort. Die Bauern in Schwarzenberg haben richtig Angst um ihren Wald. Verstehst du? Privates Eigentum. Eigener Wald. Seit Generationen leben die davon. Wer kann schon garantieren, dass nur die Staatswälder gefressen werden? Bei einer Massenvermehrung kennt der Borkenkäfer keine Grenzen. Am Wildsee schlüpfen Millionen junger Käferchen aus. Die trägt der Westwind problemlos 20 Kilometer fort bis weit hinter Besenfeld.«
»Du sprichst schon wie einer, der sich mit der Materie auskennt«, antwortete Franz-Otto Kühn. »Wahrscheinlich hast du auch diesen Anti-Nationalpark-Aufkleber hinten auf deinem Audi.«
»Darauf kannst du Gift nehmen. Ich kann diesem Plan nichts Gutes abgewinnen und sehr viele Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, auch nicht.«
Polizeidirektor Hauser ging dazwischen. »Meine Herren, bitte. Ihre Privatmeinungen sind hier nicht gefragt. Es geht in dieser Besprechung rein um polizeitaktische Fragen. Aber offenbar haben Sie Ihr Ohr ja am Mund der Bevölkerung, Herr Volz. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Wie viel Sprengstoff liegt da drin?«
Der sportlich schlanke Kriminalhauptkommissar, der sich im Dienstgeschäft überwiegend mit Tötungsdelikten zu befassen hatte, zögerte etwas. »So viel Aggression wie in Obertal gibt es bei uns noch nicht, aber die Leute sind verunsichert, und ein paar Scharfmacher hat’s ja bekanntlich überall.«
»Also, was können wir tun?« Hauser schaute in die Runde. »Herr Rothfuß, wie ist Ihre Meinung? Das Gebiet Ihres Postens umfasst schließlich ganz Baiersbronn. Vom Ruhestein oben bis runter nach Schönmünzach. Sie und Ihre Männer sind täglich dort unterwegs.«
Postenführer Rainer Rothfuß strich sich erst über seine blonden Kurzhaarstoppeln und dann über seinen struppigen Schnauzer: »Dienstlich bekommen wir nur wenig mit. Ab und zu sprechen wir mal mit einem der Förster, aber die halten sich alle ziemlich bedeckt. Kaum einer traut sich zu sagen, ob er dafür oder dagegen ist. Angeblich sind die zu Neutralität und rein fachlicher Diskussion vergattert.«