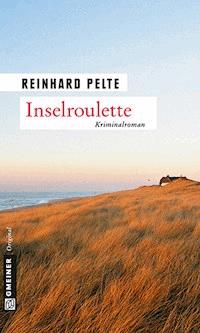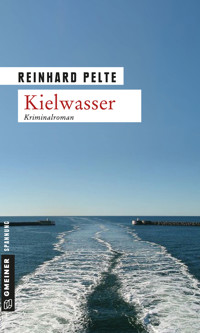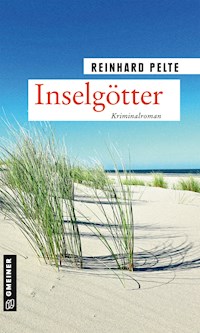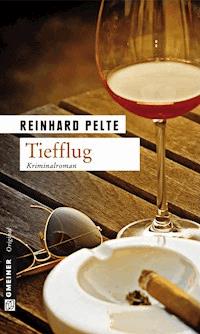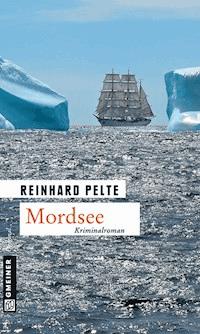
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalrat Jung
- Sprache: Deutsch
Die Untersuchungen zum Fall einer ertrunkenen Kadettin sind abgeschlossen. Lediglich eine Panne zwingt die Soko der Staatsanwaltschaft Kiel noch einmal zu Befragungen auf der „Gorch Fock“, dem Segelschulschiff der Marine. Kriminaloberrat Tomas Jung ist dabei, unterstützt von der Praktikantin Charlotte Bakkens. Je länger sich die beiden mit dem Fall beschäftigen, auf umso mehr Ungereimtheiten stoßen sie. War es wirklich ein Unfall?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Pelte
Mordsee
Der fünfte Fall für Kommissar Jung
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Christoph Neubert
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © PIZ Flottenkdo
ISBN 978-3-8392-4106-6
Widmung
Für Norbert Schatz
»It’s all over now … Baby blue«
Bob Dylan
Prolog
Die von Bord des Segelschulschiffs ›Gorch Fock‹ gestürzte Soldatin sei ohne Fremdeinwirkung gestorben. Das habe das vorläufige Obduktionsergebnis ergeben, teilte die Kieler Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Kadettin sei ertrunken.
Ein Fischereiaufsichtsboot hatte die Leiche am Montag 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland geborgen. Die Offiziersanwärterin war unter ungeklärten Umständen im März über Bord des Segelschulschiffs gegangen. Die Marine hatte eine Woche später die gezielte Suche nach der Frau eingestellt. Die Bundeswehr hatte bei der Rettungsaktion unter anderem zwei Tornado-Flugzeuge mit Wärmebildkameras eingesetzt.
Die Frau war 20 Kilometer vor Norderney aus bislang ungeklärter Ursache über Bord gestürzt. Das Schiff stoppte jedoch erst nach etwa 1500 Metern die Fahrt. Zum Zeitpunkt des Unglücks fuhr die ›Gorch Fock‹ in der Deutschen Bucht zehn Seemeilen (rund 18,5 Kilometer) nördlich von Norderney unter vollen Segeln.
Nach Angaben der Marine war die Schiffslage trotz zwei Meter hoher Wellen und Windstärke sieben ruhig und stabil. Die Marine schloss Nachlässigkeiten bei den Sicherheitsmaßnahmen aus. Die Hoffnung, die Anwärterin noch lebend zu bergen, war von Anfang an gering. Die Wassertemperatur lag bei 13 Grad. Seit 1958 starben fünf Kadetten auf dem Schiff.
*
Glücklich sieht anders aus sagt:
Die Matrosin hat schon vor ihrer Abreise ziemlich unglücklich dreingeschaut. Jemand, der sich wirklich auf die erste große Fahrt mit der ›Gorch Fock‹ freut, sieht m. E. anders aus.
*
Janina sagt:
Ihr seht alle nur dieses eine Bild, so war sie nicht. Sie hat sich wirklich gefreut, dorthin zu dürfen … Aber es ist ja auch ’ne etwas schwerere Sache, für eine Zeit Freunde und Familie erst mal hinter sich zu lassen, oder?
*
Reinhard Squarerigger sagt:
Wer auf Rahseglern gefahren ist, weiß, dass man an Deck bei Routinearbeiten, sail handling usw., sowie auf Seewache keine Schwimmweste trägt. Auch bei Arbeiten im Rigg trägt man keine Schwimmweste, allerdings einen Sicherheitsgurt. Absolut wichtig ist, dass man, besonders als Neuling, bei Sicherheitsbelehrungen genau hinhört und sich entsprechend verhält. Und immer dran denken: ›Eine Hand für dich, eine Hand fürs Schiff.‹
Auf Groß-Seglern fällt man normalerweise nicht so schnell über Bord, da die Schiffe in der Regel ein hohes Schanzkleid rundrum haben, außer auf der Back und achtern. An Deck liegt der Risikobereich besonders auf dem Vorschiff, vielleicht ist sie beim Ausguck über Bord gegangen. Deshalb sollte sich der Ausguck vorne immer mit Sicherheitsgurt einklicken. Was immer auch geschehen ist, dieser Todesfall ist zutiefst bedauerlich und ein tiefer Schock nicht nur für die Angehörigen, sondern für die gesamte Segler-Community.
Mein aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen.
*
Greenpeace sagt:
Wenn man keine Ahnung von der Seefahrt hat, einfach mal …
Es ist nicht möglich, gleichzeitig eine Schwimmweste und einen Lifebelt zu tragen. Ein Lifebelt ist unerlässlich, wenn man bei den Bedingungen ins Rigg will, und das war zu dem Zeitpunkt der Fall.
Windstärke sieben und zwei Meter Welle ist für ein Schiff wie die ›Gorch Fock‹ Alltag. Es ist tragisch, was passiert ist, aber Seefahrt ist und bleibt gefährlich.
*
Genervt von plumpen Aussagen sagt:
›Gorch Fock‹ schon mal in echt gesehen? Zwei Meter Seegang und Windstärke sieben sind kein Problem für so ein Schiff, und es kann dabei auch tatsächlich ruhig liegen. Rettungswesten sind nicht vorgeschrieben. So, und nu?
Nicht immer direkt meckern, sondern vielleicht mal sich kurz schlaumachen …
Vielleicht ist sie einfach gesprungen? Darüber schon mal nachgedacht?
*
Käpten Hook sagt:
Das Mädchen ist der fünfte Todesfall auf der ›Gorch Fock‹. Wann hört der Wahnsinn denn auf? Verschrottet das Schiff, ankert es als Postkartenmotiv im Hafen, aber holt unsere Kinder von diesem Unglücksschiff. Die BW sollte endlich mal aufhören, Steuergelder für so einen romantischen Irrsinn auszugeben.
*
Seemann sagt:
Spannend, was sich hier mal wieder für Klugkoter zu Wort melden, deren nautische Erfahrung sich auf die Kindheitserinnerung an eine Butterfahrt zu begrenzen scheint.
Die größte Lebensgefahr für über Bord gegangene Segler ist die Hypothermie, vor der auch keine Schwimmweste schützt. Bei Wassertemperaturen unter 32 °C ist ein gefährliches Auskühlen des Körpers nicht zu vermeiden. Bei 17 °C Wassertemperatur liegt die Überlebenszeit bei vielleicht zwei bis drei Stunden, selbst mit Neoprenanzug auch nur bei ca. vier bis fünf.
Die ›Gorch Fock‹ ist kein Motorschiff. Mal eben umdrehen ist nicht. Fahrt rausnehmen ist dabei noch das geringste Problem. Dann aber noch gegen den Wind zurückkreuzen und hoffen, den Matrosen auf Anhieb zu finden, ist das weitaus größere.
Je nachdem, wie schnell Lebensrettung vor Ort sein kann, hätte es sicherlich sein können, dass man die Ma-trosin noch hätte retten können. Ein Peilsender mag helfen, aber ist man auf See erst mal im Wasser, dann tickt die Uhr. Ein Garant fürs Überleben ist das in diesem Fall nicht im Geringsten.
Und zu den Wetterbedingungen: Windstärke sieben sind hervorragende Segelbedingungen, und zwei Meter Wellengang sind für ein Segelschiff vom Format der ›Gorch Fock‹ wie Kinderkarneval.
*
na und sagt:
Tragisch für die Familie, aber ansonsten – was soll’s, täglich sterben zig Tausende, also abhaken und weiter geht’s. Windstärke sieben und zwei Meter Wellen sind wirklich nicht heftig. Mal sehen, ob die Obduktion nicht doch ein Verbrechen oder Drogen an den Tag bringt.
*
Suzi sagt:
Die Kadettin ist ohne Fremdeinwirkung gestorben? Sicher, ertrunken ist sie allein, aber man (frau) fällt doch nicht einfach so über Bord.
Ich hoffe doch, dass die Staatsanwaltschaft da weiter ermittelt, denn immerhin ist es in der BW ja schon mehrfach zum Tode von Frauen gekommen, an denen ihre männlichen Kameraden die Schuld hatten.
Jung
Der Fisch musste viele Kilo wiegen. Er nippte an einem Büschel Wasserpest. Dann wälzte er sich auf den Rücken, kam an die Oberfläche und öffnete sein Maul. In das runde Loch floss das Wasser wie in einen deckellosen Gulli.
Als Sylvesterkarpfen ist er nicht mehr zu gebrauchen, dachte Jung. Er lehnte über der Brüstung des Schlossgrabens und bewunderte, wie der Fisch behäbig seine Spielchen trieb. Jung staunte, wie viele seiner Artgenossen in dem Gewässer Platz hatten. Dazwischen schwammen kleine, elegante Torpedos herum, deren Namen er nicht kannte. Ein artesischer Brunnen in der Mitte füllte das Gewässer ständig mit frischem Wasser. Sein Plätschern hatte Jungs Aufmerksamkeit erregt und ihn von der Hofterrasse aufgescheucht.
Er richtete sich von der Brüstung auf und ging zurück in den Schatten der Kastanienbäume. Der Kies knirschte unter seinen Sohlen. Den Platz hatte er sorgfältig ausgewählt. Auf dem Tisch stand ein beschlagenes schlichtes Glas, aus dem ihn ein weißgoldener Rheingauer Riesling anfunkelte. Den kühlen Wein empfand er an diesem heißen Vormittag wie ein kostbares Geschenk.
*
Er liebte es, an Plätze zurückzukehren, an die er angenehme Erinnerungen knüpfte. Auch der Friseursalon in seiner Heimatstadt gehörte dazu. Es besänftigte Jung, das kühle Treppenhaus hinaufzusteigen, die Glastür aufzustoßen und das Straßengewühl hinter sich zu lassen. Oben empfing ihn ein Design, das vor Jahren einmal Avantgarde gewesen war. Der Meister verstand sich als Künstler, nicht nur als Haarkünstler. Jung glaubte zu verspüren, dass er lieber eine ambitioniertere, modernere Kunst bevorzugt hätte, ihn aber gewichtige Gründe daran hinderten. Er zog die Fäden im Hintergrund. Neben seiner Griesgrämigkeit leuchtete die Unbekümmertheit von Jungs Friseurin besonders hell.
Anika Bargenda! Schon der Name klang in seinen Ohren wie Musik. Sie war nicht aufgebrezelt, nicht so, als sollte man unbedingt an ihr selbst die Kunst ihres Handwerks und die perfekte Herrichtung weiblicher Äußerlichkeit bewundern. Sie war groß und stattlich und hätte die junge Mutti eines strammen Söhnchens sein können. Sie verstand es, ihm jedes Mal den richtigen Haarschnitt zu verpassen: kurz, sehr kurz.
*
Es gab viele Plätze, an die sich Jung zurückwünschte. Er fragte sich, warum seine Sehnsucht so stark war. War sein Beruf schuld daran? Er war Leiter des S-Kommissariats bei der Bezirkskriminalinspektion Flensburg. Vor der Neuorganisation hatte seine Abteilung ›Dezernat für unaufgeklärte Kapitalverbrechen‹ geheißen. Hatte sich außer dem Namen überhaupt etwas geändert? Für ihn nicht. Seine Kollegen nannten seine Abteilung jetzt ›Super- oder Scheiß-Kommissariat‹, je nachdem, wie groß ihr Neid war. Auch sein Chef war von der neuen Organisation unberührt geblieben. Holtgreve leitete die Behörde, als hätte sich gar nichts getan. Die Zuständigkeitsbereiche waren neu geschnitten worden. Die Arbeit war in bestimmten Bereichen mehr geworden und musste umverteilt werden. Viel Lärm um wenig, meinte Jung.
Normalerweise arbeitete er an ungelösten Fällen aus längst vergangenen Zeiten. Nur die unmittelbar Betroffenen, falls sie noch lebten, litten unter den Missetaten von Menschen, die die Polizei nie hatte fassen können. Aber auch eine späte Aufklärung lindert das Leid. Das war eine von den Gewissheiten, zu denen Jung im Laufe der Jahre gekommen war. Gelang es ihm, einen Schuldigen zu überführen und vor den Richter zu bringen, breitete sich bei den Beteiligten Erleichterung aus. Bei den unmittelbar Betroffenen stellte sich sogar Genugtuung ein, ein Ruhekissen, auf dem sie besser schliefen als davor.
Sein vorletzter Fall hatte 16 Jahre zurückgelegen. Sein letzter Fall war eigentlich gar kein Fall. Er war ihm nicht zur Aufklärung übertragen worden. Jung war da blindlings reingeschlittert. Sein Urlaub hatte sich zu einem Albtraum entwickelt. Er war Mittäter an einem Verbrechen geworden, das rund um die Welt noch immer für Schlagzeilen sorgte. Wenn ans Licht käme, wozu er sich hergegeben hatte, drohte ihm Entlassung. Aber auch nur dann, wenn ihm sein Glück hold war. Wenn nicht, erwarteten ihn Konsequenzen, die er sich lieber nicht ausmalen wollte.
Das Schlimmste war das Schweigen. Sogar Svenja gegenüber schwieg er. Als das Erlebnis noch frisch gewesen war, hatte er einen halbherzigen Versuch unternommen, seine Frau ins Vertrauen zu ziehen, sie aber zuvor gewarnt. Ihre Reaktion hatte ihn überrascht. Früher wäre er eine Wette eingegangen, dass sie sich anders entschieden hätte. Er gestand sich ein, dass er ihre Intelligenz noch immer unterschätzte.
Nach dem Urlaub empfand er seine Stellung als Leiter des S-Kommissariats, die er bis dahin als eine kuriose Schrulle des Schicksals dankbar hingenommen hatte, nicht mehr als so glücklich. Seine Ernüchterung hatte das Verständnis für die Beamten der anderen Kommissariate wachsen lassen. Seine Kollegen mussten sich der Einflussnahme fremder Autoritäten erwehren und sich mit enthemmten Medien herumschlagen. Und dafür hatten sie sich auch noch vor einer aufgebrachten Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Wie kamen sie überhaupt damit zurecht? Darüber war nichts Genaues zu erfahren.
Jung fühlte sich zunehmend wie ein Fremder. Er kam sich schwerfällig, müde und mutlos vor und immer öfter wie ein kränkelnder Romantiker mit dem unheilvollen Hang zur Idylle. Er war zu der Einsicht gekommen, dass er damit recht hatte. Er war auf eine spezielle Art krank, gestand er sich ein. Der Urlaub hatte die letzten Zweifel ausgeräumt. ›Lerne, dich zu akzeptieren, wie du bist‹, sprach er sich Mut zu. ›Das ist gesünder und billiger, unterm Strich auch kräfteschonender‹, hatte seine Frau hinzugefügt. Nur langsam trugen die neuen Erkenntnisse Früchte.
*
Seine Vorliebe hatte ihn in den Rheingau geführt. Er gehörte schon lange zu seinen Lieblingsplätzen. Sein Autohaus hatte ihm die Erfüllung seiner Wünsche fast aufgedrängt. Während einer Routineinspektion hatten sie ihm einen Vorführwagen als Ersatz überlassen. Die Zeiten standen für Autoverkäufer gerade schlecht, was ihre Großzügigkeit mächtig stimulierte. Sie hatten ihm angeboten, das Luxusfahrzeug über ein paar Tage zu behalten und sich auf einem längeren Trip von dessen Vorzügen zu überzeugen. Jung hatte nicht lange überredet werden müssen. Das Auto war der Inbegriff deutscher Automobilbaukunst.
Bevor er sein Quartier bezog, war er nach rund 700 Kilometern Autobahn so entspannt aus dem Auto gestiegen, wie er zu Hause eingestiegen war. Leider hatte er sein Handy immer am Mann zu führen. Dienstanweisungen galten auch im Urlaub. Das war ein bitterer Wermutstropfen. Erst vorhin war eine SMS von der Inspektion eingegangen. Er hatte sie ignoriert. Wenn es etwas Wichtiges gewesen wäre, hätte man ihn zu sprechen verlangt.
Dieses Jahr hatte es sich ergeben, dass zwei seiner Wünsche in Erfüllung gegangen waren: eine Konsumentenschulung auf einem Spitzenweingut und ein Besuch des Rheingau Musik Festivals. Die Geigerin Baiba Skride gab ein Gastkonzert.
Er wollte eine dieser jungen Wundergeigerinnen schon immer mal live erleben. Die Kulturseiten und Feuilletons waren voll von ihnen, von der coolen Janine Jansen mit der Stradivari Barrere von 1727, der eigenwilligen Hilary Hahn, der blaustrümpfigen Julia Fischer und eben auch der unbekümmerten Baiba Skride. Man rühmte sie als bestens ausgebildet, technisch versiert, ehrgeizig, fleißig und vor allem vernünftig. Den Kritikern wurde bange bei so viel Vernunft, und sie machten sich Sorgen um das Leben dieser jungen Musikerinnen, das hauptsächlich aus Listen zu bestehen schien, listenweise Lehrer, Dirigenten, Orchester, Säle usw.
Jung hatte davon nichts gespürt. Die Fähigkeiten der jungen Frau und ihre Lust am Spiel hatten ihn begeistert.
Und die Schulung auf Schloss Vollrads? Er war schon vorher überzeugt, dass Rheingauer Rieslinge allen anderen Weißweinen vorzuziehen waren. Er musste nicht überzeugt werden. Er hatte den Verdacht, dass das die Absicht der Veranstaltung gewesen war. Er hatte nichts dagegen. Die Köstlichkeiten, die ihm kredenzt worden waren, schwemmten alle möglichen Einwände hinweg.
*
Er war allein. Jung ließ seine Blicke über die Grünanlage des Innenhofes schweifen. Eine Sprinkleranlage legte eine Wolke aus funkelnden Wassertropfen über die sorgfältig geschnittenen Rasenstücke und die verstreut gepflanzten Sträucher- und Blumenrabatten. Gestutzte Kastanien säumten die geharkten Kieswege.
Sein Auge blieb beim Blick durch das Hoftor hängen. Er schaute über hellgrün leuchtende Rebhänge hinunter ins Rheintal bei Hattenheim. Ein unbewegter Glast lag über dem breiten Fluss und tauchte die Rheininseln in einen durchsichtigen Schleier. Jenseits des Flusses, bei Ingelheim, ragten am Horizont ein paar bauliche Hässlichkeiten aus dem Dunst. Sie störten ihn.
Sein Glas war leer. Er fühlte sich gut und reckte sich in der Vormittagssonne. Dann machte er sich auf den Weg runter an den Fluss. Er kannte ihn von früher, als er im Rheingau Weinproben besucht hatte. Bei den Winzern in Hallgarten, Kiedrich und Rauenthal kaufte er seine Lieblinge und nahm die sonnenverwöhnten Köstlichkeiten mit nach Hause in den rauen Norden.
Zum Mittagessen würde er gerade rechtzeitig in Östrich-Winkel sein. Die Vorfreude auf den Gaumenschmaus beflügelte ihn, und er schritt kräftig aus.
*
Nach einer guten Stunde war er angekommen und nahm im Gastraum an einem Tisch vor dem Fenster Platz. Er fühlte sich wohl und war hungrig. Die Sonnenstrahlen brachen sich in den Buntglasscheiben und tauchten den Speiseraum in ein gedämpftes Licht. Nach dem gleißenden Sonnenschein in den Rebhängen tat der leichte Dämmer seinen Augen gut. Er genoss jede Minute.
Die Bedienung stellte ihm das Tagesmenü vor: gebackene Ziegenkäseschnecken, Artischocken, eingelegten Knoblauch und Basilikum Pesto, danach Rinderrückensteak in Spätburgunder-Zwiebelsauce, Mandelbrokkoli und Herzoginkartoffeln und als Dessert Reblochon mit Ananas Confit, karamellisierten Walnüssen und Lorbeer Brioche. Er willigte gern ein und wählte zur Einstimmung einen Schoppen 2003er Hattenheimer Hassel, Riesling Spätlese. Er war mit sich und der Welt im Einklang.
*
Das Vorspeisengeschirr war gerade abgetragen worden, als sein Handy klingelte. Er runzelte die Stirn. Auf dem Display las er den Namen seines Chefs.
»Jung.«
»Holtgreve hier. Moin. Ich muss Sie dringend sprechen.«
Das war das Letzte, was er jetzt wollte. Nichts konnte so dringlich sein, eine Unterbrechung seines Mittagsschmauses zu rechtfertigen. Er überlegte, wie er verhindern konnte, vorzeitig aus dem Urlaub geholt zu werden. Er musste Zeit gewinnen.
»Herr Holtgreve, ich kann zurzeit nicht frei sprechen. Rufen Sie mich bitte in einer halben Stunde wieder an.«
»Was heißt das? Sie …«
Jung drückte die Unterbrechertaste, schaltete das Handy ab und atmete aus. Holtgreve hatte ihm gerade noch gefehlt. Jung war sich sicher, dass irgendetwas von oben auf den Leitenden herabgestürzt sein musste. Oben, das war der Polizeipräsident in Kiel. Für Holtgreve bedeutete das, hektisch in Aktion zu treten. Jung wollte sich nicht davon anstecken lassen. Es gelang ihm nur schlecht.
Nach dem Hauptgang hatte er eine Abwehrstrategie entwickelt. Das stimmte ihn wieder heiterer. Dennoch sah er davon ab, einen zweiten Schoppen zu bestellen. Und obwohl das Dessert wenigstens einen Michelin-Stern verdient hätte, war er nicht ganz bei der Sache. Der Anruf seines Chefs erinnerte ihn an seine Arbeit und die Bredouille, in die er sich kürzlich gebracht hatte.
Er sah auf die Uhr. Noch exakt fünf Minuten, bis die halbe Stunde vorüber war. Er leerte sein Glas und schmeckte der fruchtigen Säure hinterher. Dann war er so weit. Wie erwartet, läutete das Handy pünktlich.
»Jung.«
»Mann, was ist denn da los bei Ihnen?«
Holtgreves Aggressivität war unangebracht. Es ging ihn nichts an, was seine Untergebenen in ihrer Freizeit machten.
»Was kann ich für Sie tun?«, überhörte er Holtgreves Frage.
»Der Polizeipräsident hat mich angerufen.« Holtgreve machte eine Pause. Alles andere wäre wirklich eine faustdicke Überraschung gewesen, dachte Jung.
»Er will Sie unverzüglich sehen. Er hat Sie ins Innenministerium nach Kiel einbestellt.«
Jung kannte seinen Chef seit vielen Jahren, aber an seine Sprache hatte er sich nie gewöhnen können. Sie fiel ihm auf die Nerven.
»Was will er von mir?«
»Es geht um die ertrunkene Kadettin vom Segelschulschiff der Marine. Sie haben davon gehört?«
»Ja, ich habe davon gelesen. Aber ist der Fall nicht längst untersucht und das Verfahren eingestellt worden?«
»Das ist ja das Problem. Die Staatsanwaltschaft in Hannover ist in der Sache tätig geworden. Sie ist aber nicht zuständig. Der Heimathafen des Schiffes ist Kiel. Also muss die Staatsanwaltschaft in Kiel noch einmal ran.«
»Und was soll ich dabei?«
»Der Präsident wünscht keine Pannen mehr. Er will einen Experten auf dem Schiff und hat sich an Sie erinnert. Sie haben doch bei der Marine eine Wehrübung gemacht.«
»Und jetzt soll ich wieder dahin. Allein?«
»Der Generalstaatsanwalt hat angeordnet, seine SOKO einzusetzen. Sie, Jung, begleiten sie als Berater.«
Jung zuckte zusammen. Die SOKO des Generalstaatsanwaltes bestand aus zwei Staatsanwälten. Bei der Polizei waren sie bekannt als ›die Kettenhunde‹. Hinter vorgehaltener Hand war auch gern von Herrn Vulgär und Frau Dümmling die Rede.
»Gut.« Jung hatte sich gefangen. »Ich wohne in Eltville, Ortsteil Erbach. Schicken Sie mir ein Fax. Die Nummer können Sie in meinem Urlaubsantrag finden. Ich bin momentan unterwegs. Aber in einer Stunde kann ich aufbrechen.«
»Was? Wieso ein Fax? Was wollen Sie?«
»Ich brauche Ihre Anweisungen schriftlich. Das lernen wir doch schon als junge Beamte auf Probe, Herr Holtgreve. Ich brauche ein Papier, um meine Unkosten erstattet zu kriegen. Die Nummer können Sie dem Urlaubsantrag entnehmen«, erklärte ihm Jung noch einmal.
»Ja, ja, natürlich, Eltville …«
»Genau. Also, ich mach mich schon mal auf den Weg. Sobald Ihr Fax vorliegt, bin ich auf dem Sprung nach Flensburg. Sie können sich auf mich verlassen. Bis dann.«
Jung drückte die rote Unterbrechertaste. Er grinste und wartete anstandshalber auf einen möglichen Rückruf. Aber nur kurz. Jung war sich seiner Sache sicher. Holtgreve steckte in der Klemme. Der Gehorsam, den er seinen Vorgesetzten schuldig zu sein glaubte, und seine Eigenverantwortlichkeit kamen sich ins Gehege. Er würde sich nicht entscheiden, sondern die Angelegenheit aussitzen. Der Schwebezustand würde nicht lange dauern. In wenigen Tagen musste Jung wieder an seinem Schreibtisch auf Norderhofenden sein.
Ich tue Gutes, lobte Jung sich selbst. Ich vermeide Kosten, gebe nicht den neurotischen Überspanntheiten meines Chefs nach und rette meinen Urlaub. Ihn erfüllte Genugtuung. Er bezahlte seine Rechnung und spazierte am Rhein entlang nach Erbach. Es wunderte ihn nicht, dass im Draiserhof kein Fax für ihn eingetroffen war.
Lange davor
Es war ruhig. Jetzt, um die Mittagszeit, war nur die stehende Wache an Oberdeck. Die Matrosen dösten auf den Backskisten, lümmelten auf dem Mitteldeck, einige lehnten am Schanzkleid oder den Nagelbänken. Zum Glück gab es in dieser Crew keine Frauen, dachte er erleichtert. Erst ein lauter Befehl des Wachoffiziers, der achtern im Steuerbordwachstand auf seinem Holzbrett kniete und die Segelstellung beobachtete, würde die Kadetten aus ihrer Lethargie aufscheuchen, sie in die Wanten jagen und an die Schoten, Halsen, Fallen, Brassen und Niederholer. Die wachfreie Mannschaft blieb bei diesem Wetter unter Deck. Das Schiff segelte unter tiefen Wolken und mit einem steifen, achterlichen Wind querab Quessant im Eingang zum englischen Kanal.
Er mochte die Stunde nach dem Mittagessen. Nach dem Abbacken in der Offiziersmesse hatte er frei. Er verholte sich dann, so oft er konnte, auf das Achterdeck hinter das Kartenhaus und warf die Angel aus. Die Bank am Klavier hatte er für sich allein. Es war unnatürlich ruhig. Der enorme Druck auf die Segel stabilisierte das Schiff in der kabbeligen See. Nur der Atlantik Swell wiegte es sanft hin und her.
Für ihn waren Rollen und Stampfen angenehme Begleiterscheinungen seiner Arbeit. Sie versetzten ihn zurück in seine Jugend bei der Hochseefischerei. Das Leben damals war hart gewesen, aber befriedigend. Davon träumte er noch heute. Die Erinnerungen an seine Fahrten auf dem Hecktrawler ›Karl Kämpf‹ in den rauen Norden, die Dänemarkstraße, den Westfjord, zu den Lofoten und auf die Neufundlandbänke waren so frisch, als hätten sie erst gestern ihre stolzen Fänge an Kabeljau und Rotbarsch in Bremerhaven angelandet.
Seine Hände zitterten. Er zog den Flachmann aus der Brusttasche und nahm einen Schluck. Sofort wurde ihm wohler. Die Wärme beruhigte ihn und stimmte ihn optimistisch. Nur in seinem Kopf störte die stetig präsente Ermahnung seiner Mutter: ›Erwin, denk an deinen Vater. Trink nicht so viel.‹
Seine Eltern waren schon lange tot. Sein Vater starb zuerst. Seine Mutter behauptete, der Alkohol hätte ihn ins Grab gebracht. Wenige Jahre später war sie ihm gefolgt.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Angelrute zuckte. Er sprang an die Rolle und kurbelte. Es konnte kein sehr großer Fisch sein, dachte er enttäuscht. Hier, vor der Bretagne, hatte er schon, wenn auch selten, weitaus kapitalere Fänge gelandet. Makrelen, Meeräschen, Franzosendorsche, sogar Wolfsbarsche hatte er am Haken gehabt. Einmal war ihm die Schnur gebrochen und die Beute entkommen. Er war der festen Überzeugung, dass nur ein riesiger Heilbutt das geschafft haben konnte. Sie hatten ihn deswegen ausgelacht, er aber war standhaft bei seiner Meinung geblieben. Es musste ein Heilbutt gewesen sein, trotz der Unwahrscheinlichkeit, ihn vor der bretonischen Küste anzutreffen.
Der Fisch ließ sich leicht an Bord nehmen. Mittel- und Ringfinger seiner rechten Hand behinderten ihn. In letzter Zeit waren die Finger immer krummer geworden und ließen sich nicht mehr strecken. Vielleicht sollte er den Schiffsarzt aufsuchen, dachte er flüchtig. Es war ein Hering. Er überlegte, was er damit machen sollte. Wieder zurück ins Wasser werfen? Nein, er würde ihn zum Räuchern in die Kombüse bringen und in ein paar Tagen verspeisen, spät am Abend, wenn alle an Bord schon satt waren, der Abwasch erledigt und in der Kombüse und der Pantry Ruhe eingekehrt war. Früher waren Heringe ein Arme-Leute-Essen gewesen, heute waren sie eine teure Delikatesse. Bei dem Gedanken an den seltenen Gaumenschmaus verflüchtigte sich seine Enttäuschung über das Leichtgewicht.
Er nahm noch einen Schluck aus dem Flachmann, hakte den Fisch ab, packte das Angelzeug zusammen und ging den Niedergang ins Offiziersdeck hinunter. Die Pantry gegenüber der Messe war sein Reich. Das Bordtelefon läutete.
»Steward … Ja, Herr Kap’tän …, ja, bin schon unterwegs.«
Die tägliche Besprechung der Offiziere in der Messe war vorverlegt worden. Heute war Donnerstag, und der Messeoffizier hatte ihn angewiesen, für den ›Seemanns-Sonntag‹ früher aufzubacken. In der sich tagtäglich wiederholenden Bordroutine war das wöchentliche Marineritual eine heilige Kuh. Man erwartete von ihm, dass er ihr die gebührende Aufmerksamkeit schenkte. Das hatte er schnell begriffen. Er verließ das Offiziersdeck durch das Plastikschott in Richtung Vorschiff. Das Schiff krängte nach Lee. Er turnte über das Mitteldeck nach vorn in den Kombüsentrakt.
»Wohin, Steward?«, rief ihn der Brückenoffizier an.
»Seemanns-Sonntag für die Messe, Herr Oberleutnant.«
»Ein Pott Kaffee würde mir jetzt auch guttun.«
»Wird gemacht, Herr Oberleutnant.«
»Beeil dich, Erwin! Wir wechseln gleich den Bug. Dass du mir ja nicht mitsamt dem Kaffee über Bord gehst.«
Der Ton des Offiziers gefiel ihm nicht. Wie alt mochte der Schnösel sein? 25, 26? Er war es gewohnt, von den Offizieren herumkommandiert zu werden. Er quittierte ihre Befehle mit gleichbleibender Freundlichkeit. Sie hatten sich daran gewöhnt und belohnten seinen stoischen Gleichmut, indem sie ihn ab und zu beim Vornamen riefen. Er schluckte sein aufflackerndes Unbehagen runter und beeilte sich, das Steuerbordschott vor der Back zu erreichen.
»Schon so früh, Erwin? Der Kaffee braucht noch Zeit«, begrüßte ihn der zweite Koch.
»Gib mir den Kuchen, Smut. Kannst nicht schon mal ’ne Kanne abfüllen? Der WO hat Kaffeedurst.«
»Weil du’s bist, Erwin, arme Sau.«
»Selbst arme Sau, alter Wichser.«
»Ich leck den Herren aber nicht die Seestiefel, Erwin.«
»Dafür darfst du ihren Müll verklappen. Also mach schon, Smut. Beeil dich.«
Der Koch füllte den Kaffee ab, stellte Kuchen, eine große Tasse und die Kanne auf ein Tablett und reichte es ihm zu. Wortlos verließ er die Kombüse und arbeitete sich wieder nach achtern.
»Kaffee wie befohlen, Herr Oberleutnant.« Er drückte dem Wachoffizier den Pott Kaffee in die Hand und verschwand im Offiziersdeck.
Heute machte er sich in der Messe mehr Mühe als sonst. Vor der Mittagspause hatte ihn der Funkmeister wissen lassen, dass eine Mail für ihn eingegangen war. Nach dem ›Seemanns-Sonntag‹ werde der Fernmelder sie vorbeibringen. Er freute sich darauf. Sie würde von seinem Sohn sein. Er kannte sonst niemanden, der ihm eine Mail geschrieben hätte. Er stellte einen Strauß Kunstblumen, die er beim letzten Hafenaufenthalt erstanden hatte, auf die rutschfeste Tischdecke.
*
Nach dem Kaffee und Kuchen frischte der Wind auf und drehte auf westliche Richtungen. Regenböen zogen über das Schiff hinweg, und die Krängung nahm zu. Je weiter sie in den Kanal hineinsegelten, desto mehr nahm der Swell ab. Das Schiff lag stabil und ziemlich ruhig.
Er war allein in der Pantry. Er schloss die Tür zum Gang und lehnte sich gegen den Kühlschrank. Bevor er das getackerte Papier aufriss, nahm er einen Schluck aus dem Flachmann.
*
›Hallo, Paps,
bei mir ist alles okay. Die Schule ist langweilig, aber ich habe kein Problem damit. In zwei Wochen komme ich an Bord. Weißt du schon genau, wann ihr in Kiel fest seid?
Ich habe jetzt ein Mädchen. Sie ist Offiziersanwärterin wie ich und in der gleichen Crew. Sie wird nach dem Abschluss Medizin studieren. Wir sind heute Abend verabredet. Ich muss mich beeilen. Die Wäsche muss noch gewaschen werden. Die Wohnung muss ich auch sauber machen. Ich erzähle mehr, wenn ich an Bord bin.
Gruß Momme‹
*
Die Mail war kurz, was ihn aber nur flüchtig verstimmte. Der Inhalt war umso erfreulicher. Sein Sohn würde Offizier werden. Er würde es besser haben als er. Und eine Freundin hatte er jetzt auch, eine Offiziersanwärterin wie Momme selbst. Eine Ärztin in der Familie würde sich nicht schlecht machen. Er wünschte sich, Gretchen würde das noch erleben können.
Wann immer er an sie dachte, hatte er ein schlechtes Gewissen. In den Jahren bei der Hochseefischerei hatte er sie allein an Land zurücklassen müssen. Als die Fischerei zusammenbrach und die Flotte abgerüstet wurde, hatten sie ihr kleines Haus an der Weser bei Vegesack verkauft. Sie waren nach Flensburg in eine Mietwohnung gezogen. Wenige Jahre später war sie gestorben. Die Ärzte meinten, an Herzversagen, er glaubte eher an Kummer. Denn ihr Tod fiel ins gleiche Jahr, in dem auch ihr Sohn als Decksjunge bei der christlichen Seefahrt angefangen hatte.
Nach der Fischerei hatte er als Steward auf Kreuzfahrtschiffen angeheuert. Die Seefahrt auf den Musikdampfern gefiel ihm nicht. Er passte da nicht hin. Seine Weitsichtigkeit zwang ihn, eine Brille zu tragen, die schrecklich große Augen machte. Zusammen mit seinen hageren, knochigen Einsneunzig, dem Panzerknackerkinn und den schütteren Haaren machte ihn das zu einer Figur, die eher auf ein Piratenschiff gepasst hätte als an Bord eines mondänen Kreuzfahrers. Er heuerte auch auf der ›Lili Marlen‹ an, einem luxuriösen Dreimaster für reiche Segelromantiker. Der Kommandant schätzte ihn, sah aber sofort, dass er anderswo besser aufgehoben war. Er ließ seine Beziehungen spielen und verhalf ihm zu einer Heuer auf dem Segelschulschiff der Marine. Er wurde als Messesteward eingestellt und war der einzige Zivilist an Bord. Eine Besonderheit, die sich die Marine gestattete und für die er wie geschaffen war.
Er war alt, nur noch ein paar Jahre bis zum Vorruhestand. Er wünschte sich eine Familie mit Enkelkindern, die er sich auf die Knie setzen und denen er Geschichten von seinen Reisen über die Weltmeere erzählen konnte. Das würde ihm auf seine alten Tage Freude bereiten.