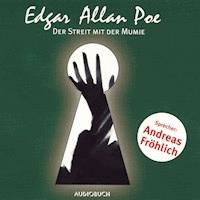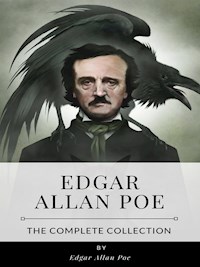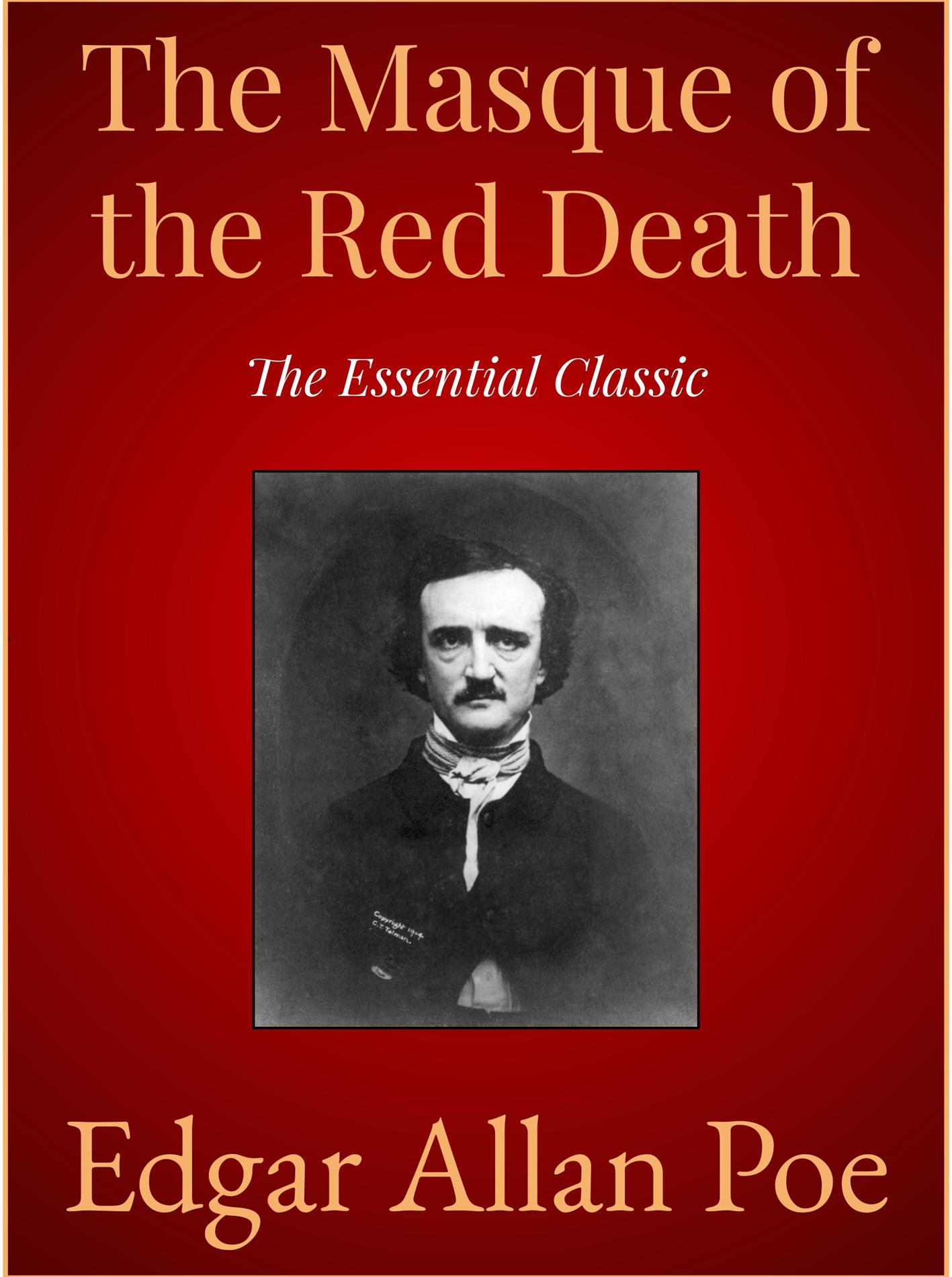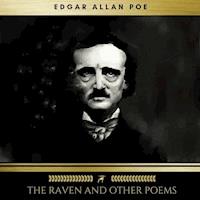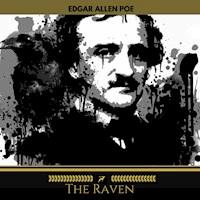Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass Krimis nicht erst seit Sherlock Holmes und Auguste Dupin in aller Munde sind? Schon Friedrich Schiller berichtete zu seiner Zeit aus dem Verbrechermilieu, Charles Dickens dokumentierte Polizeieinsätze und Vidocq beschrieb in seiner Autobiografie, wie er vom Kriminellen zum ersten Privatdetektiv der Welt wurde. Meister der Spannung wie Edgar Wallace und Arthur Conan Doyle perfektionierten das Genre der Kriminalgeschichte, das sich bis heute zahlreicher Leser erfreut. Diese Anthologie nimmt Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Kurzkrimis. Vom frühen 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht die Auswahl der Autoren, unter denen sich manch einer befindet, dem man solche kriminellen Gedanken gar nicht zugetraut hätte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
MICHAEL SEILER: Fedder und Schwerdt
EDGAR WALLACE: Doktor Kay
KAREL ČAPEK: Vom Kassenknacker und vom Brandstifter
ARTHUR CONAN DOYLE: Mein Freund der Mörder
EDGAR ALLAN POE: Du bist der Mann!
CHARLES DICKENS: Das Sofa
ANONYM: Ein Schlaukopf
ANONYM: Knacker-Ede
J. D. H. TEMME: Ein Verteidiger
FRANZ KAFKA: Ein Brudermord
KURT TUCHOLSKY: Wie benehme ich mich als Mörder?
WALTHER KABEL: Die Leuchtturmwärter von Shesterland
AUGUST GOTTLIEB MEISSNER: Französischer Justizmord
FRIEDRICH SCHILLER: Verbrecher aus Infamie
EUGÈNE FRANÇOIS VIDOCQ: Die Sicherheitsbrigade
BALDUIN GROLLER: Ein Opfer vorschneller Justiz
Quellenverzeichnis
Michael Seiler
Fedder und Schwerdt
Wann hat mich die Liebe zum Krimi gepackt? Ich weiß es nicht mehr genau. Als Kind bekam ich irgendwann eine Anthologie mit klassischen Detektivgeschichten geschenkt, die mich unter anderem mit Sherlock Holmes und Miss Marple bekannt machte, später die Kinderkrimis von Enid Blyton, Erich Kästners »Emil und die Detektive« sowie eine Gesamtausgabe der Holmes-Kurzgeschichten. Seit ich diese Bücher verschlungen habe verfolgen mich Kriminalgeschichten, bis hin zu meinen ersten eigenen Schreibversuchen. Die folgende Geschichte ist eine Liebeserklärung an das Genre, das seinen Schöpfern auch schnell zum Verhängnis werden kann.
Den Mord hatte er sorgfältig geplant und vorbereitet. Die benötigten Werkzeuge lagen vor ihm ausgebreitet auf dem Tisch. Gleich würde er zur Tat schreiten, denn die Sache war schon lange überfällig. Seit einer gefühlten Ewigkeit ließ ihm dieser Kerl keine Ruhe, also musste er eines spektakulären Todes sterben.
Frederick Schwerdt ermittelte als amtierender Hauptkommissar seit gut zehn Jahren zuverlässig in einem Fall nach dem anderen und lehrte selbst die raffiniertesten Verbrecher das Fürchten. Eine lebende Legende bei allen, die ihn kennenlernen durften und ein Genie in Sachen Verstand und Kombinationsgabe. Aber heute würde er gehen, für immer.
Der Grund dafür war weniger der unverhohlene Neid seiner Kollegen oder der Racheakt eines von ihm gestellten Verdächtigen, sondern die Tatsache, dass der wichtigste Mensch in seinem Leben ihn endlich loswerden wollte. Für manchen wäre es eine unbequeme Wahrheit, aber Schwerdts Titel und Erlebnisse existierten nur auf dem Papier. Er war eine Romanfigur. Erfunden vom Schriftsteller Jonathan Marius Fedder, der sich seinem Verlag zuliebe ein Pseudonym für seine Bücher ausgedacht hatte: Jon Marc Feather oder J. M. Feather. Jon ohne h, damit der Name »kantiger« wirkt, unbequemer, auffälliger.
Autoren mit so banalen deutschen Namen wie seinem würde kein Mensch lesen, der auf atemlose Spannung aus ist, hatte sein Lektor angedeutet, aber Fedder wusste, dass die Bücher vor allem neben den großen englischsprachigen Namen des Genres bestehen sollten. Welcher Verleger wollte seine Ware im Buchladen nicht gerne neben Don Winslow, Stephen King oder Robert Harris platziert sehen? Eben.
Wenn dann plötzlich ein Herr Müller, Schuster oder Fedder in derselben Regalreihe auftauchte, würden sich die Leser angeblich abwenden und gleich darauf fragen, ob sie versehentlich beim verpönten Heimatkrimi gelandet wären. Fischkopp un’ Doppelkorn, hatte er gespottet, worauf beide höflich lachten. Gelegentlich landete zwar auch mal ein Skandinavier wie Stieg Larsson oder Adler Olsen in den Bestsellerlisten, aber nordeuropäische Pseudonyme waren aus irgendwelchen Gründen ein No-Go. Muss man akzeptieren.
Also weg mit Schwerdt, endgültig. Ein letztes großes Abenteuer und ein Abschluss, der sich gewaschen hat. Fedders Vertrag sah nur noch ein Buch vor, aber er wusste, dass die Verlagsleitung sich gleich danach wieder händereibend mit einer Verlängerung an ihn wenden würde. Natürlich musste man sich über die Konditionen einig werden, aber ein neuer Schwerdt würde es garantiert nicht. Nach Jahren der Knechtschaft würde der Autor seine Schöpfung endlich in den Orkus schicken. Und künftig nur noch das schreiben, was er wollte. Unter seinem richtigen Namen.
Er griff sich das Mordinstrument. Der Bleistift war dünn und spitz, so wie er es liebte. Erste Entwürfe schrieb Fedder grundsätzlich mit der Hand, er musste die Verbindung zur Geschichte spüren und am Ende des Tages fühlen, dass seine Hände gearbeitet hatten. Eine Angewohnheit, die Kollegen und Kritikern meist ein gönnerhaftes Schmunzeln entlockte. Aha, altmodische Methoden. Wie sympathisch.
Das Papier lag in der Mitte des Schreibtischs, weiß und unschuldig. Nicht mehr lange.
Das Obligatorische war schnell skizziert: Ein brutaler Mord ohne großartige Anhaltspunkte, aber mit Finesse ausgeführt. Der Täter war natürlich ein geistesgestörter Psychopath, der gerne mit der Polizei Katz und Maus spielte und sich trotz seiner zahlreichen Verstecke am liebsten einem Publikum offenbarte, Bewunderung suchte. Mordwaffe und Motiv: unklar. Schwerdts private Probleme gefährdeten die Ermittlungen, sein Chef drohte mit Kündigung – dieses Mal endgültig, ganz sicher – und die hübsche Kollegin aus seinem Team hatte sich eben mit dem Staatsanwalt eingelassen. Das war immer so.
Aber warum eigentlich?
Frustriert warf Fedder seinen Stift auf den Block und grübelte über den Klischees des Kriminalromans. Was, wenn der Täter aber mal kein aufmerksamkeitsgeiler Irrer war, sondern einfach nur gerne Menschen umbrachte? Wie der Feuerwehrmann, der aufgrund seiner Faszination für Brennbares gerne Feuer legte?
Zu langweilig, liest keiner, hörte er seinen Lektor sagen. Schon tausendmal gemacht. King kann das vielleicht, aber Horror wollen wir nicht.
In ihren Gesprächen hatte sich Fedder immer höflich und kooperativ gezeigt, nur um zu Hause wütend in sein Sofakissen zu boxen und die abgelehnten Entwürfe in winzige Fetzen zu zerreißen. Papiergewordene Lebenszeit wanderte einfach in den Müll.
Doch jetzt zupfte ein grimmiges Lächeln an seinen Mundwinkeln. Ein Plan reifte in ihm heran, der die Sache zu einem endgültigen Abschluss bringen würde. Er nahm den Stift wieder in die Hand und schrieb drauflos:
Ich stehe am Schauplatz des absurdesten Verbrechens, das ich je gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. So viel, dass mir die widerwärtige Szene vertraut erscheint: Die Blutlache, die bleiche Haut des Toten, das Klicken des Fotoapparats, mit dem Kunze den Tatort dokumentiert. Alles wie in einer Filmszene, wie sie in jedem schlechten Drehbuch steht.
Nur, dass nichts auf den Hergang der Tat hindeutet. Das Opfer ist tot, definitiv, dafür sorgen schon die beiden Löcher in seiner Brust. Deren Ränder sind glatt, nicht ausgefranst oder versengt, wie es die meisten Stich- und Schusswaffen tun. Sie weisen keinerlei Unregelmäßigkeiten auf, vielmehr wurden sie mit einheitlichem Radius von den Rippen bis zum Rückgrat durchstochen oder durchbohrt.
Und dann ist da noch das Wasser.
Das Blut des Opfers hat durch die Vermischung mit einer großen Menge reinem Leitungswasser eine seltsame hellrote Farbe angenommen und sich überall im Raum verteilt. Nur so wurden wir auf den Tatort aufmerksam, denn die Mieter im übernächsten Stockwerk darunter hatten feuchte Wände mit roten Verfärbungen bekommen und schließlich den Hausmeister informiert, der schließlich die »grausige Entdeckung« gemacht hatte.
So würden es später die Zeitungen schreiben, für sie war es immer eine »grausige Entdeckung«. Ein einziger Begriff für Unmengen von Todesfällen, die bei weitem nicht immer nur »grausig« waren. Mancher schlief eben friedlich ein, erstickte im Schlaf oder wurde mit Medikamenten getötet, während andere brutal erstochen, aufgeschlitzt oder in den Kopf geschossen wurden. Das ist grausig, denn diese Bilder lassen mich auch nach dem Feierabend nicht los, damit muss ich leben.
Doch dieser Fall ist ein Rätsel. Wäre Mörder ein Beruf, dann müsste man von einem Vollprofi sprechen. Ertrunken ist unser Opfer in jedem Fall nicht. In der leerstehenden Wohnung ist das Wasser abgestellt, die Lungen und die Luftröhre sind Kunzes erster Analyse nach nicht nennenswert mit Wasser gefüllt. Und dann sind da noch diese Löcher.
Kreisrunde Öffnungen im Brustkorb, die mit einer Regelmäßigkeit hineingefräst wurden, dass mir die bittere Galle im Hals hochsteigt. Augenscheinlich war das Opfer bei Bewusstsein, hatte aber aus irgendeinem Grund nicht geschrien. In irgendeinem Horrorfilm hatte mal jemand Leute mit einer Bohrmaschine umgebracht, im Mittelalter tötete man ungewollte oder angeblich vom Teufel besessene Babys zuweilen mit einem Nadelstich ins Gehirn. Ähnliche Fälle und doch nicht das selbe.
Ein Fetisch, bei dem der Täter das Opfer wäscht? Die Brust ist sauber, aber die Schuhe sind dreckig. Wer Spaß an der Totenwäsche und ähnlichen Ritualen hat würde doch zumindest die Schuhe putzen, das lernt jeder Bestatter, der einen Verstorbenen für die Aufbahrung vorbereitet.
Ich sehe mich nochmals im Raum um. Eine unspektakuläre Gründerzeitwohnung, ohne Möbel und mit schäbiger Tapete an den Wänden, dazu Blut und Wasser auf dem Boden. Sonst keinerlei Verwüstungen im Raum, selbst die Tür hat der Täter hinterher wieder anständig geschlossen und zuvor nicht aufgebrochen.
Den Nachbarn ist außer den feuchten Wänden nichts weiter aufgefallen. Kein Wunder, denn in diesem Haus sind ohnehin nur drei von acht Wohnungen vermietet, der Rest steht leer. Perfekt, um sich so richtig auszutoben und doch nicht zu abgelegen, um ein typischer Tatort zu sein.
»Bin dann soweit«, sagt Kunze und packt den Fotoapparat ein.
Ich nicke und winke die Bestatter ins Zimmer. Bin sowieso schon viel zu lange hier und starre auf den Toten, das färbt ab. Da gibt es irgendein Sprichwort mit dem Abgrund, der irgendwann in einen hineinblickt. Neunmalkluger Blödsinn fürs Poesiealbum, wenn man es düster mag.
Auf dem Weg nach draußen bleibe ich mit meinem Trenchcoat an der schweren Eingangstür hängen, ein Knopf reißt ab. Ich hasse diesen Mantel, trotzdem habe ich nie Zeit, mir was Besseres zu besorgen, um weniger wie ein wandelndes Klischee auszusehen.
Als ich mich nach dem Knopf bücke, fallen mir die Schleifspuren auf. Zu dezent, um sie gleich beim ersten Mal zu bemerken. Die Jungs von der Spusi waren das nicht, die sind vorsichtiger mit ihren Gerätschaften. Pingelige Kettenraucher und Besserwisser, aber vorsichtig, das muss man ihnen lassen.
Vom Hereinschleifen des möglicherweise bewusstlosen Opfers können sie auch nicht sein, selbst auf dem billigen Parkettimitat hinterlassen die Hacken nicht solche tiefen Rillen. Sieht eher aus, als hätte sich jemand bemüht, einen schweren kantigen Gegenstand vorsichtig zu transportieren, ihn kurz abgestellt und beim Hochheben wenige Millimeter über den Fußboden geschleift.
Daneben liegen kleine, längliche Körner verstreut. Sie sehen aus wie halbierte Schokostreusel, sind aber nicht ganz so bröselig. Und die Farbe ist zu dunkel, selbst Zartbitterschokolade wäre nicht so tiefschwarz. Für Straßendreck sehen sie zu einheitlich aus, es gibt hier auch keine schwarze Wand, von der solches Material abbröseln könnte.
Ich nehme ein paar der Körner in die Hand und reibe sie zwischen den Fingern hin und her. Die Oberfläche ist glatt, doch die Bruchstellen hinterlassen Verfärbungen auf der Haut. Irgendwo habe ich diese Dinger schon einmal gesehen, ähnlich planlos auf dem Boden liegend. Unabsichtlich fallengelassen oder aus der Gewohnheit heraus. Für mich sind sie Brotkrumen, die mich der Lösung des Falles ein Stück näherbringen sollten. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wo ich sie zuerst gesehen habe …
Zurück im Präsidium ist erst einmal der Bericht zu schreiben. Tatortbegehung, Auffälligkeiten, Beschreibung des Opfers und erste Mutmaßungen zur Tatwaffe. Ich habe keine Ahnung, deshalb sauge ich mir etwas halbwegs Plausibles aus den Fingern, das immer noch schwammig genug ist, um später von »neuen Erkenntnissen« ergänzt zu werden.
»Schwerdt!«, blafft es quer durch den Raum.
Auch das noch. Am anderen Ende des Großraumbüros steht Präsidiumschef Fleischer und winkt mit seiner nikotinfleckigen Hand. Ich überlege kurz, mich hinter einem Aktenordner zu verstecken, doch er hat mich schon gesehen.
Dienstbeflissen gehe ich in sein Büro und ziehe die Tür hinter mir zu. Fleischer quetscht sich ächzend in seinen Bürostuhl, schiebt einige Unterlagen beiseite und greift gleich zur Pfeife, die er mit fahrigen Bewegungen zu stopfen beginnt.
»Wie sieht’s mit dem Fall aus?«, fragt er, während er am Tabaksbeutel nestelt.
»Jede Menge Verwirrung, kaum verwertbare Spuren«, antworte ich.
»Identität des Toten?«
»Unbekannt. Noch.«
»Hinweise am Tatort?«
»Viel Wasser, ein bisschen Dreck.«
Die übrigen Details behalte ich für mich, schließlich sind die kurzen Berichte beim Chef eher Rechtfertigungen für unsere Arbeitszeit, alles andere steht dann im Bericht.
Fleischer reißt ein Streichholz an. Wenn er wenigstens ein wenig Aroma in seinem Tabak hätte, könnte man den Rauch noch ertragen, aber dieser Knaster grenzt wirklich an Körperverletzung. Zwei glühende Augen starren mich durch die Rauchwolke an.
»Sie informieren mich sofort, wenn es in diesem Fall Fortschritte gibt.«
Keine Bitte, mehr ein Befehl. Das ist neu.
»Nach dem Chaos vom letzten Mal hängt es jetzt von Ihnen ab, was mit Ihrem Platz im Kommissariat passiert.«
Das Chaos beim letzten Mal. Er meint den verschwundenen Segelflieger, der dann doch wieder aufgetaucht war, dem aber niemand glauben wollte. Außer mir.
»Natürlich«, presse ich hervor. Noch mehr von dieser verseuchten Luft und ich huste mir beide Lungenlappen aus dem Leib. Nur zwei kleine Details halten mich davon ab, die plötzlich in neuem Licht erscheinen.
»Gehen Sie«, brummt die Rauchwolke, dann klappert Fleischers Stopfwerkzeug gegen den Aschenbecher. Ich mache, dass ich rauskomme.
Auf dem Parkplatz angle ich meine E-Zigarette aus der Tasche. Kein stinkender Tabak, sondern ein Fluid namens Meeresbrise. Schmeckt eigentlich nach nichts, aber wenn man ganz genau hinschmeckt, kann man sich einen Hauch salziger Luft einbilden. Und der Dampf fühlt sich gut im Mund an. Ein Wölkchen Freiheit im Großstadtdschungel.
Fleischer hat mich zugeparkt. Im Kofferraum seines Kombis liegt sein Angelzeug halbherzig abgedeckt, als wäre er vom Wochenendurlaub direkt zur Arbeit gekommen. Mit eingezogenem Bauch gelange ich auf den Beifahrersitz meines eigenen Wagens, klettere hinters Steuer und atme erst mal tief durch. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, irgendwelche Indizien muss ich bis Ende der Woche zusammenklauben.
Zum Glück parkt eben jemand neben mir aus, also kann ich die Lücke mit einem gewagten Manöver verlassen und mir zu Hause weiter den Kopf zerbrechen.
Die Nacht wird unruhig. Nicht, weil permanent das Handy klingeln würde, nein, es sind wieder die Träume. Irgendwie vermischen sich bei mir immer seltsame Details und Beobachtungen von der Arbeit mit Privatkram und ergeben eine halluzinogene Mischung, wie sie kein Drogentrip zustande bringt. Den harten Stoff habe ich nie angerührt, aber so bekomme ich einen ziemlich guten Eindruck, wie man auf LSD abgeht. Immerhin bin ich auf diese Art schon der Lösung manches verrückten Falls nähergekommen.
Das ist mein Geheimrezept, deshalb löse ich Fälle, die andere irgendwann hübsch zu den Akten legen. Natürlich darf das keiner wissen, sonst kann ich mich gleich freiwillig beim Polizeipsychologen melden. Seit Jahrzehnten geht das schon so und eigentlich will ich endlich raus. Aber ich kann nichts anderes. Wenn die Arbeit nicht wäre, würde ich vermutlich wahnsinnig, weil mir immer wieder Zusammenhänge auffallen, die ich nirgendwo an den Mann bringen kann.
Die Gummizelle im Kopf, ein irrer Gedanke. Im Fernsehen haben die Ermittler häufig einen Partner, mit dem sie durch dick und dünn gehen, für mich ist mein Unterbewusstsein das perfekte Gegenüber, solange es sich benimmt.
Also schwarzer Kaffee am Morgen und weiter geht’s.
Hier bröselte Fedders Bleistift zum ersten Mal ab. Verstimmt legte er ihn weg und massierte sein Handgelenk. Rätselhafte Situationen und spannende Einstiege fielen ihm leicht, nur das Ganze dann schlüssig aufzulösen und gleichzeitig keinen zu langweilen, das erforderte harte Arbeit. Besonders, wenn man schon acht Bände mit der gleichen Figur vorgelegt hat und der feine Herr Lektor die Manuskriptbesprechung mit Sätzen wie »Da haben Sie ja wieder was ausgeheckt ...«, eröffnet.
Seufzend stand Fedder auf und holte sich einen Kakao aus der Küche. Als er das Pulver in die Milch rührte musste er an Whiskey und Tabak denken. Für irgendein dummes Promo-Shooting sollte er sich einmal wie das Klischee eines englischen Krimiautors verkleiden: karierter Tweed, Einstecktuch, Gamaschen, Pfeife. Und Apfelsaft im Glas, als Whisky.
Fedder hasste das Zeug. Den Geruch von Alkohol, den Gestank von Tabak und die ganzen anderen dämlichen Requisiten, die angeblich dazugehören. Warum durfte niemand wissen, dass er am besten mit Kakao und Kartoffelchips arbeiten konnte? Nur einzigartige Autoren können einzigartige Bücher schreiben, wer mitschwimmt geht unter. Deshalb sollte auch der letzte Schwerdt-Roman der buchstäbliche Wahnsinn werden.
Auch das war streng genommen Standard. Wenn eine Figur anfangs noch beliebt ist, muss man sie nach und nach auseinandernehmen und mit dem Schlimmsten konfrontieren, sonst wird sie unglaubwürdig. Sherlock Holmes wurde (zum Schein) von einem Superverbrecher getötet, Hercule Poirot starb als tattriger Rollstuhlfahrer, John Luther ließ sich von einer Mörderin verführen (mehrmals!) und Kurt Wallander bekam zum Abschied Alzheimer.
Fedder riss sich von dem Gedanken los als er bemerkte, dass er unbewusst angefangen hatte den Geschirrspüler auszuräumen. Alles, bloß nicht schreiben – das war das erste Indiz für eine beginnende Schreibblockade. Bloß nicht aufhören, lieber einen schlechten Entwurf verfassen und später überarbeiten, eine andere Methode gab es nicht.
Höchste Zeit den Bleistift zu spitzen und die Sache zu Ende zu bringen. Als er die nächsten Kapitel schrieb wurde das Ende zunehmend unausweichlich und Fedders Bleistift kratzte immer schneller über das Papier ...
Die Last der Indizien ist erdrückend. Doch ich habe niemandem, dem ich es sagen kann. Mir würde ohnehin keiner glauben. Das Problem ist nicht, dass mir die Lösung wieder nach einer heftigen Nacht vor Augen stand, aber diese Enthüllung wäre das Ende. Von allem.
Ich hatte die Mordwaffe und die seltsamen Krümel am Tatort der richtigen Person zugeordnet; Kaufbelege, Fingerabdrücke und der einzige schlotternde Augenzeuge ergaben das richtige Bild.
Ich musste noch einmal mit dem Nachbarn sprechen, vielleicht hatte er das Auto des Täters doch verwechselt? Aber dank des richtigen Kennzeichens besteht eigentlich kein Irrtum mehr.
Er war es.
Er? Natürlich ein er. Frauen sind nicht so dumm, solche Fehler zu machen, sie morden leiser. Aber dieser Spezi musste ein Spektakel daraus machen und zur unlogischsten Waffe überhaupt greifen.
Auf die Lösung kam ich an einem Abend, als ich aus Angst vor den Träumen nicht ins Bett wollte. Ich hatte mir im Internet Videos von hydraulischen Pressen und Schreddern angeschaut. Ein ähnliches Phänomen wie mit der Mikrowelle – die Leute stecken alles mögliche in das Gerät und filmen das Ergebnis. Nur, dass die Gegenstände bei der Presse nicht explodieren oder schmelzen sondern, teilweise nach erstaunlich langem Durchhalten, zerbröselten oder in ein handlicheres Format gepresst wurden. Stahlkugeln, Legoautos, Gürtelschnallen und Plastikschlümpfe gehörten zu den häufigsten Opfern.
Irgendwann schlug mir der Algorithmus in seiner unendlichen Weisheit ein Video über Wasserstrahlschneidemaschinen vor. Mit einem Druck von bis zu 6000 bar durchschneidet ein Hochdruckwasserstrahl relativ mühelos (und ohne unschöne Fräskanten) Metall, Stein, Kunststoff, Haut und Knochen.
Und so ergab alles plötzlich einen Sinn. Die beiseitegeschobene Betriebsanleitung, der halbherzig versteckte Apparat, zu dem auch die Schleifspuren passten. Und natürlich das Wasser in der Wohnung.
Ich könnte das alles ignorieren, die Spuren im Sand verlaufen lassen und im Bericht »Täter nicht ermittelbar« schreiben. Aber das geht nicht.
Zu meiner Begabung – oder meinem Fluch – gehört es nunmal, dass ich meine Fälle zu Ende bringen muss, sonst holen sie mich nachts wieder ein. Und ich will einfach nur, dass das aufhört. Auch wenn es dieses Mal endgültig sein könnte, für mich und ihn.
Wenig später stehe ich vor seiner Wohnungstür. Er lebt alleine, das ist allgemein bekannt, seit diese Furie von Ex-Frau ihn verlassen hat. Mitte Vierzig und Single, herzlichen Glückwunsch. Immerhin habe ich noch zehn Jahre Zeit bis dahin. Wenn ich hier lebend rauskomme.
Er öffnet beim dritten Klingeln und lässt mich nach einem verwunderten (oder resignierten?) Blick in den Flur treten. Ein weiterer Blick ins Treppenhaus, dann schließt sich die Tür mit einem satten Geräusch. Schallgedämpft, nicht schlecht.
Abwartend bleibt er an der Tür stehen. Eine verräterische Ausbeulung seiner Strickjacke zeigt mir, dass er vorbeireitet ist. Ich gehe voraus ins Wohnzimmer.
»Sie wissen, warum ich komme?«, frage ich.
»Bevor Sie irgendwas sagen …«, beginnt er.
»Stopp«, sage ich. »Stopp.« Ich atme die verrauchte Luft ein, so gut es eben geht und erzwinge Blickkontakt.
»Ich habe mir alle möglichen Szenarien überlegt. Die Spuren ausgewertet, das beste für Sie und mich abgewägt, aber es gibt keine Alternative. Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Für alles.«
Mein Gegenüber schüttelt trotzig den Kopf, den Blick auf den Fußboden gesenkt. Die Hand nähert sich seiner Hüfte.
»Ich lasse nicht zu, dass die uns dicht machen«, stößt er hervor. »Diese Abteilung ist das einzige, das ich in meinem Scheißleben aufgebaut habe, das lasse ich mir nicht wegnehmen!«
»Ist es das Wert, Kollege Fleischer?«, frage ich.
Keine Antwort. Seine Blicke suchen die Wand hinter mir ab.
»Warum können Sie nicht einmal versagen?«, brüllt er schließlich. »Wenigstens ein ungelöster Fall, Schwerdt, nur einer! Aber nein, Sie müssen ja jeden Stein umdrehen bis irgendeine Lösung gefunden ist. Warum können Sie nicht einmal einen Fall zu den Akten legen, es gut sein lassen? Für ihre Abteilung. Für mich!«
Der letzte Satz hat einen bittenden Unterton. Angewidert wende ich mich ab und gehe zum Couchtisch. Im Aschenbecher liegen die gleichen Brösel wie am Tatort, daneben ein kaputter Pfeifenfilter. Aktivkohle in handlichen Stückchen. Fleischer fummelt immer so fahrig an seiner Pfeife herum, dass er die Filter zerlegt, in seinem Büro kann man das regelmäßig sehen.
Ich stehe mit dem Rücken zu ihm, er sieht nicht, dass ich sein Stopfwerkzeug aufhebe und den Dorn ausklappe. Oder doch? Hinter mir klickt etwas.
»Es ist Ihre Schuld, dass wir hier sind«, keucht er.
Als ich mich umdrehe starre ich in eine Pistolenmündung. Hinter dem Rücken nehme ich den Pfeifenstopfer wie einen Schlagring in die Hand, so dass der Dorn zwischen Mittel- und Ringfinger herausschaut. Es wird uns beide erwischen.
Als ich nach vorne hechte knallt es auch schon. Mein Schwung reicht trotzdem aus, um den Dorn in seinen Hals zu rammen. Warm läuft das Blut über meine Hand, als ich auf dem Boden lande …
… das Blut tropft auf das Papier und wird gierig aufgesogen.
»Wie Löschpapier«, denkt Fedder und schaut auf seine Hand. Da ist kein Pfeifendorn, nur sein Bleistift, gut gespitzt und blutrot. Der Blutstrom erreicht mit beachtlicher Geschwindigkeit die Tischkante, es tröpfelt auf den Boden.
Er kann sich nicht mehr genau erinnern, was geschehen ist. Er hat nur noch das Wort »abgelehnt« im Kopf. Eine Abrissbirne in Wortform, die seine Gedanken zermalmt. Eigentlich sollte er jetzt irgendein Papier zerreißen oder sein Sofa mit den Fäusten bearbeiten, aber er ist nicht zu Hause. Und der Bleistift hat für Ruhe gesorgt.
Seelenruhig nimmt er den blutbefleckten Papierstapel an sich. Das ist nicht ganz einfach, denn der Kopf des Bleistiftopfers liegt darauf. Als er in die vertrauten, verhassten Gesichtszüge blickt, kehren einige Erinnerungsfetzen wieder zurück. Doch jetzt: Keine Kritik mehr, endlich Frieden.
Auf dem Weg nach draußen wirft er das abgelehnte Manuskript in den Papierkorb und den Bleistift hinterher. Dann verlässt er das Büro.
Edgar Wallace
Doktor Kay
Wenn Autoren heutzutage mehrere Bücher pro Jahr veröffentlichen, wittern Literaturkritiker häufig Ghostwriter im Hintergrund oder wenigstens schnell runtergeschriebenen, billigen Schund. Krimi-Veteran Edgar Wallace war diesbezüglich ganz offen: »Ich schreibe keine guten Bücher, ich schreibe Bestseller«, soll er einmal gesagt haben. Angeblich schaffte er es, einen ganzen Roman in nur drei Tagen zu diktieren. (Ab)Schreiben musste ihn jemand anderes. Seiner Beliebtheit hat das bis heute nicht geschadet. Neben bekannten Kriminalromanen wie »Der Hexer« und »Der unheimliche Mönch« verfasste der arbeitswütige Autor Theaterstücke, Zeitungsartikel, Lyrikbände, Drehbücher, Sachbücher, Afrika-Romane und Kurzgeschichten.
An einem schönen, hellen Nachmittag verließ der Schnellzug nach Eastbourne den Victoria-Bahnhof. Mary Boyd saß in einem Abteil Erster Klasse, aber sie hatte keinen Sinn für die Schönheit der Gegend und für den herrlichen Sonnenschein. Ebenso wenig sah sie ihren Mitreisenden. Fast eine Stunde lang war er in die Lektüre seiner Zeitung vertieft und schien sich nicht im Mindesten um die junge Dame zu kümmern.
Als der Zug geräuschvoll durch Three Bridges fuhr, schaute sie zufällig auf und begegnete seinem Blick. Der Mann war schlank und hager und mochte etwa vierzig Jahre alt sein. An den Schläfen waren seine Haare leicht ergraut, aber sonst tiefbraun. Er trug sie aus der Stirn zurück gebürstet; im übrigen sah er aus wie ein erfolgreicher Kaufmann. Sein Anzug verriet, dass er Geschmack besaß und sich mit Sorgfalt zu kleiden wusste.
Mit einem Blick hatte sie sich ein Bild von ihm gemacht, von der Perlennadel in seiner Krawatte bis zu den Spitzen seiner tadellosen Lackschuhe. Und damit wäre wahrscheinlich auch ihr Interesse erloschen, wenn sie nicht durch den Blick der tiefen, dunklen Augen fasziniert worden wäre.
Nur eine Sekunde schaute sie ihn an, dann errötete sie leicht und sah zum Fenster hinaus.
»Sind Sie nicht Miss Boyd?«
Seine Stimme klang tief und melodisch und hatte einen äußerst sympathischen Klang.
Verwirrt sah sie ihn an und wusste nicht, was sie davon halten sollte. Argwohn, Verdacht, Scheu und Trotz drückten sich in ihrem Blick aus.
»Ja, ich bin Miss Boyd«, sagte sie dann ruhig und überlegte, ob sie ihm schon einmal begegnet wäre. Sie konnte es sich kaum denken, denn sicher hätte sie sein ausdrucksvolles Gesicht nicht vergessen.
»Ich bin Dr. Kay vom Innenministerium«, stellte er sich vor.
»Dr. Kay?«, erwiderte sie überrascht. Sie erinnerte sich jetzt undeutlich an ihn. Frank musste den Namen öfter erwähnt haben.
»Ich habe das Ende der Verhandlung nicht abgewartet«, fuhr er fort, »und eben den Spruch der Geschworenen in den Zeitungen gesucht. Es war doch …?«
Sie nickte und presste die Lippen aufeinander. Eine Träne blitzte in ihrem Auge. Bertram Boyd war gerade kein idealer Vater gewesen; durch seine Schwäche hatte er sich seiner Familie immer mehr entfremdet. Seine Frau hatte aus Gram darüber einen frühen Tod gefunden, und doch hatte Mary Erinnerungen an ihre Jugend, die sie nicht missen mochte. Sie stammten aus der Zeit, in der er noch nicht getrunken hatte. Damals war er ein gutmütiger, freundlicher Mann gewesen, hatte sie als kleines Mädchen auf seinen Schultern durch den Garten getragen und mit ihr gespielt.
Nun wusste sie auch, wo der Fremde sie gesehen hatte, und woher er ihren Namen kannte. Bei dieser traurigen Verhandlung, bei der zwölf Geschäftsleute als Geschworene auftraten und sich dabei zu Tode langweilten, sollte festgestellt werden, auf welche Weise Colonel Bertram Boyd seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Man konnte es ja schließlich verstehen, dass diese Leute es als reine Zeitvergeudung auffassten, denn ein entsetztes Mädchen hatte den alten Colonel eines Morgens mit einer Gasvergiftung in der Küche gefunden, und zwar in dem Haus von Sir John Thorley, dem Schwager des Verstorbenen.
»Ich habe der Verhandlung beigewohnt«, sagte der hagere distinguierte Herr. »Ich wundere mich nur … ich weiß wohl, dass es Ihnen schmerzlich ist, wenn ich über diese Dinge spreche, aber vielleicht sagen Sie mir doch, ob ihr Vater früher jemals die Absicht geäußert hat, seinem Leben ein Ende zu machen. Mir können Sie das ja ruhig sagen.«
Sie zögerte, und er wusste sehr wohl, dass sie nicht mehr über die Tragödie sprechen wollte, die ihr Leben beschattete. Und doch waren seine Augen ebenso zwingend wie freundlich. Er schien tiefes Mitgefühl zu haben, aber dann sagte sie sich, dass er als Amtsarzt schon soviel erlebt und gesehen haben musste, dass ihm die einzelnen Fälle kaum noch nahegehen konnten.
»Ja, manchmal … er hat immer stark getrunken, und seit dem Tod meiner Tante – Sie wissen, der Lady Thorley – litt er sehr unter Depressionen. Deshalb hat ihn mein Onkel John zu sich in die Stadt genommen. Er hoffte, dass ein Wechsel der Umgebung und neue Lebensinteressen ihn vielleicht etwas ablenken könnten. Aber soviel ich weiß, hatte die neue Umgebung nicht den geringsten Einfluss auf ihn. Erst einen Tag vor der Katastrophe erhielt ich einen Brief von Sir John, in dem er mir mitteilte, dass sich mein armer Vater in seinem Wesen vollkommen geändert hätte.«
»Aber hat Ihr Vater Ihnen gegenüber jemals eine derartige Absicht geäußert? Hat er Ihnen einmal gesagt: ›Ich bin lebensmüde‹, oder so etwas Ähnliches?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, aber er hat es zu Onkel John gesagt. Das kam doch bei der Verhandlung deutlich zutage.«
Dr. Kay schwieg. Er hatte sich in seine Ecke zurückgelehnt. Jetzt runzelte er die Stirn und sah zu Boden.
»Ich wünschte, ich hätte die Verhandlung bis zum Ende gehört, aber unglücklicherweise hatte ich eine Verabredung und konnte deshalb nicht bleiben. Ist sonst noch etwas im Zimmer Ihres Vaters gefunden worden?«
Wieder schien sie nur ungern zu antworten. »Zwei Flaschen Whisky – eine war leer, die andere ging stark zur Neige.«
»War er vollkommen angekleidet, als man ihn fand?«
»Ja, er hatte nur keine Straßenschuhe an. Schon früher am Abend hatte er Hausschuhe angezogen. Der Kammerdiener Sir Johns hat ja als Zeuge ausgesagt, dass mein Vater in Pantoffeln am Tisch saß, als er ihn zuletzt in seinem Zimmer sah.«
»Können Sie mir vielleicht sagen, welche Art von Hausschuhen er trug?«
Sie machte eine müde Bewegung, und er merkte wieder, dass ihr alle diese Fragen sehr unangenehm waren.
»Einfache Pantoffeln, in die man einfach hineinschlüpft und die hinten ganz offen sind. Es tut mir sehr leid, Dr. Kay, dass ich unhöflich sein muss, aber ich möchte diese Unterhaltung nicht fortsetzen.«
Er nickte ernst.
»Ich verstehe Sie vollkommen, Miss Boyd. Glauben Sie mir bitte, dass ich nicht aus reiner Neugierde frage. Ich bin ja schließlich auch unverzeihlich aufdringlich, denn ich hätte alle diese Dinge selbst herausbringen können, ohne Sie zu fragen. Übrigens kannte ich Ihre Tante. Sie war immer kränklich. Wenn ich mich recht entsinne, starb sie an Scharlachfieber. Es ging auch ein Gerede, dass sie ein Einbrecher so sehr erschreckt haben sollte … Wohnen Sie eigentlich in Eastbourne?«
Sie erzählte ihm, dass ihr Vater dort ein großes Haus besaß, und nun sprach er begeistert über die landschaftlichen Schönheiten von Sussex. Er selbst stammte auch aus dieser Gegend, und für ihn gab es kein schöneres Land auf der weiten Welt. Früher einmal hatte ihm dort eine Villa gehört, aber sie war durch Feuer zerstört worden.
»Haben Sie Ihr Haus denn nicht wieder aufgebaut?«
Er schüttelte den Kopf.
»Nein. Diesmal gehe ich nach Eastbourne, weil ich dort zu tun habe.« Er sagte jedoch nichts weiter über den Zweck seines Besuches.
Frank Hallwell, ein großer, hübscher Mann, erwartete Mary Boyd auf der Station, und in der Wiedersehensfreude vergaß sie ganz, sich von ihrem Reisebegleiter zu verabschieden.
»Es war nicht recht von mir, Liebling, dass ich dich allein nach London fahren ließ«, sagte der junge Mann, als sie ihren Arm in den seinen legte. »Ich hätte mich um dein Verbot nicht kümmern sollen. Gott sei Dank ist die unangenehme Verhandlung nun vorüber.«
Sie seufzte.
»Wir wollen nicht mehr darüber sprechen«, erwiderte sie. Dann sah sie Dr. Kay noch einmal, als sich die Reisenden dem Ausgang zudrängten.
»Kennst du ihn?«, fragte sie interessiert. »Ich meine den Mann dort – er ist mit mir im selben Abteil gefahren.«
Frank Hallwell folgte der Richtung ihres Blickes.
»Ach, das ist ja Killer Kay!«
»Killer Kay?«, wiederholte sie erstaunt. »Ich wusste wohl, dass er Kay heißt…, aber warum nennt man ihn denn Killer?«
Frank war ein junger Rechtsanwalt, der augenblicklich bei der Staatsanwaltschaft arbeitete. Selbstverständlich kannte er den Arzt sehr gut.
»Sie nennen ihn im Innenministerium Killer, weil durch ihn mehr Leute an den Galgen gekommen sind als durch drei andere tüchtige Detektive. Es gibt keinen Verbrecher in ganz England, dem er nicht unter diesem Namen bekannt ist; er ist einer der größten Spezialisten, was Verbrechen und Verbrecher anbetrifft.«
Sie schauderte.
»Ich vermute, dass er hierhergekommen ist, um den Mord an der Küste aufzuklären, über den alle Leute sprechen. Ich wünschte nur, ich hätte ihn getroffen«, fuhr er begeistert fort, »dann hätte ich dich vorgestellt.«
»Aber Frank, bitte …«
Es tat ihm sofort leid, er hatte im Augenblick nicht an ihre trübe Stimmung gedacht.
Frank Hallwell lebte mit seinem Vater in einem Haus, dessen Garten direkt an den des verstorbenen Colonels Boyd grenzte.
Er hatte den zweiten Abend nach ihrer Rückkehr mit ihr zusammen verbracht und trank gerade noch einen Whisky-Soda, als ihm der Mann gemeldet wurde, nach dem er die beiden letzten Tage vergeblich Ausschau gehalten hatte.
»Das ist aber eine angenehme Überraschung«, sagte er und half dem Besucher, den Regenmantel abzulegen.
Draußen im Kanal herrschte ein furchtbarer Sturm, und der Regen wurde prasselnd gegen die dicht verhängten Fenster getrieben.
»Ich wusste ja, dass Sie hier in der Gegend sind, und ich habe mich schon nach Ihnen umgesehen. Sie kamen mit Miss Boyd hierher – ich bin mit ihr verlobt.«
Killer Kay sah ihn freundlich an.
»Wenn ich gewusst hätte, dass Sie der Verlobte Miss Boyds sind, hätte ich Sie schon vorgestern aufgesucht. Ich habe erst heute Abend davon erfahren.«
Er begleitete Hallwell in dessen Arbeitszimmer, nahm eine der Zigarren, die ihm der junge Rechtsanwalt anbot, und setzte sich dann bequem in den großen Lehnsessel.
»Ihr Tod war nur ein Unfall«, sagte er. »Ich habe Versuche angestellt …«
»Wen meinen Sie denn?«, fragte Frank erschreckt.
»Ich meine das Mädchen an der Küste …, es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.« Kay lächelte über Franks Aufregung. »Die Polizei hier war fest davon überzeugt, dass das Mädchen ermordet wurde. Der junge Mann, den sie verhaftet haben, schwört, dass der Stein oben vom Rand der Klippe fiel. Niemand hat gesehen, dass Steine von der Klippe herunterfallen, aber es kommt tatsächlich vor. Vor einer Stunde wäre ich beinahe selbst von einem solchen Stein erschlagen worden. Es war ein Liebespaar, und die beiden hatten, wie sie glaubten, einen geschützten Platz am Fuß der Klippe gefunden. Das wurde für das junge Mädchen zur Todesursache.«
»Also ist der junge Mann unschuldig?«
»Zweifellos. Ich habe die Tote genau untersucht …, aber darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen. Wie geht es denn Sir John?«
»Ach, meinen Sie Thorley? Hat man Ihnen erzählt, dass er krank war? Er kam heute Nachmittag. Der arme Mann ist furchtbar erschüttert durch diese ganzen traurigen Vorgänge.«
Dr. Kay rauchte behaglich und hatte die Augen halb geschlossen. Er schien mit sich und der Umwelt vollkommen zufrieden zu sein.
»Ich möchte Sir John gern einmal sprechen«, sagte er schließlich. »Ich glaube, er könnte verschiedene Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Tod Colonel Boyds aufklären. Sein Kammerdiener könnte es natürlich ebenso gut tun, aber ich ziehe es immer vor, direkt aus der Quelle zu schöpfen.«
»Das wäre nicht schwer. Er ist auf ein oder zwei Tage nach Eastbourne gekommen, um die Vermögensangelegenheiten seines Schwagers zu regeln. Sir John ist sehr großzügig gewesen und hat Mary tausend Pfund vorgestreckt, so dass sie gut auskommen kann, bis die Vermögensaufnahme stattgefunden hat … Ach, Sie fragen, ob er reich ist? Ja, ich halte ihn für sehr vermögend. Er hat ein großes Haus in der Stadt und ein Landgut in Worcestershire, außerdem noch eine Villa in Mentone. Er trägt immer viel Geld bei sich, was ich für sehr unklug halte. So hat er zum Beispiel Mary bares Geld gegeben.«
Killer Kay richtete sich plötzlich in seinem Stuhl auf. Seine Augen leuchteten.
»Was? Banknoten? Das ist ja großartig … Nun, wir werden weitersehen.«
Am nächsten Abend ging er die lange Zufahrtstraße zu dem Haus des verstorbenen Colonels Boyd entlang. Noch bevor der Hausmeister ihn anmelden konnte, kam Mary in die Halle, um ihn zu begrüßen.
»Ich hatte keine Ahnung, dass ich mit einem so großen Mann zusammen reiste«, sagte sie und lächelte ihn an. »Ich habe meinem Onkel noch nichts über Ihren – Beruf gesagt. Er ist im Augenblick sehr angegriffen, und ich dachte, das könnte ihn vielleicht …«
»Ja, der Meinung bin ich auch, Miss Boyd. Sie sind sehr vorsorglich. Sie haben jetzt natürlich sehr viel zu tun?«
Sie nickte.
»Sie mussten wohl viele Unterschriften leisten, auch mussten andere Leute Ihre Unterschrift als Zeugen bestätigen?«
Sie nickte wieder.
»Onkel John kann Rechtsanwälte nicht leiden. Morgen kommt mein Notar. Aber es gab verschiedene Dinge zu regeln, die meinen verstorbenen Vater betrafen und die wir um seines Andenkens willen lieber unter uns abgemacht haben. Ich weiß allerdings nicht, wie ich dazu komme, Ihnen das zu erzählen.«
Sie lachte ein wenig verlegen.
»Bevor wir hineingehen, möchte ich Sie noch um einen Gefallen bitten.«
Sie zog die Augenbrauen hoch.
»Ich werde Ihnen gern einen Wunsch erfüllen, wenn ich kann.«
»Versprechen Sie mir, mich telegrafisch zu benachrichtigen, welchen Zug Sie benutzen, wenn Sie das nächste Mal nach London kommen.«
Sie starrte ihn verwundert an.
»Aber warum denn?«
»Wollen Sie es mir versprechen? Sie sagten doch eben, dass Sie mir gern einen Wunsch erfüllen würden, wenn Sie könnten.«
»Ja, ich werde Ihnen telegrafieren, wenn es Ihnen Freude macht, aber …«
»Ich lasse kein Aber gelten«, erwiderte er gutgelaunt und folgte ihr dann ins Wohnzimmer.
Sir John Thorley war ein untersetzter Herr mit rotem Gesicht, weißem Schnurrbart und weißen Augenbrauen. Er sah aus wie ein strenger Oberst, der viele Jahre in Indien gedient hat, und sein Wesen war auch ziemlich hart und rau.
»Ich freue mich, Sie zu sehen, Doktor«, sagte er. »Sie sind ein Freund des jungen Hallwell – hm.«
Es war eine dumme Angewohnheit von ihm, dass er am Ende eines Satzes dieses »Hm« hinzufügte, denn dadurch verwandelte er unwillkürlich jedes Kompliment ins Gegenteil. Es hatte immer den Anschein, als ob er mit seinen Worten weitergegangen wäre, als er vorher beabsichtigt hatte, und als ob er seiner Meinung nach liebenswürdiger und freundlicher gewesen wäre, als es die Situation verlangte. Nachher schien er den Doktor völlig zu ignorieren und sprach nur mit seiner Nichte.
»Es ist ein ziemlich großes Haus für ein junges Mädchen«, sagte er kopfschüttelnd. »Du würdest besser tun, eine Wohnung in der Stadt zu mieten oder ein paar Hotelzimmer zu nehmen. Leider kann ich dich nicht in mein Haus einladen – das ist mir einfach unmöglich –, du verstehst schon, was ich meine. Aber hier darfst du auf keinen Fall allein bleiben.«
»Warum denn nicht, Onkel John?«, fragte sie beinahe belustigt.