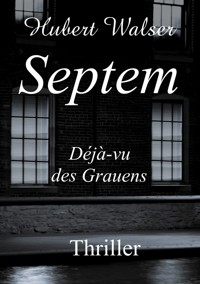Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schon früh musste Morrigan lernen, dass das Leben für sie nur wenige Glücksmomente bereithält. Als sie aber Jahre später auch noch des Mordes an Dorothea Kelter, ihrer unbarmherzigen Adoptivmutter bezichtigt wird, beginnt für sie ein Spießrutenlauf mit folgenschweren Begebenheiten. Wird diese junge Frau trotz aller Widrigkeiten jemals Glück und Frieden finden oder muss sie sich ihrem Schicksal beugen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Vorbestimmung
Alltag
Schändlich
Kindheit
Ausweglos
Flucht
Mogustral
Neuanfang
Hoffnung
Bestimmung
Schmetterlinge
Schock
Schuldspruch
Einsicht
Zufall
Magie
Chance
Trott
Fügung
Botschaft
Monster
Déjà-vu
Schicksal
Über das Buch
Danksagung
Prolog
Es ist eine Zeit, in der Zwietracht die Bevölkerung des neu gegründeten Staates in zwei Lager teilt. Das Bürgertum steht der sozialen Klasse der Gesellschaft gegenüber, wodurch es immer wieder zu Abgrenzungen kommt. Die sich daraus ergebenden Konflikte enden meist in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit vielen Verletzten und Toten. Während die Aristokratie, geschützt durch eine korrupte Gendarmerieherrschaft in ihren Nobelvierteln im Überfluss und Reichtum lebt, herrscht in anderen Teilen des Landes bittere Armut. So auch in Mogustral, der größten Stadt des Landes, wo die Teilung der Bevölkerung nicht nur durch die gesellschaftliche Schichtung erfolgt, sondern auch durch einen Fluss. Nördlich des Miislats lebt die Oberschicht mit all ihren Annehmlichkeiten und Reichtümern, während südlich des Flusses der tägliche Kampf ums Überleben von Tag zu Tag härter wird. Zudem kommt auch noch, dass seit einiger Zeit die stetig wachsende Einwohnerzahl von Mogustral regelrecht explodiert. Die sich daraus ergebenden Folgen sozialer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Art werden in den noblen Bezirken des nördlichen Teils der Stadt kontinuierlich totgeschwiegen. Die Versorgung der Bewohner von Mogustral mit den Dingen des täglichen Alltags verlangte schon vor Jahren ein weitreichendes Verkehrsnetz, weil ausnahmslos alle Waren auf dem Seeweg nach Mogustral kommen. Der neue Hafen sowie auch der alte Hafen liegt jedoch im südlichen, dem ältesten und ärmsten Teil der Stadt. Sieben Brücken führen über den Miislat, wobei Letztere erst in der Fertigstellung liegt. Es ist eine besondere Brücke mit einem nicht alltäglichen Verwendungszweck. Über sie sollen die Geleise der neuesten Errungenschaft der Technik, direkt vom neuen Hafen bis zu den großen Lagerhäusern nordwestlich der Stadt führen. Es ist eine Dampfeisenbahn, deren Fertigstellung kontinuierlich von den Arbeitern einer auf Gewinn orientierten Eisenbahngesellschaft vorangetrieben wird, welche ihren Sitz in Estrashafen hat. Allerdings soll dieses Statussymbol des Fortschrittes nicht nur dem Transport von Waren dienen. Die Führung der Stadt hat diesem Projekt nur unter einer Bedingung zugestimmt, dass in weiterer Folge auch eine Dampfstraßenbahn zur Personenbeförderung in die vornehmen Viertel gebaut wird. Im Westen der Stadt, dort wo in weiter Ferne die große Wüste zu erkennen ist, breitet sich ein Industrieviertel aus. Obwohl tausende Menschen hier einen Arbeitsplatz finden, trägt dies nicht im Geringsten zu einer Entspannung der Lage bei. Die Besitzer der Fabriken, welche zumeist Baumwollspinnereien, Färbereien, Schlachthöfe sowie andere Gewerbebetriebe sind, kommen ausschließlich aus dem nördlichen Wohnviertel von Mogustral. Die Arbeiter hingegen stammen vorwiegend aus dem südlichen Teil sowie dem ärmlichen Umfeld der Stadt. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, unzureichende Bezahlung, sowie das Fehlen einer ärztlichen Notversorgung tragen das ihre dazu bei, dass unter den Arbeitern ein ständiges Kommen und Gehen zum Alltag gehört. Dass dieser Umstand den Besitzern der Fabriken nur recht ist, erklärt sich dadurch, dass jeden Tag Hunderte vor den Werkstoren der Fabriken nur darauf warten einen Arbeitsplatz zu ergattern. Neid und Missgunst um jedes Beschäftigungsverhältnis führen zu Reibereien unter den Arbeitssuchenden.
Vorbestimmung
Es ist ein kalter und verregneter Herbstmorgen im Jahre 1835, als Elsbeth Zott wie jeden Tag, die unter einem Vordach abgestellten Wäschekörbe in ihre Waschküche trägt. Es sind meist Bettlaken, Vorhänge und Tücher zur Körperpflege, welche von der Dienerschaft der Reichen von früh morgens bis meist mittags bei ihr und den vielen anderen Wäscherinnen von Mogustral abgegeben werden. Im selben Zug werden die Körbe mit der frisch gewaschenen Wäsche der letzten Woche wieder mitgenommen. Elsbeth Zott ist eine von Dutzenden Frauen, die sich auf diese Art und Weise ihren kärglichen Lebensunterhalt verdienen. Ihre Arbeit beginnt mit dem ersten Licht des Tages und endet meist spätabends. Nach einem nicht gerade üppigen Frühstück schürt Elsbeth zu allererst den Wasserdämpfer an, ehe sie damit beginnt, all die Wäsche sorgsam zu sortieren, damit nur ja nichts durcheinander kommt. So wie es der Brauch ist, hängt an jedem Korb ein kleiner Säckel, in dem sich der Lohn für ihre mühevolle Arbeit befindet. Drei bis vier Stunden steht sie täglich am Zuber, um den Waschvorgang abzuschließen. Anschließend nimmt sie die getrocknete Wäsche vom Vortag ab, um die frisch gewaschene aufzuhängen. Danach gönnt sie sich ein bescheidenes Mittagessen, ehe sie mit dem Bügeln und Glätten beginnt. Nein Elsbeth beklagt sich nicht, obwohl ihr in letzter Zeit die langen Arbeitstage immer mehr gesundheitliche Probleme bereiten. Ihren Mann und ihre beiden Kinder, zwei Mädchen, hat sie schon vor vielen Jahren verloren, damals als die Pest in Mogustral wütete. Ihr Mann Cornelius Zott war ein begnadeter Zimmermann, der für sie und ihre Kinder ein kleines aber umso liebevoller gestaltetes Haus errichten konnte, um das sie viele in ihrer Nachbarschaft beneiden. Doch das Schicksal wollte Elsbeth dieses bescheidene Glück nicht gönnen. So vergeht für sie Tag für Tag, Woche für Woche, ohne dass sich auch nur das Geringste an ihrem Alltag ändern würde. Und dennoch, an diesem Morgen kommt ihr etwas anders vor als gewöhnlich. Es ist ein Wäschekorb mehr, der unter dem Vordach ihres kleinen Hauses steht. Ein Wäschekorb, den sie noch nie gesehen hat.
Hat da vielleicht gar jemand einen falschen Korb bei ihr abgegeben? Ein junges Dienstmädchen oder ein Hausdiener, der sich noch nicht so gut auskennt in diesem Viertel der Stadt. Was also soll sie jetzt tun? Diese Wäsche auch noch waschen oder einfach nur ignorieren? Wie wenn sie nicht schon genug Arbeit hätte, denkt sie sich. Andererseits macht es kein gutes Bild, wenn sie diesen Korb so mir nichts dir nichts stehen lassen würde, obwohl nicht einmal ein Säckel daran befestigt ist und somit auch ihr Lohn fehlt. Um aber länger über dieses Problem nachzudenken, fehlt ihr schlichtweg die Zeit. Also beschließt sie, auch diese Mehrarbeit zu verrichten und darauf zu achten, wer diesen Korb abholen kommt. Also auch noch diesen Korb in die Waschküche tragen. Dabei glaubt sie, von irgendwo her ein Weinen zu vernehmen, obwohl sie schon seit Jahren immer schlechter hört. Wie immer beginnt sie schon bald, ein Lied zu singen. Elsbeth hat eine schöne Stimme, die früher im Chor ihrer Glaubensgemeinde gerne gehört wurde. Weil sie aber nach dem Tod ihres Mannes für ihren Unterhalt selbst sorgen musste, blieb ihr nicht mehr die Zeit, die zweimal wöchentlich stattfindenden Chorproben zu besuchen.
Erschrocken zuckt ihre Hand zurück, nachdem sie den letzten Korb zu sortieren begonnen hat. Es ist etwas Unbekanntes, was sie in diesem Moment fühlt. Etwas Warmes und zugleich Feuchtes, das sich auch noch zu bewegen scheint. Als sie aber ein weiteres Lacken anhebt, glaubt sie, ihren Augen nicht zu trauen. Zappelnd und schreiend liegt in dem Korb ein Neugeborenes, dem weder die Nabelschnur verbunden, noch die Käseschmiere von seinem zarten Leib gewaschen wurde. Es ist ein kleines Mädchen, das vor ihr in dem Wäschekorb liegt. Ein kleines unschuldiges Wesen, dem das Schicksal einen nicht gerade wohlgesonnenen Start in sein Leben beschert hat. Was soll sie damit jetzt aber nur tun? Natürlich weiß Elsbeth, dass dieses kleine Häufchen Leben zuallererst versorgt werden muss. Behutsam badet sie das Mädchen im lauwarmen Wasser, trocknet es sanft ab, um es anschließend in ein sauberes, weiches Lacken zu wickeln. Dass es damit aber nicht getan ist, dessen ist sich Elsbeth natürlich bewusst. Das Kind braucht unbedingt Nahrung. Wie aber soll das gehen? Stillen kann sie das Kind nicht. Allerdings erinnert sie sich an einen Artikel, den sie in der Zeitung, die sie sich einmal im Monat gönnt, erst vor Kurzem gelesen hat. Dabei ging es darum, dass viele Frauen komplett auf das Stillen verzichten, ohne dass dies dem Kind schaden soll. Diese neue Modeerscheinung betrifft zum einen Frauen, die von morgens bis abends in den Fabriken hart arbeiten müssen und zum anderen solche, die aus der gehobenen Schicht kommen. Sie tun dies aus ästhetischen Gründen, weil es bei den Damen immer schicker wird, einen schlanken und grazilen Körper vorzuzeigen zu können. Und dazu passt nun Mal keine große Brust. Obwohl Elsbeth zur Gruppe der ersteren Frauen gehört, hat sie ihre Kinder länger als zwei Jahre gestillt. Doch das soll jetzt nichts zur Sache tun. Also mussten sich viele der Neugeborenen dieser Zeit mit Zuckerwasser und einem dicken Milchbrei begnügen, der oft schon sauer vergoren war. Ein weiteres Rezept um geeignete Kindernahrung zuzubereiten war Biersuppe mit Butter und Zucker oder süße Molken, mit frischer Milch und gequirltem Ei. Als Babyflasche dient ihr eine Schnabelkanne, deren Ende sie mit einem Stück Leinen umwickelt, sodass nie zu viel von der Nahrung in den Mund des Kindes kommen kann. Und siehe da, das kleine Mädchen scheint diese Art der Nahrungsaufnahme anzunehmen, was allerdings noch lange nicht bedeutet, dass es die kommenden Tage, Wochen oder Monate überleben wird, zumal die Kindersterblichkeit bei der ärmeren Bevölkerung sehr hoch liegt. Dessen ist sich auch Elsbeth bewusst. Dennoch hofft sie, diesem kleinen, mehr als nur hilflosen Mädchen helfen zu können. Und wie es aussieht, hat ihr Bemühen Erfolg. Obwohl für sie ihr ohnehin schwerer Arbeitstag kaum zu bewältigen ist, umsorgt sie das kleine Mädchen genauso, wie wenn es ihr eigenes wäre. So vergeht Woche um Woche, ohne dass jemand nach dem Kind fragt oder den Korb abholen kommt. Es interessiert auch niemand aus ihrer Nachbarschaft, wie Elsbeth zu einem Kind kommen konnte, bis eines Morgens zwei Männer vor ihrer Tür stehen. Es sind dies ein junger Gendarmeriewachtmeister und ein Mann, klein, rundlicher Bauch und einer Nickelbrille auf seiner Nase. In seiner Hand trägt er eine alte und abgegriffene Ledertasche.
„Guten Tag. Mein Name ist Oberkanzleirat Giselbert Seiser. Unserer Magistratsabteilung wurde gemeldet, dass Sie seit einiger Zeit ein Kind haben, welches Sie noch nicht eintragen haben lassen. Ich bin vom Melderegister und muss Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Unzulänglichkeit von seitens unseres Amtes nicht geduldet werden kann“, rechtfertigt der Mann sein Erscheinen, ehe er ohne zu fragen in ihr Haus geht.
„Seit wann ist es verboten, ein Kind in seinem Haus großzuziehen?“
„Gute Frau, das ist nicht verboten und hat auch niemand behauptet. Was aber verboten ist, ist der Tatbestand, diese Gegebenheit der Behörde zu verschweigen, um sich den anfälligen Betrag für die Eintragung im Geburtenregister zu ersparen. Aus diesem Grund ergeht ein Straferlass von 30 Selani an Sie. Zuvor aber muss ich Sie nach den Namen des Vaters, den der Mutter sowie den des Kindes fragen. Außerdem benötigt unser Amt das Geburtsdatum und das Geschlecht des Kindes, um alles ins Einwohnerregisterbuch einzutragen“, erklärt ihr dieser Mann, nachdem er sich an den Tisch setzt und seine Unterlagen vor sich ausbreitet. Völlig überrascht von dieser Situation weiß Elsbeth nicht, was sie sagen soll, ehe sie der Mann fragt: „Haben Sie das verstanden?“, worauf Elsbeth wiederum nur mit dem Kopf nickt.
„Nun denn, welchen Namen haben Sie und Ihr Mann dem Kind gegeben?“
Weil aber Elsbeth weder den Namen des Kindes noch deren Eltern kennt und ihr auch kein anderer, als der einer ihrer verstobenen Töchter einfällt, gibt sie diesen als den Namen des Kindes an.
„Also Morrigan. Weiblich, wie sich aus dem Namen ergibt. Und wie noch? Gute Frau ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um mir jede Antwort aus Ihrer Nase zu ziehen. Also wie lautet der Zuname dieses Kindes?“
„Es tut mir leid, aber Morrigan ist ein Findelkind. Morrigan wird wohl genügen.“
„Also Morrigan Zott. So lautet wohl Ihr Nachname oder irre ich mich?“
„Nein“, antwortet Elsbeth verlegen.
„Geburtsdatum?“
„Letzte Woche?“
„Das ist kein Datum! Aber was soll's, ist doch einerlei. Also dritter Tag des vierten Monats 1835.“
„Und der Name des Vaters. Wie lauter der?“, fragt der Beamte, worauf Elsbeth wiederum nur mit ihren Schultern zucken kann.
„Also, Name des Vaters … Unbekannt. Dann wäre nur noch ein Bußgeld von, wie schon erwähnt, 30 Selani von mir als Beauftragter des Melderegisters unserer Magistratsabteilung einzufordern.“
„Was 30 Selani? So viel habe ich nicht!“
„In diesem Fall muss Sie mein Kollege mitnehmen, genauso wie es in den Statuten der Stadt Mogustral verankert ist.“
„Wohin mitnehmen?“
„Ins Gefängnis natürlich, wohin denn sonst. Für jeden säumigen Selani ist eine Woche Arrest vorgesehen.“
„Nein ins Gefängnis gehe ich nicht. Nicht in den Arrest. Was soll in der Zeit aus dem Kind werden“, beteuert Elsbeth, ehe sie aus der Schublade am Küchentisch schweren Herzens ihren Geldsäckel hervorholt, diesen auf ihre Handfläche entleert und mit Tränen in ihren Augen sagt: „Das ist alles, was ich habe. Mein ganzes Erspartes, 22 Selani.“
„Nun gut. In Anbetracht der Tatsache, dass Sie gewillt sind, die Strafe zu bezahlen, ist es mir in meiner Funktion als Kanzleirat gestattet, Ihnen eine Zahlungsfrist von einem Monat für den noch ausstehenden Betrag in der Höhe von acht Selani plus vier Selani Zinsen einzuräumen. Sollten Sie diese Frist allerdings versäumen, so mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie die gesamte Strafe, einschließlich der Zinsen absitzen müssen. Haben Sie das verstanden?“
Zurückhaltend nickt Elsbeth nach dieser Ansage, um den Mann nur ja nicht zu verärgern. Wie sie allerdings in einem Monat mehr als ein Dutzend Selani absparen soll, weiß sie nicht.
Schon naht jener Tag, an dem Giselbert Seiser, der Mann vom Melderegister, sein erneutes Kommen angesagt hat, als Elsbeth nach einem harten Arbeitstag ihren Geldsäckel zur Hand nimmt, um das mühevoll erarbeitete und gesparte Geld zu zählen. Neun Selani und ein paar Kupfermünzen. Mehr konnte sie in einem Monat nicht beiseitelegen, obwohl sie nur einige Groschen für Milch und etwas Zucker ausgegeben hat. Dabei müsste sie dringend noch Holz für den Winter kaufen, um ihr Haus zu beheizen und auch ihren Waschzuber zu erwärmen.
„Was sollen wir nur machen, mein Schatz? In drei Tagen wird dieser Mann vor unserer Tür stehen, um meine Restschuld einzufordern“, fragt Elsbeth ihr Mündel, geradeso als Morrigan ihr eine Antwort darauf geben könnte. Noch hadert Elsbeth mit dem Gedanken, ob sie das einzige Erinnerungsstück, welches sie von ihrer Mutter vererbt bekommen hat, verpfänden soll. Es ist eine silberne Taschenuhr. Den Wert dieser Uhr kennt sie nicht und so weiß sie auch nicht, wie viel sie dafür bekommen würde. Und dann wäre noch ihr Notgroschen, den sie dafür verwenden könnte. Es sind dies 40 Selani, die sie nie angerührt hat. Letzteres kommt für sie nach kurzem Überlegen jedoch nicht in Frage. Als nämlich Morrigan in ihr Leben trat, stand für Elsbeth fest, dass dieses Geld irgendwann einmal ihrer Adoptivtochter gehören soll. Ursprünglich war das Geld für ihre Mädchen gedacht, um ihnen, wenn es so weit ist, den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Jetzt aber will sie es für Morrigan aufsparen, um ihr zu gegebener Zeit eine Aussteuer mit ins Leben geben zu können.
Am Morgen des nächsten Tages, gerade als Elsbeth die vor ihrem Haus abgestellten Schmutzwäschekörbe in ihre Waschküche trägt, kann sie beobachten, wie Dorothea Kelter unweit ihres Hauses eines ihrer Mädchen mit Schlägen aus dem Haus jagt. Dorothea ist die Frau von Tommen Kelter, dem Besitzer einer Schenke, die Abend für Abend zu einem Bordell wird. Seine Mädchen wohnen im angrenzenden Frauenhaus. Elsbeth kennt das Mädchen, welches mehr als unsanft von Dorothea vor die Tür gesetzt wurde. Es ist Maren Sattler, die im Haus der Kelters allerlei Arbeiten verrichten musste. Sie ist aber keine Prostituierte und mit ihren zwölf Jahren noch zu jung für dieses Gewerbe, obwohl Dorothea nur darauf wartet, bis ein Freier nach ihr fragt. Von morgens früh, bis die ersten Gäste kommen, muss Maren den Schankraum putzen, die Spucknäpfe leeren und all die Arbeiten verrichten, die sonst niemand verrichten will. Unter anderem auch die Schmutzwäsche zu Elsbeth bringen und die Gewaschene abholen. Selbst am Abend, wenn sich das Publikum in Tommens Schenke ändert und seine Mädchen ihre Dienste anbieten müssen, gibt es für Maren keine Ruhepause.
„Hat sie dich wieder geschlagen?“, fragt Elsbeth, als Maren mit einem Korb voll Lacken vor ihr steht. Beschämt blickt Maren zu Boden, ehe sie mit einem Kopfschütteln Elsbeths Frage verneint.
„Hier trink einen Schluck Milch, während ich die frischen Laken hole. Wenn du möchtest, darfst du auch Morrigan in deine Arme nehmen.“
„Danke“, antwortet Maren schüchtern, obwohl sie sich Elsbeth schon des Öfteren anvertraut hat.
„Möchtest du mir erzählen, was geschehen ist?“, fragt Elsbeth ohne Maren dabei zu bedrängen, als sie mit einem Stapel Wäsche zurückkommt. Noch überlegt die junge Frau, ob sie sich Elsbeth wieder einmal anvertrauen soll, ehe sie verlegen und mit leiser Stimme zu erzählen beginnt.
„Dorothea hat mich beschuldigt, dass ich einen ihrer Ohrringe gestohlen habe, aber ich war das nicht. So etwas würde ich nie tun.“
„Natürlich nicht. Bestimmt hat Dorothea den Ohrring nur verlegt und er findet sich wieder. Möchtest du noch etwas Milch?“
„Nein danke, ich muss jetzt gehen, sonst setzt es eine weitere Tracht Prügel.“
„Armes Ding“, denkt sich Elsbeth, ehe sie sich wieder an ihre Arbeit macht und dabei Morrigan ein Lied vorsingt. Beim Sortieren der Wäsche, die Maren gebracht hat, dünkt es Elsbeth plötzlich, als ob etwas daraus auf den Fußboden gefallen wäre. Nachdem sie auch noch ihren Blick nach unten wendet, sieht sie dort einen goldenen Ohrring liegen. Schwer wirkt dieses Schmuckstück, als sie es in ihrer Hand hält. Obwohl sie dessen Wert nicht abzuschätzen vermag, weiß sie, dass mit diesem Ohrring ihre Schuld beimMelderegister beglichen wäre. Trotzdem steht sie kurz darauf mit Morrigan im Arm vor Dorothea Kelter und erklärt ihr, dass sich dieser Schmuck in ihrer Wäsche befunden hat.
„Siehst du, ich habe dir gleich gesagt, dass sich dein Ohrring wieder finden wird. All die Aufregung war umsonst“, tadelt Tommen seine Frau, ehe er Elsbeth fragt, ob er sich für diese ehrliche Geste revanchieren könne.
„Vielleicht können Sie mir wirklich helfen. Die kalte Jahreszeit steht unwiderruflich vor der Tür und ich muss noch Heizmaterial kaufen, damit mein kleiner Schatz nicht frieren muss. Ich hätte da eine Herrenuhr, mit der ich eigentlich nichts anzufangen weiß. Vielleicht gefällt sie Ihnen. Es ist ein … Erbstück, das meine Mutter vor vielen Jahren von einem Onkel, den ich nicht einmal gekannt habe, bekommen hat. Nichtsdestotrotz, die Uhr ist in tadellosen Zustand. Vielleicht sind Sie interessiert, mir diese kleine Kostbarkeit abzukaufen?“, fragt Elsbeth und es fällt ihr wirklich schwer, dieses letzte Erinnerungsstück von ihrer Mutter aus ihrer Hand zu geben.
Es war bestimmt kein gutes Geschäft und Elsbeth weiß das auch, als sie mit einem Dutzend Selani wieder zurück zu ihrem Haus geht. Dennoch genügt der ausverhandelte Preis, den ihr Tommen Kelter für die Uhr bezahlt hat, um ihre Schuld zu begleichen. Letzten Endes ist sie sogar froh, diesen Weg gewählt zu haben. Zum einem, weil auch Maren im Schankraum war, als sie den Ohrring zurückgegeben hat und somit Dorothea ihr Dienstmädchen nicht weiter beschuldigen kann, sie bestohlen zu haben und zum anderen, weil sie auf diese Weise ihren Notgroschen nicht anrühren muss.
Alltag
So vergehen die Jahre, ohne dass irgendwer sich jemals nach Morrigan erkundigt hätte. An Elsbeths Alltag ändert sich auch nicht viel, außer dass es ihr immer schwerfällt, ihre Arbeit zu verrichten. Zudem hat sie auch noch vor etwas mehr als einem Jahr damit begonnen, Morrigan und einige gleichaltrige Kinder aus der Nachbarschaft nach dem Mittagessen zu unterrichten. Lesen, schreiben und rechnen sollen sie genauso lernen, wie die Kunde der Natur. Sie hat sich dazu entschieden, weil sie so wie viele aus der ärmlichen Arbeiterklasse das Geld für einen Schulbesuch nie und nimmer aufbringen könnte. Elsbeth tut dies jedoch mit Freude, ohne jemals den Gedanken daran zu verlieren, Kapital daraus zu schlagen. Nur Morrigan und ihre Freunde sollen davon profitieren, um in Zukunft vielleicht ein besseres Leben führen zu können. Doch das Schicksal scheint anderer Meinung zu sein.
„Mama, was ist mit dir?“, fragt Morrigan, mittlerweile sieben Jahre alt, als sie ihre Ziehmutter am Morgen eines schwülen und heißen Sommertages schweißgebadet und zugleich zitternd, gerade so als ob sie frieren würde, in ihrem Bett vorfindet.
„Morrigan … geh zu Maren … sag ihr, sie soll herkommen“, stöhnt Elsbeth mit schwacher Stimme.
„Was willst du denn hier. Das ist eine Schenke, in der Kinder nichts zu suchen haben. Also raus mit dir“, schimpft Dorothea Kelter, als sie Morrigan kurz darauf zur Tür hereinkommen sieht.
„Meine Manna schickt mich. Ich soll Maren holen.“
„Deine Mama schickt dich, um meine Maren zu holen? Warum kommt sie nicht selber her? Oder bist du jetzt ihr Dienstmädchen?“
Mehr aber als den Kopf zu schütteln getraut sich Morrigan nach diesen Worten nicht.
„Wo ist deine Mutter? Geht es ihr nicht gut?“, fragt Maren mit Besorgnis, weil sie Morrigans Bitte mit anhören konnte.
„Ich weiß es nicht“, antwortet Morrigan schüchtern.
„Was heißt, du weißt es nicht? Du wirst wohl wissen, wo deine Mutter ist. Außerdem ist sie mit einem ganzen Wäschekorb, für den ich sie bereits entlohnt habe im Rückstand. Richte deiner Mutter aus, sie soll gefälligst ihrer Verpflichtung nachkommen. Ich bezahle ihr sowieso schon mehr als all die anderen. Also worauf wartest du noch?“, schimpft Dorothea.
„Ich werde trotzdem nachsehen. Ohne Grund schickt Elsbeth nicht nach mir. Womöglich ist sie krank oder hat sich verletzt und braucht deshalb meine Hilfe“, sagt Maren, ehe sie Morrigan an der Hand nimmt, um mit ihr gemeinsam nach Elsbeth zu sehen.
„Nichts da. Du bleibst gefälligst hier. Schon vergessen, du bist an der Reihe den Schankraum zu fegen, die Spucknäpfe zu leeren und für meinen Mann das Frühstück zu bereiten. Ich werde selbst nach Elsbeth sehen und wehe es handelt sich nur um eine Lappalie“, maßregelt Dorothea Maren, ehe sie ihr das junge Mädchen entreißt, um sich selbst mit großen Schritten auf den Weg zu machen. Dabei vergisst sie nicht, allen Anwesenden zu erklären, dass sie selbst nach dem Rechten sehen wird.
Erschrocken weicht Dorothea im ersten Moment zurück, als sie Elsbeth in ihrer Kammer sieht, ehe ihr die wohl unpassendste Frage über die Lippen kommt: „Was zum Henker hast du denn für eine Krankheit?“
Doch Elsbeth ist bereits zu schwach, um darauf zu reagieren oder zu antworten. In Dorothea aber reift ein Plan, der ihr zum begehrtesten Objekt dieser Straße verhelfen könnte. Dieses Haus sowie der dazugehörige Garten. Obwohl ihr nichts am Wohl der sterbenskranken Frau liegt, schickt sie Morrigan noch einmal los, um auch Maren herzuholen.
„Morrigan hat gesagt, ich soll sofort herkommen? Geht es Elsbeth nicht gut? Ist sie krank?“, möchte Maren besorgt wissen, als sie in deren Kammer kommt.
„Wahrscheinlich nur einer ihrer Schwächeanfälle, um ihren Rückstand mit meiner Wäsche zu rechtfertigen. Nichtsdestotrotz werde ich mich um sie kümmern, wie es für eine rechtschaffene Bürgerin und Nachbarin unserer Stadtgemeinde geziemt. Geh zu Doktor Lumen und bitte ihn herzukommen. Na los worauf wartest du noch?“, bestimmt Dorothea nicht ohne Hintergedanken.
„Ohne eine Anzahlung für sein Honorar wird der Doktor bestimmt nicht kommen“, rechtfertigt Maren ihren nicht sofort erfolgten Aufbruch, worauf ihr Dorothea voller Zorn zwei Selani überreicht und meint, „hier das muss reichen und jetzt sieh zu, dass dieser geldgierige Doktor hier erscheint.“
„Danke Herr Doktor, dass Sie so schnell gekommen sind. Können Sie schon sagen, was meiner lieben Freundin fehlt?“, heuchelt Dorothea etwas später, als der Arzt in der Tür zu Elsbehts Kammer erscheint.
„Ohne sie zu untersuchen? Ich bin kein Hellseher, sondern Arzt. Also muss ich Sie bitten, für die Dauer der Untersuchung den Raum zu verlassen. Ich gebe Ihnen schon rechtzeitig bekannt, wenn sie wieder zu der Kranken dürfen“, erklärt der Mann Dorothea, ehe er einige Instrumente aus seiner Arzttasche holt.
„Eindeutig Fleckfieber in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Da kann ich nicht viel tun, diese Krankheit muss von selbst abheilen. Aber keine Sorge, Fleckfieber ist weder ansteckend noch gefährlich“, diagnostiziert der Arzt mitleidlos, als er nach gut einer viertel Stunde Dorothea zu sich bittet.
„Aber irgendwie müssen wir ihr doch helfen“, heuchelt diese daraufhin.
„Ich werde Ihnen einen Balsam sowie ein neues Medikament hierlassen, vorausgesetzt Sie kümmern sich um die Patientin und verabreichen ihr meine Medikation. Zwei Tropfen Morphin in einem Glas Wasser zweimal täglich, damit sie wieder zu Kräften kommt. Aber achten Sie tunlichst darauf, dass dieses Medikament sonst niemand in die Hände bekommt. Eine Überdosierung führt in den meisten Fällen zum Tode. Mit dem Balsam können Sie vorsichtig ihre Fieberflecken einreiben, um deren Abheilung ein wenig zu beschleunigen. Haben Sie das verstanden? Gut, dann wäre nur noch die Frage, wer für die Kosten dieser Medikamente aufkommt. Ich bin kein Samariter.“
„Ich habe Maren doch schon zwei Selani gegeben, um Ihre Unkosten zu begleichen?“
„Die zwei Selani reichen gerade einmal für meinen Besuch. Ein Selani und sieben Groschen wären für die Salbe zu entrichten. Morphin hingegen ist ein nicht so billiges Medikament, das bei richtiger Anwendung jedoch einen vorzüglichen Heilungsverlauf verspricht. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist damit äußerste Vorsicht geboten. Wenn aber niemand bereit ist, für die Unkosten von vier Selani aufzukommen, muss ich meine Medikamente wieder mitnehmen, so leid es mir tut.“
„Sie sind ein Halsabschneider Herr Doktor. Nichtsdestotrotz, hier sind noch einmal drei Selani. Mehr habe ich nicht.“
„Meinetwegen. Ich tue das aber nur, damit dieses Kind seine Mutter nicht verliert. Also geben Sie schon her. In ein paar Tagen werde ich noch einmal nach der Frau sehen. Und nicht vergessen! Zwei Mal zwei Tropfen täglich und auf keinen Fall mehr“, ermahnt der Arzt Dorothea noch einmal.
Geradeso, als ob mit ihr ein Sinneswandel einhergegangen wäre, kümmert sich Dorothea schon fast vorbildhaft um Morrigan und auch um Elsbeth, der es nach einigen Tagen erstaunlicherweise sogar ein wenig besser zu gehen scheint. Doch der Schein trügt. Es ist nicht die Pflege, welche Dorothea der Frau zukommen lässt, sondern der natürliche Verlauf der Krankheit. So sind nach ein paar Tagen bereits nur mehr wenige Flecken zu erkennen. Das Morphin, welches der Arzt für ihre Genesung in gleicher Weise als unabdingbar erachtet hat, scheint ebenfalls eine sichtbare Wirkung zu zeigen. Jedoch nicht jene, welche der Arzt prognostiziert hat. Elsbeth wird zusehends müder und lethargischer. Sie isst nichts mehr und trinkt auch nur das, was ihr Dorothea schon fast mit Gewalt einzuflößen versucht.
„Stirb endlich du verdammte Schlampe. Ich bin es leid, mir seit Tagen dein Gejammer anzuhören“, schimpft Dorothea, als sie Elsbeth erneut eine viel zu hohe Dosis Morphin zu verabreichen versucht. Dem nicht genug hat sie diesmal dem Wasser einen Absud aus Eisenhut beigegeben. Es dauert auch nicht lange, bis diese tödliche Mixtur ihre Wirksamkeit zeigt. Von Krämpfen gepeinigt wälzt sich Elsbeth in ihrem Todeskampf schon seit mehr als einer halben Stunde hin und her, ehe ihr schmerzverzerrter Gesichtsausdruck erschlafft.
„Na endlich wird auch langsam Zeit. Ich habe schon befürchtet, du willst ewig leben du verdammtes Miststück“, schimpft Dorothea sichtlich zufrieden, als sie feststellen kann, dass die Frau vor ihr nicht mehr atmet.
Ohne jeglichen Skrupel beginnt Dorothea im Anschluss daran Elsbeths Sachen zu durchsuchen, bis sie findet, wonach sie gesucht hat. Eine Art Buch, mehr ein Heft, in dem Elsbeth stets sorgfältig ihre Einnahmen notierte. Des Weiteren findet sie einige Schriftstücke, die zweifelsohne von Elsbeth verfasst wurden, sowie drei Scheine Papiergeld mit dem Wert von je zehn Selani, sowie zwei von je fünf Selani. Elsbeths Notgroschen.
„Sieh einer an, wer hätte das gedacht? Dieses hinterhältige Miststück lässt sich von mir die Arztkosten begleichen und hortet zugleich ein kleines Vermögen in ihrem Nachttisch“, erzählt Dorothea sich selbst, ehe sie ohne Gewissensbisse die Geldscheine in ihrer Schürzentasche verschwinden lässt. Ohne jeglichen Skrupel vor der Verstorbenen beginnt sie nun, jede Schublade der gegenüber dem Bett stehenden Kommode nach Schmuck oder dergleichen zu durchsuchen. Danach setzt sie sich an einen kleinen Tisch in der Ecke der Kammer, um zu überlegen, wie sie an Elsbeths Besitz kommen könnte.
Mit Genugtuung liest Dorothea etwas später das von ihr verfasste Testament durch, in dem sie sich zur alleinigen Erbin erklärt. Das von ihr gefundene Kassenbuch, sowie die wenigen Schriftstücke verstaut sie ebenfalls in ihrer Schürzentasche, um es später zu verbrennen. Nur das Testament legt sie, für jeder Mann gut sichtbar, zurück. Um diesem Schriftstück mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen, legt sie nach kurzem Überlegen und auch schweren Herzens einen Teil des gefundenen Geldes bei.
Morrigan, die seit dem ersten Besuch des Arztes im Haus von Tommen wohnen muss, versteht nicht, was mit ihrer Ziehmutter wirklich geschehen ist, zumal ihr Dorothea verbietet, den Menschen, den sie am meisten liebt, zu sehen.
„Ich möchte zu meiner Mama nach Hause. Bitte“, fleht Morrigan wieder einmal mit Tränen in ihren Augen, als Dorothea mit einem selbstgefälligen Lächeln von Elsbeth zurückkommt.
„Morgen, sobald der Arzt nach deiner Mutter sieht, darfst du mich begleiten. Vielleicht geht es ihr dann wieder besser. Dann darfst du auch wieder bei ihr wohnen. Jetzt aber leer die Spucknäpfe“, vertröstet und tadelt Dorothea zugleich das kleine Mädchen.
Wie abgemacht treffen am Morgen des nächsten Tages Dorothea sowie Maren mit Morrigan und der Arzt vor Elsbeths Haus ein.
„Na wie geht es denn unserer Patientin“, möchte der Arzt von Dorothea wissen, ehe sie die Kammer der Frau betreten.
„Ich glaube ganz gut Herr Doktor. Gestern am Abend, als ich nach ihr gesehen habe, hat sie mir erzählt, dass sie nächste Woche schon wieder mit ihrer Arbeit beginnen möchte“, lügt Dorothea den Arzt an, worauf dieser meint, „das sind ja gute Nachrichten. Bringen Sie sofort das Kind hinaus. Na los, machen Sie schon“, schimpft Dr. Lumen, als er erkennt, dass die Frau vor ihm nicht mehr am Leben ist.
„Mama!“, ruft Morrigan verzweifelt, weil auch sie erkannt hat, dass mit ihrer Mutter etwas nicht stimmt.
„Keine Sorge Morrigan, der Arzt wird sich schon um deine Mutter kümmern. Du wartest hier mit mir in der Küche“, vertröstet Maren Morrigan, wohl wissend, dass das nur eine Lüge ist.
„Herr Doktor, wie sieht es aus? Ist sie tot?“, fragt Dorothea mit heuchlerischer Stimme, ehe sie Maren zu sich ruft, damit diese Morrigan zurück zu ihrem Haus bringt.
„Das verstehe ich nicht. Das Fleckfieber scheint zur Gänze abgeheilt zu sein. Hat die Frau in den vergangenen Wochen sonst noch über irgendwelche Beschwerden geklagt. Schwindel, Herzrasen oder dergleichen?“
„Eigentlich schon. Manchmal hat sie gesagt, dass sie in letzter Zeit in ihrer Brust immer wieder einen heftigen Schmerz verspüren konnte, der sich bis hinaus in ihre Fingerspitzen bemerkbar machte. Außerdem klagte sie über Übelkeit und unerklärlichen Schweißausbrüchen. Letzteres wird allerdings wohl an ihrem fortschreitendem Alter gelegen haben“, lügt Dorothea.
„Wie viel von den Tropfen haben Sie ihr gegeben?“
„Genau so viele wie Sie es mir aufgetragen haben, Herr Doktor. Morgens und abends zwei Tropfen in einem Glas Wasser. Hier sehen Sie selbst, in dem Fläschchen befindet sich noch mehr als die Hälfte der Medizin“, beteuert Dorothea, um den Verdacht von sich zu weisen, sie hätte Elsbeth mehr als erlaubt von den Tropfen gegeben und somit absichtlich ihren Tod herbeigeführt. Dass die Flüssigkeit in dem Fläschchen nur mehr Wasser ist, ahnt der Arzt allerdings nicht.
„Nun gut. Angesichts der Tatsache, dass ich der armen Frau nicht mehr helfen kann, bleibt mir nur noch die Aufgabe den Totenschein auszustellen“, stellt der Arzt fest, ehe er sich noch erkundigt, wer die Kosten für seine Besuche übernimmt. Dabei scheut er sich nicht, die Schublade der Nachtkommode neben Elbeths Sterbebett zu öffnen.
„Soviel mir bekannt ist, hatte Elsbeth weder Verwandtschaft noch Angehörige oder sonst wem der ihr nahestand. Aber machen sie sich deswegen nur keine Gedanken Herr Doktor, ich übernehme das, genauso wie ich mich um die kleine Morrigan kümmern werde“, verspricht Dorothea, ohne dabei auch nur den geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, dass sie ihr Versprechen nur aus Habgier macht.
„Sieh einer an, wer hätte sich das gedacht. Diese Frau scheint ein Testament hinterlassen zu haben. Wussten Sie davon? Natürlich wussten sie davon, schließlich waren Sie ja ihre Freundin. Aber das tut nichts zur Sache“, stellt der Arzt fest, als er einen Umschlag mit der Aufschrift mein letzter Wille in seinen Händen hält.
So endete die zwar ärmliche, aber gut behütete Kindheit von Morrigan mit einem Schlag. Weil Elsbeth Zott weder Verwandte noch Angehörige hatte, zweifelte auch niemand an dem gefälschten Testament.
Ihr kleines Haus wurde von Tommen, Dorotheas Mann, bereits wenige Wochen nach Elsbeths Ableben an einen Geschäftsmann verkauft.
Schändlich
Weil Tommen in Morrigan nur eine Belastung sieht, muss das kleine Mädchen vom ersten Tag an all jene Arbeiten verrichten, welche noch vor Kurzem Maren zu erledigen hatte. Maren, mittlerweile gerade einmal 17 Jahre alt, war ebenfalls wie Morrigan ein elternloses Kind, das Dorothea vor einigen Jahren aus dem Waisenhaus zu sich geholt hat. Sie tat dies jedoch nicht aus Mitleid. Nein, keinem der Mädchen, die sie immer wieder unter dem Vorwand der Barmherzigkeit in ihr Haus geholt hat, ist es in ihrer Jugend anders ergangen, als Morrigan jetzt. Schuften und putzen von früh morgens bis spät abends, ohne jemals ein lobendes Wort oder Dank dafür erhalten zu haben. Für Dorothea, die schon immer zu träge war, um auch nur ein paar Schritte mehr als nötig zu machen, mussten diese Mädchen all jene Sachen erledigen, die ihrer Ziehmutter zu beschwerlich erschienen. Lediglich zu ihren Damenkränzchen in einem Kaffeehaus auf der anderen Seite des Miislats erscheint Dorothea regelmäßig, weil diese Nachmittagsgesellschaften für sie eine Art von Wohlstand darstellen, den diese Frauen mehr oder weniger gekonnt zur Schau tragen. Dabei verschweigt sie jedoch beharrlich ihre Herkunft und ihren wirklichen Stand in der Gesellschaft. Ihren Freundinnen gegenüber behauptet sie, dass sie nur aus Liebe zu ihrem Mann einem Leben auf der anderen Seite der Misslat zugestimmt hat. Dies alles geschieht jedoch zum Missfallen ihres Ehemanns, da dieser der Meinung ist, dass es eine pure Verschwendung darstellt, für ein Getränk, das weder gut schmeckt noch den Hunger stillt, Geld auszugeben. Außerdem sei er Stolz auf seine niedrige Herkunft, die ihm zu einem starken Mann gemacht hat, der sich von nichts und niemandem aus der Bahn werfen lässt. Dennoch lässt sich Dorothea dieses Vergnügen nicht nehmen. So steigert sich an diesen Tagen der Unmut Tommens meist bis zum Unerträglichen. Dies war mitunter ein Grund für seinen Entschluss, den er im Herbst vor einem Jahr gefasst hatte, war er doch der Meinung, dass es an der Zeit wäre, dass Maren endlich damit beginnen soll, ihre Schuld bei ihm abzuarbeiten. Eine Schuld, die jedoch nie bestand. Dass Maren von ihrem Gemüt her noch ein Kind war, scherte ihn nicht im Geringsten. Seiner Ansicht nach war sie reif genug, um wie seine anderen Mädchen ihren Körper zu verkaufen. Um seinemWillen Nachdruck zu verleihen, hat es für Maren, nachdem er sie vergewaltigte, gleich noch eine gehörige Tracht Prügel von Tommen mit seiner Reitergerte gegeben.
Schnell hat es sich bei den Matrosen der einlaufenden Schiffe herumgesprochen, dass in Tommens Hurenhaus ein noch blutjunges Mädchen auf ihren ersten Freier warten würde. Maren wurde daraufhin in den folgenden Monaten herumgereicht wie eine Kuriosität, die jeder einmal in seinen Händen halten wollte. Wie es der jungen Frau dabei erging, scherte niemand. Weder Tommen noch seine Frau Dorothea und schon gar nicht die anderen Frauen, zumal diese, hätten sie für Maren Partei ergriffen, nur Tommens Zorn auf sich gezogen hätten. Nicht einmal Rittmeister Mormont Jusfar, seines Zeichens Kommandant der hiesigen Gendarmerie, Stellvertreter des Bürgermeisters und Vertreter der Justiz in Form eines Anklägers, berührte diese Ungerechtigkeit, welche Maren tagtäglich begegnete. Wohl aber wusste er davon, weil er mehrmals im Monat den Mädchen von Tommen einen Besuch abstattete. Hinter vorgehaltener Hand wusste jedes Mädchen in Tommens Hurenhaus, dass Jusfar nicht ein einziges Mal auch nur einen Selani für ihre Liebesdienste zu bezahlen hatte. Im Gegenzug gab es bei Tommen nie einen der üblichen Kontrollbesuche der Polizei. Selbst als ein rabiater Besucher von Tommen mit einem Eichenknüppel derart verprügelt wurde, dass er zwei Tage später verstarb, wurde nie eine Untersuchung eingeleitet. Für Tommen hingegen war Maren ein gutes Geschäft, zumal er am Anfang mehr als den doppelten Preis für ihren Körper verlangen konnte. Ihre Arbeit als Dienstmagd blieb ihr in weiterer Folge allerdings nicht erspart. Lediglich das Privileg, einmal in der Woche ein Bad nehmen zu dürfen, wurde ihr ab diesem Zeitpunkt gewährt. Dass Dorothea als Ersatz für Maren kein weiteres Kind mehr adoptieren wollte, lag wiederum daran, dass seit den letzten Bürgermeisterwahlen ein neues Gesetz erlassen wurde. Ein Gesetz, das besagt, dass den Waisenhäusern der Stadt eine Gebühr von fünfzehn Selani zu entrichten ist, sollte es jemand in Betracht ziehen, ein Kind aus diesen Einrichtungen zu adoptieren. Des Weiteren wurde den Adoptiveltern die Auflage erteilt, ihren Kindern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Um aber die ohnehin überfüllten Waisenhäuser nicht noch mehr zu belasten, wurde den Adoptiveltern das übliche Schulgeld von sechs mal acht Selani für ein Jahr erlassen. Der Stadtrat unter der Führung des neu gewählten Bürgermeisters Rorriger Hendersen, der selbst das Schicksal vieler Waisen erleiden musste, wollte damit dem Handel mit unschuldigen Kindern Einhalt gebieten. Nicht zuletzt, weil viele von ihnen unter menschenunwürdigen Verhältnissen in den Fabriken arbeiten mussten. Aus diesem Grund muss, wie es früher von Maren verlangt wurde, jetzt Morrigan Botengänge für Dorothea und Tommen erledigen. Für sie stellt dies jedoch eine der wenigen Annehmlichkeiten dar, die ihren tristen Alltag ein wenig aufheitern, zumal sie es liebt, sich zwischen den Menschenmassen hindurchzuschlängeln oder sich frech an den Marktständen vorzudrängen. Auf diese Weise gelingt es Morrigan sich schon früh in der Stadt zurechtfinden. Vorbei an ihrem alten Zuhause bis hin zum Marktplatz, zu den Droschkenständen oder zum alten Hafen kennt sie schon bald jeden Pflasterstein. Ja selbst den Weg über eine der Brücken muss Morrigan ab und zu gehen, obwohl sie dabei stets ein mulmiges Gefühl begleitet. Es ist das ununterbrochene Rauschen des Miislats, dessen Wasser sich an den mächtigen Pfeilern bricht und somit in ihr ein unheimliches Gefühl aufkommen lässt. Aber auch die Tatsache, dass vor nicht allzu langer Zeit eines von Tommens Mädchen sich in dem reißenden Fluss das Leben genommen hat, lässt Morrigan bei jedem Überqueren erschaudern. Ein weiterer Anziehungspunkt für sie ist, wie auch für viele andere Menschen dieser Stadt, eine noch im Bau befindliche Brücke. Über diese soll später einmal eine Dampfeisenbahn fahren, obwohl sich nur wenige ein Bild davon machen können, wie das vonstattengehen soll. Zum einen, weil diese Brücke nicht wie all die anderen aus gehauenen Granitblöcken mit unzähligen Pfeilern den Miislat überqueren soll, sondern aus einem Gewirr aus Stahlträgern besteht. Zum anderen, weil sie nur von zwei hoch aufragenden Stahlgitterpfeilern getragen wird, die zudem auch noch auf künstlich errichteten Inseln im Fluss stehen. Aber auch die Vorstellung, dass ein Zug, bestehend aus mehreren Wagen ohne ein einziges Zugpferd oder Maultier sich fortbewegen könnte, will nicht in die Köpfe derer, welche diesem Projekt mit Skepsis entgegensehen. Es gibt aber auch Personengruppen, die in all dem einen Nutzen für die Stadt sehen. Und dann gibt es auch noch jene, so wie Norma Morgenstern. Sie ist die Frau eines jungen aufstrebenden Arztes aus reichem Elternhaus, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele zu ergründen. Norma Morgenstern, ebenfalls aus reichem Haus ist eine egozentrische Frau, der alle Mittel recht sind, um ihre Persönlichkeit ins rechte Licht zu rücken. Seit jenem Tag aber an dem bekannt wurde, dass die Geleise der Dampfstraßenbahn an ihrem Haus vorbeiführen, kämpft sie dafür, dass dort auch eine Haltestelle errichtet wird, welche ihren Namen tragen soll.
Kindheit
Es ist ein Tag wie jeder andere, als Morrigan zeitig in der Früh nach einer kärglichen Mahlzeit mit dem Auskehren der Schenke beginnt. Und dennoch, an diesem Tag hält das Schicksal für sie einen weiteren Streich bereit, den sie ihr Leben lang nicht vergessen wird. Jedoch ist es weder so weit, noch ahnt Morrigan etwas davon.
„Morrigan, du faules Dreckstück, wo sind meine Miesmuscheln?“, schimpft Dorothea ein paar Stunden später, als sie bemerkt, dass diese auf ihrem reichlich gedeckten Frühstückstisch fehlen.