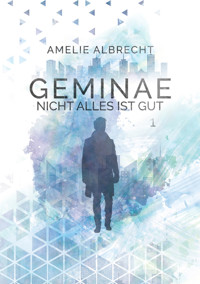Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Wir waren Morrow nicht entflohen. Im Gegenteil. Wir beide, Jack und auch ich, lagen sehr viel tiefer in den Klauen dieses Ortes, als ich bisher angenommen hatte." Ein altes Haus, mitten im Wald. Kinder, die sich an dessen stumme Regeln halten. Ein Junge, der die Wahrheit nicht aussprechen will. Was ist wirklich im Morrow Asylum passiert? Was widerfuhr dem kleinen Mädchen, dessen Grab im Wald steht? Und wer ist der mysteriöse alte Mann, der in den Anlagen sein Unwesen treibt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amelie Albrecht,geboren 2002, fing die junge Autorin schon früh mit dem Schreiben an. Ihre Jugend verbrachte sie zwischen einer Menge Büchern und sie strebt an, als zukünftige Bibliothekarin diese Lebensweise beizubehalten. Sie mag Katzen, Theater und Mochi. Derzeit lebt sie in Bautzen. Mit ihrem Debütroman "Morrow" wagt sie erste Schritte in die Welt der Schriftstellerei.
Für Mom, die meine Geschichten oft zu düster findet
Und J. und L., ohne die dieses Buch nie entstanden wäre
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Dritter Teil
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Danksagung
ERSTER TEIL
1
Die beiden Männer waren sympathische Kerle. Sie schienen nicht nur Kollegen, sondern auch gute Freunde zu sein, denn sie scherzten und lachten unaufhörlich miteinander, und zwar ganz ohne dass eine ihrer zahlreichen Kameras lief. Wir liefen einen verwachsenen Trampelpfad hinab, trockenes Gras raschelte unter unseren Füßen bei jedem Schritt. Ab und zu sprang ein einzelner Grashüpfer aufgeschreckt davon, während ich die zwei auf das Landhaus zulotste, welches einsam und verlassen am Ende des Pfades stand. Es war früher Nachmittag, und doch schien die Sonne in einem blassen Orange auf uns herab, als wolle sie das wohlige Gefühl eines schönen Sommerabends imitieren. In Wirklichkeit war es erst März – wenn auch ein äußerst warmer.
Es war nicht mehr weit bis zu unserem Ziel. Schon von weitem sah man, dass der Zustand der Wände das Alter des Hauses deutlich widerspiegelte. Wir hatten uns nie besonders darum gekümmert, und so war das kastanienbraune Holz über die Jahre immer trister geworden. Dennoch hatte es seine sonderbare Heile-Welt-Atmosphäre behalten, das alte Haus, obwohl niemand mehr darin wohnte, schon lange nicht mehr. Vor zehn Jahren hatten wir es verlassen. Im selben Jahr, in dem wir auch eingezogen waren.
Die Männer und ich waren in den Schatten getreten, und nun schloss sich die Sonne wie ein Heiligenschein um das Haus. Es schien uns zu begrüßen mit einem warmen, seichten Lächeln, das ich tief in meinem Herzen spürte.
Auch ich lächelte. Ich war daheim.
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich stehengeblieben war. Erst als die Schritte der Männer hinter mir stoppten, löste sich mein Blick von dem Haus und ich drehte mich zu ihnen. Sie schienen richtig von dem alten Gebäude gefesselt zu sein, denn sie verharrten einen erhabenen Augenblick, ehe der Kleinere von ihnen mich ansah und lächelte.
„Es ist ein schönes Haus. Alt, gemütlich. In einer schönen Gegend.“
„Naja“, meinte der andere. Ich hatte schon bemerkt, dass er von der Persönlichkeit her ehrlicher, ausladender war, doch es störte mich nicht. Er hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt und betrachtete den Bau nachdenklich. „Es gibt schönere Häuser. Aber das hier hat etwas, etwas…“, er wedelte mit der Hand in der Luft herum, „… Magisches.“
Sein Freund und Kollege lachte und nannte ihn einen Idioten. Auch ich musste lachen. Ich mochte die zwei. Sie waren beide um die Mitte dreißig, wirkten aber sehr viel jugendlicher, verspielt irgendwie, und sie hatten einen Humor, den man einfach mögen musste. Gleichzeitig besaßen sie aber hinter dieser Fassade auch eine Ernsthaftigkeit und Empathie, die ihre Anwesenheit sehr angenehm machte. Man musste nicht zwanghaft Witze machen, um die Stimmung zu erheitern oder das Eis zu brechen, und machte sich nicht lächerlich, wenn man etwas Ehrliches sagte. Was auch der Grund war, warum ich sie ausgewählt hatte. Sie kannten mich nicht, als ich sie das erste mal kontaktierte, ich aber hatte ihre Arbeit schon lange verfolgt.
Einen letzten Moment ließ ich den Anblick des Hauses und der Natur auf mich wirken. Dann bat ich sie, mit hineinzukommen. Wir mussten nach rechts aus dem Schatten heraus auf eine gepflasterte Einfahrt laufen, zu der früher mal eine Straße geführt hatte. Inzwischen war davon nichts mehr zu sehen. Der Boden, über den unser alter Wagen in früheren Zeiten zu unserem Haus getuckert war, war völlig überwuchert. Die Pflastersteine wurden von der Natur in eine innige Umarmung geschlossen. Überall spross Unkraut aus den Ritzen, viele Steine lagen schief oder wurden von Wurzeln aus der Erde gedrückt. Wir liefen an einem kaputten Holzzaun vorbei, der früher einmal Mamas Kräuter- und Lavendelbeet vor Hasen hatte schützen sollen. Er war von vielen Stürmen auseinandergerissen worden. Das Holz war morsch, und Würmer hatten sich hineingefressen.
Die Haustür war noch immer die Alte. Natürlich – nach uns hatte ja niemand mehr darin gewohnt oder das Haus gar renoviert. Sie sah aus, als wäre nichts passiert, als hätte es die letzten zehn Jahre nicht gegeben. Das Holz der Tür war immer noch so schön glatt, dass ich den Drang unterdrücken musste, sanft darüber zu streichen. Die Tür war mit gelben und roten Ornamenten verziert und besaß einen goldenen Türgriff, der als einziger von der Benutzung ein wenig mitgenommen aussah. Ich fischte den Schlüssel aus meiner Hosentasche und schloss auf. Die Tür öffnete sich mit einem vertrauten Klacken.
„Wundern Sie sich nicht“, warnte ich vor. „Drinnen sieht immer noch fast alles so aus wie vor zehn Jahren.“
Ich ließ den Herren den Vortritt und schloss hinter ihnen die Tür. Der Geruch von altem Holz, Büchern und Staub stieg mir in die Nase. Einfallendes Sonnenlicht machte die Staubkörnchen sichtbar, die scheinbar schwerelos durch den Vorraum flogen und um uns herumtanzten. Die Wände waren von einer Seite mit einer roten Tapete verkleidet, der Rest bestand aus dunklem, rissigem Holz. Ein kleiner Tisch mit einer grasgrünen Blumenvase stand vor dem Fenster, doch es waren keine Blumen darin. Von der Decke baumelte eine halbrunde Lampe. Ich fragte mich, ob sie noch funktionierte. Ausprobieren wollte ich es allerdings nicht, schließlich war noch helllichter Tag, und außerdem wollte ich mir keinen Stromschlag holen. Die Technik hier war schon früher nicht mehr die beste gewesen.
Von hier aus erreichte man die Küche, wenn man geradeaus ging, oder das Büro meiner Eltern, links von uns. Oder aber auch die Treppe, die nach oben führte. Dorthin führte ich auch meine Gäste.
Mit einer Geste wies ich sie an, nach oben zu gehen, während ich die Gelegenheit nutzte, einen Blick in unser altes Wohnzimmer zu werfen. Meine Mutter hatte für dieses Zimmer damals eine gelbe Tapete ausgesucht. Dadurch leuchtete der Raum jedem fröhlich zu, der hereintrat. In der Ecke stand noch immer ihre alte Nähmaschine, die sie einfach nicht mehr hatte mitnehmen wollen, und davor unser Sofa, ein einfacher Zweisitzer mit einem blassen rosa Teint. Auf der anderen Seite, die ich gerade nicht sehen konnte, war früher immer ein großes Bücherregal gewesen. Es war Papas Sammlung, und sie bestand aus vielen alten Schmökern, welche die Luft im Raum stets in den Geruch von Papier und Geschichte hüllte. Als wir hier gewohnt hatten, hatte ich noch nicht sehr gut lesen können, aber ich liebte es, mich vor das Regal zu setzen und die Bücher herauszuholen, um mich herum zu verteilen und durchzublättern, auf der Suche nach alten Zetteln, die Papa als Lesezeichen benutzt und vergessen hatte, oder vielleicht Bildern, die ich schön fand und abmalen konnte. Die ganz alten, besonderen Bücher hatte Papa stets ganz oben aufbewahrt und niemand durfte sie auch nur anfassen.
Ich fragte mich, ob Papa vielleicht einige dieser Bücher sogar hiergelassen hatte. Aber ich wollte jetzt nicht nachschauen. Ich hatte Gäste.
Die Treppenstufen knarzten, als ich nach oben ging, jede einzelne von ihnen. Es war die Melodie des Hauses. Nie hatte ich mich nach unten schleichen können, ohne dass sie erklang und jeder sofort gewusst hatte, wer auf der Treppe war. Auch der Oberboden knarzte, aber nicht allzu laut.
Wir standen nun in einem Durchgangszimmer. Von hier aus erreichte man das Schlafzimmer meiner Eltern, ein Bad, Mamas Abstellraum, in den ich nie hatte reingehen dürfen, weil sie dort Süßigkeiten und Geschenke versteckte, und mein eigenes Zimmer.
Neugierig trat ich an den Herren vorbei in die Tür zu meinem Zimmer. „Am besten setzen wir uns hier herein“, sagte ich, während ich mit großen Augen jede Ecke des Raumes absuchte. Ich wusste nicht, was genau ich erwartet hatte, denn natürlich war noch alles so wie damals, als ich es verlassen hatte.
Es war nie sehr groß oder voll gewesen. Und eigentlich auch immer recht dunkel. Morgens schien die Sonne sehr schräg durch das einzige Fenster meines Zimmers, dann wanderte sie um das Haus herum, und abends konnte ich das Abendrot sehen, wenn ich die andere Richtung schaute. Auch mein Mobiliar war sehr überschaubar. Alles in meinem Zimmer, außer die Glühbirne, die von der Decke baumelte, war aus Holz: mein altes Bettgestell, das noch immer hier stand, der Schrank, der die komplette vordere Wand einnahm und indem man sich gut verstecken konnte, und mein kleiner Nachttisch.
Wirklich viel Spielzeug hatte ich in meiner Zeit hier nie besessen, nur ein paar Sachen, die mein Vater mir geschnitzt hatte, und meine eigenen kleinen Funde. Naturschätze, die ich draußen fand und auf meinen Nachtisch legte. Mal war es ein Stock, mal ein kleiner Stein in Form eines Herzens, eines Tages nahm ich sogar eine Schnecke mit in mein Zimmer, und als ich am nächsten Morgen aufwachte, klebte sie an meiner Wange. Damals fand ich das schrecklich eklig, ließ es mir aber nicht anmerken. Ich lief mit der Schnecke an der Wange nach unten, wo meine Eltern frühstückten, und fragte Mama, ob sie sie mir abnimmt. Meine Eltern mussten natürlich herrlich über mich lachen, doch ich putzte nur meine Wange ab und stürmte wieder nach oben, wohin sie mir nachliefen, damit ich nicht beleidigt war.
Der Tisch, das Bett und der Schrank standen noch immer in meinem Zimmer. Ich wusste, dass im Flur auch immer zwei Stühle gestanden hatten, und im Schlafzimmer meiner Eltern musste auch noch einer sein, also wies ich die zwei Herren an, diese zu holen. Sie gingen sofort los, rissen ihre Witzchen, und ich hatte Zeit, mich zurückversetzen zu lassen. Zurück in meine Kindheit.
Das Haus war stets meine früheste Erinnerung gewesen. Alles, was davor in meinem Leben passiert war, wusste ich jetzt nicht mehr, und gerade deshalb wurde dieser Ort zu etwas Besonderem für mich. Es gibt keine Schlüsselerinnerung, nichts im Sinne von „Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem ich hier einzog“. Es war einfach schon immer da gewesen in meiner Erinnerung, das Haus. Wwir kamen hier an, lebten hier und waren glücklich, meine Eltern und ich.
Ich war noch ein Kind gewesen, als wir hier einzogen, und eigentlich hätte ich mir über die Zeit auch einiges zusammenreimen können. Ich hatte Narben an meinem Körper. Die habe ich noch immer, aber früher hatte ich sie als selbstverständlich hingenommen und nie weiter gefragt. Erst um einiges später, als diese Erinnerungen fast nicht mehr da waren, erzählte mir meine Mutter, dass ich, bevor wir hierherzogen, krank gewesen war – sehr krank. Dieser stille Ort sollte eine Erholungsstätte für mich sein, psychisch wie körperlich.
Die Erinnerung an meine Krankheit und die Ankunft hier hatten sich in meinem Kopf zu einem großen Klumpen verschmolzen, den ich nicht auseinandernehmen konnte. Früher waren die Erinnerungen mit Sicherheit noch lebhafter gewesen, aber heute weiß ich nicht mehr wirklich viel davon, einmal schwer krank gewesen zu sein. In meinem Kopf waren zwar Fetzen von Erlebnissen und Orten und vor allem Gefühlen vorhanden, die es mal gegeben haben könnte, und wenn ich mich sehr anstrengte, kann ich mich an weiße Wände und Liegen erinnern, auf denen ich durch die Gegend geschoben wurde, an Menschen in Kitteln und mit Masken; aber mehr weiß ich nicht mehr.
Für mich gab es eine sehr lange Zeit lang nur diesen Ort. Es fühlt sich immer so an, als hätte ich ewig hier gelebt, nicht nur ein Jahr. Vielleicht, weil ich hier geistig so sehr gewachsen war, oder vielleicht auch wegen ebendieser Krankheit, durch die ich das Leben davor nicht wirklich hatte kennenlernen dürfen.
Wir hatten keine Nachbarn, jedenfalls nicht in meinem Alter. Das war das erste, was mein Vater mir hier mit Bedauern erklärte: dass ich keine Spielkameraden haben werde. Allerdings störte mich das nicht, wirklich nicht, denn ich konnte mich nicht erinnern je einen Spielkameraden gehabt zu haben. Ich beschäftigte mich stets selber, mit allen möglichen Sachen.
Zum Beispiel liebte ich es, die Gegend zu erkunden, denn das durfte ich zum Glück. Wir waren das einzige Haus weit und breit, nur ein paar hundert Meter weiter lebte eine alte Dame in einem heruntergekommenen Haus, Miss Winston, aber die kam nie wirklich heraus. Weiter unten war außerdem ein kleines Dorf, welches man von hier aus kaum sah. Meine Eltern hatten Mitleid mit mir, wenn sie im Haus arbeiten mussten und ich mich mit niemanden beschäftigen konnte, und so erlaubten sie mir, ganz frei überall herumzulaufen, wenn ich nur auf mich aufpasste.
Als Erstes lief ich über die Wiesen. Es war Frühling, als wir einzogen, und ich sammelte schöne Blumen und die ersten kleinen Käfer. Vor denen ekelte ich mich nicht. Ich sammelte Kräuter und Gräser und warf sie mit den Käfern in einen Topf, mixte alles zusammen und nannte es „Wiesensuppe“. Dann lief ich zu meinen Eltern, damit sie die Suppe probierten, und erst wenn sie zumindest so taten, als aßen sie einen Löffel, gab ich mich zufrieden und kochte die nächste Suppe.
Ich versuchte, Hasen zu fangen. Manchmal sah ich sogar Rehe, und ein Spiel von mir war es, so nah an sie heranzuschleichen wie möglich, ohne dass sie wegliefen. Ich war gut darin. Einmal kam ich so nah an eines heran, dass ich es fast hätte streicheln können, doch dann wand es den Kopf zu mir und schreckte damit auch alle anderen auf. Sie rannten mich fast über den Haufen, und ich war ganz erschrocken. Papa belehrte mich und sagte, wenn ich einen Huf abbekäme, könne das wirklich wehtun, aber ich hörte trotzdem nie mit meinem Spiel auf.
Neben der riesigen Wiese, auf der sich unser Haus befand, war ein Waldstück. In das traute ich mich anfangs nicht hinein. Ich hatte Angst, ich würde nicht mehr herausfinden, denn alle Bäume sahen irgendwie gleich aus. Mama sagte mir, es ginge nicht tief herein, ich könne mich gar nicht verlaufen, aber Angst hatte ich trotzdem. Einmal lief ich ganz aus Versehen hinein, als ich ein paar Rehe verfolgte, und als ich sie aus den Augen verlor, sah ich mich um und konnte die Wiese nicht mehr entdecken.
Da pochte mein kleines Herz ganz fest und ich sah mich aufgeregt um, lief ein paar Schritte, blieb unschlüssig wieder stehen, aus Angst, in die falsche Richtung zu laufen, und lief wieder ein paar Schritte zurück in die andere Richtung. Irgendwann dämmerte es, und ich hatte mich noch nicht wirklich vorwärts bewegt. Da fiel mir ein, dass ich die Sonne abends immer aus dem Fenster meines Zimmers sehen konnte, wenn sie unterging. Außerdem sah man den Wald, wenn man aus dem Fenster sah. Also fing ich an, in die Richtung zu laufen, in der ich die Sonne nicht sah. Fünf Minuten später stand ich vor dem Haus. Meinen Eltern erzählte ich nicht, dass ich mich verlaufen hatte, aber ich war stolz darauf, von selbst nach Hause gefunden zu haben.
Es musste fast schon Sommer gewesen sein, denn es war schon wärmer geworden, als ich mich zum ersten Mal richtig in den Wald traute. Ich war inzwischen immer mal wieder hineingegangen und hatte nach Fixpunkten Ausschau gehalten. Zum einen war da ein großer Fels, der nicht zu weit von der Wiese entfernt war, und von dem man schon das andere Ende des Waldes sehen konnte, wenn man sich drauf stellte. Zum anderen gab es einen maroden Baum, der umgestürzt war, und zwar direkt über einem seltsamen Loch, dass sich mit Wasser gefüllt hatte. Ab und zu sah ich darin einen Frosch.
Dass der Baum marode war, wusste ich, weil ich versucht hatte, darüber zu laufen. In der Mitte war ich eingebrochen und in das dreckige Wasser gefallen, beinahe auf eine Kröte, die erschrocken weghüpfte. Ich war nass bis zu den Haaren gewesen und überall hatten Blätter an mir geklebt, aber Mama schimpfte nicht, als ich schweigend und mit hängendem Kopf nach Hause tapste, sondern lies mir ein Bad ein und küsste mich auf die Stirn. Meine Eltern waren fast nie böse mit mir, egal was ich tat.
Zu dem Baum ging ich nicht mehr, aber der Felsen war mein Wegweiser, und an dem Tag ging ich geradewegs darauf zu und blieb dann stehen. Weiter war ich noch nie hineingegangen. Aber ich wusste, wenn ich weiterlief, immer geradeaus, kam ich auf die andere Wiese. Und ich wollte dorthin, vielleicht gab es dort nämlich andere Blumen und Käfer, und vielleicht konnte ich mir dort auch ein Haus aus Ästen und Blättern bauen und die Wiese meinen Garten nennen, oder es gab dort sogar andere Tiere als Rehe und Hasen, freundlichere, die nicht so scheu waren. Ich träumte davon, eines der Tiere zu zähmen, sodass ich vielleicht darauf reiten konnte. Heute weiß ich, dass das Unsinn war, aber damals war die Idee mein erstes, großes Ziel, und so überwand ich meine Angst und lief weiter.
Das Ergebnis war enttäuschend. Als ich auf die Wiese heraustrat, sah ich keine anderen Blumen oder Tiere, sondern genau das gleiche Gras und sogar noch höheres, gelbliches Zeug, dass mir bis zu meinem Gesicht reichte und mich niesen ließ. Ich sah auch keine Tiere, nicht mal Rehe oder Hasen, nicht mal ein Eichhorn, die ich manchmal beobachtete, die aber furchtbar flink waren und ich es deswegen aufgegeben hatte, sie fangen zu wollen.
Diese Wiese war viel kleiner als unsere, denn nicht weit entfernt von dem Waldstück, aus dem ich heraustrat, befand sich auch schon das nächste.
Ich ärgerte mich schrecklich. Wütend stapfte ich die Gräser nieder, die in meiner Nase kitzelten, und beinahe wäre ich vor Wut in den nächsten Wald hineingelaufen, aber dann hätte ich wohl nie wieder zurückgefunden und lies es deswegen sein. Ich zertrat sogar aus Versehen einige Grashüpfer, denn ausgerechnet die gab es hier, die gab es überall, und ich mochte sie nicht, weil so ständig laut waren und zirpten und mir entgegensprangen und allgemein schrecklich aufdringlich waren.
Ich war so wütend, dass ich das riesige Anwesen gar nicht bemerkte, welches fast direkt vor mir auf der Lichtung stand. Ich bemerkte auch den Weg nicht, der dorthin führte, denn alles war ja voll von so hohem Gras, dass ich nicht einmal hochsah. Erst, als ich heraustrat, auf die verblichenen Spuren des Weges, wo das Gras nicht so hoch war, interessierte ich mich endlich dafür und sah mich um.
An diesem Tag fand ich das Morrow Asylum.
2
Man konnte es vom Haus aus sehen. Sogar von meinem Zimmer aus. Ich hatte das als Kind vorerst nicht bemerkt, und auch jetzt, als ich auf dem Stuhl vor dem Fenster saß, sah ich es nicht, denn das Fenster war hoch und der Sims verdeckte den Blick auf die Wiese und den Wald. Man sah nur ein paar Baumkronen. Erst, als ich als Kind diesen Stuhl in mein Zimmer holte und mich daraufstellte, vor das Fenster, sah ich endlich den anderen Wald und die andere Wiese und auch das Anwesen. Es war ein großes Haus, und davor begrenzte eine Mauer, die schon leicht eingefallen war, ein kleines Stück Wiese, auf dem sich ein Spielplatz befand. Vor der Mauer befand sich außerdem ein Platz mit einigen einzelnen Steinen, die ganz zugewachsen waren, zusammen mit einem Eingangstor, das nach oben gerichtet war und in dessen Torbogen in schwarzen Lettern „Morrow Asylum“ stand.
Den beiden Männern erzählte ich das alles nicht. Sie sollten es sich später selbst ansehen. Auch in den hinteren Teil wollten sie heute Nacht noch, denn wenn man die Lichtung längst den Hügel hinunter lief, kam man zu den anderen, längst abgerissenen Anlagen, die auch zu Morrow gehörten, die man von meinem Zimmer aus aber nicht sah.
Meine beiden Gäste hatten ihre Kameras inzwischen wieder angeschaltet. Nach einer kurzen Einführung für das Video unterhielten sie sich mit mir darüber, wie schön die Gegend und das mein altes Haus waren und ich fing an, ein wenig von der Geschichte zu erzählen. Dass es alt wäre, mindestens zweihundert Jahre alt, und dass es einmal bis auf die Grundmauern niedergebrannt sein sollte. Erbaut wurde es wohl als Teil eines Dreiseitenhofes, und nach dem Brand wurde nur dieses eine Haus wiederaufgebaut. Das muss ziemlich früh gewesen sein, keine zehn Jahre nach dem Bau. Ich hatte das in meinen Recherchen herausgefunden, aber erst nachdem wir hier ausgezogen waren.
Ich spürte allerdings schnell, wie die zwei Männer ungeduldig wurden. Ich schaute gern in ihre Gesichter, denn sie hatten ein sehr freundliches Lächeln. Der Kleinere fing an, herum zu drucksen, traute sich aber nicht, mich zu unterbrechen. Also beendete ich meinen Vortrag und lies ihn eine Frage stellen, mit der er das Thema umlenken wollte.
Als er sie gestellt hatte, nickte ich und schaute intuitiv aus dem Fenster, obwohl ich das Asylum sitzend doch gar nicht sehen konnte. Dann erzählte ich die Geschichte weiter.
Ich traf Jack erst sehr viel später, jedenfalls fühlte es sich so an. Tage kamen mir wie Wochen vor, denn jeden Tag passierten so viele Dinge, dass mein kleiner Kopf sie gar nicht so schnell verarbeiten konnte.
Als ich das Gebäude mit dem Spielplatz fand, war ich begeistert gewesen, denn meine mutige Aktion, den Wald zu durchlaufen, entpuppte sich doch als Erfolg: nun hatte ich meinen eigenen Platz, auf dem ich sogar richtig spielen konnte.
Der Spielplatz bestand aus einer alten Rutsche, an der ein Klettergerüst anknüpfte, sowie zwei Schaukeln, einer Wippe und einigen mir damals hüfthohen Gestellen, auf denen man balancieren oder sich einfach nur hinsetzten konnte. Alles war aus Metall gebaut, und an vielen Stellen war die bunte Farbe abgeblättert und das Metall rostete.
Mir machte das nichts aus. Ich kam von nun an jeden Tag hierher. Das Gebäude interessierte mich nicht wirklich, obwohl ich direkt daneben spielte. Ich hatte kein großes Interesse daran, denn solange mich niemand wegschickte, war ich zufrieden. Ich schaukelte und wippte, kletterte und holte mir sehr viele blauen Flecken. Mama schimpfte fürsorglich mit mir, ich solle nicht allzu wild sein. Sie machte sich bestimmt Sorgen wegen meiner Narben und meiner Krankheit, die noch nicht so lange her war, aber ich fühlte mich nicht krank, sondern kräftig, und so war ich übermütig, schabte mir ständig das Knie auf, holte mir Blutergüsse und mehr blaue Flecken. Ich wurde immer sicherer im koordinieren meines Körpers und traute mir immer mehr zu. Meine Eltern beobachteten das und freuten sich darüber. Früher hatte ich mich wohl nie so viel bewegt, deswegen waren sie froh, dass ich es jetzt tun konnte, und ließen mich größtenteils einfach machen.
Irgendwann entdeckte ich, dass ich das Gebäude von meinem Fenster aus sehen konnte, wenn ich es nur richtig anstellte. Von da an stellte ich einen Stuhl unter das Fenster und warf ab nun jeden Tag von meinem Zimmer aus einen Blick darauf, auf meinen Spielplatz, fast so als wollte ich überprüfen, dass er mir während meiner Abwesenheit nicht weggelaufen war.
Dadurch sah ich ihn zum ersten Mal.
Es war abends, und ich lief im Dunkeln durch die oberen Etagen unseres Hauses. Das tat ich oft, denn ich sah erstaunlich gut ohne Licht und hatte auch keine Angst vor der Dunkelheit. So versteckte ich mich gern vor meinen Eltern, wenn sie hochkamen, um mich ins Bett zu bringen. Dann kam ich aus einer dunklen Ecke hervor, um sie zu erschrecken. Es war fast schon ein Ritual geworden, und wir kugelten uns fast immer auf dem Boden vor lachen, weil Papa jedes Mal wieder darauf reinfiel.
An diesem Abend aber lief ich viel zu früh nach oben, und da ich noch Zeit hatte, bis meine Mutter und mein Vater hochkamen, stieg ich auf den Stuhl und sah hinaus.
Es war nie wirklich finster bei uns in der Nacht, denn der Mond und die Sterne schienen immer sehr hell, wenn nicht gerade Wolken den Himmel verdeckten. So konnte ich das Asylum selbst im schwachen Licht gut ausmachen. Doch diesmal kniff ich die Augen zusammen und musste zweimal hinsehen.
Da stand jemand auf meinem Spielplatz. Ich sah ihn ganz deutlich, denn seine Erscheinung war ziemlich hell und blass. Er musste wohl etwas größer sein als ich, denn er stand neben einem der kleinen Gestelle auf dem Spielplatz. Diese reichten ihm bis zu den Beinen, und nicht nur bis zur Hüfte wie mir. Aber so groß wie ein Erwachsener war er mit Sicherheit nicht.
Was mich an dem Anblick ein wenig verschreckte war nicht die Tatsache, dass ein Kind im Dunkeln auf meinem Spielplatz stand, nein, es war etwas anderes. Denn wen auch immer ich da sah, die Gestalt spielte nicht mit den Geräten oder lief herum oder irgendetwas. Nein, sie bewegte sich überhaupt nicht. Und am merkwürdigsten war, dass es den Anschein hatte, als würde sie mich direkt ansehen. Als würde die Gestalt wissen, dass ich sie anstarre, hier, hinter diesem Fenster, und als würde sie zurückstarren, direkt in mein Gesicht.
In diesem Moment kam meine Mutter herein, und ich erzählte ihr aufgeregt, dass da jemand sei, auf meinem Spielplatz, und ich sagte ihr, sie solle auch hinausschauen. Sie brauchte keinen Stuhl dafür, sie war ja groß genug. Doch als ich auf das Asylum deutete, war da niemand mehr, und sie sah auch niemanden. „Bestimmt ist er hereingegangen“, sagte ich. Mama wuschelte mir nur durch die Haare und sagte mir, dass der Spielplatz nun auch nicht wirklich mir gehören würde. „Deswegen kann ich doch trotzdem darauf spielen“, sagte ich, und sie lachte nur und erwiderte, ich solle mich jetzt ins Bett legen.
Am nächsten Tag ging ich wieder zum Spielplatz. Diesmal war ich extra vorsichtig, ich schlich um die Mauer herum und zog große Bögen um das Anwesen, um nach jemandem Ausschau zu halten. Doch da war niemand.
Dieses Mal sah ich mir das Gebäude zum ersten Mal etwas genauer an. Es hatte, im Gegensatz zu unserem Haus, keine Holzverkleidung, und der Stein hatte Risse an einigen Stellen oder bröckelte sogar. Einige Fenster waren kaputt, aber ansonsten sah es schon so aus, als könne jemand darin wohnen. Im Grunde war es nicht anders als Miss Winstons oder unser Haus, nur größer und halt alt.
Hinein ging ich aber nicht. Ich setzte mich auf die Schaukel und wartete lieber, ob jemand hinauskommen würde. Immerhin hatte ich ja wirklich jemanden gesehen, und es hatte den Anschein gehabt, als habe er oder sie mich auch gesehen. Doch es passierte nichts. Ein paar Vögel zwitscherten, ab und zu kam Wind auf, aber ich blieb allein.
Plötzlich kam eine besonders starke Windböe und wirbelte meine Schaukel hin und her, so dass ich mich im Oval kreiselte. Das gefiel mir nicht, aber ich ließ es zu, schließlich war ich nur ein Kind und der Wind viel stärker. Doch nach dieser Windböe hörte ich plötzlich nicht mal mehr die Grashüpfer. Es war gespenstisch still, die Vögel waren verstummt, und meine Schaukel hörte auf zu schaukeln, weil ich mich nun mit den Füßen abbremste.
Ich betrachtete das Haus. Irgendwie war die Stimmung so, als könne jetzt irgendetwas passierten, dachte ich, und wartete darauf, dass sich die große Doppeltür öffnete und jemand heraustrat oder ähnliches. Eine Prinzessin vielleicht. Oder eine Hexe. Die Fenster des Hauses waren ein wenig verdreckt, man hätte vielleicht nach innen schauen können, aber es war ohnehin so dunkel darin, als würden die Räume das Sonnenlicht schlucken.
Ich wunderte mich, wer wohl darin wohnen könnte. Das Haus war so groß, es hatte mit dem Dachgeschoss vier Etagen und mit Sicherheit auch noch einen Keller, und es war so lang und breit. Ich zählte die Fenster auf der langen Seite, auf jeder Etage waren es zehn. Auf der anderen Seite, das hatte ich gesehen, als ich drum herumlief, befand sich noch ein Eingang. Ein paar Stufen führten nach oben zu einer Tür, die noch größer war als diese hier. Es war komisch, dass der größere Eingang auf der Seite des anderen Waldes war, aber ich habe auch gesehen, dass auch dort mal eine Straße weggeführt haben muss, und zwar den Hügel herunter.
Es rührte sich nichts. Langsam wurde ich ungeduldig. Es war still, jetzt sogar windstill, und irgendwie war es auch dunkler geworden. Der Himmel war nun voller Wolken und das Licht der Sonne kam nur noch schwer hindurch.
Ich hatte genug von der Stille. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jemand wollte mich ärgern, weil es so schien, als müsste etwas passieren, aber es passierte nichts. Also sprang ich auf und fing an, Lärm zu machen.
Ich sang Lieder, die mir durch den Kopf gingen, irgendwelche Kinderreime, und hangelte mich am Klettergerüst lang. Ich wippte wie verrückt, sodass der andere Sitz immer wieder ziemlich doll auf den Boden aufkam, domp, domp, und ich lief auf dem Hof herum, die Arme ausgebreitet als könnte ich fliegen. Ich schrie irgendetwas Unverständliches in den Himmel, Vögel flogen davon. Es machte mir Spaß.
Doch irgendwann, als ich schon ziemlich lange ziemlich laut gewesen war, stolperte ich plötzlich mitten auf dem gepflasterten Platz.
Ich konnte nicht genau ausmachen, über was ich gestolpert war – es hätte ein loser Stein sein können oder auch meine eigenen Füße. Das war mir wirklich ein Rätsel, denn es hatte sich nicht so angefühlt, als wäre ich gestolpert. Eher so, als hätte mich ein kalter Windhauch getroffen, ein sehr starker, aber das konnte ja nicht sein. Ich fiel wirklich schwer, mit dem Kopf voran mitten auf den Stein, ohne mich mit den Armen schnell genug abfangen zu können.
Es fühlte sich so an, als hätte jemand einmal kräftig mit einem Hammer gegen meinen Kopf geschlagen. Einen Moment lang setzte mein Denken aus, ich lag nur mit dem Po zum Himmel gerichtet auf dem Boden, und hielt mir die Stelle auf meinem Haaransatz, die so wehtat. Ich sagte auch nichts, ich wimmerte nicht oder gab irgendwelche anderen Geräusche von mir – ich hatte Angst, dass, wenn ich etwas sagen würde, das Hämmern nur noch schlimmer würde.
Ich spürte etwas Warmes über meine Hände fließen. Langsam, ganz langsam richtete ich mich auf und starrte auf meine Hände. Rotes Blut war in alle kleinen Ritzen meiner Hand geflossen und tropfte nun auf den Boden vor mir.
Toll, dachte ich, wenn ich meine Hand jetzt auf ein Stück Papier drücken würde, dann hätte ich einen richtig schönen Handabdruck. So etwas dachte ich, nicht irgendetwas anderes, panisches, nein, ich war irgendwie ganz ruhig. Ich kannte Blut sehr gut, gerade mein eigenes, das wurde mir erst später klar. Ich hatte keine Angst davor. Auch nicht vor Wunden oder Schmerz.
Ich stand auf. Meine Knie taten auch ein wenig weh, und ich wusste, dass ich jetzt zu Mama musste, damit sie mich gründlich waschen und dann ein Pflaster oder so auf meine Stirn kleben konnte, und ich ärgerte mich wieder, weil ich den Spielplatz verlassen musste, meinen Spielplatz, den ich doch verteidigen wollte. Vor dieser Gestalt, die sich nicht zeigte. Vor den Leuten im Haus. Oder dem Haus selbst sogar. Ich hatte verloren, dachte ich, aber nur für heute.
Mama erschrak sich, erholte sich aber sehr schnell davon. Sie schimpfte nicht, nein, sondern holte ein Tuch mit schönem warmem Wasser und tupfte mir über die Stirn und die Hände. Dann nahm sie einen Verband und etwas, das wie Watte oder so was aussah, drückte es sanft auf meine Wunde und band den Verband drum herum. Papa kam herzu, er fragte mich, ob mir schlecht war oder schwindelig, und ich verneinte. Er sagte, ich sollte ein paar Tage im Bett liegen bleiben.
Das war schrecklich. Ich konnte nicht zu meinem Spielplatz. Schmollend lag ich im Bett und ließ mir ab und zu ein Stück Apfel füttern, aber ich stand nicht auf oder versuchte nach draußen zu laufen, denn erstens war mir doch ein wenig schwindelig geworden, und zweitens regnete es in den nächsten Tagen wie verrückt. Alles wurde nass, sicher auch die ganzen blöden Grashüpfer, sagte ich mir, während ich aus dem Fenster in den Himmel starrte.
Am letzten Abend aber wurde ich neugierig. Es regnete noch immer, aber Papa sagte, es würde aufhören, schon heute Nacht. Er hatte mir jeden Abend eine Gutenachtgeschichte erzählt, sehr schöne Geschichten. Erzählen konnte Papa ganz toll.
Als Papa gegangen war an diesem Abend, schlich ich mich im Mondlicht aus meinem Bett heraus. Ich wusste, dass unter mir das Wohnzimmer war, und dass der Boden mit jedem Schritt knarzte. Deswegen versuchte ich sehr vorsichtig, ein paar Schritte zu gehen, und stellte zufrieden fest, dass nicht nur der Schwindel vorbei war, sondern auch, dass meine Schritte gar keine Geräusche machten, wenn ich vorsichtig genug war. So schlich ich langsam zum Fenster.
Etwas umständlich kletterte ich auf den Stuhl. Mein Fenster war voller Tropfen, also öffnete ich es kurzerhand.
Sturm wehte mir entgegen. Haare und Regen flogen mir ins Gesicht, während ich blinzelnd versuchte, die Wiese und den Wald durch den nassen Schleier vor meinem Gesicht ausfindig zu machen.. Das Rauschen der Bäume wirkte gespenstisch und war wirklich laut. Ich versuchte, das alles zu ignorieren und wand meinen Blick zum Asylum.
Ich sah die Gestalt wieder. Sie stand auf dem Spielplatz und diesmal wusste ich, das konnte einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Selbst wenn diese Person dort wohnte: Wer war denn so dumm und stand im strömenden Regen draußen? Die Gestalt starrte mich wieder an, genau in meine Richtung, als wüsste sie, dass ich hier bin. Warum war sie nur nicht herausgekommen, während ich auf dem Spielplatz war, und hatte mit mir geredet?
Ich schrie. Ich rief der Gestalt zu, sie solle nicht so feige sein und streckte ihr die Zunge heraus. Nicht, dass ich gedachte hätte, sie würde es im strömenden Regen, so weit weg von mir, auch nur ansatzweise verstehen. Aber wenn sie mich sah, sah sie vielleicht auch, dass ich schrie, und das musste doch reichen.
Am nächsten Tag nahm Mama mir den Verband endgültig ab. Sie hatte mir vorher zweimal täglich eine Salbe darauf gemacht und jetzt sah die Wunde gar nicht mehr so schlimm aus, fand ich jedenfalls. Sie wies mich an, vorsichtig zu sein, und ich durfte wieder raus spielen. Nur rennen durfte ich noch nicht, also tapste ich in Gummistiefeln und einem gelben Regenmantel (denn es regnete zwar nicht mehr, tropfte aber noch immer von den Bäumen) hinüber zum Asylum.
Als ich aus dem Wald heraustrat, stellte ich erstaunt fest, dass mein Spielplatz bereits besetzt war.
Jemand hockte auf einem der kleinen Eisengestelle. Sein Blick war den Hügel hinunter gerichtet, obwohl man dort ja eigentlich gar nichts sah, jedenfalls nicht vom Spielplatz aus. Wenn man auf den Dachboden des Asylums stieg, dachte ich nach während ich auf die Gestalt zulief, und dann aus dem Fenster sah, dann würde man bestimmt sehen, was sich unten hinter dem Hügel befand. Aber von hier aus doch nicht. Hier sah man nur Gras.
Als ich näher kam erkannte ich, dass es ein Junge war. Ich hätte nicht sagen können, ob er nur eines oder fünf Jahre älter war als ich, auf jeden Fall schätzte ich ihn sofort älter und änderte meine Meinung auch nie, hatte aber auch kein einziges Mal nach seinem wirklichen Alter gefragt. Er trug ein blasses, dreckiges Hemd, dass er in löchrige Hosen gesteckt hatte, und die Farben seiner Haut und seiner kurzen bräunlichen Haare waren bleich, wie auf einem alten Foto.
Mir kam das nicht weiter komisch vor. Doch ich wusste im selben Moment als ich ihn sah, dass er die Gestalt war, die ich von meinem Fenster aus gesehen hatte.
Er sah mich nicht, als ich auf ihn zukam. Erst, als ich eine Öffnung in der Mauer durchschritt, die zum Spielplatz führte, rührte er sich und wand seinen Kopf zu mir. Seine Augen waren das einzige, was an ihm nicht blass war, sondern vielmehr leuchtete. Sie besaßen ein wirklich schönes grüngrau, das mir sofort auffiel. Meine Augen waren blau, was Papa wirklich mochte, denn es war die Augenfarbe meiner Mutter, ich hatte das aber noch nie besonders spannend gefunden. Deswegen gefielen mir die Augen des Jungen wirklich sehr. Aber das behielt ich natürlich für mich.
So, wie er zu mir aufgesehen hatte, wand er sich auch wieder ab: mit einer einfachen Bewegung, die so leichtfertig war, dass man denken könnte, sie fände gar nicht statt. Ich wurde ungeduldig, weil er mich einfach so ignorierte, also lief ich zu ihm und stellte mich neben das Gestell, auf dem er saß. Gemeinsam schauten wir nach unten, sahen aber nichts außer Gras und den Himmel, und dass es hinten bergab ging, und man deshalb nicht sah, was im Tal war. Da war nichts. Man sah nichts. Was schaute der Junge sich nur an?
Irgendwann riss mir der Geduldsfaden.
„Was ist da?“, fragte ich.
„Die anderen Häuser.“, antwortete er prompt. Seine Stimme war ein wenig tiefer als meine, und leicht kratzig, als hätte er eine Erkältung überstanden.
„Was ist das hier?“
„Morrow“, sagte er. „Kannst du nicht lesen? Es steht vorn an dem Torbogen.“
„Ich kann lesen.“
„Dann solltest du’s doch wissen.“
Wir schwiegen eine Weile. Ich starrte weiter mit ihm den Hügel herab.
„Und da unten?“
„Die anderen Häuser. Hab ich doch gesagt.“
„Man sieht sie nicht. Ist das auch Morrow?“
„Ja.“ Der Junge wirkte ein bisschen genervt, aber gleichzeitig schien er das Gespräch nicht beenden zu wollen.
Ich nickte nur. „Und du?“
„Was?“
„Wer du bist.“
„Ich kenn dich doch nicht. Da sag ich dir das doch nicht.“
„Du stehst abends immer hier und guckst mich an. Ich seh dich doch. Von meinem Fenster aus.“ Ich wies auf mein Kinderzimmerfenster, das man von hier aus sah. Es ragte zwischen den Spitzen der kleinen Nadelbäumen hervor.
„Ja und?“
„Gestern hat’s sogar geregnet und du bist nass geworden.“
„Ich bin nicht nass geworden.“
„Du standest hier. Genau hier. Ich hab dich sogar angeschrien. Das ist mein Spielplatz.“
„Ist es nicht.“, meinte der Junge trotzig. „Du spielst nur immer hier. Deswegen ist es aber nicht dein Spielplatz.“
Ich legte meinen Kopf schief. „Ist es deiner?“
„Hm?“
„Ist es dein Spielplatz? Wohnst du hier?“
Der Junge zögerte. „Ja.“
„Darf ich trotzdem hier spielen?“
Jetzt wand er wieder seinen Kopf zu mir, und ich konnte seine Augen sehen. Er musterte mich von oben bis unten. Dann deutete er ein Nicken an. „Na gut.“
Ich nickte zufrieden zurück und setzte mich auf die Schaukel, die direkt neben ihm stand. Eine Weile schaukelte ich nur langsam hin und her, während der Junge weiter nach unten starrte.
Es war nicht mehr so still wie letztes Mal, als ich hier war. Die Vögel sangen wieder, und die nervigen Grashüpfer hörte man auch. Ein Hase hoppelte in den Wald hinein. Der Wind rauschte durch die Bäume.
„Bist du gestürzt?“, fragte der Junge auf einmal. Überrascht sah ich ihn an. Er starrte auf den Punkt auf meiner Stirn, wo die Wunde gewesen war.
„Ja“, sagte ich.
„Schwer?“
„Geht schon.“ Ich warf einen Blick auf das Haus. „Und du wohnst echt hier?“
„Ja.“
„Mit deinen Eltern?“
„Nein.“
„Also alleine?“
„Nein.“ Der Junge machte plötzlich einen Satz und stand neben mir. „Willst du was spielen?“
Ich fing an zu strahlen und nickte. Ich wollte wirklich gern spielen und hatte nichts gegen einen Spielkameraden. Der Junge lächelte zurück und rief: „Komm! Wir gehen auf das Klettergerüst.“
„Warte!“, rief ich ihm zu.
„Was denn?“
„Wie heißt du?“
Der Junge war schon fast dabei gewesen, hochzuklettern. Er nahm die Hände vom Gerüst und seine Augen leuchteten mich an.
„Mein Name ist Jack“, sagte er. „Komm, wir spielen Pirat.“
3
„Jack?“, fragte einer der Männer.
Ich nickte.
„Und wann war das genau, als Sie ihm zum ersten Mal begegnet sind?“
„Das muss ungefähr im Mai gewesen sein.“
Der Mann schrieb etwas auf und sagte seinem Kollegen etwas über den Videoschnitt und was sie noch einfügen wollten. Ich hatte keine Ahnung, was sie bisher von meiner Geschichte hielten. Sie kannten ja beide den ungefähren Sachverhalt, und ich war mir sogar relativ sicher, dass der Kleinere mir glaubte, während sein Kollege immer mal wieder schmunzelte und scherzte, aber das störte mich kaum. Ich wollte nur meine Geschichte loswerden.
Inzwischen war es dämmriger geworden, aber noch nicht dunkel. Das hatte noch Zeit. Intuitiv sah ich auf meine Uhr, es war fast um vier. Die beiden Männer hatten mich gefragt, was ich später machen wollte, ob ich sie heute die ganze Nacht begleiten werde. Ich verneinte. Ich hatte zwar zugestimmt, sie nach Morrow zu bringen, aber ich wollte ihnen sonst nicht weiter im Weg rumstehen. Außerdem hatte ich meine ganz eigene kleine Aufgabe.
„Du musst jetzt gehen.“
Jack war plötzlich sehr bestimmt. Er stand unten auf dem Boden, hatte den Rücken durchgedrückt und die Fäuste geballt, so als würde er schlimmen Widerstand erwarten.
Stirnrunzelnd sah ich auf ihn herab. Ich saß auf dem Klettergerüst, das den ganzen Tag unser Piratenschiff gewesen war. „Warum?“
„Weil das so ist.“
Beleidigt deutete ich auf den Himmel. „Meine Eltern sagen, ich muss erst um sieben zu Hause sein. Wenn die Sonne da hinten ist.“
„Du kannst aber nicht länger bleiben als bis um sechs.“ Er zeigte nun direkt auf die Sonne. „Im Sommer, jedenfalls. Das ist Regel.“
„Na schön.“ Ich sprang vom Klettergerüst herab.
Jack war beeindruckt. Er hatte wohl erwartet, dass ich darauf bestehen würde, zu bleiben. Aber ich hielt mich an Regeln.
„Sagen deine Eltern das?“, fragte ich trotzdem neugierig. „Das ich nicht länger bleiben darf?“
„Ich hab keine Eltern. Hör doch zu.“
„‘Tschuldigung“
Einen kurzen Moment standen wir einfach so voreinander. Nachdenklich sah ich in Jacks leuchtende Augen.
Es war so ein schöner Tag gewesen. Die ganze Zeit hatten wir Pirat gespielt, und zwischendurch konnte ich einfach vergessen, dass wir uns eigentlich gar nicht wirklich auf einem Piratenschiff befanden. Ich hatte das Meer förmlich hören können, obwohl ich noch nie am Meer gewesen war. Wir hatten uns etlichen feindlichen Piraten gestellt und riesige, hässliche Seeungeheuer mit unglaublich langen Tentakeln besiegt. Das ich nun schon gehen sollte, fand ich schade.
„Bist du morgen wieder hier?“, fragte ich Jack.
Er nickte. „Ich bin immer hier.“
Grinsend verabschiedete ich mich. Das war mit Abstand der schönste Tag gewesen, den ich bisher erlebt hatte.
Jack und ich wurden gute Freunde. Jeden Tag spielten wir zusammen. Die Piratengeschichte wurde schnell langweilig, und so waren wir bald schon Abenteurer im Dschungel, dann Weltraumforscher (was ich Jack seltsamerweise erst einmal erklären musste) und schließlich Ritter. Und jedes Mal vergaß ich, was wirklich um mich herum war, während wir spielten, bis mich der Abend in die Realität zurückholte. Es war das schönste Gefühl auf Erden.
Ich hatte sonst noch nie einen Spielkameraden gehabt. Normalerweise tauchte ich allein in meine Fantasiewelt ab, aber mit einem Freund wurde das noch viel spannender. Jack hatte so viele Ideen, ging aber auch auf meine ein und beschwerte sich nie. Er war ein Held, wenn er einer sein sollte, aber ließ sich auch retten, wenn ich den Helden spielen wollte. Unser Spiel war immer so fließend, dass ich die Zeit vergaß, und es war das reinste und wunderbarste Gefühl, dass ich in meiner Kindheit kennengelernt hatte.
Aber eine Sache blieb. Pünktlich um sechs schickte mich Jack stets nach Hause. Und ich wagte es nicht, nachzufragen, denn wir hatten uns so gut angefreundet, dass ich wegen so einer Kleinigkeit keinen Streit anfangen wollte. Allerdings wurde die Blase an Fragen mit jedem Tag größer und größer.