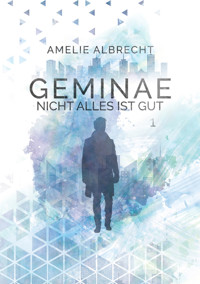
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amelie Albrecht
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zoran glaubt, seine Rebellengruppe ganz gut im Griff zu haben. Gemeinsam stellen er und seine Freunde sich gegen das brutale Regime des Metropolenbundes, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg. Doch als der quirlige Kalian eines Tages verschwindet und bewusstlos in den Armen eines Fremden wieder auftaucht, gerät alles aus den Fugen. Plötzlich soll ihr Viertel ausgelöscht werden, und dann verschwindet auch noch ihr jüngstes Mitglied, die kleine Saya. Nyco, der Fremde, weigert sich zu gehen und will stattdessen helfen. Obwohl Zoran ihn nicht gut kennt, muss er sein Angebot annehmen - doch Nyco hat dunkle Geheimnisse, und bald ziehen sich die Fäden der Regierung immer enger um sie. Zoran weiß nicht, wie lange er seine Freunde noch beschützen kann...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amelie Albrecht
GEMINAE
Amelie Albrecht
Geboren 2002, fing die junge Autorin schon früh mit dem Schreiben an. Ihre Jugend verbrachte sie in der schönen Oberlausitz zwischen einer Menge Büchern und unfertigen Geschichten. Wenn sie nicht gerade an Büchern, Kurgeschichten und Theaterstücken schreibt, verliert sie sich gern in Bibliotheksbüchern und alten Akten und möchte ihre Zukunft als Archivarin verbringen. Sie lebt in Erfurt.
Amelie Albrecht
GEMINAE
Nicht alles ist gut
Band 1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
©2024, Amelie Albrecht
Schlachthoftstraße 66
99085 Erfurt
Website: ameliealbrecht.de
Instagram: @autorin_ameliealbrecht
Lektorat/Korrektorat: Lélo Kalmus
Buchcover und Grafikdesign: Lisa Wirth
Bildlizenzen:
©shutterstock/HolyCrazyLazy©shutterstock/Marina Demidova©shutterstock/Kate Si©shutterstock/korkeng©shutterstock/ Orfeev
ISBN: 978-3-98995-625-4
Alle Rechte vorbehalten.
Für Papa,
für all die Geschichten, die du mir erzählt und gezeigt hast
Erster Teil
D O M I N O
Prolog
Liebe geht nicht verloren
Sie versteckt sich nur
»Mein Name ist Nyco.« Alazon starrte mich mit offenem Mund und halb geöffneter Tür an. Ich wusste, wie ich aussah. Schlamm bis zu den Knien, die Haare fettig und zerzaust, eines meiner Beine blau und blutig. Aber irgendwie hatte ich es bis hierher geschafft, irgendwie war ich ihnen entkommen. Ich wusste kaum, wer ich war und was passiert war. Nur eines wusste ich sicher: Ich war nicht mehr die Person, die ich in ELOHIM noch gewesen war und die Alazon entsetzt beim Namen genannt hatte, als er mir die Tür geöffnet hatte. Ich hatte nicht gewagt, mir selbst in die Augen zu sehen, in keinem der Spiegelbilder, an denen ich vorbeigegangen war. In meiner Vorstellung glühten sie rot wie die eines Monsters oder waren tot wie die von Maschinen. Oder wie meine Stofftiere, die ich alle in meinem warmen Bett zurückgelassen hatte. Ich wollte mich nicht ansehen und sehen, was Vater in mir sah. Ich wollte nicht an Nates Gesichtsausdruck denken. Es war meine Schuld, nicht wahr? Ich merkte kaum, wie Alazon mich an den Schultern packte, so vorsichtig, als könnte ich zerbrechen. Wie er mich auf einen Hocker drückte. »Nyco«, wiederholte er leise. Wie der Held aus meinem Lieblingskinderbuch. Der, der, anstatt Prinzessinnen zu retten auf ein Abenteuer ging und nie zurückkehrte. Nate hatte diese Geschichte nie gemocht, ich dafür umso mehr. Ich hatte früh lesen gelernt, damit ich ihn nicht ewig anbetteln musste, sie mir vorzulesen. Der neue Name war mir ja egal. Alles war besser als das, was sie mich vorher genannt hatten. Es war das erste, was mir eingefallen war, der erste klare Gedanke, den ich wieder hatte fassen können.
Das zweite, an das ich mich erinnerte, war der riesige Schriftzug, den man sah, wo immer man auf das größte Gebäude der Stadt blickte. DOMINO.
»Wie bist du hierher gekommen?« Ich blinzelte Alazon nur an, brauchte einen Moment, um seine Frage zu verstehen. »Ich weiß es nicht«, murmelte ich. Ich kannte Alazon eigentlich kaum. Nur von ein paar Partys und Einladungen von ihm. Manchmal hatte er mir gezeigt, woran er arbeitete, weil ich es so interessant fand. Er war wie ein Onkel, den man viel zu selten besucht. Vielleicht würde er mir gar nicht helfen. Vielleicht würde ich gleich wieder im Zug nach ELOHIM sitzen. Vielleicht würde ich sterben. Wie auch immer. Im Moment war mir alles egal. Ich war müde. Er drückte mir eine heiße Tasse in die Hand. Der Inhalt roch süß, lieblich. So sehr, dass mir alles gleich viel weniger egal war. Vorsichtig nippte ich. Schokolade. Mit großen Augen sah ich auf. Alazon hatte die Stirn in Falten gelegt und sah mich an, als wäre ich ein abgestürztes Küken. »Meine Güte ... Junge.« Er seufzte. Betrachtete mein Bein. »Du bist viel zu jung für all das. Hier. Damit wird es dir gleich besser gehen.« Er nahm ein kleines Behältnis aus seinem Schrank und träufelte etwas von der klaren Flüssigkeit in meine Schokolade. Noch einmal nippte ich. Sie schmeckte immer noch süß.
Kapitel 0
Gib niemals auf
Wofür du stehst
Es war Winter.
Zumindest war es das, was die meisten von euch als Winter bezeichnen würden. Ein kalter Schleier hing in der Luft. Das Licht war trüb. Die Wolken beherrschten diesen Planeten, diese Stadt, und doch lichteten sie sich bereits. Der Tag war zu Ende, obwohl es auf den Uhren der Menschen noch nicht einmal sechs Uhr war. Es dämmerte langsam.
Irgendwo war das Summen einer Lampe zu hören. Die Gestalt in weiß-roter Rüstung - ein Gardist, wie die Leute sie nannten – bemerkte das allerdings nicht. Starr wie eine Maschine stand er am Fuß der Lampe. Ein paar Leute gingen müde an ihm vorbei. Viele trugen dicke Mützen. Niemand achtete auf die Gestalt, als wäre sie nur eine Statue.
Die meisten interessierten sich sowieso für fast gar nichts. Nur für sich und ihre Lebensblase, aus der sie sich nicht herauswagten. Sie hatten einen Job, alle, und eine Wohnung, alle, und eine Familie, jedenfalls fast alle, und alles um sie herum sollte so bleiben, wie es war. Unverändert für sie, gleichgültig für sie. Denn sie hatten genug erlebt in ihrem bisherigen Leben und keine Lust auf Überraschungen.
Die Gebäude waren kalt und strahlten keine Sympathie aus. Sie waren funktional, ihren Anforderungen angepasst und hatten fast alle die gleiche Farbe: einen undefinierbares, glänzendes Graublau, das in den Augen brannte, wenn sich das Sonnenlicht darin spiegelte. Die Bürogebäude unterschieden sich kaum von den Wohnkomplexen. Alles war eng, alles war voll, und doch irgendwie leerer als erwartet. Hier versteckten sie sich meist, die Bewohner dieser Stadt.
DOMINO hieß sie. So stand es in großen, unübersehbaren Lettern auf dem Regierungsgebäude am Rande des Zentrums. Es war etwas größer und unförmiger als die anderen Häuser und hatte auch eine andere Farbe. Grau. Hellgrau. Und matt. Kein Licht spiegelte sich darin. Man konnte es von überall sehen. Besonders gut war es vom Bahnhof aus zu sehen, damit jeder, der hier ausstiegt, wusste, wo er gelandet war. Die Inschrift darunter, das Motto von DOMINO, war überall gut zu erkennen. »Dieses Land ist Eures« verkündete sie. Und niemand stellte es in Frage.
Die Menschen hier waren ruhig. Geschäftig. Meistens müde. DOMINO war eine normale Stadt, die normalste der sieben Metropolen. Es gab Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte und ein paar Restaurants. Die Menschen führten ein einfaches Leben, nach dem Krieg gab es viel zu tun, viel zu arbeiten, und ein Restaurantbesuch war schon etwas zu nobel geworden für den normalen Bürger. Theater und Kinos gab es nicht, denn niemand schien von seiner Pflicht abgelenkt werden zu wollen. So sagte es die Regierung. Keine Auffälligkeiten, keine Störungen waren erwünscht. Das war DOMINO. Das war das Leben hier.
Jetzt bewegte sich der Gardist. Offensichtlich hatte er etwas gehört, was die anderen nicht hören konnten, vielleicht hatte er einen Befehl über sein Helmfunkgerät erhalten, und nun hielt er Ausschau Richtung Süden. Nach wie vor interessierte das niemanden. Viele waren gar nicht mehr auf der Straße, und die wenigen, die noch an ihm vorbeigingen, starrten auf den Boden. Bis sie plötzlich ein Geräusch wahrnahmen, das sie und der Gardist zu hören schienen.
Jemand schrie. Es war kein ängstlicher Schrei, kein verzweifelter, kein wütender, nicht einmal ein fröhlicher. Es war die Art von Schrei, der eine verwirrende Mischung von Gefühlen enthielt und den man benutzte, wenn man einfach alles rauslassen musste, was gerade in einem vorging.
Kurzum, etwas völlig Fremdes in dieser Stadt.
Die wenigen Menschen auf der Straße wichen zur Seite, als das schreiende Etwas an ihnen vorbeiraste. Gut zwanzig Meter hinter ihm folgte eine Gruppe Gardisten, die ihm mit beängstigender Entschlossenheit nachsetzte. Auch der Gardist unter der Lampe schloss sich ihnen an. Der Schrei des Etwas - es war wohl ein Junge im Teenageralter – zerriss die kalte Luft, die kühle Stimmung, und die ganze grobe Konstellation der Stadt, die die Menschen Tag für Tag in sich aufnahmen, bis sie selbst graublau, kalt und funktional geworden waren. Plötzlich lag etwas rosa Schimmerndes, süßlich Duftendes in der Luft, das an Kindheit erinnerte. An früher, als man noch Dinge sah, die später einfach verblasst waren, und alles groß und wunderbar gewesen war. Das edle Auftreten von Freiheit. Die Menschen rümpften die Nasen.
Aber der Junge, der diesen wundersamen Schleier mit sich zog, verschwand. Er floh vor den toten Blicken der Gebäude – und wohl auch vor der Schar Gardisten, die ihn noch immer hartnäckig verfolgten – und lief, vorbei an Häusern und Menschen, durch Straßen und Gassen, aus dem Zentrum hinaus ins Grüne. Auf eine große, weite Wiese, so fehl am Platz und doch so wichtig für die Stadt, die Menschen und diese Geschichte. Der einzige schöne Fleck in der Stadt, für den der Regierung bisher die Zeit fehlte, ihn zu verschandeln.
Von der Stadt aus war es nicht zu sehen, aber hinter der grünen Wiese lag ein Fleck, der DOMINO sehr interessant machte. Sogar so interessant, dass die Leute hier nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben wollten.
Was man allerdings sah, war eine Gestalt, die mitten auf dem grünen Hügel stand.
Und wenn man noch genauer hinsah, und sich ein wenig Zeit nahm, bemerkte man, dass der schreiende Junge und seine Horde von Verfolgern genau auf ihn zu hetzten.
Und wenn man jetzt noch ein, zwei Minuten geduldig wartete, hörte man, wie das schöne Geräusch von Ärger über die Ebenen hallte.
Kapitel 1
Nyco
Nicht alles hat einen perfekten Anfang
Ich konnte es nicht fassen.
Keuchend wirbelte ich im Gras herum, sprachlos, verwirrt und irgendwie auch wütend. Ich wusste nicht, was mich in diesem Moment mehr aus der Fassung brachte: der schreiende Typ mit der offensichtlich ungeladenen Waffe, der mir die ganze Zeit völlig wirkungslose Befehle entgegen schrie, oder die Schlägertypen der Regierung, die aus irgendeinem Grund gegen mich waren.
Es waren etwa zehn Mann, nicht allzu schwer bewaffnet. Wahrscheinlich Wachposten, auf jeden Fall Gardisten. Und sie schossen nur wegen dieses Typen auf mich.
Ich fluchte laut, als ich einen weniger gut gepanzerten Gardisten mit einem beherzten Tritt in die Magengegend davon abhielt, mir näher zu kommen, als meine Komfortzone zuließ. Und die war im Moment leider verdammt klein. Seine Waffe fiel zu Boden, eine schöne mit handlichem Griff, die ich mir kurzerhand schnappte. Schließlich war ich sonst so gut wie unbewaffnet.
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. War ich gerade wirklich in einen Kampf verwickelt worden?
Lass dich nicht von deinen Gefühlen ablenken.
Da war viel Frust in mir, aber meine Kopfstimme hatte recht. Mit einer schnellen Bewegung schob ich den Gardisten neben mir beiseite und versuchte in dem Tumult um mich herum den Jungen ausfindig zu machen, der für das ganze Chaos hier verantwortlich war, als mich plötzlich ein vertrautes prickelndes Gefühl überkam.
Links von dir.
Ich drehte mich zur Seite und drückte ab.
Tot.
Schnell rollte ich mich nach vorn ab, um einem Schlag von hinten auszuweichen, und verlor dabei die geliehene Waffe. Fluchend wollte ich nach ihr greifen, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Und dann sah ich ihn.
Der Typ rannte in mein Blickfeld und winkte mir zu, gefolgt von einem Gardisten. »Versuch mal, einen zu erschießen!«, rief er mir zu.
Ich seufzte.
Wer zum Glauben ist dieser Kerl bloß?
Er war ein seltsam gekleideter Hampelmann, dem ich vor wenigen Minuten in die Arme gelaufen war. Er schien völlig desorientiert zu sein, und man konnte ihm sein albernes Grinsen einfach nicht aus dem Gesicht wischen. Solche Leute machten immer Ärger. Das stand ihnen buchstäblich auf die Stirn geschrieben. Ich versuchte, seine ständigen Anfeuerungsrufe und lächerlichen Ratschläge zu ignorieren, machte einen Ausfallschritt und duckte mich keuchend unter einem Schuss hindurch. Gleichzeitig riss ich mein anderes Bein hoch, kickte dem Gardisten die Waffe aus der Hand und fing sie einen Atemzug später wieder auf.
Dann hielt ich weiter Ausschau nach dem Jungen. Er stand jetzt irgendwo am Rande des Geschehens und wich den Angriffen der Gardisten ungeschickt, aber ruhig und manchmal fast wie durch Zufall aus. Als er bemerkte, wie ich ihn anstarrte, begann er zu lächeln und winkte mir wieder zu.
Er trug ein sehr seltsames Gewand. Hellblau, mit Lederbändern umschlungen und einer viel zu großen Mütze, unter der sein weißes, strubbeliges Haar hervorlugte. Um ehrlich zu sein sah er wirklich lächerlich aus.
Aber am unheimlichsten war, dass er meinen Namen kannte.
Meinen kompletten, bescheuerten Namen.
»Nyco Filline Dubberstone!«, rief er nun schon zum mindestens fünften Mal und stolperte fast über seine eigenen Füße, als er auf mich zulief. Ich verdrehte die Augen, schüttelte den Fremdscham ab und hob meine Waffe. Die Gardisten waren noch nicht besiegt.
»Nenn mich bitte einfach Nyco!«
»Mit 'i' und 'c'?«
Hinter dir. Einer mit guter Rüstung.
»Mit Ypsilon!«, rief ich ihm zu und machte eine Drehung, um auch den Gardisten hinter mir zu entwaffnen. Er schrie überrascht auf und wollte seinen Schlagstock ziehen, doch ich war schneller und schickte ihn mit einem gezielten Schuss in die Brust zu Boden. Dann wirbelte ich wieder zu dem Fremden herum. »Hör zu, ich bin absolut nicht an Ärger mit diesen Typen interessiert!«
»Das kann ich mir vorstellen!« Er musste schreien, damit ich ihn verstand. »Wer legt sich schon gerne mit der Regierung an? Ich heiße übrigens Kalian, freut mich sehr!«
Ich konnte einfach nicht fassen, wie kurzsichtig dieser Freak war. Es schien ihn überhaupt nicht zu interessieren, welche Konsequenzen das Ganze hier für uns haben würde. Ein hellblauer Blitz zuckte haarscharf an mir vorbei und zwang mich, mich wieder auf den Kampf zu konzentrieren. Doch bevor ich mich dem nächsten Gegner zuwandte, nahm ich mir die Zeit, ungläubig den Kopf zu schütteln.
Ich wusste nicht wirklich, wie er mich in diesen Kampf hineingezogen hatte. Geschweige denn, warum. Ich war ganz normal meinem täglichen Ritual nachgegangen, aufmerksam durch die Straßen von DOMINO laufend, als er plötzlich auf mich zugerannt kam.
Zuerst rannte er einfach an mir vorbei, verfolgt von einer Truppe Gardisten, aber ich dachte mir nichts dabei. Es war zwar ungewöhnlich, mitten in der Stadt am helllichten Tag Gardisten zu sehen, die jemanden verfolgten, aber Ärger machende Herumtreiber kamen ab und zu mal vor. Und ich musste es wissen. Schließlich war ich selbst einer. Nur normalerweise mit weniger Ärger.
Erst etwa eine halbe Stunde später - ich war gerade auf dem Weg zum »Verlassenen Viertel« und befand mich mitten auf der Grasebene - tauchte der Typ plötzlich wieder vor mir auf, nur um mit voller Geschwindigkeit in mich hineinzustürzen. Wir hatten beide auf dem nassen Grasboden gesessen, irgendwo auf der ungenutzten Freifläche zwischen dem Zentrum und dem Elendsviertel. Er hatte sich mit verwirrtem Gesichtsausdruck die Nase gerieben und mich etwas benommen angesehen. Aber nicht lange.
Plötzlich hatte ein überbreites Grinsen sein Gesicht bedeckt. Im Hintergrund hatte ich schon die Rufe der Gardisten gehört. Ich hatte etwas sagen, hatte weglaufen wollen, aber er hatte so schnell wie möglich nach Luft geschnappt und meinen Namen in den Himmel geschrien.
Was mich wirklich geschockt hatte. Denn den kannte sonst niemand. Wirklich niemand.
Ich pflegte weder Kontakte noch Freundschaften, hatte keine richtigen Papiere. Ich war ein Obdachloser, ein Herumtreiber, der sich vor dem System versteckte. Dieser bescheuerte Name war natürlich auch nicht mein richtiger. Ich hieß zwar Nyco, aber den Rest hatte ich erfunden, als die Beamtin im Meldeamt bei meiner Ankunft in DOMINO nach meinem Namen fragte. Ich hatte diesen Kerl, der meinen Namen schrie, noch nie vorher in meinem Leben gesehen.
Schließlich waren die Männer aufgetaucht und attackierten uns nun beide. Seitdem versuchte ich, mich möglichst nicht umbringen zu lassen. Und rettete ihm gefühlt alle drei Sekunden das Leben, indem ich ihn aus der Schussbahn der Gardisten drängte.
Es ist wirklich nicht oft vorgekommen, dass ich mich in irgendwelchen Ärger hineinziehen lassen habe; meistens halte ich mich tunlichst aus allem heraus, was Schwierigkeiten mit sich bringen könnte. Mit der Regierung war nicht zu spaßen. Die sperrten jeden ein, der auch nur die kleinste Verhaltensauffälligkeit zeigte. Wie konnte dem Typen das nur so egal sein? Was zum Glauben war er genau? Ein Herumtreiber? Ein Außenseiter? Jedenfalls steckte er jetzt tief in der Patsche, doch es schien ihn gar nicht weiter zu beschäftigen. Immerhin war ich ja da, um ihm den Hintern zu retten. Vorerst.
Tatsächlich sah er nicht so aus, als würde er lange allein irgendwo zurechtkommen. Kampferfahrung schien er auch nicht viel zu haben. Seine Verteidigung bestand hauptsächlich aus Weglauferei, die Gardisten zu attackieren versuchte er erst gar nicht. Er tat gerade so, als wäre dieses Gefecht nur ein Spiel. Und allmählich ging mir seine kindliche Ignoranz ziemlich auf den Geist.
Als ich einen Impuls von links spürte, wandte ich mich abrupt von ihm ab.
Da. Der Mann mit dem roten Abzeichen auf der Rüstung.
Er zielt auf ihn.
Ein eisiger Stich fuhr durch meine Magengegend.
»Vorsicht!«
Heftig und ziemlich unsanft stieß ich – wie hieß er noch? Ach ja - Kalian aus dem Schussfeld und bemerte, wie der Gardist statt auf ihn auf seinen Kollegen schoss, der gerade noch hinter Kalian gestanden hatte. Es gab ein hässliches, metallisches Knirschen, als der blaue Blitz die Hüfte des anderen Gardisten traf. Die Wunde war wahrscheinlich nicht tödlich, aber sie würde garantiert nicht ohne Folgen bleiben.
Der Getroffene gab keinen Laut von sich, taumelte nur einen Schritt zurück und blieb schließlich benommen stehen. Alle um ihn herum erstarrten.
Stille breitete sich aus.
Für einen Moment blieb die Zeit stehen, und alles schien sich in Zeitlupe zu bewegen. Staub stand still in der Luft. Schweißtropfen blieben auf der Haut hängen, und der Wind hielt den Atem an.
Jetzt war mein Moment gekommen.
Jetzt.
Ich wirbelte herum und versetzte dem Bewaffneten einen dumpfen Schlag gegen die Schläfe. Einen Herzschlag später sprang ich auf, schlang meine Beine um seinen Schädel und riss ihn so zu Boden. Verzweifelt fluchend und äußerst ungeschickt versuchte der Kerl, mich mit der Faust zu treffen, doch ich konterte jeden seiner Schläge. Mit einer gezielten Bewegung schnappte ich mir meine einzige Waffe, die zweite hatte ich bereits verloren, und rammte sie ihm in den Nacken.
Die Stromstöße ließen ihn unkontrolliert zucken. Kurz darauf keuchte der Mann und sackte geschlagen zu Boden.
Ich wartete einen Moment, um zu sehen, ob er auch wirklich liegen blieb. Dann stand ich auf und klopfte mir das Gras von der Hose. Ab und zu zuckte der Körper des Gardisten noch einmal kurz zusammen, aber er war endgültig besiegt. Nüchtern betrachtete ich seinen Körper.
Wie ich diesen Anblick hasste. Normalerweise vermeide ich es, meinen Taser einzusetzen. Bei normalen Menschen richtete er kaum Schaden an, aber für Gardisten war er an der richtigen Stelle zweifellos tödlich.
Kalian jubelte, aber ich nahm es kaum wahr. Die Stille um mich herum war noch angespannter geworden, wenn das überhaupt möglich war. Die Männer starrten mich an. Dann den Toten. Dann wieder mich.
Dann geschah einen sehr langen Moment lang nichts.
Auch Kalian verstummte und hörte auf, wie wild auf und ab zu hüpfen. Selbst er schien zu merken, dass etwas nicht stimmte. Die Männer wurden unruhig.
Du weißt, was jetzt passiert.
»Hey«, sagte ich so ruhig wie möglich zu Kalian. »Auf den Boden.«
Er wandte den Kopf und starrte mich mit einem Eselsblick an. Ich seufzte.
Meine Beine bewegten sich wie von selbst. Mit wenigen Schritten war ich bei ihm und stürzte mich auf ihn. Gerade noch rechtzeitig, denn im selben Moment zogen alle verbliebenen Gardisten ihre Waffen und begannen, ziellos um sich zu schießen. Die Schüsse hallten durch die Landschaft und die Luft wurde unerträglich heiß.
Ich spürte den zwingenden Drang, laut zu schreien, um das brennende Gefühl der Angst loszuwerden, das mich überkam. Aber das hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Stattdessen versuchte ich, den beißenden Schrecken in den Griff zu bekommen. Mein Körper zitterte. Die Stimmen in meinem Kopf waren mal wieder so laut, zu laut.
Ich hatte Angst, gegen mich selbst zu verlieren und in Panik aufzuspringen, aber nichts dergleichen geschah. Das einzige, was die Schüsse der Gardisten trafen, waren sie selbst, wie ich gehofft hatte. Wie gefällte Bäume fielen sie einer nach dem anderen zu Boden.
Dann war es wieder still. Aber diesmal lag keine Spannung in der Luft. Es war die Stille des Todes, scharf wie die Sense des dunklen Herrn selbst. Aber friedlich. Und kühl. Ein wahrer Widerspruch zu dem hitzigen Kampf wenige Sekunden zuvor.
Das feuchte Gras kitzelte an meiner Nase. Ich versuchte, ruhig zu atmen. Kalian unter mir wälzte sich herum, um sich umsehen zu können.
»Was war das denn?«
»Ich hab ihren Anführer umgebracht«, antwortete ich mechanisch und etwas zu schnell. »Ohne Anführer funktionieren die Gardisten nicht.«
Kalian kicherte. »Mann, die haben echt ein schwaches Nervensystem. Hey Nyco, würdest du bitte von mir runtergehen? Du bist schwerer als du aussiehst.«
Langsam erwachte ich aus meiner Rage. Meine Wahrnehmung wurde schwächer. Plötzlich spürte ich meine lähmende Erschöpfung. Ich atmete schwer und meine Schulter schmerzte. Kalian schob mich schließlich von sich und half mir auf die zitternden Beine. »Du warst echt heftig! Wo hast du denn so kämpfen gelernt?! ...Hey, Kumpel. Alles okay?«
Nein. Gar nichts war okay.
Ich hatte es schon wieder getan. Verdammt. Ich durfte mich nicht mit diesen Typen anlegen. Verflucht! Ich durfte nicht kämpfen. Erstens gewann ich immer, was mein geringstes Problem war, und zweitens durfte auf gar keinen Fall irgendjemand auf mich aufmerksam werden. Ich starrte auf die am Boden liegenden Gardisten. In meinem Kopf dröhnte es.
So dumm, so leichtsinnig, so emotional.
Oh Mann. Dabei gab es mich doch eigentlich gar nicht mehr.
Wie lange hatte es gedauert, meine frühere Existenz auszulöschen und von der Bildfläche zu verschwinden?
Fast sieben Jahre, Nyco.
Ich durfte nicht auffallen. Seit Jahren hatte ich mich unter Kontrolle, seit Jahren war nichts mehr passiert. Bis dieser Typ kam und mich in einen handfesten Kampf verwickelte. Er musste verrückt sein. Er musste einen kompletten Schaden haben! Niemand in DOMINO legte sich mit Gardisten an! Jedenfalls niemand, der bei Verstand war.
Mit aufkommender Wut sah ich ihn mir genauer an. Er hatte seine dämliche Mütze verloren. Weiße Haare standen ihm kreuz und quer vom Kopf ab. Die Augen des Jungen waren fast übertrieben blau und jedes noch so kleine Fitzelchen Licht spiegelte sich in ihnen. Sie passten fast puppenhaft perfekt zu seiner ungewöhnlich hellen Hautfarbe. Seine Kleidung bestand aus einem alten Leinenhemd und einer dazu passenden Hose, über der er eine Art Gürtel mit einem stahlblauen Lendenschurz trug. Handbandagen schützten seine Hände und Lederriemen waren in alle Richtungen um seinen Oberkörper gebunden. Dazu trug er ein selten unbekümmertes Grinsen auf dem Gesicht.
Kurz gesagt: Er sah total naiv aus, wie aus einem blöden Videospiel. Genau die Art von auffälligen Menschen, die ich grundsätzlich nicht leiden konnte und mit denen ich mich auch nicht abgeben möchte.
Aber meine Wut auf ihn ließ langsam nach. Er schien so unschuldig zu sein, dass es fast unmöglich war, ihm böse zu sein. Rätselnd stand ich neben diesem geheimnisvollen Jungen und fragte mich, warum ich ihn in meiner Rage nicht auch umgebracht hatte.
»Heyyy! Planet an Nyco! Ich sollte dich doch nur Nyco nennen? Tolle Aktion, Kumpel! Hätt' ich nie so hinbekommen, reife Leistung! Machst du irgendeinen Kampfsport?«
Das mit dem Umbringen meinte ich übrigens nicht im übertragenen Sinne. Also nicht, weil er nervte, sondern eher: Warum habe ich ihn wie einen Freund behandelt, der auf meiner Seite steht, obwohl ich ihn gar nicht kannte?
»Aber ich habe auch ein bisschen dazu beigetragen. Oder? Ich meine, okay, ich habe uns beide erst in diese Situation gebracht, aber trotzdem. Oder? Na ja, jedenfalls ist es ja gut, dass wir beide überlebt haben. Wir müssen jetzt los, meine Freunde im Verlassenen Viertel machen sich bestimmt schon Sorgen.« Er schulterte seinen völlig zerfransten Rucksack, den er während des Kampfes wohl fallen gelassen hatte. »Lass uns gehen!«
Oh Mann.
»Woah, Moment mal, Freundchen! Es gibt kein ‚wir’«, stellte ich klar.
Er zögerte. »Nicht?«
»Nein.«
Kalian schaute mich einen Moment lang verwirrt an. Dann grinste er. »Gut, also gehen du und ich jetzt...«
»Nein, stopp!«, rief ich etwas zu laut. Von irgendwoher kam ein Echo zurück. Verdammt, hoffentlich war niemand in der Nähe, der noch am Leben war. Ich senkte meine Stimme. »Es gibt auch kein du und ich! Ich brauche keine Verbündeten. Bitte geh jetzt.«
»Aber-«
»Geh jetzt!«, zischte ich.
Kalian zuckte zusammen. Sein verletzter Gesichtsausdruck tat mir leid, aber ich durfte nicht nachgeben. Zu seinem Wohl.
Zwei weitere Sekunden starrte er mir schweigend in die Augen, und ich glaubte, Tränen darin zu erkennen. Schließlich verzog er stur die Lippen und stampfte fest auf den Boden. Er versuchte wohl, wütend auszusehen, aber er wirkte wie ein trotziger Dreijähriger. Offensichtlich wollte er etwas sagen, überlegte aber noch, wie. Ich seufzte. Er hatte die Sturheit eines Kleinkindes. Er würde nicht gehen.
Schön. Dann würde ich halt gehen.
Ohne noch einmal zurückzublicken, drehte ich mich um und ging in Richtung Stadtzentrum, in die Richtung, aus der Kalian vorhin mit der Horde Gardisten angerannt kam. Ich sah die hohen Gebäude vor mir, die das rote Licht der untergehenden Sonne reflektieren. Die Nacht brach an. Der Grasboden vor mir wölbte sich bergab und der Wind zerzauste mein Haar.
Ich durfte mich nicht umdrehen. Ich wusste gar nicht, warum ich mich wegen dieses Typen so genierte. Ich musste doch einfach nur nach vorn schauen. Noch ein paar Schritte und ich würde Kalian... ich meinte, den Typen, nicht einmal mehr hören können, und...
»Feigling!«
Oh, ich hörte ihn. Natürlich hörte ich ihn. Klar und deutlich sogar, und ich erschauderte. Meine Beine wollten sich nicht mehr bewegen.
»Feigling. Elendiger Feigling!«
Ich drehte mich um. Da stand er, Kalian, oben auf dem Hügel, leicht vornübergebeugt, die Hände zu Fäusten geballt und mit tränenden Augen. Hinter ihm ging die Sonne unter und hinterließ einen Schleier am Himmel, rot wie Blut. Er weinte. Er weinte meinetwegen. Inmitten der Leichen weinte er um einen Lebenden.
Um jemanden, der es wirklich nicht verdient hatte.
Schluchzend und schniefend setzte er zu einem weiteren Schrei an, brach dann aber mit einem weinerlichen Seufzer auf die Knie nieder, als ob er Schmerzen hätte und sich nicht halten könnte. Auf einmal wirkte er viel jünger, als ich ihn eingeschätzt hatte. Fünfzehn vielleicht, oder sechzehn. Viel zu jung für all das hier.
Aber das zwang mich noch lange nicht, zu ihm zurückzugehen!
...Oder doch?
Diese Entscheidung wurde mir schnell abgenommen. Plötzlich brach Kalian völlig zusammen. Sein Schluchzen verstummte und er sank neben den toten Gardisten ins Gras. Kein Zucken, kein Laut war mehr von ihm zu hören.
Innerlich zuckte ich zusammen, obwohl er mir egal sein wollte. Ist er etwa verletzt? Braucht er Hilfe?
Ich hatte nicht gesehen, dass er verletzt worden wäre...Er hatte auch nicht so getan, als ob er Schmerzen hätte. Aber selbst wenn er nicht ernsthaft verletzt gewesen wäre, würden gleich noch mehr Leute von der Regierung hier auf der Matte stehen. Sie würden ihn mitnehmen. Wenn ich ihn hier ließ, würde er entweder sterben oder in Gefangenschaft geraten – wahrscheinlich beides auf die eine oder andere Weise.
Beim Glauben nochmal.
Ich sog die Luft ein und stieß sie seufzend wieder aus. Was brachte es mir, ihn hier zu lassen? Ein schlechtes Gewissen. Darauf konnte ich gut verzichten.
»So dumm, so leichtsinnig, so emotional.«
Diese verdammten Gefühle.
Also fing ich an, zu ihm laufen. Dem blutenden Himmel entgegen.
Kapitel 2
Saya
In schlechten Zeiten
gehen wir unserer Angst entgegen
Sayas Puppen waren heute ungezogen. Die goldlockige Prinzessin wollte sich das Haar einfach nicht richtig bürsten lassen. Es war schon nicht mehr golden glänzend wie sonst, sondern matt, wie Sand oder helles Holz.
Sie hasste es, dass die Puppe so furchtbar unprinzesslich aussah. Außerdem hatte sie sich schon zum dritten Mal Beerensaft auf das rote Rüschenkleidchen geschüttet. Saya kam mit dem Waschen und Schimpfen gar nicht mehr nach. Und von der Agentenpuppe hatte sie heute noch nicht einmal eine Strähne ihres braunen Haares gesehen. Dabei war sie so schön und konnte so gut geschminkt werden. Saya hatte zwar vor einiger Zeit ihre Kleider verloren und sie deshalb ohne Taléas Erlaubnis in deren Tusche getaucht, damit es so aussah, als würde sie enge schwarze Kleidung tragen. Aber sie hing immer noch sehr an ihr. Ihre Abenteuer als Heldin waren einfach toll. Später musste sie Zoran fragen, ob er sie für sie suchen würde.
Jetzt war allerdings kein guter Zeitpunkt dafür. Saya schielte in die Richtung, in der sich Zoran aufhalten musste, wenn man von den stetigen Schrittgeräuschen ausging, die durch den Raum hallten. Durch das Chaos des Raumes konnte sie nur einen Teil seines Hemdes erkennen, aber sie war sich absolut sicher, dass er es war.
Nervös lief er im Foyer der Villa auf und ab, zwischen den vielen Tischen und alten Bänken, die quer im Raum verteilt waren. Eine Hand hatte er nachdenklich an die Wange gelegt. Saya wusste: Wenn er das tat, war er sehr mit Nachdenken beschäftigt. Und die anderen in der Gruppe sagten ihr immer, dass man Zoran beim Nachdenken nicht stören sollte.
Sie drehte sich um. Ihr gegenüber saß Robin, ein weiterer Mitbewohner ihres Zuhauses, auf einer Bank und brütete über einem Plan, der wie ein Labyrinth aussah. Interessiert betrachtete sie die komplizierte Zeichnung und versuchte sie zu verstehen, aber sie wollte einfach nicht begreifen, was es damit auf sich hatte. Trotzig sog sie Luft ein, bis ihre Wangen aufgebläht waren, und blies sie laut und frech zu Robin hinüber. Dann kroch sie so schnell sie konnte hinter die nächste Bank und kicherte, als Robin verwirrt aufblickte, aber niemanden sehen konnte. Saya konnte sich gut verstecken, und Robin war so groß und stark und mürrisch. Es war leicht, ihn zu ärgern.
Aber manchmal hatte sie auch ein bisschen Angst vor ihm. Und auf keinen Fall wollte Saya mit ihm reden, obwohl Zoran gesagt hatte, dass er ihr nie etwas tun würde. Robin war komisch, er sagte manchmal komische Sachen und wollte immer alles kaputt machen. Er war laut und grob. Sie würde auf gar keinen Fall zulassen, dass er ihre Puppen vor ihr findet.
Hastig krabbelte sie um die Bank herum und suchte Schutz unter einem der vielen runden Tische in der Halle. Fayre meinte immer, ihr Haus sei viel zu groß für alle, schließlich waren sie nur zu siebt, aber Saya mochte die verwinkelte Villa hier im Verlassenen Viertel der Stadt. Zoran sagte, sie hätten wirklich Glück gehabt, die Villa unbewohnt vorgefunden zu haben, als sie nach DOMINO kamen. Sie nutzen ohnehin nur einen Teil davon, nämlich das Erdgeschoss mit der Eingangshalle, einigen Schlafzimmern und die Flure, die zu ihnen führten.
Zwischen der Halle und den Schlafzimmeren führten Treppen in tiefe, dunkle, geheimnisvolle Kellerräume, die mit den Katakomben unter dem Stadtviertel verbunden waren. Dort wollte Saya allerdings nicht allein hingehen. Der goldlockigen Prinzessin war es viel zu dunkel dort unten. Als sie das letzte Mal nicht aufgepasst hatte, waren sie und Saya beim Fangenspielen hinuntergeraten. Plötzlich war der Prinzessin eine Spinne auf das Haar geklettert, und Saya erschrak sich so sehr, dass sie die hübsche Puppe im hohen Bogen davon warf. Bestimmt lag die Agentinnenpuppe auch noch im Keller, zwischen Kisten und Kartons mit Anziehsachen, Waffen und Büchern darin. Aber so ganz ohne jemanden, der ihr beim Suchen half, würde Saya bestimmt nicht hinuntergehen. Nicht noch einmal.
Sie wünschte, Fabjen wäre hier. Er war nur ein bisschen älter als sie, dafür aber ziemlich mutig. Er sagte er immer, er würde sie beschützen, und manchmal spielte er sogar mit ihr, wenn er nicht gerade wieder komisch drauf war und unbedingt »erwachsen« wirken wollte.
Oder Kalian. Kalian wäre bestimmt mit ihr die Puppe gegangen, um die Puppe zu suchen. Er half Saya immer, wenn sie ihn um etwas bat. Und er war ganz lieb und lustig. Sicherlich käme er auch ganz leicht an die Lichtschalter. Aber Kalian war nicht hier, und nun müsste Saya sich wie beim letzten Mal eine Taschenlampe von Fayre leihen, oder im schlimmsten Fall von Robin, und das fanden beide nicht besonders lustig. Sie fragte sich, ob die Agentinnenpuppe es vielleicht sogar allein wieder aus den Gängen schaffen würde. Schließlich sind Agentinnen ja mutig. Sie hatte bestimmt keine Angst im Dunkeln. Allerdings war sie sich auch nicht sicher, ob die Puppe die Türen ganz allein aufbekommen würde.
Nicht, dass Saya Angst gehabt hätte. Aber sie konnte auch nicht so gut Karate wie die Agentin, und wer weiß, was im Dunkeln alles lauerte? Fabjen hatte ihr einmal von einem bösen Fressmonster erzählt, das sich zwischen den Kisten versteckte. Er hatte dafür großen Ärger von Fayre bekommen. Sie meinte, so etwas würde es nicht geben. Beweisen konnte sie es aber nicht.
Saya versuchte, auf eines der Sofas zu klettern, die etwas höher und weicher waren als die kalten, schmalen Metallbänke. Oben angekommen, konnte sie Zoran besser beobachten, der immer noch auf und ab ging, den Blick ernst auf den Boden gerichtet. Sie spürte, wie ihr Magen knurrte. Am liebsten hätte sie ihn gefragt, wann Kalian mit dem Essen zurückkäme, schließlich war er schon so lange weg. Aber sie traute sich noch nicht, Zoran anzusprechen. Manchmal war er so in Gedanken versunken, dass er gar nicht hörte, wenn sie ihn etwas fragte. Und sie mochte es nicht, wenn man sie abwies, auch wenn es unabsichtlich passierte. Eigentlich war Zoran immer sehr freundlich zu ihr. Sie fragte sich, ob etwas passiert war, das ihn beschäftigte.
Immerhin war Zoran derjenige, der sich immer um alle kümmerte. Jeder hörte auf ihn und er bestimmte, wo es lang ging. Sogar Robin, der sich eigentlich nicht gerne etwas sagen ließ, tat immer das, was Zoran sagte. Auch wenn Robin in letzter Zeit immer mürrischer wurde. Fast so, als wolle er nicht mehr zur Gruppe gehören. Zu ihrem »Team«, wie Zoran es nannte. Manchmal nannte man sie sogar Rebellen, aber Zoran mochte das Wort nicht besonders. Saya auch nicht. Er klang komisch. So schwierig. Und irgendwie böse.
Plötzlich öffnete sich unweit von Saya die Eingangstür. Neugierig wandte sie sich um.
Draußen war alles dunkel, nass und schlammig. Der Wind peitschte unnachgiebig den Regen durch die Tür. Zwei Jungen standen direkt hinter der Türschwelle. Saya lächelte, als sie erkannte, dass einer der beiden Kalian war.
Ihr Lächeln erstarb jedoch, als sie sah, wie er dort stand. Sein Kopf hing schlaff nach unten, der andere Junge musste ihn stützen, damit er nicht zu Boden fiel. Saya konnte Kalians Gesicht nicht sehen, doch seine weißen Haare waren vollkommen nass und platt, nicht so witzig nach allen Seiten abstehend wie sonst immer. Um seine Schultern hing ein schwarzer Mantel, den Saya noch nie zuvor gesehen hatte. Er musste dem anderen Jungen gehören, aber ein starker Windstoß fegte ihn plötzlich von Kalians Schultern. Der Junge bemerkte es nicht einmal. Unruhig musterte Saya den Fremden.
Er war in dunkelgrau bis schwarz gekleidet. Einen Arm hatte er um Kalian gelegt, in der anderen Hand hielt er die Schlüsselkarte für die Eingangstür der Villa. Sein braunes, kurzes Haar klebte an seiner Stirn und er sah Saya aus ziemlich verwirrten, grauen Augen an. Schnell duckte sie sich hinter die Armlehne der Bank, was aber kaum Wirkung zeigte. Der Junge wandte seinen Blick nicht von ihr ab.
Da hörte Saya, wie Zoran Kalians Namen rief. Er kam angerannt und nahm dem Fremden eilig ihr ohnmächtiges Teammitglied ab, trug ihn ins Innere und legte ihn behutsam auf eine Bank. Saya reckte den Hals, um Kalian besser sehen zu können. Der Fremde trat zögerlich hinein, dann folgte er Zoran. Die Tür schloss sich und das wilde Rauschen des Windes verstummte. Saya sprang über die Rückenlehne der Bank und drückte den Verschlüsselungsknopf neben dem Eingang, so wie Zoran es ihr beigebracht hatte.
»Er hat eine Wunde an der Seite«, erklärte der Fremde ungefragt. »Ich...ich habe sie erst gar nicht gesehen, er sah nicht aus als hätte er Schmerzen, und dann ist er einfach mitten auf dem Hügel zusammengebrochen.«
Saya sah den Fremden jetzt von hinten, sein Rücken verdeckte die Sicht auf Zoran. Sie bemerkte ein kleines schwarzes Kästchen an der Rückseite seines Gürtels und lächelte tatendurstig.
»Wie, zusammengebrochen?!« Zoran klang aufgebracht. »Wo war er? Was hat er gemacht?«
Saya konzentrierte sich voll und ganz auf den kleinen Kasten des Fremden. Sie musste ihn unbedingt an sich bringen. Im Hintergrund hörte sie, wie Robin sich vom anderen Ende der Halle einmischte.
»Waren es Gardisten?« Seine Stimme klang mehr interessiert als besorgt. »Diesen Holzkopf kann man wirklich nirgendwo allein hinschicken.« Seine schweren Schritte kamen näher und Saya hielt kurz inne, um zu lauschen, ob er in ihr Blickfeld kommen würde. Doch die Schritte verstummten einige Meter vor ihr. Erleichtert atmete sie leise aus.
»Sei still, Robin«, befahl Zoran schroff. Er kniete sich neben den scheinbar schlafenden Kalian und untersuchte ihn notdürftig. »Er blutet nicht.«
»Es ist vielleicht eine Prellung, schlimmstenfalls aber ein Rippenbruch«, erklärte der Fremde. »Ich weiß nicht, wovon er umgekippt ist. Ich habe nicht wirklich gesehen, was er alles abbekommen hat.«
Inzwischen hatte sich Saya hinter ihn geschlichen. Sie wartete, bis er aufgehört hatte zu gestikulieren, und nahm dann mit ruhigen Fingern das Kästchen von seinem Gürtel. Stolz zeigte sie es der goldlockigen Prinzessin, die zufrieden nickte.
Zoran seufzte. »Robin, hol Taléa. Und Fayre am besten auch.«
Robin nickte, musterte den Fremden noch einmal misstrauisch und verschwand in den hinteren Gängen. Schweigen legte sich über die Halle.
Saya hatte sich inzwischen hinter der Lehne der Bank versteckt, auf der Kalian lag. Interessiert beobachtete sie den Fremden, der sich aufmerksam in der Halle umsah. Er schien nicht zu bemerken, dass etwas an seinem Gürtel fehlte. Zum Glück war es ziemlich dunkel, denn die Fenster waren zugemauert und nur ein paar Lampen an der Wand spendeten Licht, sonst hätte er sie vielleicht entdeckt.
Zoran hatte etwas aus seiner Gürteltasche gekramt und begann, die Kratzer in Kalians Gesicht zu versorgen. Behutsam trug er eine blassgelbe Salbe auf. »Was genau ist überhaupt passiert?«, fragte er den Fremden.
Der Junge zögerte kurz. »Er... hat sich mit ein paar Gardisten angelegt, so wie es aussah. Ich weiß es nicht genau, ich bin nur zufällig mit reingezogen worden.«
Zoran nickte. Dann musterte er den Fremden. »Seid Ihr bewaffnet?«
Darauf hatte Saya gewartet. Sie kam ihm zuvor und stürmte auf Zoran zu. »Das hier hing an seinem Gürtel, Zoran!« So bedeutungsvoll wie sie konnte, drückte sie ihm das Kästchen in die Hand und beobachtete zufrieden, wie der Fremde verwirrt an die Stelle griff, an der es bis eben noch gehangen hatte.
»Ein Taser.« Zoran wuschelte ihr durchs Haar. »Gut gemacht, Saya.«
»Erzieht Ihr eure Tochter zum Stehlen?« Der Fremde trat amüsiert einen Schritt näher. Mit hochgezogener Augenbraue musterte er Saya. Rasch versteckte sie sich hinter Zoran.
»Ich erziehe das Mädchen zur Vorsicht.« Zorans Hand glitt nach hinten und legte sich auf Sayas Kopf. »Sie ist nicht meine Tochter.« Er machte eine Pause und lachte trocken. »Sehe ich wirklich schon so alt aus?«
Der Fremde zuckte mit den Schultern. »Ich kenne Männer, die in keinem Alter in der Lage sind, Kinder zu erziehen.«
»Dann sind es keine Männer, sondern Söhne schlechter Eltern.«
Saya verstand nicht, wovon die beiden sprachen. Sie klammerte sich an Zorans Oberteil fest und spähte hinter seinem Rücken hervor.
Der Fremde musterte Zoran von oben bis unten. »Ich glaube, wir werden uns verstehen.«
»Wir werden sehen«, meinte Zoran. Sanft löste er sich aus Sayas Umklammerung, ging zu einem der Tische und schenkte ein Glas Wasser ein. Saya ließ sich auf den Boden fallen und kroch zu der Bank, auf der Kalian lag. Behutsam legte sie die Puppe auf seine Brust und beobachtete, wie sie sich hob und senkte. Langsam beugte sie sich vor und gab Kalian einen sanften Kuss auf die Wange. Vielleicht würde ihn das ja aufwecken? Sie wartete eine Weile, doch Kalian hielt die Augen geschlossen. Enttäuscht wandte sie sich ab. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Zoran dem Fremden das Glas reichte.
»Hier, trinkt.« Als er merkte, dass der Fremde ablehnen wollte, unterbrach er ihn, noch bevor er etwas sagen konnte. »Ihr müsst durstig sein, schließlich habt Ihr einen Kampf hinter Euch. Und wir teilen, was wir haben.«
Saya nickte. »Ja«, bestätigte sie laut, und sah dem Fremden tief in die Augen. »Teilen.«
Er lächelte ihr kurz zu, nahm dann mit einem dankbaren Nicken das Glas an und trank einen großen Schluck.
In diesem Moment ertönten aus den Gängen, die zu den Schlafsälen führten, vertraute Stimmen.
»Robin, ich schwöre dir, wenn du noch ein einziges Mal ungefragt in mein Zimmer platzt, dann trete ich dir in deinen hässlichen, verbeulten Ar-«
»Fayre!«, unterbrach sie eine zweite Frauenstimme. »Keine Schimpfwörter! Denk an Saya.«
»Och«, hörte Saya Robin sagen. »Die Kleine soll ruhig lernen, wie man Männer verschreckt.« Saya stellte sich vor, wie er dabei grinste, so wie er es immer tat. So doof und schräg. Sie würde ihn nie mögen.
Fayre, Robin und Taléa traten aus dem Schatten in die Halle. Robin nickte Zoran kurz zu und betrachtete ein letztes Mal nachdenklich Kalian und den Fremden, dann zog er sich wieder in seine Ecke der Halle zurück. Taléa reagierte weniger gelassen. Sie stieß einen erschrockenen Laut aus und stürzte auf die provisorische Krankenliege zu.
Saya trat einen Schritt zurück, als Taléa sich neben Kalian hockte und über sein schlafendes Gesicht strich. Sie wollte Taléa nicht im Weg stehen. Also drehte sie sich um und baute sich stattdessen breitbeinig vor Fayre auf.
»Denk an Saya!«, sagte sie laut und plusterte ihre Wangen auf. »Keine Schünfwörter.«
»Schimpfwörter.« Korrigierte Fayre. Sie pustete sich eine rötliche Strähne aus dem Gesicht. »Jawoll Süße. Kommt nicht wieder vor. Also, was geht hier ab, Zoran?«
»Kalian hat es irgendwie geschafft, die Gardisten auf sich zu hetzen.« Zoran wirkte müde. Er hatte den Kopf in die Hände gestützt. Saya sah die Sorge in seinen Augen und hätte ihn am liebsten in den Arm genommen. »Dabei sollte er doch nur Lebensmittel besorgen.«
»Du meinst klauen«, rief Robin vom anderen Ende der Halle. »Das konnte der Schneekopf noch nie.«
Saya warf ihm einen bösen Blick zu. Sie mochte es nicht, wenn Robins raue Stimme Zoran beim Reden unterbrach. Nachdenklich blickte sie wieder zu Kalian.
Wie gern würde sie ihm helfen. Wenn er krank war, brauchte er Medizin. Sie hatten wenig Medizin zu Hause, das wusste Saya, weil Taléa sich immer darüber beschwerte. Angestrengt dachte sie nach.
Ihr fiel etwas ein, das sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit von zwei Verkäufern auf dem Markt gehört hatte. Etwas von einer Medizin, die alles heilen konnte. Vielleicht könnte das Kalian helfen! Aber wie sollte sie an diese Medizin kommen?
Sie sah sich um. Alle waren plötzlich aufgeregt und beschäftigt, redeten durcheinander und schimpften. Niemand würde ihr zuhören. Sollte sie vielleicht allein…?
Nachdenklich betrachtete sie die Puppe in ihrer Hand. Würde sie es mit der goldlockigen Prinzessin zusammen schaffen, die Medizin allein zu besorgen? Saya kannte den Weg zu dem Ort, von dem die Händler geredet hatten. Streng genommen würde sie nicht einmal vor die Tür müssen. Normalerweise durfte sie nicht alleine fortgehen, schon gar nicht nachts, aber das hier war ein Notfall! Oder?
Angestrengt grübelnd legte sie den Kopf schief. »Was meinst du?«, flüsterte sie der Prinzessin zu. »Für Kalian?«
Die Puppe nickte vorsichtig. Saya nickte auch.
Dann war es also beschlossen. Sie und die Prinzessin hatten eine neue Mission. Aber dafür musste sie jetzt doch in die dunklen Gänge gehen. Sie beruhigte sich mit dem Gedanken, dass sie es für eine gute Sache tat. Zoran sagte, für etwas Gutes soll man seine Angst überwinden können.
Robins Stimme ertönte erneut und ließ Saya innehalten. »Du darfst dich nicht wundern, wenn Lebensmitteldiebstahl Ärger mit sich zieht. Das passt nicht ins System.«
»Wo passt Diebstahl schon in ein ‚System‘?«, fragte Zoran.
»Das ist ja der Punkt. Wir brauchen eine andere Lebensmittelquelle.«
Fayre schnaubte. »Also wir fangen bestimmt nicht wieder an, bei diesem Gauner Casanova zu schnorren! Der hat sowieso nur vergammeltes Zeug.«
Saya hatte sich schon fast aus der Eingangshalle geschlichen, als sie die Taschenlampe bemerkte, die neben Robin auf der Bank lag. Fragend schaute sie die Prinzessin an. Die Puppe nickte. Sie würden eine brauchen. Kurz vor dem Eingang zu den Fluren schlug sie noch einmal einen Bogen nach links.
»Moment mal, ihr wolltet klauen?«, hörte sie den Fremden fragen. »Etwa im Zentrum?«
Fayre schnalzte »Wie sollen wir sonst überleben? Wer zum Glauben bist du denn überhaupt?« Provozierend trat sie einen Schritt auf ihn zu. Der Fremde zuckte nicht einmal.
Zoran unterbrach Fayre. »Lass ihn. Er hat Kalian gerettet.«
»Sagt wer?«
»Sagt er!«
»Ach und du glaubst ihm einfach? Verdammt Zoran, hast du völlig den Verstand verloren?«
Mit einer schnellen Bewegung hatte Saya sich die Lampe von der Bank stibitzt. Leise wie ein Fuchs schlich sie nun mit der goldlockigen Prinzessin aus der Halle und blieb vor dem Eingang zum Keller stehen. Erst als sie sicher war, dass Robin das Verschwinden seiner Lampe nicht bemerkt hatte, öffnete sie so leise wie möglich die Tür.
Einen Moment lang lauschte sie Fayres Dialog mit Zoran. Fayre benutzte Worte, von denen Zoran immer sagte, sie seien unhöflich und Saya dürfe sie nicht sagen. Sie hielt sich die Ohren zu.
Denk an Saya.
Dann lugte sie noch ein letztes Mal um die Ecke. Beim Anblick des völlig überforderten Fremden, über den sich Fayre und Zoran gerade heftig stritten, musste sie leise kichern. Dann sah sie noch einmal zu Kalian hinüber, der friedlich schlief.
Saya war fest entschlossen, ihrem Freund zu helfen. Sie knipste die Taschenlampe an und verschwand in der Dunkelheit.
Kapitel 3
Taléa
Nur für andere werden wir stärker
Behutsam zog Taléa Kalians Shirt hoch, bis ein dunkelblauer Fleck etwas oberhalb seiner Hüfte zum Vorschein kam. Sie erschauderte. Das sah übel aus.
Mit zitternden Händen zog sie ihre Latexhandschuhe an, mehr aus Gewohnheit als aus hygienischen Gründen, denn zum Glück war das hier keine blutende Wunde. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Mehrmals versuchte sie nervös, die Schnalle ihres kleinen Notfallkoffers zu öffnen, bis er endlich aufschnappte. In der blassrot schimmernden Box befanden sich neben etlichen Pflastern auch ein halbleeres Desinfektionsmittel, ein paar Bandagen, Schmerztabletten sowie ein längst abgelaufenes Kühlgel, das neben einem nicht mehr ganz vertrauenswürdig aussehenden Blutstillungsspray vor sich hin vegetierte. Innerlich seufzte Taléa. Ihre Ressourcen als Ärztin der Gruppe waren mehr als knapp. Eigentlich wollte sie sich schon längst bei Zoran darüber beschweren, aber jedes Mal, wenn sie das vorhatte, sah er aus, als hätte er schon genug Sorgen, und sie ließ es bleiben. Langsam wandte sie sich wieder Kalian zu und versuchte, ihr Zittern in den Griff zu bekommen.
Reiß dich endlich zusammen!
In ihrer Zeit als Lazarettsanitäterin während der Neusiedlerkriege hatte es sie nie gekümmert, Wunden zu behandeln, die weitaus schwerwiegender waren als diese hier. Sie war sogar auf offene Wunden spezialisiert gewesen. Dazu gehörten abgetrennte Gliedmaßen, Schusswunden, Bisswunden von den Tieren der Ureinwohner, die manchmal wirklich bestialisch ausgesehen hatten, üble Platzwunden, und vieles mehr. All ihre Patienten hatte sie immer ohne mit der Wimper zu zucken gewaschen, desinfiziert, verbunden, operiert und dann wieder gesund gepflegt. Das ganze Blut und auch die Schmerzen, die ihr Gegenüber empfunden und nicht selten auch lauthals zum Ausdruck gebracht hatte, waren für sie kein Problem gewesen. Sie hatte sich mit den Jahren abgestumpft gegenüber jeder Form von Mitleid. Jedenfalls erzählte sie sich das selbst.
Aber in den letzten Jahren hatte sie festgestellt, dass sie, wenn sie Verletzungen von Freunden behandeln musste, einfach nicht mehr die nötige Nüchternheit aufbringen konnte, um ihr Unbehagen zu verbergen.
Sie wusste nicht genau, woher das kam. Aber hier ging es um einen Menschen, den sie nicht verlieren wollte. Nicht weil es ihre Aufgabe als Ärztin war, sondern weil sie ihn mochte. Weil er ihr Freund war. Heilen war keine Arbeit mehr, die man einfach nur erledigte, sondern eine Aufgabe mit Erwartungen und Konsequenzen.
Im Lazarett der Regierung war es immer so anders gewesen. Dort gab es keine Tränen und keine übertriebene Sentimentalität – wer starb, starb; wer lebte, lebte. Taléa hatte deshalb immer geglaubt, sie sei gefühlskalt, aber es stellte sich heraus, dass sie genau das Gegenteil war – wenn das Leben eines Freundes in ihren Händen lag, fühlte es sich oft an, als würden alle Gefühle gleichzeitig in ihrem Kopf tanzen.
Nachdem sie aus dem Lazarett vertrieben worden war und auf Zoran traf, hatte sie ihre Gefühlskälte mehr und mehr verloren. Doch statt Stärke hatten sich Empfindungen wie Unsicherheit und Angst in ihrem Kopf breit gemacht. Böse Stimmen begannen laut zu werden. Sie war von Tag zu Tag ruhiger und introvertierter geworden, ohne etwas dagegen tun können. Oder war sie schon immer so gewesen und hatte es nur nie ausleben können?
Als die Gruppe Kalian zum ersten Mal traf, war ihre Situation sehr hoffnungslos gewesen. Sie hatten in dieser Zeit buchstäblich vor dem Nichts gestanden. Obdachlos und nirgendwo willkommen lebten sie auf der Straße, unter Brücken und in leeren Häusern, ohne viel zu essen, aber mit viel zu viel Zeit. Kalian war trotz ihrer Lage immer zuversichtlich geblieben. Das hatte Taléa damals sehr geholfen, vor allem, weil sie mehr und mehr das Gefühl gehabt hatte, ihr Leben und vor allem ihren Kopf nicht mehr im Griff zu haben. Schnell begann sie, Kalians sorgloses Lachen und seine gesamte Persönlichkeit zu bewundern. Kalian war ihr ein echter Freund geworden. Sie konnte ihn jetzt nicht im Stich lassen.
Aber genau das brachte die Angst vor dem Scheitern mit sich. Was, wenn sie durch ein falsches Zögern oder einer überstürzten Entscheidung alles nur noch schlimmer machte? Jetzt lief es ihr kalt den Rücken runter, wenn sie daran dachte, welche Schmerzen diese Wunde für Kalian bedeutete, und welche Folgen sie haben könnte, wenn sie nicht…
…gut behandelt wird.
Taléa zwang sich, ruhig zu bleiben, und atmete tief durch. Es hing von ihr ab, ob Kalian weiterhin Schmerzen haben würde oder ob er bald wieder unbeschwert atmen und lachen konnte. Vorsichtig begann sie, die Stelle abzutasten. Wenn die Verletzung mehr als nur ein großer blauer Fleck war, musste sie sehr vorsichtig sein. Sie hoffte sehr, dass es harmloser war, als es aussah. Denn mehr als eine starke Prellung würde sie mit ihren Mitteln kaum behandeln können. Aber allein die Tatsache, dass Kalian durch die Wunde ohnmächtig geworden war, ließ nichts Gutes hoffnen.
Der Blick des Fremden, der auf ihr ruhte, machte ihre Nervosität nicht besser. Er war immer noch hier, während alle anderen einfach verschwunden waren. Sie hasste es, beobachtet zu werden, und zwar nicht nur bei der Arbeit. Zoran und Fayre hatten ihren Streit in den Kommunikationsraum verlegt, und Robin hatte irgendetwas von einer Taschenlampe gemurmelt, die er suchte, und war ebenfalls verschwunden. Der Fremde hingegen hatte sich einen Stuhl genommen und sich an das Ende der Liege gesetzt, auf der Kalian lag. Schweigend verfolgte er Taléas Arbeit.
Du kennst ihn nicht, flüsterte es in ihrem Kopf. Sei achtsam.
Taléa atmete tief durch.
Draußen donnerte es. In unregelmäßigen Abständen war ein beängstigendes Krachen und Rumpeln zu hören. Das meditative Rauschen des Regens klang wie eine Untermalung zu einem wunderschönen und doch furchteinflößenden Konzert. Taléa war mehr als froh, dass sie ein Dach über dem Kopf und jeder ein eigenes Bett hatte. Es war keine Selbstverständlichkeit, im Trockenen und Warmen zu sitzen, nicht für Leute wie sie.
Langsam zog sie ihre Hand von Kalians Oberkörper zurück. Nichts deutete auf einen komplizierten Bruch hin. Erleichtert atmete sie aus.
Sie bemerkte, wie der Fremde es ihr nachtat. Aber sie wagte es nicht, zu ihm aufzuschauen. Es war schlimm genug, dass er sie die ganze Zeit so aufmerksam beobachtete. Das peinliche Schweigen zwischen ihnen brachte Taléa in Verlegenheit. Wohlwissend, dass Gespräche mit Fremden nicht zu ihren Stärken zählten, versuchte sie, die Stille zu brechen.
»Mit was ist er getroffen worden?« Ja, das klappte. Professionell klingende Fragen, damit das Gespräch nicht gleich zu privat anfing. Bemüht, möglichst ernst zu wirken, nahm sie, ohne ihn wirklich zu beachten, eines der großen Kühlpflaster und eine Tube aus dem Medi-Koffer und salbte kurz darauf vorsichtig die blaue Stelle ein.
Der Fremde sah sie kurz überrascht an, als hätte er nicht erwartet, angesprochen zu werden. »Keine Ahnung. Ich war damit beschäftigt, mich zu verteidigen, und hab nicht darauf geachtet. Wie gesagt, es schien ihm ja gut zu gehen.«
Taléa hatte ein Gespür dafür, wenn man ihr etwas verschwieg. Sie wusste nur nicht, was. Sie hätte gern nachgefragt, schließlich ging es um das Leben ihres Freundes, aber sie und der Fremde waren allein. Was, wenn er auf ihre Frage aggressiv reagieren würde? Insgeheim hoffte sie einfach, dass es für sie nicht relevant war, und ignorierte es. Vorerst.
Mit einer Hand versuchte sie, das Pflaster aus der Tüte zu ziehen. »Wie habt Ihr hierher gefunden?«
Der Junge nahm ihr das Pflaster aus der Hand und riss die Verpackung auf. »Bevor er bewusstlos wurde, hat er gesagt, er hätte Freunde im Verlassenen Viertel. Und in seiner Jacke hatte er eine Schlüsselkarte. In diesem Viertel gibt es nicht viele Häuser, die bewohnt sind, und nur ein einziges, das eine verschließbare Tür hat.« Er reichte ihr das entpackte Pflaster.
Da ist er ja gut informiert. Taléa klebte es vorsichtig auf, während der Junge begann, sich interessiert im Raum umzusehen. Offenbar war er auch kein großer Redner. Gut so. Taléa wollte es vermeiden, dass er sie ausfragte. Zoran und vor allem Fayre mochten es nicht, wenn man sich verplapperte und irgendwelche Informationen preisgab, so klein sie auch sein mochten. Alles war gefährlich.
Dabei sollte sie ihm eigentlich dankbar sein. Immerhin hatte der Fremde Kalian zurückgebracht. Wieso sollte er also schlechte Absichten haben? Sie fragte sich, ob ein bisschen Smalltalk wirklich schaden konnte. Schließlich war sie nicht so dumm, leichtfertig Informationen preiszugeben.
Andererseits wirkte Kalians Helfer gerade nicht sehr interessiert an einem Gespräch. Mit nüchternem Blick betrachtete er die Wände mit den zugemauerten Fenstern und den behelfsmäßig angebrachten Lampen. Taléa wandte sich wieder Kalian zu. Sie seufzte leise. Ach, Kalian. Du kannst reden, ohne dass es peinlich wird. Kannst du mir das beibringen?
»Taléa?« Zoran erschien am Eingang zur Halle. »Wie geht’s ihm?«
»Gut«, antwortete Taléa automatisch, erleichtert, nicht mehr mit dem Fremden allein zu sein. »Relativ gut. Dass er ohnmächtig ist, deutet auf eine innere Verletzung hin, die bluten könnte. Aber ich gebe ihm eines dieser modernen Mittel gegen innere Blutungen und bestrahle die Stelle ein wenig. Er wird wieder gesund. Er hat nichts sehr Ernstes.«
Er hat nichts sehr Ernstes. Sie hörte sich an, als wollte sie sich selbst beruhigen. Was zum Teil auch stimmte. Eine innere Blutung könnte sich sehr wohl zu etwas sehr Ernstem entwickeln. Und diese neuen Methoden, innere Verletzungen von außen zu behandeln, waren nach allem, was sie gehört hatte, nicht sehr effektiv. Aber sie hatte nicht die Mittel für eine bessere Behandlung. Sie hatte das Gefühl, dass man ihr die Lüge an der Nasenspitze ablesen konnte. Schnell wandte sie sich von Zoran ab. Doch er kam näher und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Hoffentlich geht’s ihm bald wieder besser.«
»Wird es.«
»Ja.« Zoran drückte ihr einen Kuss auf die Haare. »Du bist die Beste.«
Es war ein rein brüderlicher Kuss, und Taléa spürte die Dankbarkeit hinter der Geste. Sie verstand Zoran. Er war so etwas wie der Anführer ihrer kleinen Gruppe. Er fühlte sich zutiefst verantwortlich für jeder Person in diesem Haus. Kalians Zustand beschäftigte ihn mehr, als er zugab. Sofort hatte Taléa ein schlechtes Gewissen, weil sie Kalians Verletzung so verharmlost hatte. Sie hätte ehrlich zu ihm sein sollen. Andererseits wollte sie Zoran aber auch nicht noch mehr Sorgen bereiten.
Bedrückt fragte sie sich, wo Fayre wohl war. Ob sie noch zu ihnen stoßen würde? Wahrscheinlich hatte sie sich nach ihrer Auseinandersetzung mit Zoran in ihr Quartier zurückgezogen. Taléa wusste, dass auch Fayre nur das Beste für die Gruppe wollte. Aber ihre und Zorans Vorstellungen von »dem Besten« unterschieden sich ein wenig, und so kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen.
Taléa kannte Fayre gut. Sie wollte nicht die Anführerin spielen. Sie war lediglich viel misstrauischer und vielleicht auch praktisch etwas erfahrener als Zoran. Und vielleicht war das auch gut so. Fayre bereicherte die Gruppe auf eine ganz eigene Weise. In gewisser Weise war sie Zorans Vize, und sollte ihm jemals etwas zustoßen, würde sie das Kommando übernehmen. Im Laufe der Jahre hatte sich zwischen ihnen eine Hackordnung entwickelt, die zwar nirgendwo geschrieben stand, aber jedem in der Gruppe deutlich bewusst war. Auch Fayre. Und sie mochte ihren Platz darin am wenigsten. Weder wollte sie an der Spitze stehen, noch eine Art »Ersatz« für Zoran sein. Dafür hing sie viel zu sehr an ihm.
Zoran sah Kalian noch einen Moment an, bevor er aufstand und sich vorsichtig, aber bestimmt vor dem Fremden aufbaute. Dieser erhob sich ebenfalls von seinem Stuhl. Zoran war etwas größer, wirkte seinem Gegenüber aber in keiner Weise überlegen. Im Gegensatz zu ihm strahlte der Fremde eine undurchdringliche Ruhe aus, gepaart mit einer Prise gesunder Wachsamkeit und der ständigen Bereitschaft eines Soldaten.
»Danke.« Zoran sagte das ganz neutral, und doch spürte Taléa die Unruhe in ihm. Ob sie von der Anwesenheit des Fremden herrührte oder von Kalians Zustand, konnte sie nicht sagen. »Dafür, dass Ihr unseren Freund verteidigt und nach Hause gebracht habt. Kalian kann manchmal sehr anstrengend und tollpatschig sein. Eigentlich kann er sich ganz gut verteidigen…«
»Das waren etwa fünfundzwanzig Gardisten«, nahm der Junge Zoran seine verborgene Entschuldigung ab. »Da kann man noch so gut sein. Die schüttelt man nicht so leicht ab.« Er betrachtete Kalian. »Und ohne bleibende Wunden ist man kein fairer Kämpfer.«
Taléa runzelte die Stirn. Irgendetwas an dem Jungen machte sie nervös. Denn, oh doch, er hätte Kalian einfach so zurücklassen können. Aber er hatte sich dagegen entschieden. Und außerdem…wie hatte er fünfundzwanzig Gardisten besiegt?
Zoran nickte leicht demütig. »Ihr seid willkommen zu bleiben.«
Der Junge zögerte. »Eigentlich lehne ich solche Angebote immer ab. Allein schon, weil es nur Höflichkeitsfloskeln sind. Niemand hat gern einen Fremden im Haus. Aber ich habe Fragen... und befinde mich gerade in einer ungünstigen Situation.« Verlegen legte er eine Hand in den Nacken und unterbrach den Blickkontakt mit Zoran. »Es kommt nicht oft vor, dass man einen ganzen Trupp Gardisten auf sich hetzt...«
Zoran hob eine Augenbraue, während der Blick des Fremden an Kalian hängen blieb. Taléa wusste, dass er recht hatte. Zoran gefiel es genauso wenig wie ihr, ihn im Haus zu haben. Ohne Kalians Aussage konnten sie schließlich nicht einmal sicher sein, ob seine Geschichte stimmte, oder ob er nicht etwas weggelassen oder dazu gedichtet hatte. Am Ende könnte er Kalian sogar selbst angegriffen haben. Was, wenn er nachts etwas stahl oder gar jemanden ermordete? Taléa ärgerte sich, dass sie ihn für harmlos gehalten hatte. Sie nahm sich vor, heute Nacht wach zu bleiben.
»Ihr habt Fragen? Fragt«, forderte Zoran nun mit entschlossener Miene.
Der Fremde seufzte und setzte sich mit einer abwehrenden Geste wieder. »Ich fürchte, Ihr könnt mir keine Antworten geben. Ihr wart schließlich nicht dabei. Ich werde warten müssen, bis Kalian aufwacht.« Bei diesen Worten verschränkte er die Arme und wandte den Blick ab. Ohne etwas dergleichen zu erwähnen, hatte er das Gespräch beendet und Zoran gleichzeitig alle Entscheidungen über seinen Verbleib abgenommen.





























