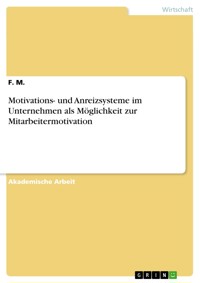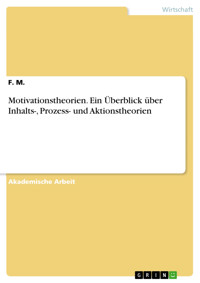
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Führung und Personal - Sonstiges, Note: 2, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die Entstehung von modernen motivationstheoretischen Ansätzen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis begann um 1930 als Gegenbewegung zum Taylorismus. Das mechanische Menschenbild des Taylorismus wurde seitdem zugunsten der Vorstellung des Menschens als „sozial motiviertes Gruppenwesen“ verdrängt. Bis heute gibt es keine universale, allgemein akzeptierte Motivationstheorie, die umfassend, exakt, empirisch belegt und abschließend erklären kann, wie menschliches Verhalten in Organisationen zielgerichtet beeinflusst und gesteuert werden kann. Nach vielen Forschungsbemühungen, insbesondere in den 1950er - 1970er Jahren, stellt sich der aktuelle Stand der Wissenschaft so dar, dass es heute eine ganze Reihe unterschiedlicher Arten von Motivationstheorien, verteilt auf verschiedene akademische Fächer, gibt. Dabei handelt es sich leider nicht um ganzheitliche, belegte, in sich völlig abgeschlossene Theorien, sondern nur um Erklärungsansätze, die je nach Forscher, Auslegung, Kulturkreis, Zeitgeist, etc., auf verschiedenen Annahmen basieren. Die bekanntesten Vertreter der motivationstheoretischen Ansätze lassen sich in den Wirtschaftswissenschaften im Wesentlichen in drei Klassen einteilen. Diese sind: - Die Inhaltstheorien. - Die Prozesstheorien. - Die Aktionstheorien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Einleitung
1 Inhaltstheorien
1.1 Murray
1.2 Bedürfnispyramide von Maslow
1.3 ERG Theorie von Alderfer
1.4 Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
1.5 Bedürfnisarten von McClelland
1.6 XY-Theorie von McGregor
1.7 Theory Z
1.8 Leistungsmotivationstheorie nach Atkinson
1.9 Zusammenführung
2 Prozesstheorien
2.1 VIE Theorie von Vroom
2.2 Weg-Ziel-Modell von House und Evans
2.3 Erwartungs-Wert-Modell von Porter und Lawler
2.4 Gerechtigkeitstheorie von Adams
2.5 Anreiz-Beitrags-Theorie von March und Simon
2.6 Zielsetzungstheorie von Locke
2.7 Zusammenführung
3 Aktionstheorien
3.1 Situation
3.2 Emotion
3.3 Intuition
3.4 Volition
3.5 Zusammenführung
Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Einleitung
Die Entstehung von modernen motivationstheoretischen Ansätzen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis begann um 1930 als Gegenbewegung zum Taylorismus. Das mechanische Menschenbild des Taylorismus wurde seitdem zugunsten der Vorstellung des Menschens als „sozial motiviertes Gruppenwesen“ verdrängt.[1]
Bis heute gibt es keine universale, allgemein akzeptierte Motivationstheorie, die umfassend, exakt, empirisch belegt und abschließend erklären kann, wie menschliches Verhalten in Organisationen zielgerichtet beeinflusst und gesteuert werden kann.
Nach vielen Forschungsbemühungen, insbesondere in den 1950er - 1970er Jahren, stellt sich der aktuelle Stand der Wissenschaft so dar, dass es heute eine ganze Reihe unterschiedlicher Arten von Motivationstheorien, verteilt auf verschiedene akademische Fächer, gibt. Dabei handelt es sich leider nicht um ganzheitliche, belegte, in sich völlig abgeschlossene Theorien, sondern nur um Erklärungsansätze, die je nach Forscher, Auslegung, Kulturkreis, Zeitgeist, etc., auf verschiedenen Annahmen basieren.[2]
Die bekanntesten Vertreter der motivationstheoretischen Ansätze lassen sich in den Wirtschaftswissenschaften im Wesentlichen in drei Klassen einteilen.
Diese sind:[3]
- Die Inhaltstheorien.
- Die Prozesstheorien.
- Die Aktionstheorien.
Abbildung 1: Die drei klassischen motivationstheoretischen Ansätze[4]
1 Inhaltstheorien
Die Inhaltstheorien beschäftigen sich mit der Frage nach der Art, Anzahl und Bedeutung der einem Verhalten zugrunde liegenden Motive,[5]mit den einzelnen Motiven in bestimmten Situationen[6]und Bedürfnissen, mit „zu bestimmenden Zielen, die auf die Motive gerichtet sind.“[7]
1.1 Murray
Henry A. Murray (1938)ist der Pionier der persönlichkeitspsychologischen Motivforschung, er betrachtete den Menschen als einen aktiven, handelnden Organismus, der in seine Umwelt eingebettet ist.[8]
Nach Murray richtet sich menschliches Verhalten nach situationsspezifischen Anreizen und Kräften, aber auch nach eigenen Impulsen. Um dieses Verhalten zu erklären, muss man sowohl die Situations- als auch die Personenseite berücksichtigen.[9] Er stellte auch klar heraus, dass der Organismus (Mensch) und dessen Milieu zusammen betrachtet werden muss, als eine einzelne Kreatur-Umwelt-Interaktion.[10]
Die Anreize und Kräfte, die von Seiten der Situation auf die Person einwirken, bezeichnete Murray als „Press". Sie können auf eine Person beispielsweise bedrohlich, verlockend oder ablenkend wirken.[11]
Die Bedürfnisse und Motive der Person selbst nannte Murray „Needs" und stellte sie in einer Liste zusammen.[12]„A need is a potentiality or readiness to respond in a certain way under certain given circumstances… It is a noun which stands for the fact that a certain trend is apt to recur.”[13]
Diese lassen ein Individuum eine Situation aktiv aufsuchen oder selbst erschaffen. Die Person selbst wird als aktiver Organismus aufgefasst, der nicht nur auf den Druck von Situationen reagiert.[14] Dabei muss ein Bedürfnis als ein Konstrukt angesehen werden, das Handeln, Denken und Wahrnehmen organisiert, um ein Individuum zu befriedigen.[15]
„Press“ und „Needs“, bzw. Umweltbedingungen und Personenmerkmale stehen in ständiger Interaktion.
Aus diesem Grund lassen sich nach Murray die beeinflussenden Faktoren in einer Situation definieren und so zur Erklärung von Verhaltensmustern heranziehen.[16]
Ein wichtiges Ergebnis seiner Forschungen ist sein Katalog universell nachweisbarer psychogener Bedürfnisse (Needs), welcher heute oftmals noch die Grundlage für motivationstheoretische Überlegungen darstellt:[17]
Tabelle 1: Bedürfnisse nach Murraw[18]
Murraw untersuchte noch weitere psychogene Bedürfnisse, stellte diese auch vorläufig auf, eine systematische Untersuchung und/oder Aufstellung erfolgte aber nicht:[19]
1.2 Bedürfnispyramide von Maslow
Diese Theorie, bekannt in der Darstellungsweise der Pyramide, ist die wohl populärste Erklärungsweise der Motivation. Sie wurde von Abraham Harold Maslow (1940er Jahren)[20] vorgestellt und fand seitdem weltweite Verbreitung.
Maslow postulierte eine Hierarchie der Bedürfnisse, bei der zuerst die niedrigeren befriedigt sein müssen, bevor die höherwertigen zum Zuge kommen.[21] Der Grundgedanke von ihm war, dass Menschen nicht nur von Bedürfnissen getrieben, sondern auch von allgemeinen Bedürfnisfolgen angetrieben werden.[22]
Maslow unterschied fünf Motivgruppen menschlicher Bedürfnisse. Diese stehen nicht nebeneinander, sondern sind hierarchisch geordnet.[23] Die ersten vier werden als Defizit- oder als Mangelbedürfnisse (Basic/Deficiency Needs) bezeichnet.[24]
Für den Menschen steht zunächst die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisstufe im Vordergrund, ist diese gesättigt, wird die nächste aktuell.[25] Nur ein nicht vollständig befriedigtes Bedürfnis wirkt motivierend und gibt den Anstoß zu einer bestimmten Handlung oder Verhalten, wodurch die Befriedigung des Bedürfnisses herbeigeführt werden soll.[26]
Nach Maslows Grundtheorie entwickelt der Mensch ein höherrangiges Bedürfnis, wenn die Bedürfnisse einer darunterliegenden Hierarchieebene befriedigt sind. Gelingt die Befriedigung eines wichtigen Bedürfnisses, verliert dieses bis auf weiteres (vorläufig) seine motivierende Wirkung.[27] Längerfristige Frustuation, das Nicht-Befriedigen kann dauerhaft zu psychologischen Störungen führen.
Die Selbstverwirklichungsbedürfnisse auf der fünften Stufe, die Wachstumsmotive (Groth Needs/Self-Actualisation), können allerdings nie endgültig erfüllt werden, da diesen keine formbaren Grenzen gesetzt sind.[28]
Sie versprechen ein glückliches inneres Wesen.„The self-actualized person had a harmonious personality and his perceptions were less distorted by desires, anxieties, fears, hopes, false, optimism, or pessimism.“[29]