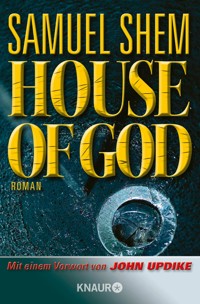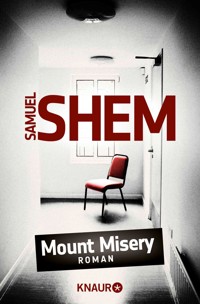
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der engagierte Roy Basch beendet seine Ausbildung in der renommierten psychiatrischen Klinik Mount Misery. Schnell gerät er in die Mühlen skrupelloser Ärzte, die die Patienten als Versuchsobjekte für ihre Experimente missbrauchen. Und bald werden ihm die Gesetze der Klinik klar: die Irren sind immer die anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 962
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Samuel Shem
Mount Misery
Aus dem Amerikanischen von Rudolf Hermstein und Christian Spiel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dr. Roy Basch darf seine Ausbildung in der renommierten Psychiatrie Mount Misery vollenden. Doch was er dort erlebt, lässt ihn mehr als einmal an seinem Beruf und seiner Berufung zweifeln …
Inhaltsübersicht
Widmung
EMERSON
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
TOSHIBA
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
THOREAU
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Die Heidelbergs
Heidelberg-West
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Heidelberg-Ost
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Canyon de Chelly
Zweiundzwanzigstes Kapitel
GESETZE VON MOUNT MISERY
Gesetze von Mount Misery
Glossar
Für Janet, Katie und Rose
Dank an Judith Abbot, Joy Harris, Les Havens und Ben Heineman
EMERSON
Angst und Schrecken
wirken durch das Medium des Geistes
gewaltig auf den Körper ein
und sollten dazu genutzt werden,
den Wahnsinn zu heilen.
Benjamin Rush M.D.,der »Vater der amerikanischen Psychiatrie«, 1818
Erstes Kapitel
Ein WASP, ein White Anglo-Saxon Protestant aus besseren Kreisen und gediegenen materiellen Verhältnissen, das hatte ich in meinem ersten Monat als Seelenklempner gelernt, ist notorisch schwer einzuschätzen. Seine Körpersprache grenzt ans Ausdruckslose, und seine Sprache selbst ist alles andere als geradeheraus, ganz ähnlich wie bei den Meistern der Unaufrichtigkeit, den Engländern, die – das hatte ich in meinen drei Jahren in Oxford mitbekommen – »nein« meinen, wenn sie »ja, schon« sagen, und wenn sie »eigentlich nicht« sagen, weiß Gott was damit meinen.
Cherokee Putnam blieb mir ein Rätsel, so sehr ich mich auch bemühte, wie auch immer ich bei meiner Befragung ansetzen mochte, aus verschiedenen Winkeln, wie mein Vater, der Zahnarzt, bei einem störrischen Zahn. Es war halb sieben Uhr morgens. Ich war sterbensmüde, nachdem ich die ganze Nacht in der Klinik Dienst geschoben hatte. Putnam war ohne vorherigen Anruf in der Aufnahme erschienen und hatte den diensthabenden Arzt verlangt – mich. Er erklärte, er sei sich keineswegs sicher, ob er hier richtig sei, aber er habe nicht schlafen können und müsse mit irgend jemandem unter vier Augen über eine »heikle Angelegenheit« sprechen. So etwas wie Gefühl hatte ich bei ihm noch am ehesten registriert, als er berichtete, er habe vor kurzem bei einem Abendessen in seinem Haus aus Wut auf seine Frau Lily etwas Unerhörtes getan: seine Leinenserviette zusammengeknüllt und neben seinem Teller auf den Tisch geworfen.
Als ich nachbohrte, bestritt er, depressiv zu sein. Er bestritt, jemals einen Selbstmordversuch unternommen zu haben; suizidale Gesten, Suizidgedanken und Anzeichen von Geistesgestörtheit waren nicht zu bemerken. Er wirkte genau wie der Typ Mann, auf den das Wort »normal« perfekt zutraf.
Er war in meinem Alter – zweiunddreißig –, mir in Größe und Körperbau ähnlich und nicht mehr ganz schlank. Doch im Gegensatz zu mir, einem glaubenslosen Juden, war er ein ratloser WASP, in sorgfältig gebügelter Khakihose und einem pinkfarbenen Hemd mit Button-down-Kragen, mit einer tollen, scharf geschnittenen Nase, einem reizenden Muttermal auf einer der jungenhaften Wangen und rötlichblondem Haar, in der Mitte gescheitelt und nach hinten gekämmt. Gebräunt und gutaussehend, erinnerte er an den jungen Robert Redford. Er war reich, Vater zweier kleiner Mädchen – Hope und Kissy –, und er gestand etwas betreten, daß er von Beruf Anwalt sei. Er habe bei Disney in Kalifornien gearbeitet und dabei ein kleines Vermögen gemacht. Vor anderthalb Jahren sei er nach Neuengland heimgekehrt.
»Bei Disney schuftet man sich zu Tode«, sagte er. »Die haben dort einen Spruch: ›Wenn du dich am Samstag nicht blicken läßt, brauchst du am Sonntag gar nicht erst aufzukreuzen.‹«
Auch seine Frau Lily stammte aus Neuengland. Er habe »ein bis zwei Millionen« für ein Hanggrundstück mit einem Gestüt in der hiesigen Gegend angelegt. Er und seine Frau seien Pferdenarren; sie stehe auf Springreiten, er selbst spiele Polo. Nachdem er ein Jahr pausiert habe, müsse er sich jetzt klarwerden, was er als nächstes mit seinem Leben anfangen wolle.
»Und das liegt Ihnen auf der Seele?« fragte ich.
»Nein, nein, ganz und gar nicht«, sagte er, »aber manchmal wache ich um drei Uhr morgens auf und vergleiche mich mit anderen, mit erfolgreichen Leuten. Ich drehe mich zu meiner Frau um und sage zu ihr: ›Ich bin ein Versager.‹ Das hat sie früher sofort aus dem Schlaf geholt, aber inzwischen ist sie so daran gewöhnt, daß sie kaum noch aufwacht und nur murmelt: ›Nimm ein Halcyon und schlaf weiter.‹ Sie hat es zu oft gehört.«
»Also haben Sie Eheprobleme?«
»Nein, nein«, antwortete er. »Eigentlich ist alles in Ordnung. Die üblichen kleinen Differenzen, meistens weil sie so einen Ordnungsfimmel hat, und ich – na ja, sehen Sie, wie ordentlich ich wirke?«
»Sehr, doch, ja.«
»Nicht wahr? Aber zu Hause bin ich ziemlich schlampig. Nichts Dramatisches, bloß Socken auf dem Boden und nichts ordentlich aufgehängt. Sie ist sehr ordentlich. Letzte Woche hatten wir Zoff, als die Haushaltshilfe frei hatte – ich hab den Geschirrspüler ausgeräumt und das Besteck einfach so in die Schublade geworfen. Lily stapelt die Löffel! Erst neulich hab ich zu ihr gesagt: ›Sei so nett und laß mich leben wie ein Schwein.‹« Ich lachte. Er lächelte schwach. »Lily ist eine hinreißende Frau. Wenn sie jetzt hier wäre, könnten Sie die Augen nicht von ihr lassen. Sie hat den ganzen Debütantinnenzirkus absolviert, mit allen Schikanen. Sogar nach zwei Geburten hat sie noch eine Superfigur. Wirklich unglaublich. Sie sollten sie mal im Sattel sehen.«
»Muß toll sein«, sagte ich – ein Gähnen unterdrückend, während ich dachte: Jetzt hab ich genug von dem Scheiß; wie krieg ich den Kerl bloß wieder los, damit ich wenigstens noch ein bißchen schlafen kann? –, »wenn Sie frühmorgens aufwachen und mit Ihrer Frau reiten gehen.«
»Frühmorgens ist sie nie da.«
»Warum nicht?«
»Lily macht eine Psychoanalyse. Übrigens – ihr Analytiker ist einer von den Ärzten hier. Deswegen bin ich ja gekommen. Ein Dr. Dove. Kennen Sie ihn?«
»Ja.«
»Sie geht jeden Morgen um sechs zu ihm.« Er warf einen Blick auf seine Uhr, eine von diesen Seemannsuhren mit neunzehn Zifferblättern. »Jetzt, in diesem Augenblick, ist sie bei ihm.« Sein Blick begegnete meinem und irrte dann ab, wie bei einem Mann, der mit einer Frau anbändeln will. »Sehen Sie, ich komme mir schon richtig verrückt vor, weil ich so was denke, und als Anwalt werde ich bestreiten, jemals so etwas zu Ihnen gesagt zu haben, aber – nein – ich glaube – nein, es ist verrückt.«
»Fahren Sie fort.«
»Ich glaube – ich glaube, meine Frau hat was mit diesem Dr. Dove.«
Die Vorstellung war abwegig. Apropos Schweine: Schlomo Dove war einer der unattraktivsten, ja, abstoßendsten Männer, denen ich jemals begegnet war. Er war um die Fünfzig, klein, vielleicht einsfünfundsechzig, ein korpulenter Jude mit dichtem kastanienbraunem Lockenhaar, das ihm wie ein Helm in die Stirn ragte, winzigen Schlitzaugen, Zähnen, die noch immer auf Spangen hofften, und einer unfroh wirkenden Nase. Es schien ihm Spaß zu machen, seine unappetitliche Erscheinung vorzuführen. Er trug verknitterte Anzüge und fleckige Krawatten, die ihm schlaff um den Hals hingen wie gebraucht gekaufte Henkerstricke. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen war Schlomo Dove – auf die kontraphobische Art, in der manche Leute, die an Höhenangst leiden, Brückenmaler werden – ein Selbstdarsteller. Der schmierige Zwerg war einem ständig vor Augen, kam immerzu angetanzt, als wäre er der Größte, in Seminaren oder Supervisionssitzungen, hob sich immer auf die Tippelzehen wie eine angesäuselte Ballerina, um mit der Stimme und Gestik eines Borscht-Belt-Komikers irgendwelchen freudianischen Stuß zu präsentieren. Dabei war er im höchsten Grade selbstironisch. Schlomo Dove hatte eine große Privatpraxis und gehörte außerdem zu einer kleinen Gruppe von Psychiatern, die man konsultierte, wenn man an den richtigen Therapeuten vermittelt werden wollte. Er war ein hochangesehener Analytiker, der Häuptling der freudianischen Clique an dem Institut unten in der Stadt und Direktor der Misery-Tagesklinik am sumpfigen, verschilften Ende des wurstförmigen Sees, der das Gelände der Klinik ungefähr in zwei Hälften teilte.
Hochangesehen, ja, anziehend, nein. Wie konnte irgendeine Frau, zumal eine hinreißende WASP-Prinzessin, auf Schlomo Dove abfahren?
So ging mir, als ich Cherokee Putnam ansah, der Gedanke durch den Kopf: Also doch ein Sprung in der Schüssel. Dennoch, eines hatte ich in meinem Leben gelernt beziehungsweise im vergangenen Jahr, in dem ich als junger Arzt um die Welt gereist war: So wie es trotz allem, was ein Mensch auf die Beine stellt, immer einen anderen gibt, der noch mehr erreicht hat, kann jemand gar nicht so tief sinken, daß nicht ein anderer an ihm vorbei noch tiefer, ja, ins Bodenlose stürzt. Ich bemerkte nur: »Was Sie nicht sagen!«
»Ja, sie ist jetzt seit mehr als einem Jahr bei ihm in Therapie. Wir sind in den Osten zurückgekommen, das war unser Traum. Uns zusammen eine schöne Zeit zu machen, für die Kinder dazusein, nach dem verlogenen Hollywood. Alles lief ganz nach Wunsch. Aber dann fühlt sie sich ein bißchen down, wissen Sie, und geht zu ihm, um eine Therapie zu machen.« Er seufzte. »Sie besucht ihn jeden Tag in der Woche, manchmal auch samstags und gelegentlich sogar am Sonntag. Unser Sexleben ist vertrocknet. Dabei sieht sie mit jedem Tag schärfer aus. Das finde nicht nur ich, das sagen auch meine Freunde. Kauft sich Reizwäsche. In allen möglichen Farben, mit Spitze, Sie verstehen.« Ich nickte. Höchst angenehme Vorstellungen von meiner Freundin Berry blitzten auf, und ich dankte Gott dafür, daß man als Seelenklempner wenigstens ein paar scharfe Sexgeschichten zu hören bekommt. »Dabei ist das gar nicht ihre Art. Nicht, seit die Kinder da sind. Inzwischen trägt sie das Haar kurzgeschnitten, wie ein Junge. Wirklich seltsam. Ihre langen Haare waren ihr ganzer Stolz. Es sieht ihr überhaupt nicht ähnlich.«
»Haben Sie sie mal darauf angesprochen?«
»Ich hab keine handfesten Beweise. Ich frage sie schon, was in der Therapie vor sich geht, aber sie sagt nur, Dr. Dove sagt, das sei vertraulich.«
»Aber es macht Sie verrückt. Sie könnten geradezu …«
»Sie halten mich für verrückt?«
Eine Spur Verrücktheit war an der Sache, wenn man bedachte, was für ein Mensch Schlomo Dove in Wirklichkeit war, aber eben nur eine Spur. »Nein, nein, Sie sind nicht verrückt.«
»Gott sei Dank. Sie glauben, daß er – Sie wissen schon – daß er sie in der Therapie bumst?«
»Ich glaube, daß Sie das glauben.«
»Nicht hundertprozentig, um genau zu sein. Aber Sie sagen, ich bin nicht verrückt?«
»Mißtrauisch, ja, verrückt, nein.«
»Nicht mal – ich weiß nicht – ein bißchen paranoid?«
»Haben Sie Dr. Dove schon mal gesehen?«
»Nein, warum fragen Sie?«
»Schauen Sie«, sagte ich. »Sie kennen die Wahrheit nicht. Sie haben nichts in der Hand.«
»Aber es macht mich wahnsinnig. Muß ich mich stationär aufnehmen lassen?«
»Nein.«
»Ich kann also herkommen und mit Ihnen sprechen?«
»Um eine Therapie anzufangen?«
Er verzog das Gesicht, als hätte ich ihm eine Wurzelbehandlung vorgeschlagen. »Ich wollte, Sie würden es nicht so nennen. Mein Vater hält nichts von Psychiatrie, keiner aus meiner Familie hält was davon. ›Kopf hoch‹, sagen sie immer, wenn es Schwierigkeiten gibt. ›Kopf hoch und den Anwalt anrufen.‹ Psychotherapie, das ist was für – für die andern.«
»Bringt zuviel durcheinander, was?«
Er blinzelte, als würde er von grellem Licht geblendet, und antwortete seufzend: »Sie haben mich durchschaut. Scheiße.«
»Ich würde Sie nehmen.«
Er schwieg. Ich spürte, wie ihm mein Vorschlag zusetzte. Dann lockerte er seine Krawatte und sagte mit zusammengebissenen Zähnen: »Zum Teufel mit denen. Ja, machen wir was aus.«
Wir vereinbarten einen Termin für die folgende Woche. Er stand auf, zerquetschte mir die Hand und ging so anmutig hinaus wie, nun ja, wie ein Pferd. Ich fand ihn sympathisch, er tat mir leid, und wenn es mir gelang, ihn zu einer Therapie zu bewegen, würde ich ihm sicher helfen können. Schlomo Dove? Ich überlegte: Sollte ich ihm davon erzählen? Lieber erst mit Ike White sprechen, meinem Supervisor.
Mein Nachtdienst war zu Ende. Ich ging hinüber zur Verwaltung im Farben-Gebäude, gab meinen Piepser ab und spazierte an der großen Treppe mit dem Rosenholzgeländer vorbei, das sich rechts und links nach oben zog. Auf dem Absatz umrahmten zwei antike chinesische Vasen, gefüllt mit Seidenblumen, eine Landschaft mit Feldern, Kühen und einem einsamen Baum. Meine Füße versanken in dem Teppich, als hätte ich Pantoffeln an. Als ich die Eingangstür öffnete und aus der gekühlten Luft hinaus in die Realität trat, traf mich die feuchte Hitze wie die feiste Hand des türkischen Masseurs, der mich in einem Dampfbad in Istanbul malträtiert hatte. In den rotgrauen Morgen blinzelnd, stand ich auf den Eingangsstufen, auf der Kuppe eines hohen Hügels, der die Stadt überragte. Die Füße auf Granit, den Kopf zwischen hochstrebenden Säulen, kam ich mir vor, als stünde ich unter dem Portal einer Bank.
Mount Misery, so hießen dieser Hügel und die darauf errichtete Klinik. Der Hügel war Anfang des 18. Jahrhunderts von abgehärteten puritanischen Bauern auf diesen Namen getauft worden, im Hinblick auf die rauhen Nordostwinde, die hier manchmal vier Tage hintereinander über die Felsen fegten. Die Klinik war später, 1812, von einer Gruppe Yankees mit Gemeinsinn gegründet worden. Sie hatten in der Stadt ein Krankenhaus für körperliche Leiden errichtet und später beschlossen, weit draußen auf dem Land ein Gegenstück für seelische Leiden zu bauen, im Schatten der Berge. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es viele dieser architektonisch eleganten, rustikalen Anstalten, von denen einige noch heute existieren: Austin Riggs, McLean, Brattleboro Retreat, Shepard Pratt und Chestnut Lodge. Das Leitprinzip beim Bau solcher Heime hieß Verleugnung: Aus den Augen, aus dem Sinn. Misery war vor dem Ausufern der Vororte durch seine natürlichen Begrenzungen geschützt worden, den hohen Hügel, mehrere bedrohlich wirkende Schluchten und den Sumpf am Ende des Sees. Die Klinikgebäude, rund ein Dutzend an der Zahl, waren umgeben von mehr als dreißig Hektar Feldern, Waldungen und Bächen, alles von einem hohen Zaun mit Eisenspitzen eingehegt.
Mount Misery war schon bald ein Lehrkrankenhaus geworden, angeschlossen an die BMS, wie der Spitzname lautete, die »Best Medical School«. Zeit seines Bestehens hatte es zu den führenden Kliniken mit den neuesten Behandlungsmethoden für psychische Leiden gehört. Diese bestanden anfangs in der Verwendung von Fesseln, in Einläufen, Aderlässen und der Unterweisung in schicklichen Tischmanieren. Mittlerweile bot Misery sämtliche psychiatrischen Behandlungsmethoden des ausgehenden 20. Jahrhunderts an. Ihrer Tradition nach war die Klinik eine Heilstätte für die psychisch labilen Wohlhabenden – einst war es sogar schick gewesen, wenn man sich rühmen konnte, »einen Sohn auf der Harvard University, einen Vater auf dem Mount Auburn Cemetery und einen verrückten Vetter in Misery« zu haben. Inzwischen zog Mount Misery nicht nur die Reichen, sondern auch die Privatversicherten an. (Jeder der neuen Psychiatrie-Residents verbrachte einen Teil seiner Ausbildungszeit am Candlewood Hospital, dem staatlichen Krankenhaus drunten in der Ebene, jenseits des Sumpfes.) In Misery waren Künstler, Lyriker, Folksänger, Schriftsteller und immer wieder sensible junge Männer und Frauen, die von den anspruchsvollen, prestigeträchtigen Colleges kaputtgemacht worden waren. Kreative, interessante Leute, die, wie es hieß, »tolle Fälle« abgaben. Das inoffizielle Motto der Klinik lautete: »In Misery wartet die psychische Gesundung.«
Es war kurz vor Ende Juli. Schon so früh am Tag war es feuchtheiß, die Kühle der Morgendämmerung, die unter dem Schirm der Nacht in immer kleineren Tröpfchen hervordrang, sich erhitzte und verdampfte, restlos verschwunden. Im Norden hielten die Berge ihre Gipfel in kühlende Wolken. Vor mir, die Straße säumend und zu lauschigen Wäldchen versammelt, standen Eichen, Ahornbäume und Katalpen mit ihren lilienähnlichen Blüten. Rechts von mir lag das aus rotem Ziegelstein im Kolonialstil erbaute Toshiba, die Aufnahmestation, mit dem fensterlosen Forschungsflügel, der dicht über dem Erdboden vom Hauptgebäude abstand wie eine Fußprothese aus Edelstahl. Oberhalb einer Schlucht auf dem Hügel links von mir lugten aus einer Lichtung in einem Kiefernwäldchen wie zwei Augen aus einem Versteck in einem gruseligen Märchen die spitzen Türme der beiden »Heidelbergs« – den Brückentürmen nachgebaut, die den Zugang zur Heidelberger Altstadt flankieren. Heidelberg-West war das Misery-Zentrum für Psychopharmakologie, die medikamentöse Behandlung psychischer Leiden. Heidelberg-Ost beherbergte die Suchtstation. Ein Bach strudelte in der Schlucht talwärts und ergoß sich in den wurstförmigen See, und sein Wasser verwandelte sich in Schlamm, dort, wo zwischen Rohrkolben, Mandelblumen und vereinzelten Weiden das geduckte, efeuumsponnene Gebäude stand, in dem Schlomo Dove seine Tagesklinik hatte. Weiter den Hügel hinunter erhob sich jenseits des breiten, abgemähten achten Fairways der einst imposanten Golfanlage »Misery Links« der klassizistische Bau von Thoreau, der freudianischen Familienabteilung. Das blasenförmige Oberlicht starrte wie ein Zyklopenauge an mir vorbei und hinauf zu den beiden selbstbewußten, der Pharmakologie geweihten Heidelbergs mit ihren hohen Turmspitzen. Weitab zur Linken, hinter dem See und im tiefen Wald dem Blick entzogen, lag Emerson, wo ich derzeit stationiert war. Hier befanden sich, auf drei Stockwerke verteilt, die Abteilungen für Depressionen, Borderline-Störungen und Psychosen. Hie und da breitete auf dem üppigen Grün der Rasenflächen eine riesige Blutbuche ihre Äste wie einen paillettenbesetzten Reifrock aus.
Ich zog das Jackett aus, bog nach links ab, wanderte auf der schmalen, kurvigen, an- und absteigenden Straße dahin, die sich den See entlangzog, und überquerte auf einer kleinen Steinbrücke den Bach. Die efeuumrankten Gebäude erinnerten an einen College-Campus. Friedlich spazierten Leute umher, die Studenten hätten sein können, und keiner von ihnen wirkte wie ein Patient. Ich mußte erst noch lernen, die Patienten vom Klinikpersonal zu unterscheiden.
Ich war einer der fünf neuen Residents, die in einem dreijährigen Training zu Psychiatern ausgebildet werden sollten. Dieses Jahr, unser erstes, war streng reglementiert. Etwa alle acht Wochen sollten wir von einer »Etappe« zur nächsten wechseln, nach einem per Computer erstellten Plan, den man uns an unserem ersten Tag in Misery ausgehändigt hatte. Durch diese turnusmäßigen Wechsel sollte uns beigebracht werden, stationäre Patienten zu behandeln, diese armen Seelen, die in den verschiedenen Stationen eingesperrt waren. Jeder Wechsel brachte uns mit Patienten zusammen, denen allen dieselbe Diagnose gestellt worden war, und jede dieser Gruppen war in einem anderen Gebäude untergebracht – die Depressiven im Erdgeschoß von Emerson, die Borderliner auf Emerson 2, die Drogenabhängigen in Heidelberg-Ost und so fort. Im ersten Jahr absolvierten alle Residents genau den gleichen Turnus, nur in unterschiedlicher Reihenfolge, und zogen alle paar Monate weiter, in einer Art psychiatrischer Reise nach Jerusalem mit einer genau für alle Teilnehmer ausreichenden Anzahl von Stühlen. Ich hatte den ersten Monat meiner Etappe in Emerson bereits hinter mir. Als nächstes sollte ich nach Toshiba wechseln, anschließend nach Thoreau und für den letzten Teil des Jahres nach Heidelberg-Ost und Heidelberg-West. Außerdem war jeder von uns für das erste Jahr einem anderen »Team für ambulante Patienten« zugeteilt. So konnten wir unsere ambulanten Patienten, also diejenigen, die nicht in die Klinik aufgenommen wurden, das ganze Jahr über therapeutisch betreuen. Und natürlich hatten wir Residents im ersten Jahr jede vierte Nacht Dienst als DOC, Doctor on Call, als einziger Arzt, der die ganze Nacht für die 350 stationären Patienten zur Verfügung stand.
Als ich das andere Ende des Sees umrundet und einen letzten Anstieg durch den Wald hinter mich gebracht hatte, erreichte ich Emerson, wo Ike White sein Sprechzimmer hatte. Die reich verzierte Haupttreppe war von hohen Geländern gesäumt, die verhindern sollten, daß Patienten in selbstmörderischer Absicht in die Tiefe sprangen. Das durch das Oberlicht einfallende Licht wurde durch Tausende von Lamellen gebrochen. Auf dem Absatz im ersten Stock hing ein Schild mit der Aufschrift: EMERSON 2. BORDERLINE-STATION. Daneben ein handgeschriebener Zettel: Achtung, Ausreißer.
Ich suchte aus den zwanzig Schlüsseln an meinem Ring den richtigen heraus und schloß die Tür auf. Während ich den Schlüssel aus dem Schloß zu ziehen versuchte, schoß jemand an mir vorbei und brüllte: »Freiheit!« Er flitzte die Treppe hinab und war im nächsten Augenblick verschwunden.
Als nächstes stürzten zwei kräftige Männer heraus und rasten hinter dem Mann her. Mit dem Gefühl, einen schrecklichen Fehler begangen zu haben, trat ich in den großen, gut eingerichteten Aufenthaltsraum.
»He, Sacknase!«
Ich drehte mich um, einen Augenblick, nachdem mir bewußt geworden war, daß es wirklich bescheuert ist, auf so eine Anrede zu reagieren. Ich sah mich einem Mann meines Alters mit rotblondem Haar und Babygesicht gegenüber, in Jeans mit Hosenträgern und einem weißen Hemd.
Er lächelte und sagte: »Die Sacknasen machen Fehler!«
In der Stationszentrale ging es drunter und drüber. Zwei Leute telefonierten gleichzeitig: Harrison, ein gefährlicher Paranoiker, sei wieder einmal abgehauen.
»Saubere Arbeit, Dr. Basch«, sagte die Stationssekretärin. »Da ist also unser ›Ausreißer‹ wieder mal ausgebrochen! Wenn der seine Frau in die Finger kriegt, ziehen uns die Anwälte das Fell über die Ohren.«
»Tut mir leid. Wann kommt Ike White?«
»Er ist schon an die zwei Stunden hier. Unten in seinem Sprechzimmer.«
»Wie, seit fünf Uhr morgens?« fragte ich. »Warum denn das?«
»Er hat gesagt, er hätte zu tun.«
Ich ging die Treppe hinunter zu Emerson 1, Depressionen, und klopfte an Ike Whites Sprechzimmertür.
»Her-r-rein«, sagte er mit dem ihm eigenen Stottern. Dr. Ike White, Leiter der Residents-Ausbildung, war ein kleiner, schmächtiger Vierziger, mit einem schmalen Gesicht und hellgrünen Augen mit auffällig langen, feinen Wimpern. Sein dunkles Haar war wie das eines kleinen Jungen geschnitten, samt einer hochstehenden Stirnlocke, die er um den Zeigefinger wickelte, wenn er nachdachte. Ike White gehörte zu den Menschen, die sich immer zu freuen scheinen, wenn sie einen sehen. Sein Stottern gab ihm etwas Verletzliches und Bescheidenes. Er war mein Mentor, der Anlaß, warum ich zur psychiatrischen Ausbildung nach Mount Misery gekommen war. Ich hatte ihn im Vorjahr bei einem Bewerbungsgespräch kennengelernt. Es war schwierig, nach Misery zu kommen – auf jede freie Stelle zehn Bewerber. Doch Ike White hatte nur einen einzigen Blick auf meine Papiere geworfen und gesagt: »Ein t-toller Lebenslauf.«
»Ja, auf Papier mache ich mich ganz gut.«
Er lächelte. »Wie können wir Sie ü-ü-berreden, zu uns zu kommen?«
»Sie wollen mich also haben?« fragte ich.
»Ja. Aber ich bin nicht d-dafür, Leute unter Druck zu set-setzen. Plaudern wir einfach ein b-bißchen.«
Ich war überrascht gewesen. Seit Jahren hatte ich mich vor Bewerbungsgesprächen an den besten Colleges und Universitäten dagegen gewappnet, aufs Kreuz gelegt zu werden, und war meinerseits zum Tricksen entschlossen gewesen. Ike White aber schien sich wirklich für mich zu interessieren, wollte etwas über mich hören – rein aus Neugier. Schon bald unterhielten wir uns wie alte Freunde. Und im Verlauf des Gesprächs kam ich aus dem Staunen nicht heraus, denn Ike White konnte zuhören. Jemand hörte mir zu, ging auf das ein, was ich sagte – ich fühlte mich plötzlich lebendiger. Wir führten eine gemütliche Unterhaltung, die viele Themen berührte, was an sich schon eine Überraschung war, denn die meisten anderen Ärzte, bei denen ich mich vorgestellt hatte, hatten es eilig gehabt. Für sie hatte das Ziel des Gesprächs im wesentlichen darin bestanden, es möglichst rasch hinter sich zu bringen. Als ich White Fragen nach ihm selbst und seiner Arbeit stellte, antwortete er klar und mit einer Bescheidenheit, die ihn ehrte. Seine Fachgebiete waren Depression und Selbstmord. Er behandelte Patienten, erforschte die Ursachen von Depressionen und war außerdem noch Analytiker der Freudschen Schule und Experte für den Einsatz von Psychopharmaka bei der Behandlung depressiver Patienten. Es machte ihm Freude, neue Residents zu unterrichten. Ike White war ein aufgehender Stern am BMS-Himmel.
»Gibt es auch was, worin Sie nicht so gut sind?« fragte ich.
Er lächelte und wies mit einer ausholenden Handbewegung auf die mit ungeordneten Büchern vollgestopften wandhohen Regale, die Stapel von Zeitschriften und Blättern mit Notizen auf dem Boden, die nur ein paar schmale Pfade zwischen Schreibtisch, Couch und Sessel frei ließen, und den Schreibtisch, der unter einem Wust von Papieren und Manuskriptstapeln verschwand. Er sagte: »Ich schaffe es einfach nicht, Ordnung in meinem Kram zu halten.«
Ich war mit der Absicht in das Gespräch gegangen, meine psychiatrische Lehrzeit im Rahmen des streng konkurrenzorientierten Ausbildungsprogramms an dem Krankenhaus in der Innenstadt zu absolvieren, das den Spitznamen MBH, »Man’s Best Hospital«, trug. Die Unterhaltung mit Ike White – vor dem Hintergrund Miserys mit all seiner Eleganz, wo nicht nur die Gebäude und das Gelände, sondern sogar die beiden Tennisplätze tadellos in Schuß waren – veranlaßte mich, meinen Entschluß umzustoßen.
»Okay«, sagte ich. »Sie haben mich überzeugt. Ich komme hierher, aber unter einer Bedingung.«
»Und die w-wäre?«
»Daß Sie mein Lehrer werden.«
Er lächelte schüchtern. »Aber mit dem g-größten Vergnügen.«
So war Ike White mein Lehrer Nr. 1 beziehungsweise mein Supervisor geworden. Psychiater wurde man in einer Art Lehrling-Meister-System – man war der Lehrling erfahrener Psychiater aus dem Kollegium der Klinik. Man sah ihnen zu, wie sie Patienten behandelten, und wurde supervidiert, wie man selbst Patienten behandelte. In der Regel erhielt man für jede Stunde, die man als Therapeut mit einem Patienten verbrachte, eine Stunde Supervision. Die Supervisionsstunde lief so ab, daß man dem Supervisor berichtete, was während der therapeutischen Sitzung abgelaufen war, entweder aus dem Gedächtnis oder, wie es manche Supervisoren verlangten, anhand von Notizen, die man sich dabei gemacht hatte. Wie die meisten Residents im ersten Jahr hatte ich keinerlei praktische psychotherapeutische Erfahrung mit Patienten. Ja, ich hatte als Student nicht einmal Psychiatrie als Studienfach belegt – sie gehörte nicht zum vorgeschriebenen Ausbildungsgang an der BMS, und ich, damals mehr auf den Körper als auf die Psyche konzentriert, war nie dazu gekommen. Im Unterschied zu den meisten anderen Residents im ersten Jahr hatte ich mich selbst nie einer Therapie unterzogen – ich hatte bis zu meiner Internship in einem Krankenhaus nie das Bedürfnis danach empfunden, und auch dann waren weder die Zeit noch das Geld dafür dagewesen. Der Wunsch, Psychiater zu werden, hatte sich in meinem Fall erst spät gemeldet. Er hatte mich gegen Ende meiner Internship gewissermaßen überrumpelt. Die meisten anderen Residents hatten sich bereits lange vorher entschlossen, Psychiater zu werden, spätestens am Ende ihres Medizinstudiums. So kam es, daß ich diesem ganzen Psychokram gegenüber viel ahnungsloser war als die vier anderen Residents und mich ständig bemühte, ihren Vorsprung aufzuholen.
Ike White hatte mir sehr geholfen. Meinen ersten Monat in Misery hatte ich bei ihm auf Emerson 1, Depressionen, verbracht. Und in dieser Zeit hatten mich nicht nur seine fachliche Brillanz und Integrität, sondern auch seine Bescheidenheit und schlichte Menschlichkeit tief beeindruckt. Ich hatte während seiner täglichen Visiten erlebt, wie gekonnt er den Patienten zuhörte und auf sie einging, und mich bemüht, ihm nachzueifern. In diesem ersten Monat mit ihm hatte Ike White alle meine Erwartungen erfüllt.
Jetzt begrüßte er mich mit einem Nicken. Er saß hinter seinem großen Schreibtisch, auf dem sich die Papiere bis zur Höhe seines Kopfes stapelten. Sein dunkler Anzug wirkte zu groß für ihn, so als hätte er abgenommen. Da es in seinem Sprechzimmer kalt war, zog ich mein Jackett wieder an. Ich erzählte ihm von dem Gespräch mit Cherokee Putnam und fragte ihn, wie ich mich verhalten solle.
»Erz-zählen Sie mir mehr von seiner W-wahnvorstellung.«
»Ist es das?« fragte ich. »Eine Wahnvorstellung?«
»Vorläufig j-jedenfalls.«
»Soll ich mit Schlomo Dove darüber sprechen?«
»Wie stellen Sie sich das vor …«
»Mit ihm darüber sprechen? Ich finde, ich sollte ihn darüber aufklären, daß …«
Das Telefon läutete zweimal, dann schaltete sich der Anrufbeantworter ein, und mit großer Lautstärke meldete sich eine kräftige, selbstbewußte Stimme.
»Dr. White, hier spricht Hilda von der Personalabteilung. Zu Ihrem Anruf heute morgen wegen Ihres Leistungspakets …«
Ike White sprang auf und stellte den Ton leiser. Dann setzte er sich wieder, schüchtern lächelnd. Seine Augen hatten einen seltsam verlegenen Ausdruck, der mich nervös machte. Um die Situation zu entschärfen, witzelte ich:
»Gratulation. Meine Damen und Herren, wir können eine Heilung verzeichnen. Hilda hat ihre Depressionen überwunden, und zwar vollkommen!«
Wir lachten. Ike White, der den ganzen Tag mit Fällen von Depression beschäftigt war, hatte eine »Anrufbeantworter-Strategie« entwickelt. Er stellte die Empfindlichkeit so niedrig ein, daß das Gerät abschaltete, wenn depressive Patienten anriefen und auf ihre leise, zögernde Art in den Hörer sprachen. Damit das nicht passierte, mußten sie lauter sprechen. So lernten sie im Laufe der Zeit, selbstsicherer zu werden, was ihrem Zustand zugute kam. (Ich wußte nicht, ob diese Hilda wirklich depressiv gewesen war, aber es wurde zu einem oft wiederholten Scherz zwischen uns.)
»Natürlich k-können Sie mit ihm r-r-reden«, sagte Ike White.
»Kennen Sie ihn gut? Ich meine, könnte an der Geschichte was dran sein?«
»Er war mein A-analytiker. Ich war sechs Jahre lang fünfmal in der Woche bei ihm. Ob ich ihn gut k-kenne? Nein. Aber jetzt zu Ihrem Patienten, Cherokee Putnam, ja?« Er blickte auf seine Hände. »Es hat w-was Unheimliches, wenn man mit kranken M-menschen zu tun hat. Irgendwann fragt man sich: ›Bin ich krank? Warum ist er der P-patient und ich der Arzt?‹« Er lächelte mich an. »Roy, die P-psychiatrie ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine K-kunst. Mehr als auf jedem anderen medizinischen Spezialgebiet lernt man durch die Zusammenarbeit mit anderen. Ü-übermorgen, am ersten August, gehe ich in Urlaub. Ich habe dafür gesorgt, daß ein ausgezeichneter Resident im dritten Jahr, Dr. Leonard Malik, Sie an meiner Stelle supervidiert, wenn Sie zur B-borderline-Station wechseln und …« Die Wechselsprechanlage summte: »Mary Megan Scorato.« Mary war eine Patientin aus unserer Depressionsstation. Ike White zuckte die Schultern. »Tut mir leid, die Sache ist dringend. Sie ist wieder akut selbstmordgefährdet. M-muß zu ihr. Kommen Sie heute abend zum S-seminar bei mir zu Hause?«
»Aber natürlich.«
»Gut. Dann heben wir uns den Abschied bis d-dahin auf.«
»Aber das kann doch nicht sein, oder? Daß jemand wie Schlomo Dove so etwas macht?«
»Unsere Patienten kommen mit Narben bedeckt hierher«, sagte er, »und sie gehen ohne Narben wieder fort.«
»Was bedeutet das?« fragte ich, überrascht, wie glatt ihm das über die Zunge gegangen war.
Doch der Summer meldete sich wieder, und meine Zeit war um.
Als ich mit dem Lunch fertig war und mein Plastiktablett zum Abfalleimer brachte, sah ich Schlomo Dove beim Essen. Den Kopf gesenkt, die Gabel hochgereckt, bot er keinen erfreulichen Anblick. Ich hatte keine Lust, ihn anzusprechen. Doch dann fiel mir ein, daß er, als Freudianer, zwei Tage später verschwinden und den ganzen August abwesend sein würde. Ich ging zu ihm hin. Rechts und links von ihm und auch gegenüber waren Stühle frei.
»Dr. Dove?«
Er hob den Kopf. Die Knopfaugen traten ein wenig zwischen den Lidschlitzen hervor, und er sagte: »Sagen Sie Schlomo zu mir, wie alle anderen auch. Ich selber eingeschlossen.« Er lachte. Ein Rinnsal roter Soße vom Spezial-Lunch des Hauses, »Sloppy Joe«, lief ihm aus dem Mundwinkel.
»Schlomo, kann ich …«
»Gut so. Schlomo mag es, wenn ihn aufgeweckte junge Psychiater mit Schlomo anreden.«
»Kann ich später zur Supervision zu Ihnen kommen?«
»Oi. Wie mich das freut! Schlomo Dove wird Sie um vier empfangen.«
Am Nachmittag trottete ich durch die feuchte Hitze den Hügel hinab, um den See herum, zu seinem sumpfigen Ende, und schlängelte mich durch die Moskitoschwärme und die übermannshohen Rohrkolben auf dem schlammigen Pfad, der an meinen Schuhen zog, zur Misery-Tagesklinik. Schlomo Doves Sprechzimmer war voll von stark duftenden Blumen – Narzissen und Jasmin – und Bananen in allen Stadien der Reife, manche noch grün, einige gelb, ein paar bereits schwarz. Mit einer riesigen gelben Plastikgießkanne in der Hand betreute Schlomo gerade seine Pflanzen. Er schenkte mir ein breites Lächeln, das ein Gebiß mit Lücken entblößte, Zeugen einer Kindheit, in der eine Zahnregulierung unerschwinglich gewesen war. Zwischen den Lippen steckte eine erloschene Zigarre. Er begrüßte mich mit einem herzlichen: »Hallo, Dr. Basch!«, drückte mich auf einen lederbezogenen Stuhl neben der freudianischen Ledercouch und sagte: »Nu?«
Schlomo war einer der Menschen, denen es mehr Freude macht, einen Besucher zu empfangen, als umgekehrt. Und ich wußte nicht, wie ich reagieren sollte. Wenn man ihn leibhaftig vor sich sah, schien es ausgeschlossen, daß Cherokee Putnams Verdacht begründet sein könnte. Ich war schon halb entschlossen, Schlomo nichts davon zu sagen. Doch er stand so erwartungsvoll da, anscheinend so bereit, mich anzuhören, und obendrein so fähig, zu verkraften, was immer ich ihm erzählen mochte, daß ich es riskierte und ihm berichtete, Cherokee Putnam habe den Verdacht, er, Schlomo Dove, habe etwas mit Lily Putnam, die Patientin bei ihm sei.
Eine Sekunde lang stand Schlomo nur da, und der übergroße Schnabel der Gießkanne reckte sich mir entgegen wie ein, tja, wie ein langer, dünner, gelber Penis.
»Was für ein toller Fall!« sagte er dann. »Ödipal. Bub denkt, Mami treibt’s mit Papa Schlomo, Bub wird meschugge. Toller Fall für Sie. Schlomo wird Sie in dieser Sache supervidieren.«
»Wäre das nicht ein Interessenkonflikt?«
»Nu, werd ich halt nicht supervidieren.« Er lachte. »Wenn Sie einen andern Supervisor finden, der was aushält, statt einen von den Gojim hier, die sich einbilden, daß ihre Scheiße nicht stinkt, viel Glück!«
»Also ist nichts dran an dem, was er sagt?«
»Sie glauben einem Patienten?« sagte Schlomo.
»Soll ich dem Patienten nicht glauben?«
»Nie und nimmer.«
»Nicht mal das, was er in der Therapie sagt?«
»Das schon gar nicht. Dem Patienten darf man nicht glauben. Und auch jemandem wie Ihnen nicht, weil Sie keine Analyse gemacht haben. Wenn Sie sich doch dazu entschließen sollten, hat Schlomo den Richtigen für Sie zur Hand.«
»Ich weiß, ich weiß, Ed Slapadek.« Ed Slapadek war einer der Analytiker, die Schlomo neuen Residents empfahl.
»Nicht Slapadek für Sie, Bubele. Was Besseres. Patienten lügen in der Therapie wie gedruckt und glauben dabei, sie sagen die Wahrheit. Es ist Ihre Aufgabe, ihnen zu zeigen, daß sie lügen. Und wenn sie mit dem Lügen aufhören, machen Sie Schluß. Die Therapie ist etwas Einfaches: Sie verlieben sich in Sie, sie werden enttäuscht – fühlen sich traurig und einsam –, sie verarbeiten es, und ihr Zustand bessert sich. Es gehört Chuzpe dazu, ein Seelenklempner zu sein. Ob Schlomo sie hat?«
»Keine Frage«, sagte ich, denn das Wort Chuzpe erinnerte mich an das Gerücht, daß der Rechtsanwalt Dershowitz ein Patient Schlomos sei, der auch hier auf der Couch lag und log, daß sich die Balken bogen …
»Sagen Sie Schlomo zu mir.«
»Kein Problem, Schlomo.«
»Und Sie, haben Sie Chuzpe?«
»Was würde Ihnen dazu einfallen, wenn ich sie hätte?«
Schlomo lachte herzlich und warf mir dann unversehens die Gießkanne in den Schoß. Ich wurde patschnaß und sprang auf. Schlomo bog sich vor Lachen.
»Sie Arschloch!«
»Ich weiß, ich weiß. Ist das nicht köstlich?« Er zog ein ekliges Taschentuch heraus und wollte sich damit über meinen Schoß hermachen, aber ich war schon auf dem Weg zur Tür. »Royele, Royele«, sagte er und wischte sich die Lachtränen vom Gesicht. »Vielleicht haben Sie doch Chuzpe. Lassen Sie sich von denen hier nicht fertigmachen. Wenn in diesem christlichen Scheißhaus einer einen Furz läßt, holen sie gleich die Feuerwehr. Gottes auserwähltes Volk trifft auf Gottes eingefrorenes Volk. Sie haben einen Funken Mumm, lassen sich nicht alles bieten. Wie Schlomo. Bleiben Sie so. Schlomo kann helfen.«
Ich war verblüfft. Er hatte recht. Schon nach einem einzigen Monat in dieser steifen, überkonventionellen Atmosphäre fühlte ich mich eingeengt. »Ja. Vielen Dank.«
»Keine Ursache. Richtig, daß Sie diesem Patienten nicht glauben. Ich weiß von seiner Frau alles über ihn.«
»Ihr glauben Sie?«
Die Schlitze seiner Lider öffneten sich. Dahinter schimmerten wie schwarze Perlen die Augen. Dann faßte er sich wieder. »Was für ein Kerl! Schlomo aufs Kreuz zu legen, ist nicht einfach. Vielleicht haben Sie doch Chuzpe. Toller Fall. Halten Sie Schlomo auf dem laufenden. Ein richtiger Thriller. Schönen Tag noch. Rufen Sie an, damit ich Sie mit diesem ganz besonderen Analytiker zusammenspannen kann. Sie können sich’s aussuchen: Rufen Sie Schlomo bald an oder später. Wenn Sie mittendrin sind in diesem Gefühlschaos, sind Sie auch schon halb draußen. Mmm, was für ein leckeres Häppchen. Ich würde gern selber die Zähne in dieses zarte, kleine Ego schlagen. Ciao!«
Ich verließ ihn mit dem Gefühl, als wären ein paar Windungen meines Gehirns aufgerollt worden. Ich hätte nicht zu sagen gewußt, ob ich gerade mit einem Schwachsinnigen oder mit einem Genie zusammengewesen war oder ob das überhaupt eine Rolle spielte. Dieser Clown der Analytiker von Ike White? Sex mit so was? Da müßte man ja verrückt sein.
Erschöpft irrte ich draußen umher und kam irgendwie zu den Tennisplätzen. Ich setzte mich im Schatten einer gewaltigen Rotbuche auf eine gußeiserne Bank und sah zwei Patienten beim Spielen zu. Der eine, weißhaarig, in der langen weißen Hose und dem langärmeligen weißen Hemd des Gentleman-Tennis der Ära Bill Tilden, stand an der Grundlinie und absolvierte perfekte Grundschläge.
Der andere, ein magerer junger Mann mit pechschwarzem Haar und einer schwarzen Brille mit bernsteinfarben getönten Gläsern, hatte sich das Spiel offensichtlich selbst beigebracht. Er wirkte wie besessen, begabt mit einer zappeligen Behendigkeit und Schnelligkeit. Der Ältere schlug den Ball weit nach hinten rechts ins gegnerische Feld, der Jüngere fing ihn in letzter Sekunde mit einem uneleganten Schlag ab, als wäre sein Ellbogen an der Hüfte angewachsen, und hob sich dann auf die Zehenspitzen wie ein Mann, der etwas auf die Ladefläche eines Lastwagens wuchtet. Der Return zielte weit hinten auf die linke Seite, scheinbar nicht zu erreichen, doch mit fanatischem Einsatz schaffte es der junge Mann hinzukommen, und der Ball flog erneut zurück. Lange spannende Ballwechsel schlossen sich an. Der Ältere schien unerschütterlich gelassen und nüchtern in seinem Spiel; der Jüngere, unermüdlich, erwischte auch die schwierigsten Bälle. Diagnose? Der Jüngere manisch-depressiv, manische Phase; der Ältere normal. Der Ort war so friedlich, das Licht der untergehenden Sonne durch den kupferroten Laubvorhang so gedämpft, das leise Plopp des Balls gegen die Schlägerbespannung so wohltuend, daß ich einnickte.
Später am Abend nahm mich ein anderer Resident im ersten Jahr, Henry Solini, in seinem Auto zu Ike Whites Freud-Seminar in seinem Haus am Stadtrand mit. Misery hielt uns neue Residents derart auf Trab und auf unseren jeweiligen Stationen derart voneinander isoliert, daß ich noch nie Gelegenheit gefunden hatte, mich mit Solini zu unterhalten. Er war ein kleiner Kerl mit schiefem Lächeln, dunklem Lockenhaar, das zu einem ordentlichen kurzen Pferdeschwanz zusammengefaßt war, übermütigen Augen und einem dünnen Goldring in einem Ohr. Er legte keinen Wert auf Kleidung – er trug Hemd und ungebügelte Freizeithose statt Anzug und Krawatte – und hatte deswegen von den maßgeblichen Leuten in Misery bereits einen Rüffel bekommen. Ich war Henry Solini im Korridor des Dachgeschosses von Toshiba über den Weg gelaufen, als wir beide aus unseren winzigen Sprechzimmern zu der eisernen Feuerleiter rannten und auf die mit einem Drahtzaun umgebenen Tennisplätze drei Etagen tiefer hinabstarrten, wo ein gewaltiger Aufruhr herrschte.
Sechs Männer waren hinter »Ausreißer« Harrison her, dem Patienten, den ich versehentlich aus der Station gelassen hatte. Er schrie gerade: »Ihr habt Christus gekreuzigt, ihr kreuzigt den netten Bill Clinton. Ist euch nicht klar, wen ihr jetzt ans Kreuz schlagt?«
Die sechs Pfleger rannten hinter ihm her. Er stürzte davon, so schnell er konnte, und sprang übers Netz, mußte aber feststellen, daß die Tür im Zaun verschlossen war. Er drehte sich um, breitete die Arme am Maschendraht aus und sagte: »Hört zu! So funktioniert diese Beziehung nicht. Ihr müßt euern Gekreuzigten kennenlernen, ist das klar?«
Sie packten ihn, fesselten ihn und schleppten ihn weg.
»Falsche Küste«, sagte Solini und sah zu mir hoch.
»Falsche Küste?«
»An der Westküste wäre er ziemlich normal, kein Problem. Zeit meines Lebens habe ich versucht, den Begriff des ›Normalen‹ zu erweitern.«
Während der Fahrt zu Ike Whites Haus erzählte mir Solini am Steuer seines grellrot lackierten Geo mit einem North-Dakota-Nummernschild, auf dessen Rand »Entdecke den Geist« stand, von sich selbst. Er war italienisch-tschechischer Abstammung und in Mandan, North Dakota, aufgewachsen, wo seine Familie die chemische Reinigung »Ideal Cleaners« betrieb. »Ich bin unter Weizenfarmern und Dakota-Sioux groß geworden. Meine besten Kumpel unter den Indianern saßen ohne Beine im Ort rum; sie waren mal auf dem Heimweg zum Reservat Fort Yates betrunken auf den Bahngleisen eingeschlafen.«
»Hört sich ja ziemlich schlimm an.«
»Ich habe den Verdacht, daß die Dämpfe aus unserer chemischen Reinigung bei mir das Wachstum gehemmt haben.« Mit einem traurigen Seitenblick auf mich fügte er hinzu: »Ich bin nur gut einssechzig groß.«
Er hatte sich ins Reed College abgesetzt und anschließend Medizinstudium und Internship in San Francisco absolviert. Seine medizinische Internship, die er genau einen Monat vorher abgeschlossen hatte, war genauso schauerlich und desillusionierend gewesen wie meine in dem Krankenhaus mit dem Spitznamen »House of God«, nur daß er zu allem Überfluß eine große Zahl von Aidskranken hatte betreuen müssen. Viele aus seinem Bekanntenkreis waren an Aids gestorben.
»O Mann, ich bin erledigt«, sagte er. »Nicht nur von meiner Internship, sondern auch vom Singen bei den Beerdigungen.«
»Du singst?«
»Reggae. Ich bin der einzige Weiße, der jemals Leadsänger bei Jamaica Juice war. Schau, die Medizin ist eins, aber Bob Marley and Wailers sind was ganz anderes.« Er drückte auf eine Taste des Kassettenrecorders, und wir hörten eine Weile dem harten Drive der revolutionären Lebensfreude zu. Ich fragte ihn, wie er auf die Psychiatrie gekommen sei.
»Ich mach das gern, mit Verrückten arbeiten«, antwortete er. Der kleine Kerl schlug auf dem Lenkrad den Rhythmus, seine Hände steckten die Arme an, die Arme den Körper, bis er auf seinem Sitz beinahe tanzte und ich ins Steuer greifen mußte.
»Aber wie bist du nach Misery gekommen? Misery ist die Wall Street der Psychiatrie.«
»Misery ist cool. Ich brauche Erholung. Dreitausend Meilen von meiner Ex-Flamme weg. Ich hab Ike White mal bei einem Vortrag erlebt, in Berkeley. Er war cool. Ich hatte zwar keine Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, hab aber mit ihm telefoniert. Seinetwegen bin ich hierhergekommen.«
»Ja, ich auch.« Ich warf einen Blick auf seinen Pferdeschwanz und den Ohrring und fragte: »Aber daß sie dich genommen haben?«
»Weil ich aus einem kleinen Bundesstaat komme und einen beschissen guten Lebenslauf habe.«
»Aber das Foto? Das Foto für die Bewerbung?«
»War kein Problem. Hab ihnen eins aus meinem Jahrbuch geschickt.«
»Von der Universität?« Er schüttelte den Kopf. »College?«
»Überleg doch mal. Da hatte ich schon Haare bis zur Hüfte und drei Ohrringe. Und einen in der Nase. Nein, High-School. Basketball. Bürstenschnitt. Kein Schmuck, kein Piercing, kein Problem. Und wie ist es bei dir gelaufen, Roy-Babe?«
Ich erzählte ihm, daß ich während meines Jahrs im »House of God« ziemlich zynisch über die Medizin zu denken begonnen, daß ich das Gefühl gehabt hatte, irgend etwas fehle an meiner Tätigkeit als Arzt, von meinem Leben ganz zu schweigen. »Ich hatte genug davon, in kranken Körpern herumzustochern. Mit Körpern kenn ich mich jetzt aus. Aber ich hatte das Gefühl, nichts zu verstehen. Ich möchte Menschen verstehen, das ist alles.«
»Na ja, jetzt bist du einen Monat hier. Verstehst du schon irgendwas? So richtig, mein ich?«
Ich dachte darüber nach. »Ja, so ganz allmählich ein bißchen, dank Ike. Aber was wir hier machen, das muß doch etwas Gutes für die Menschheit sein, oder nicht?«
»Ziemlich edel gedacht, Mann. Ganz schön große Hoffnungen. Könnte Ärger geben.«
In Ike Whites Haus gingen Henry und ich an die Bar und gossen uns Bourbon ein. Wir versammelten uns in einem Wohnraum, in dem, im Unterschied zu Ike Whites Sprechzimmer in Misery, Ordnung herrschte und die ganze Einrichtung aus Hartholz und Laura-Ashley-Stoffen bestand, was auf Mrs. White deutete. Der Gastgeber bot Zigarren an. Nur Henry und ich nahmen welche, von Ike White selbst abgesehen. Unter seiner Anleitung beschäftigten wir uns mit Sigmund Freud.
Ich hatte den Aufsatz, um den es an diesem Abend ging, »Trauer und Melancholie«, während meiner medizinischen Internship gelesen. Während Ike White uns durch den Text führte, beeindruckte er mich immer mehr. Er war nicht nur brillant, sondern auch überaus bescheiden. Er entschuldigte sich beinahe dafür, daß er uns in der Ära der High-Tech-Psychiatrie dieses geheimnisvolle Wiener Zeug vortrug. Er war glänzend.
Die Monographie handelte vom Trauerprozeß. Freud arbeitete den Unterschied zwischen normalem neurotischem Kummer – »Trauer« – und pathologischem Kummer – »Melancholie« oder Depression – heraus. »Der Kern des Unterschieds zwischen normal und krank«, sagte Ike White, »ist in einer einzigen bemerkenswerten Zeile eingefangen.« Mit Leidenschaft in der Stimme zitierte er: »Der Schatten des verlorenen Objekts fällt auf das Ich.«
Bourbon und Schlafmangel bewirkten, daß ich schon bald beschwipst war und mich nicht mehr konzentrieren konnte. Nicht lange, und meine Resident-Kollegen ergingen sich in klugen Worten über diese Trauer, diese Melancholie, diesen Freud.
Als Ike White mich verabschiedete, wirkte er besorgt. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Klar. Nur ein bißchen beduselt.«
»Daß der P-patient Harrison getürmt ist, hat Ihnen das Schwierigkeiten gemacht?«
»Nein«, sagte ich, überrascht, daß er davon wußte. »Eigentlich nicht.«
»Mit kranken Menschen zu a-arbeiten, ist ziemlich stressig.«
»Es kann auch nicht stressiger sein, als normale Medizin zu machen.«
Ike White zögerte kurz – vielleicht zwei Sekunden – und sagte dann: »Es ist eine a-andere Art von Streß.«
Als wir in dem gemütlichen roten Geo nach Hause zuckelten, sangen Solini und ich Bob Marleys »Them Belly Full (But We Hungry)«.
Ich stolperte unsicher die schmale und tückisch gewundene Treppe zu meiner Wohnung im Dachgeschoß eines alten, mit Türmchen verzierten viktorianischen Hauses hinauf und fand Berry in einem Sessel schlafend vor. Ich hatte sie einige Tage nicht gesehen. Wie reizend sie aussah mit ihrem langen, gebräunten Modigliani-Gesicht, das an ihre bloße Schulter geschmiegt war, der aufgeknöpften Bluse, dem Spitzenbesatz ihres BHs, der sich sexy wölbte und sich weiß von der tiefen Bräune ihrer Haut abhob, ihrem kurzgeschnittenen dunklen Haar und den langen, schwarzen, die Wangen wie zwei Halbmonde überwölbenden Wimpern. Ihre volle Unterlippe war wie ein Kissen für die obere, und beide kräuselten sich in einem halben Lächeln, als träumte sie einen süßen Traum. Da ich wußte, wie schwer sie es in letzter Zeit gehabt hatte, mit ihrem Selbstvertrauen und ihrer Verletzlichkeit, freute ich mich über dieses Lächeln.
Ich war seit beinahe zehn Jahren mit Berry zusammen. Nach meinem gräßlichen Jahr als medizinischer Intern und ihrem gräßlichen Jahr als Kinderpsychologin an einer anderen Hochleistungsklinik hatten wir uns gesagt, wir brauchten Zeit für uns, um einander wieder kennenzulernen und Wunden heilen zu lassen. Wir hatten ein freies Jahr eingelegt und waren um die Welt gereist, von Südfrankreich bis Südchina, von wo wir erst vor einem Monat zurückgekehrt waren. In diesem Jahr der Freiheit hatte sich unsere Beziehung vertieft. Wir dachten ans Heiraten. Doch wir waren uns einig, daß wir erst abwarten mußten, wie es sich anließ, wenn wir wieder in der Testrakete Amerika saßen.
Auch Berry war dabei, etwas Neues auszuprobieren: Sie unterrichtete Vierjährige in einer Vorschule. Sie war noch arg mitgenommen von ihrer Internship, in der ein paar übereifrige Supervisoren ihr klargemacht hatten, daß sie »zu sensibel« sei und es ihr für den Arztberuf an »kritischer Disziplin« fehle. Sie hatte sich dagegen aufgelehnt, Kinder psychologisch zu testen und ihnen das Etikett »krank« zu verpassen – ein wesentlicher Punkt ihrer Ausbildung. Wegen dieser Weigerung hatte man ihr immer wieder zu verstehen gegeben, daß sie eine Versagerin sei.
Doch es machte ihr große Freude, mit Kindern zusammenzusein. Überall, wo wir auf unserer Reise einen längeren Aufenthalt einlegten, leisteten wir freiwillige Arbeit, sie als Kindergärtnerin, ich als Arzt. Sie hatte sich vorgenommen, nach unserer Rückkehr mit »normalen« Kindern in einer Vorschule zu arbeiten.
Ich beugte mich zu ihr hinab und küßte sie.
»Wo warst du denn?« fragte sie, und als sie ganz wach war, wich das schwache Lächeln einem Ausdruck der Besorgnis. Ich sagte es ihr. »Du hast keinen Ton davon gesagt, daß du heute abend zu einem Seminar gehst.«
»Ich hab’s vergessen.«
»Es gibt da jetzt so moderne Geräte, Telefon genannt. Noch nie was davon gehört?« Doch, antwortete ich, ich hätte schon davon gehört. »Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Wie war dein Tag heute?«
»Mein Tag und meine Nacht und mein Tag? Jede Minute davon hab ich genossen. Die Psychiatrie ist ein Kinderspiel. Genau das richtige für mich, einen jüdischen Arzt, der kein Blut sehen kann.«
»Kein Wunder, wenn du ständig betrunken bist.«
»Ich bin nicht betrunken.«
»Na schön«, sagte sie und stand auf, »und ich bleibe nicht hier.«
»Jetzt komm, sei doch vernünftig.«
»Versuch’s morgen noch mal.«
»Warte noch. Wie war dein Tag heute?«
»Wenn ich etwas gelernt habe«, sagte sie, »dann, daß man nie versuchen soll, mit einem Betrunkenen zu reden.«
»Hey, jetzt mach mal einen Punkt. Ich bin schließlich nicht dein Vater, sondern dein …«
»Bis morgen«, sagte sie und machte sich auf den Weg zu ihrer eigenen Behausung.
Im Bett las ich einen Brief von meinem Vater, dem Zahnarzt, einem der großen Optimisten dieser Welt und Meister im Gebrauch der Konjunktion »und«. Alles, was er schrieb, folgte dem Muster: kurzer Satz – Konjunktion – kurzer Satz.
… Freut mich, daß Du Dein freies Jahr hinter Dir hast, und es war ein Jahr ohne Einkommen und nicht normal. Mit der Psychiatrie vergeudest Du Dein Talent, und Du wirst es schon bald einsehen und zur richtigen Medizin zurückkehren. Die Zahnheilkunde hat immer ihren Mann ernährt und ihn geistig gefordert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es eines Tages mal zu einem Viererspiel in der Familie kommt, und Mom hat einen so glatten, kurzen Schlag. Ich spiele ganz brauchbar und versuche mich zu konzentrieren, meine Arme so locker zu lassen, als wären es Stricke …
Zweites Kapitel
Verkatert und mit einem Gefühl, als wäre ich durch den Fleischwolf gedreht worden, schleppte ich mich am nächsten Morgen in das Farben-Gebäude und die Treppe hinauf zum Büro meiner Sekretärin Nancy. Die Cherokee-Schlomo-Affäre erschien mir weit weg, unwirklich, wie ein verblaßter Traum. Nancy trug ein lustiges pinkfarbenes Top, das ihre gebräunten Schultern frei ließ. Sie hatte rotgeweinte Augen.
»Was ist denn los?«
Sie riß die Augen auf. »Haben Sie’s noch nicht gehört?«
»Was? Was gehört?« Sie begann hemmungslos zu schluchzen. »Was denn?«
»Ike White ist tot. Er hat sich gestern abend umgebracht.«
»Was? Ike? Das kann nicht sein! Ich hab gestern abend noch mit ihm gesprochen. Und alle andern auch.«
»Es ist passiert, nachdem Sie gegangen waren.«
Ich starrte ins Leere. Ich hörte Nancy schluchzen, aber wie aus weiter Ferne. Als wäre sie ein Stockwerk tiefer. Meine Beine gaben nach, und ich landete in einem Sessel.
Wie konnte das sein? Es war unmöglich. Ich hatte mich mit ihm unterhalten, ihm die Hand geschüttelt. Er hatte gelächelt. Er hatte in Urlaub fahren wollen, Herrgott im Himmel! Ja, er wirkte ein bißchen ausgelaugt, war aber im Grunde heiterer Stimmung gewesen.
»Sind Sie sicher, daß es Selbstmord war?«
»Hundertprozentig.« Sie schluchzte noch heftiger.
Ich spürte ein kaltes Schürfen in der Brust, eine eiserne Faust, die mein Herz umklammerte. Mein ganzer Körper war bleischwer. Und dann, als wäre es gestern, sah ich wieder den dunklen Fleck auf dem Parkplatz, wo einer meiner Kumpel, ein Intern namens Potts, nach seinem Sprung aus dem siebten Stock aufgeprallt war, und die Tränen stürzten mir nur so aus den Augen. Heiß versengten sie mir die Lider. Ike? Unmöglich, er doch nicht!
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und als Solini und ich um halb zehn zur Vormittagsbesprechung in den Raum drängten, in dem es nur noch Stehplätze gab, wußten alle Anwesenden nicht nur, daß Ike White sich mit einer Überdosis Beruhigungsmittel das Leben genommen hatte, sondern alle kannten auch die ungefähre Zahl der Tabletten und hatten erfahren, daß er an seinem letzten Nachmittag die Personalabteilung angerufen und sich nach dem Umfang seines Versicherungsschutzes erkundigt hatte – ich hatte den Rückruf auf dem Anrufbeantworter selbst gehört. Er hatte die Pillen gegen elf Uhr geschluckt, keine halbe Stunde, nachdem wir einander matt und ohne Blickkontakt die Hände geschüttelt und ich ihm einen schönen Urlaub gewünscht hatte. Er war in der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Stadt gestorben, mit seiner Frau und seinem neuen Analytiker am Sterbebett, während sein Psychopharmakologe über den Piepser ständigen Kontakt hielt.
Die meisten von uns, die jetzt dichtgedrängt im hinteren Teil des alten Vortragssaals standen, kannten die grausige Wahrheit. Wir suchten Hilfe, um damit zurechtzukommen.
Auf dem Podium erhob sich Dr. Lloyal von Nott, sein schwarzer Anzug und die dunklen Augen und Brauen dem düsteren Anlaß angemessen. Er war der Chef von Misery, und wie bei den Chefs anderer Institutionen ging von ihm jene strahlende Aufrichtigkeit aus, die bedeutete, daß man ihm kein Wort glauben durfte. Bei dieser täglichen Morgenbesprechung, die eine halbe Stunde dauerte, wurde aus den verschiedenen Stationen über die Vorkommnisse der vergangenen vierundzwanzig Stunden berichtet, Neuaufnahmen und aktuelle Probleme eingeschlossen. Mit der gelassenen Würde seines ausgeprägten britischen Akzents handelte Lloyal von Nott die üblichen Fragen des Alltags in der Klinik Punkt für Punkt ab, als ob nichts Besonderes geschehen wäre, bis schließlich die Standuhr in der Ecke mit zehn traurig dröhnenden Gongschlägen die Stunde schlug. Als der letzte Schlag verhallt war, herrschte beklommenes Schweigen. Lloyal von Nott räusperte sich. Die Spannung war unerträglich.
»Ich danke Ihnen«, sagte er und schickte sich an zu gehen.
Surrealistisch. Eine Sekunde lang sagte keiner ein Wort. Dann begann sich die Versammlung aufzulösen. Plötzlich rief eine Frau: »Entschuldigen Sie, Dr. von Nott!«
Er blieb stehen. Das Publikum fand sich wieder zusammen. Köpfe drehten sich nach der Fragestellerin um. Eine hochgewachsene, grauhaarige Frau mit dunkler Brille stand da, das Kinn in der typischen Stevie-Wonder-Haltung hochgereckt – offensichtlich war sie blind. »Ich bin Dr. Geneva Hooevens. Wir sind alle tief betroffen über Dr. Whites Tod. Könnten Sie uns vielleicht Näheres dazu mitteilen?«
»Wir teilen Ihnen mit tiefem Bedauern den Tod von Dr. Isaac White mit. Er erlag einem tödlichen Leiden. An seiner Stelle wird Dr. Schlomo Dove die Leitung der Residents-Ausbildung übernehmen. Der Zeitpunkt des Gedenkgottesdienstes wird in Kürze bekanntgegeben.«
Tödliches Leiden? Selbstmord war es. Was zum Teufel ging hier vor?
»Aber«, sagte Dr. Geneva Hooevens, »es geht das Gerücht, daß es sich um Selbstmord handelt.«
»Dieses Gerücht hat keinerlei Wahrheitsgehalt. Dr. White ist einem tödlichen Leiden erlegen.« Lloyal von Nott drehte sich um und verließ den Raum. Die Besprechung war zu Ende.
Solini und ich gingen langsam durch den friedlichen Sonnenschein in Richtung Emerson, begleitet von Hannah Silver, der einzigen Frau unter uns Residents im ersten Jahr. Ich kannte Hannah von der BMS. Sie war eine junge Frau mit feinen Zügen und schwarzem Haar, das sich auf ihre Schultern hinabringelte, eindringlich blickenden Augen in einem schmalen, jüdisch wirkenden Gesicht und einem Körper, der nach unten zu immer mehr in die Breite ging, als wäre er »tiefer gelegt« worden, um sich schneller bewegen zu können. Sie stammte aus New York, war von zartem Gemüt und hatte während einer konzentrierten Analyse auf der Upper East Side eine vielversprechende Karriere als Cellistin aufgegeben und sich der Medizin zugewandt. Sie und ich hatten zusammen mit Ike White in Emerson gearbeitet.
»Was soll der Quatsch, ›tödliches Leiden‹?« sagte Solini. »Hatte der arme Kerl wirklich eine körperliche Krankheit?«
»Nein, er war kerngesund«, sagte ich. »Er war erst einundvierzig. Nancy hat mit einer Schwester gesprochen, mit der sie befreundet ist und die den Laborbefund gesehen hat: massive Barbiturat-Überdosis. Es war Selbstmord, gar keine Frage.«
»Aber warum geben die’s dann nicht zu? Was wollen sie vertuschen?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich und fühlte dabei gespenstisch den matten Zugriff von Ike Whites kleiner, stotternder Hand. Es war nicht zu fassen, daß er, als er mir die Hand gab, bereits alles vorbereitet hatte, um sich eine Stunde später das Leben zu nehmen. Was hatte er so routiniert gesagt? Sie gehen ohne Narben wieder fort. Ich sah Hannah an. Auch sie hatte sich Ike Whites wegen für Misery entschieden, hatte beschlossen, sich auf Whites Spezialgebiet zu spezialisieren: Depressionen und Selbstmord. Jetzt bewegte sie sich mühsam dahin, wie ein Roboter, im Schock.
In dem Monat bei Ike White, als wir mit Depressiven zu tun gehabt hatten, die auf der Welt ihresgleichen suchten, hatte ich gelernt, ihm zu glauben, zu glauben, was er sagte und was er tat. Er war immer gelassen gewesen, hatte nie viel gesagt oder getan, aber er hatte Hannah und mir das Gefühl gegeben, daß er genau wußte, was er wollte, und daß diese armen, depressiven Geschöpfe, wenn sie an der Hand genommen wurden, auf der anderen Seite ins Freie gelangen würden. Ike White war der weise, gelassene, allwissende Seelendoktor gewesen.
Jetzt brach etwas in mir auf, ich stellte mir die Frage, wem oder was ich glauben konnte oder nicht glauben durfte. Als Ike White noch dagewesen war, hatte ich für wahr gehalten, wie ich ihn erlebte, und mich doch gründlich getäuscht. Der Boden unter meinen Füßen kam mir vor wie Watte, in der Hitze drehte sich mir der Kopf. Ich sagte zu Henry: »Aber ich dachte, Psychiater sollten fähig sein, sich unangenehmen Gefühlen zu stellen, sollten einem helfen können, über sie hinwegzukommen, und zwar lebendig.«
»Vielleicht wollen sie uns beibringen, daß wir psychisch besser dran sind, wenn wir so tun, als wäre nicht geschehen, was doch geschehen ist. Uns einreden, daß wir nicht fühlen, was wir sehr wohl fühlen.«
»Aber wenn man nicht einmal die Ärzte daran hindern kann, sich umzubringen«, sagte ich, »wie will man dann die Patienten davon abhalten?«
Henry verzog verdutzt das Gesicht. »Ja, gute Frage.«
»Ich bin völlig am Boden zerstört«, sagte Hannah und verdrehte die Augen. Das tat sie beim Sprechen oft. Ich hatte sie einmal darauf angesprochen, und sie war überrascht gewesen, daß sie es noch immer tat. Es komme davon, erklärte sie, daß sie so lange Jahre in Analyse gewesen sei. Auf der Couch liegend, den Analytiker hinter sich, habe sie sich angewöhnt, jedesmal zu ihm nach hinten zu schauen, wenn sie etwas sagte, von dem sie glaubte, daß er glaubte, sie solle es für wichtig halten. »Ich bin hierhergekommen, um mit Ike zu arbeiten, und als ich ihn bat, mein Lehrer zu sein, sagte er …« Sie begann zu weinen, so daß ihre Worte in einem klagenden Ton herauskamen: »›Aber mit dem größten Vergnügen.‹«
Die hohen Mauern und verschlossenen Türen von Emerson wirkten unheimlich. Im Erdgeschoß schloß Hannah die Tür zu ihrer Station auf. Solini verließ mich auf dem Treppenabsatz der ersten Etage und stieg hinauf zu seiner Station, Emerson 3, Psychosen. Als ich das Schild mit der Warnung vor Ausreißern neben der Tür zu meiner neuen Station, Emerson 2, Borderliner, sah, öffnete ich vorsichtig die Tür, blockierte die Öffnung mit meinem Körper, drehte mich hinein und warf die Tür zu.
»Die Sacknasen knallen Türen zu!«
Derselbe junge Mann mit dem sandfarbenen Haar wie vorher. Der Pegel meiner Wut stieg langsam. Ich wollte erst reagieren, ließ es dann aber bleiben. An die zwanzig weitere Patienten saßen im Aufenthaltsraum und starrten zu mir her. Ich sah die beiden Tennisspieler. Der normale, ältere Mann trug einen Sommeranzug und las das Wall Street Journal. Der schmächtige Jüngere, der manische Typ, las eine Boulevardzeitung und hielt eine Karotte in der Hand, von der er gerade abbiß. Das Geräusch zerriß die gespenstische Stille. Ärzte waren nicht zu sehen. Die Patienten – von Heranwachsenden bis zu Senioren, hochmodisch gekleidet oder mit Fetzen am Leib, viele mit verbundenem Handgelenk, Kopf oder Bein, eine Frau mit einer Plastik-Halskrause, ein Mann im Rollstuhl – wirkten wie verwundete Flüchtlinge unter Bombenschock, die auf das Kriegsende warten, um weiterziehen zu können. Diese Menschen waren die gefürchteten »Borderliner«.
Ich fragte die Stationssekretärin nach Dr. Malik.
»Das ist der mit der Mohrrübe. Das Flurtreffen ist gleich zu Ende.«
Das war eine Überraschung. Ich blieb stehen und beobachtete die Leute. Malik sagte:
»Wie gesagt, Ike White hat sich das Leben genommen. Warum, weiß keiner. Schwer zu begreifen. Aber wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Für ihn ist das Spiel zu Ende, aber nicht für uns. Ich bin hier. Sie wollen über das Thema Selbstmord sprechen? Ich werde darüber sprechen. Aber jetzt machen Sie erst mal Sport. Wir sehen uns später.«
Malik trat zu uns. Er trug ein kurzärmeliges weißes Hemd, eine schmale rote Krawatte, eine Khakihose und ausgelatschte Nike-Joggingschuhe. Sein drahtiger, sportlicher Körper schien zu klein für die Energie, die in ihm steckte. Sein rabenschwarzes Haar war sorgfältig gescheitelt und mit Gel hoch- und nach hinten frisiert. Auf der Hakennase in seinem langen, gebräunten Gesicht saß eine schwarze Brille mit bernsteinfarben getönten Gläsern. Wir begrüßten uns. Seine Hand war groß für seine Statur, sehnig, doch der Druck sanft. Die Hand eines Sportlers.
»Ich hab Sie gestern Tennis spielen sehen und Sie für einen Patienten gehalten.«
»Sie glauben also, es gibt einen großen Unterschied zwischen Ärzten und Patienten? Manchmal sind die Patienten normaler als man selbst.« Er fixierte mich. Ich hatte das sonderbare Gefühl, daß er in mich hineinsah. Er warf einen kurzen Blick auf meinen Anzug. »Sie hat’s aber erwischt!«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie wissen doch, was ich meine, oder?«
»Mehr oder weniger«, sagte ich und merkte, daß er mein Unbehagen spürte, weil ich in einem Anzug steckte.
»Wenn Sie also wissen, was ich meine, dann fragen Sie nicht, was ich meine. Um Seelenklempner zu werden, müssen Sie sich noch allerhand abgewöhnen, wie wir alle, die Medizin studiert haben. Vor allem wie wir ehrgeizigen Juden, die hoch hinauswollen.«
Ich wollte ihn schon fragen, was er damit meinte, besann mich aber eines Besseren.
»Sie haben sich gebremst. Gut so.« Wieder biß er ein Stück von seiner Karotte ab, schloß die Augen und kaute genießerisch.
»Was soll die Karotte?«