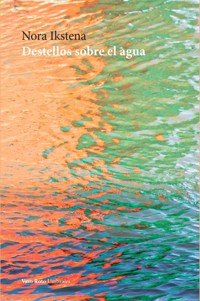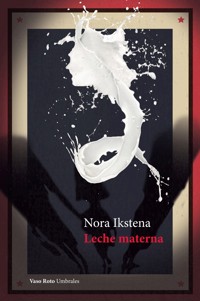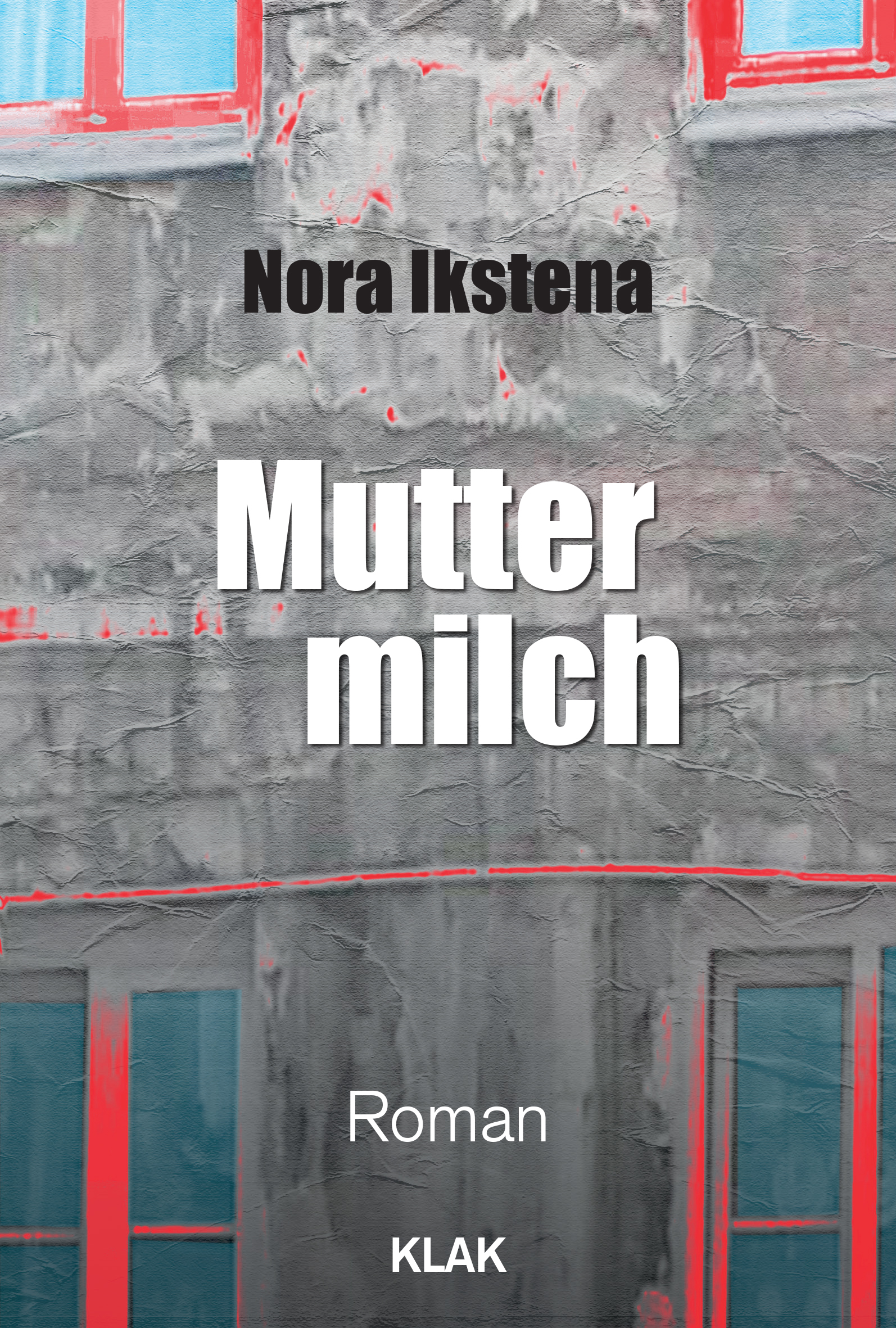
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KLAK Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
“Meine Milch war bitter, voll Ratlosigkeit, Milch der Verwesung. Ich bewahrte mein Kind davor.” Mutter und Tochter - die Generationen von 1944 und 1969 - sind die erzählenden Stimmen des Romans. Die Mutter wird nach einem Skandal mit einem Kriegsveteranen in die lettische Provinz verbannt. Ihre berufliche Karriere in Leningrad endet abrupt durch einen Staat, der ihr die Chance nimmt, sich beruflich und sozial zu verwirklichen. Die Isolation frisst sich in ihr Leben hinein, Bitterkeit und Ohnmacht prägen das Verhältnis zu ihrer Tochter. Die Großmutter bietet ihr, was die Mutter nicht leisten kann: Liebe und ein Zuhause, in dem sie – fast – wie eine mustergültige Sowjetbürgerin aufwächst. Die Familie trifft auf andere Ausgestoßene und Unangepasste, frömmelnde Russinnen, einen Hermaphroditen, einen oppositionellen Lehrer. Immer verlangt das Leben ihnen Kompromisse ab, die sie nicht eingehen wollen. Bis sich die Vorboten der Freiheit regen. Wozu sind sie noch fähig, als der politische Wandel im Land und in Europa beginnt? Voller Symbolik und Feingefühl erzählt Nora Ikstena über die Liebe zur Freiheit und das Drama des Lebens bis zum Fall der Berliner Mauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
© Nora Ikstena, Riga 2015
© KLAK Verlag, Berlin 2019
Alle Rechte vorbehalten
Satz/ Layout: Jolanta Johnsson
Umschlag: Jolanta Johnsson
Druck: BookPress, Olsztyn
ISBN 978-3-948156-17-6
*
An den 15. Oktober 1969 erinnere ich mich nicht. Wie sollte ich auch. Obwohl es ja Leute gibt, die behaupten, dass sie sich an ihre Geburt erinnern. Vermutlich habe ich richtig im Mutterleib gelegen, denn es soll eine natürliche Geburt gewesen sein. Sie war weder besonders lang noch kurz, die Wehen kamen alle fünf Minuten. Meine Mutter war bei meiner Geburt fünfundzwanzig, demnach jung und gesund, was sich allerdings später als nicht ganz richtig herausstellte. In meinem Gedächtnis oder vielleicht in meiner Vorstellung geblieben ist aber das milde goldene Oktoberwetter, in das sich die Vorahnung der dunklen Tage mischt. Ein Schwellenmonat, zumindest in unserer Klimazone, in der sich die Jahreszeiten abwechseln und der Herbst langsam in den Winter übergeht.
Die Bäume hatten vermutlich gelbe Blätter, und unsere Hausmeisterin fegte sie schimpfend zusammen. Sie war mit ihrer Familie aus dem sonnigen Kirgistan eingewandert und hatte für ihre hochqualifizierte Arbeit sofort eine Wohnung in der Mitschurin-Straße 20 zugeteilt bekommen. Ihr mandeläugiges Töchterchen saß auf der Fensterbank, aß Rote-Bete-Suppe und lud jeden freundlich in die Wohnung ein. Der einstige Prunk der Vorkriegszeit, den die jüdische Familie 1941 gezwungenermaßen zurückgelassen hatte, als die Deportation nach Sibirien sie vor dem gelben Stern im wenige Monate später von den Nazis besetzten Riga bewahrte, dieser Prunk der Vorkriegszeit wurde nun von der kirgisischen Vorstellung von Schönheit dominiert. Dicke Teppiche bedeckten das Parkett und Sonnenblumenkerne füllten die Porzellanschälchen, während auf dem Klavier Spucknäpfe standen. Zeiten und Konfessionen hatten sich vermischt. Und so war das überall in diesem Haus, in dessen Wohnung Nummer dreizehn man mich trug, sorgfältig gewickelt nach damaligem Brauch wie die Puppe eines Schmetterlings.
Ich habe manchmal einen Traum, aus dem ich mit einem Brechreiz erwache. Ich liege an die Brust meiner Mutter geschmiegt und sauge daran. Die Brust ist groß und milchreich, aber ich bekomme nichts heraus. Ich sehe meine Mutter nicht, sie hilft mir nicht und ich kämpfe ganz allein mit ihrer Brust. Plötzlich habe ich Erfolg und in meinen Mund fließt eine ekelhafte bittere Flüssigkeit, an der ich würge, bis ich mit einem Gefühl von Übelkeit aufschrecke.
Wie komisch es ist, so abgetrennt zu existieren. Getrennt von etwas so Natürlichem, Erhabenem, Schönem, jahrhundertelang Besungenem. Eine Mutter stillt ihr Kind. Ihr Gesicht ist erleuchtet, ihre Augen blicken auf das wunderbare Gottesgeschenk in ihren Armen. Die Augen des Kindes blicken hilflos und vertrauensvoll, die Stimmen der Natur sind ineinander verwoben, die Milch, die aus der Mutterbrust strömt, ist das Wasser des Lebens, das das Kind trinkt, und das Band zwischen ihnen ist ewig und endlos.
Als junge Ärztin wusste meine Mutter vielleicht, dass ihre Milch dem Kind mehr schaden als nutzen konnte. Wie anders ließe sich erklären, dass sie gleich nach der Geburt verschwand. Fünf Tage lang war sie fort, dann kehrte sie heim mit schmerzenden Brüsten, in denen die Milch ausgebrannt war.
Die Mutter meiner Mutter hatte mich zwei Tage lang verzweifelt mit Kamillentee gefüttert. Dann ging sie zur Milchküche, wo eine misstrauische Ärztin sie auf Russisch beschimpfte und meine Mutter ein Flittchen nannte, ihr aber dennoch die schriftliche Genehmigung erteilte, Milchpulver zur Säuglingsernährung abzuholen.
In den zwanzig Jahren, die ich mit meiner Mutter zusammen war, habe ich sie nicht fragen können, warum sie mich, einen hilflosen kleinen Säugling, von ihrer Brust gerissen hat. Ich konnte es nicht, denn damals wusste ich noch nichts davon. Und vielleicht war die Frage auch unpassend, denn es fügte sich, dass ich zu ihrer Mutter werden musste.
*
An den 22. Oktober 1944 erinnere ich mich nicht. Doch ich stelle ihn mir vor. Riga frisch befreit von den Hitlerdeutschen. Bei den Bombenexplosionen sind die Fenster der Frauenklinik zersprungen, es ist feucht und kalt, und die Frauen, die gerade entbunden haben, wickeln sich hilflos in ihre blutigen Laken. Übermüdete Schwesternhelferinnen trinken Hochprozentiges und wickeln tote Säuglinge in Päckchen ein. Es grassiert eine Seuche, die allgemein Nasentyphus genannt wird. Jammern und Weinen ist zu hören, Bomben pfeifen durch die Luft, und durch das Fenster dringt Brandgeruch. Meine Mutter hat mich heimlich aus der Säuglingsstation geholt. Sie hat mich an sich gewickelt und pumpt mir ihre Milch in die Nase. Aus meinem Näschen läuft eine Mischung aus Eiter, Milch und Blut. Ich würge und atme, würge und atme.
Und dann plötzlich Ruhe und Frieden. Ein Pferdchen zieht einen Wagen über einen sonnigen, herbstlichen Weg von Riga nach Babīte. Mein Vater hält den Wagen mehrmals an, damit meine Mutter mich stillen kann. Ich würge nicht mehr, atme ruhig und sauge gierig Mutters Milch. Wir haben ein schönes Haus in der Oberförsterei von Babīte, es gibt dort kaum Möbel, auch keine Wiege, aber meine Mutter bereitet mir ein Bett in einem großen Koffer.
Jeden Morgen schaut mein Vater nach den Tannen in seiner Baumschule. So geht das bis Weihnachten, als plötzlich ein Lastwagen mit Soldaten in die Försterei fährt. Sie schreien herum in einer Sprache, die meine Eltern nicht verstehen. Die Soldaten springen vom Wagen und fangen an, die jungen Tannen zu fällen. Mein Vater läuft aus dem Haus, vorher schließt er noch meine Mutter im Dachzimmer ein, wo sie mich im Koffer versteckt, in den sie zuvor Löcher gebohrt hat, damit ich atmen kann. Mein Vater schreit: „Ihr Halunken, ihr Halunken!“ und versucht, die Tannen zu retten. Sie schlagen ihn blutig und werfen ihn zusammen mit den gefällten Bäumen auf den Lastwagen. Die Rotte zieht fluchend durch das Haus, hämmert an alle Türen. Meine Mutter sitzt mit angehaltenem Atem im verschlossenen Dachzimmer im Schrank, auf den Knien hält sie den Koffer, in dem ich atme. Der Lärm ist schrecklich, sie demolieren das Haus. Bis alles still ist und man nur noch ein Geknatter hört, als der Lastwagen abfährt.
Gegen Morgen klettert meine Mutter aus dem Schrank. Sie stillt mich, bindet mich an sich, zieht eine dicke Schicht Kleidung an und geht zu Fuß zurück nach Riga. Erst am späten Abend erreichen wir die Tomsons-Straße, die bald darauf nach Mitschurin umbenannt wird, und die Wohnung Nummer dreizehn. Meine Mutter ist todmüde, aber sie muss noch die von den Bomben zerschlagenen Fenster zukleben, sonst erfrieren wir beide.
*
Ich weiß nicht, wie meine Mutter und Großmutter unter sich die Geschichte von Mutters Verschwinden lösten, denn sie wurde nie erwähnt. Den Duft der Muttermilch ersetzte in meiner Kindheit das Aroma von Medikamenten und Desinfektionslösungen, das meine Mutter stets wie eine Wolke umschwebte, wenn sie erschöpft vom Nachtdienst in der Frauenklinik zurückkehrte, oder wenn sie zu Hause stundenlang wach auf ihrem Bett lag. Ihre Handtasche war vollgestopft mit Tabletten, Ampullen und diversen Metallwerkzeugen. Durch einen Vergleich mit Abbildungen im Lexikon der Medizin erkannte ich darin später die verschiedenen, in meinem Bewusstsein furchtbaren, Instrumente eines Frauenarztes. Ziemlich gruselig erschien mir diese Welt, in die jede ihrem Mutterinstinkt folgende Frau zu gegebener Zeit unvermeidlich hineingezogen wird. Wenn meine Mutter einmal eine Nacht zu Hause verbrachte, saß sie lange wach bei Zigaretten und Kaffee, gebeugt über Berge medizinischer Fachbücher und Nachschlagewerke. Auf ihrem Schreibtisch reihten sich Zettel aneinander, auf denen neben schriftlichen Notizen Zeichnungen von Gebärmuttern, Eileitern, Becken und Scheiden in verschiedenen Kombinationen, aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven erschienen.
Meine Mutter kannte sonst nichts von der Welt. Sie schloss demonstrativ die Tür, wenn im Nebenzimmer die Fernsehnachrichten mit dem lispelnden Leonid Iljitsch Breschnew eingeschaltet wurden, sie las nicht die Zeitung Rīgas Balss, nach der die Leute an der Ecke der Gorkistraße schon ab fünf Uhr abends anstanden. Genauso lange Schlangen bildeten sich am Nachmittag in den Fleisch- und Milchgeschäften, wo hin und wieder das eine oder andere zum Verkauf angeboten wurde: Würstchen oder Fleischwurst oder gar abgepackte Butter, und man durfte maximal ein Pfund kaufen. Auch davon wusste sie nichts. Aber neben den Bergen medizinischer Fachliteratur stand Melvilles Moby Dick. Die Sehnsucht nach der unfassbaren Freiheit eines eigenen Lebens.
Ich erinnere mich nicht daran, dass Mutters Hand mich berührte, aber ich erinnere mich an ihren durchstochenen Oberschenkel, an dem sie das Spritzensetzen übte. Ich erinnere mich, wie sie mit blauen Lippen im Bett lag, als sie das erste Mal ein Medikament überdosiert hatte, möglicherweise im Rahmen eines medizinischen Experiments. Ich erinnere mich an den Geruch ihres Morgenrocks, den Geruch der bitteren Tinkturen, die man ihr gab, als man sie ins Krankenhaus brachte. Und ich erinnere mich an den Flur der Frauenklinik, wo ich nach dem Nachtdienst auf sie warten durfte. Dann gingen wir ins Café in der Aloja-Straße und aßen Soljanka und grusinische Würstchen, und sie goss sich aus einer Ampulle Koffein in den Kaffee. Und ich weiß noch, wie starr unsere kleine Straße war, wie auf einem Bild, das aus einer anderen Zeit ausgeschnitten und in die heutige eingeklebt sein könnte. Nur die elegant gekleideten Leute auf dem Weg zu den Pferderennen im Hippodrom um die Ecke waren daraus verschwunden. An ihrer Stelle eilten nun andere Menschen mit eingezogenem Kopf auf dem Weg zur Arbeit dem Kommunismus entgegen. Aus ihren löchrigen Einkaufsnetzen lugten Stangenbrot und Kefirflaschen mit grellgrünen Deckeln und in graues Papier eingeschlagene Wäschepakete, die mit dünner brauner Kordel verschnürt waren.
*
Seit dem Drama in der Baumschule waren mindestens neun Jahre vergangen. Ich war eine Musterschülerin und nahm an Schulaufführungen und Kundgebungen teil. Ich hielt das große M, als wir Kinder die russische Botschaft My za mir! Wir für den Frieden! bildeten. Jeden Morgen lag für mich eine frisch gebügelte Schürze bereit, die Zöpfe wurden fest auf den Hinterkopf geflochten oder zu Affenschaukeln gebunden. Meine Mutter liebte und verwöhnte mich. Eines Tages tauchte ein großgewachsener, freundlicher Mann bei uns auf. Meine Mutter sagte, das sei nun mein Stiefvater. Am Abend, als er fort war, sah ich meine Mutter zum ersten Mal weinen. Sie saß in unserer langen engen Küche mit dem Fenster zum Hof, auf dem Herd dampfte ein Topf Kürbis zum Einlegen, und meine Mutter erzählte.
Mein Töchterchen, mein liebes Töchterchen. Dein Papi wurde verhaftet, weil er die Tannenbäumchen retten wollte. Die Tannenbäumchen wollte er retten, und was hatte er davon, wäre er nicht hinausgerannt, hätte er nicht „ihr Halunken“ geschrien, wäre er heute noch bei uns. Aber er liebte den Wald und seine Tannenbäumchen, und er rannte hinaus. Sie haben ihn zusammengeschlagen, abgeführt, drei Tage lang habe ich ihn gesucht, bis ich ihn am Bahnhof Šķirotava gefunden habe. Hinter Gittern, voller Wunden, ganz ausgezehrt. Durch das Gitter hindurch hat er meine Hand genommen und sie ganz fest gehalten, bis ein Aufseher kam und ihm mit dem Gewehrkolben auf die Hand schlug, auch meine hat er dabei getroffen. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Es fehlte jede Spur. Bis einer aus der Ferne die Nachricht brachte, dass er tot sei. Fünf Jahre ist das jetzt her. Er ist tot, mein Töchterchen, dein Papi.
Ich erinnere mich nicht, dass es mir viel ausgemacht hätte. Ich erinnere mich an Mamas weinerliche Stimme und daran, dass sie für alles Verkleinerungsformen benutzte – Töchterchen, Tannenbäumchen, Papi. Mein stattlicher Stiefvater gefiel mir, und an meinen Vater konnte ich mich nicht erinnern.
Bis eines Nachmittags am Kiosk bei meiner Schule, wo es einen Sodaautomaten gab, von dem zu trinken kategorisch verboten war, aber genau das war es, was man am meisten wollte, ein großer aufgedunsener Mann zu mir kam und sagte, er sei mein Vater. Ich rannte weg, so schnell ich konnte, schreiend und weinend rannte ich nach Hause, wo ich meine Mutter bleich wie ein Leintuch vorfand. Er war nicht gestorben. Er war zurückgekommen.
*
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich jemals zur Schule gebracht oder von der Schule abgeholt hätte. Das tat immer ihr Stiefvater, der sie adoptiert hatte. Wir gingen die nach dem russischen Klassiker Gorki benannte Straße entlang, ein leichter Wind wehte von der Straße des französischen Schriftstellers Barbusse eine Mischung aus Hopfen- und Schokoladengerüchen herbei. Das kündigte von Frieden und Zuhause. Es war nur ein kurzer Weg, ein Streifen Zeit im Raum der Geschichte. Irgendwo weit weg, in einer unerreichbaren geographischen Zone, desertierte jemand aus dem Vietnamkrieg und verdarb sich damit das Leben unter mustergültigen amerikanischen Gastgebern und Gastgeberinnen, die sich von Blumenkindern, Drogen und Rock ‚n‘ Roll abwandte. Irgendwo weit weg lag jemand in der sibirischen Weite unter dem Gras, jemand verbüßte noch seine Strafe für den Verrat am Volk, doch ein anderer war zurückgekehrt, um den Alltag für die ihm noch bestimmte Zeit schweigend zu ertragen. Irgendwo nicht ganz so fern lebte jemand ein alternatives Leben: las verbotene Bücher im Samisdat, trank Wodka und träumte vom freien Westen, der wie eine Fata Morgana hinter dem Eisernen Vorhang in der Luft schwebte. Aber hier in der Nähe lebten die Menschen ihren Alltag. Standen am Morgen auf, arbeiteten, legten sich schlafen. Verliebten sich, machten Kinder, lebten, starben.
Ich hatte keine Angst vor den Amerikanern, ich fürchtete mich weder vor Onkel Sam noch vor einem Atomkrieg. Ich hatte Angst vor meiner Mutter. Manchmal wurde sie von einer satanischen Macht befallen, die aus ihr hervorbrach und alles um sie herum vernichtete, insbesondere die Liebe ihrer Nächsten. Dann hasste sie ihre Mutter, hasste noch mehr ihren Vater und hasste die Tatsache ihrer eigenen Geburt. Sie schloss sich im Klo ein und heulte, und der lange Flur, an dessen Ende ich stand und durch den dies Heulen drang, das meine Kinderknochen zum Zittern brachte, war Ausdruck eines endlosen, unerklärlichen Hasses auf ein Leiden, das ich noch nicht verstand, auf die Ungerechtigkeit des Schicksals, auf die Gier nach Leben, in dem sich das Licht der Existenz wie in einem dunklen Tunnel in einem grausigen Strudel der Vergänglichkeit drehte.
Dann wieder wurden die Momente der Dunkelheit von seltenen kleinen Lichtflecken abgelöst. Wir saßen im Wohnzimmer am offenen Fenster, durch das Essensgeruch und Kindergeschrei drangen. Meine Mutter zeichnete mit Buntstiften auf ein großes Blatt Papier, wie ein Baby auf die Welt kam. Ich saß auf ihrem Schoß und hatte keine Angst. Zuerst zeichnete sie ein lächelndes Baby im Bauch der Mama, dann zeichnete sie den Kopf des Babys, der gerade zwischen den Beinen der Mama herausgeglitten war, und die Grimasse auf seinem Gesichtchen zeugte von dem Leiden und dem Schrecken, die es hier erwarteten. Dann zeichnete sie Mama und Kind mit der Nabelschnur zwischen sich, sie schienen sich an der Hand zu halten und fröhlich zu tanzen. Dann zeichnete sie noch die Schere, die die Nabelschnur durchschnitt. Und dann zeichnete sie die Mama, die ihr Kindchen im Arm hielt und es mit sanften, aber zugleich erschreckten Augen betrachtete. Ich folgte den Bewegungen ihrer Hand, den Zügen des Stifts. Ihre Hand war klein und weiß, die Nägel abgebrochen, die Haut in der Handfläche trocken und aufgerissen vom ewigen Talkum, den sie in die Gummihandschuhe schütten musste. Ich saß auf Mamas Schoß, ich hatte keine Angst, und ich beugte mich nieder und schmiegte meine Wange in ihre Hand.
*
Meine Mutter beschloss, nicht zurück zu blicken. Sie heiratet meinen Stiefvater, der mich adoptierte und wie sein eigenes Kind liebte. Wir sprachen nie über meinen wahren Vater. Meine Mutter erfuhr auch nie, dass ich meinen Vater über mehrere Jahre hinweg besuchte. Er war schwerkrank aus der Verbannung heimgekehrt und lebte unter unmenschlichen Bedingungen in einer Kammer in einer Gemeinschaftswohnung, in der es immer feucht war und der Fußboden mit Zeitungen ausgelegt wurde. Fast immer war er leicht oder schwer betrunken. Wenn er etwas nüchterner war, erinnerte er sich an seine Studienzeit, an seine Forschungen über jungen Wald, an seinen Widerwillen gegen Studentenverbindungen. Er erinnerte sich, dass seine Mutter ihn als Kind wie einen kleinen Herrn kleidete und ihn Jeannot nannte. „Du, meine Tochter, hast blaues Blut“, behauptete er, denn sein Vater sei ja nicht der Schuster in Dobele gewesen, den seine Mutter hatte heiraten müssen, sondern ein deutscher Baron. So war das. Mein Vater war nur einer in der schweigenden Legion derer, die sich nicht an die sowjetische Realität anzupassen vermochten. Die weder Breschnews noch Andropows Tod erlebten, weder Gorbatschow noch die singende Revolution, weder…
Berührt von Vaters Leiden, beschloss ich, Ärztin zu werden. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ihn geliebt habe. Manchmal tat er mir leid, manchmal hasste ich ihn, denn ich spürte sein Selbstzerstörungsgen tief in mir stecken, spürte, dass es allmählich wachsen und stärker werden würde, und sah voraus, dass es mich besiegen würde. Wie sehr ich auch dagegen ankämpfen würde, es würde mich besiegen.
Ich erinnere mich gut an Vaters Todestag. Ein Nachbarin machte die Tür zur Gemeinschaftswohnung auf. Sie war eine herzliche jüdische Dame und hatte mich oft mit Kringeln aus der jüdischen Küche verwöhnt, die mit einer braunen, etwas zähen Glasur überzogen waren. Sie nahm mich liebevoll in den Arm, presste mich an ihr weiches Häkeltuch und schluchzte leise. Dann nahm sie mich an die Hand und wir gingen in Vaters Kammer. Dort lag er – ausgemergelt, mit halb geöffnetem Mund. Die Nachbarn hatten erst am zweiten Tag, nachdem er zu atmen aufgehört hatte, die Tür eingeschlagen.
Auf der fleckigen Couch und überall unter ihm lagen Zeitungen, aus denen uns die Gesichter froher Arbeiter und gerahmter Politbüromitglieder entgegenblickten. Er lag zwischen Texten, die den Fünfjahresplan in einem Jahr versprachen und die hohe hehre Moral des Kommunismus priesen, Texten, die dazu aufriefen, neue Städte in den großen Weiten zu bauen (wo Tausende unschuldig Gestorbene lagerten, die das Wesen ihres Vergehens so auch nicht erfuhren), zwischen Texten, die dazu aufriefen, die Ströme der Flüsse umzulenken, in Kirchen Dünger zu lagern und das Erbe der Vergangenheit in Büchern und Kunstwerken auszulöschen.
So lag er dort, einer von vielen, er hatte still kapituliert und war in einer Ecke gestorben, denn er vermochte nicht gegen die Epoche zu kämpfen, war unfähig zu vergessen, sich anzupassen, körperliche, geistige Erniedrigungen zu schlucken, Schande, Entehrung, Enttäuschung. Schuldlos schuldig. Auf die Müllhalde der Epoche geworfen. Höchstwahrscheinlich wurde er in einem Sammelgrab für Obdachlose am Stadtrand beerdigt. Meine Mutter fragte nie danach und erfuhr nie von seinem Tod. Sie schützte ihr neues Leben und versuchte, auch mich darin zu beschützen.
*
Meine Eltern, das waren für mich die Mutter meiner Mutter und ihr Stiefvater. Meine Mutter war ein Wesen, das außerhalb des Familienverbands stand. Etwas, um das sich unsere Leben drehten, dem sie sich unterordneten, mit dem sie etwas untrennbar verband und von dem sie abhingen. Die ständigen Kämpfe ihrer Engel und Dämonen, die zeitweise unseren Alltag aus Zeit und Raum hinauskatapultierten. Die uns in einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse hineinrissen und auf der fragilen Grenze zwischen Leben und Tod balancieren ließen. Voll Sorge warteten wir darauf, dass sie nach Hause kam, und atmeten manches Mal erleichtert auf, wenn sie die Tür aufmachte. Wir konnten nicht wissen, was der kommende Tag oder die kommende Nacht bringen würde. Keiner von uns wusste etwas über meinen Vater. Großmutter meinte, dass sie sich vielleicht auf einem Dorffest getroffen hatten, zu dem hinzugehen sie und ihre Schwester sie gedrängt hatten. Jedenfalls war meine Mutter danach schwanger. Mehr wusste niemand. Aber ich stelle es mir vor, wie sie sich begegnet sind.
Wie sind sie sich begegnet?
Während sie in der kleinen Küche im kleinen Haus der Schwester ihrer Mutter den löslichen Kaffee umrührt, kündet das krächzende Transistorradio zum wiederholten Male, dass heute der (wievielte?) Januar 1969 ist. Ein Januarmorgen in ihrem Leben, an dem sie, zu Besuch bei ihrer Tante auf dem Land, versucht, den Blödsinn des wissenschaftlichen Kommunismus schnell durchzulesen und im Gedächtnis zu behalten, um die übrige Zeit der Medizin und der Entstehung des Lebens zu widmen, sowie hin und wieder den Werken von Boris Pasternak und Jean Paul Sartre in gelblichen Kopien. Sie wird Ärztin, sie wird Wissenschaftlerin, was auch immer sie dafür tun muss. Bisher fällt es ihr leicht, ihr Studium im offiziellen System zu durchlaufen und sich parallel dazu eine ganz andere, verbotene Bildung anzueignen. Mutter und Tante machen sich Sorgen. Sie kann tagelang in ihrem Zimmer bleiben und lesen. Sie ist schon über zwanzig, aber noch nie wurde ein junger Mann an ihrer Seite gesehen. Ist sie attraktiv? Ja, besonders, wenn sie abmagert. Zarte Knochen, runde, feste Brüste. Blondes Haar, das sie manchmal bleicht. Sommersprossige Haut, kleine Hände.
Über ihre Kleidung macht sie sich kaum Gedanken. Sogar in die Uni geht sie in weiten, bequemen Hosen, auch wenn sie die ängstlichen, argwöhnischen Blicke von Dozenten und Kommilitonen spürt. Hosen schicken sich für Frauen nur sonnabends und beim Ernteeinsatz. Ansonsten haben sie knieumspielende Röcke zu tragen, oder zurückhaltende Minis, wenn die Mode es gerade verlangt.
Während die Tante ihrem Mann Kartoffeln zum Frühstück brät, trinkt sie bitteren Kaffee, sieht aus dem Fenster und denkt, dass der riesige Wal, von dem der wilde Kapitän besessen ist, wohl ein Name für die starke Seelenkraft ist, gegen die man sich nicht wehren kann, die einen immer weiter vorwärts und schließlich ins Meer hinein treibt.
Am Abend stecken Mutter und Tante sie beinahe mit Gewalt in das Kleid, das ihr Bruder aus England geschickt hat. Sie soll endlich aufhören, sich in diese Bücher zu verbeißen, sie soll jetzt lieber ins Dorfklubhaus gehen zum Ball. Das örtliche Ensemble spielt, es gibt Häppchen und Erfrischungen, und vor allem wird getanzt. Das oberschlaue Stadtfräulein soll mal ordentlich mit den Landburschen tanzen. Sie soll bloß nicht denken, dass sie entkommt, die beiden Schwestern bringen sie bis an die Tür des Klubhauses.
Als sie die Tür aufmacht, weiß sie nicht, womit sie das, was sie sieht, vergleichen soll. Auf der Bühne bewegt sich hölzern ein Sänger.
Eine weiße Karavelle
gleitet durch das Himmelszelt,
wenn ein Tag
mit der Nacht
in den ewgen Abgrund fällt.
Auf der Tanzfläche bewegen sich mehrere Paare. Die einen versuchen sich im freien Tanz, andere halten sich gefasst wie zum Walzer. Am Buffet an der einen Seite des Saals drängeln sich die Dorfschönheiten mit selbstgemachten Türmen auf dem Kopf. Die Jungs treten am anderen Ende auf der Stelle.
Wenn ein Tag mit der Nacht in den ewgen Abgrund fällt.
Was tut sie hier? Was zum Himmel tut sie hier? Sie versteht nicht, was hier vor sich geht – Das Sein oder Das Nichts?
Doch natürlich zieht das von Mutters Bruder aus England geschickte Kleid sofort die Blicke der konkurrierenden Gruppe auf sich. Auch ihr blonder, glatt gekämmter Bubikopf.
Sie hofft, dass die Schwestern nicht mehr vor der Tür stehen wie Zerberusse, um sie in die sieben Kreise der Hölle zurückzustoßen. Zur Sicherheit wird sie noch ein wenig hierbleiben und dann rausgehen, einen langen Spaziergang machen, am Seeufer verweilen und bei ihrer Rückkehr vorspielen, bis zum Umfallen getanzt zu haben und dass der Jüngling, der sie nach Hause gebracht hat, zu schüchtern war, um herein zu kommen und Guten Abend zu sagen.
Sie richtet sich in einer Ecke in der Nähe der Tür ein und wird fast fröhlich beim Beobachten der Tanzenden.
Wenn ein Tag mit der Nacht in den ewgen Abgrund fällt.
Doch dann kommt quer durch den Saal ein klein gewachsener junger Mann auf sie zu. Sie hofft noch, dass seine Bahn abgelenkt wird, aber sehr bald ist klar, dass er auf sie zusteuert. Höflich bittet er um einen Tanz. Sie erwägt nicht einmal ihre Möglichkeiten. Gibt ihm einfach die Hand und reiht sich unter die Tanzenden ein. Sie tanzen Walzer. Er ist ungefähr so groß wie sie, aber er tanzt gut und sicher. Manchmal berührt seine Wange die ihre und sie konstatiert, dass das nicht unangenehm ist. In der Pause zwischen zwei Tänzen machen sie dasselbe wie die anderen Paare, sie stehen ein Stück weit auseinander, wissen nicht, wohin mit den Händen, und warten auf das nächste Lied. Nach dem zehnten Tanz lädt er sie ein, am Rand der Tanzfläche ein Glas Wein zu trinken. An den Tischen herrscht ein großes Gedränge, aber er schlüpft geschickt zwischen den Anstehenden hindurch und taucht aus dem Gewühl mit zwei Weingläsern auf. Sie setzen sich und trinken.
Sie wird Ärztin, Wissenschaftlerin.
Ach so. Er arbeitet zur Zeit als Mechaniker. Was hat sie denn hierher geführt?
Besuch bei der Tante auf dem Land.
Wie gefällt es ihr denn auf dem Land?
Ganz gut. Wenn sie Bücher hätte, könnte sie auf dem Land leben.
Was wird sie denn mal werden?
Wissenschaftlerin.
Ach so. Er würde gerne studieren und Flugzeugingenieur werden. Noch ein Tanz?
Nein.
Darf er sie zum Haus ihrer Tante begleiten?
Ja.
Die Januarnacht ist ungewöhnlich mild. Sie gehen zum See, der noch nicht zugefroren ist. Er sammelt flache Steinchen und zeigt ihr, wie man sie übers Wasser hüpfen lässt. Ihre Gedanken wandern, während sie versucht, sagen wir, Feuerbach zu begreifen… Der Mensch urteilt über die Natur in Analogie zu sich, so nähert er sie scheinbar sich selber an… Das Steinchen berührt leicht die Wasseroberfläche und fliegt einen weiteren Bogen, aber um ein Diplom zu bekommen, muss sie Feuerbachs Atheismus begründen können. Das Steinchen versinkt.
Danach lädt er sie auf einen Tee ein, ganz in der Nähe, in ein Wachhäuschen, in dem die Nacht dann vergeht.
*
Nach Vaters Tod wuchs in mir langsam, aber sehr bestimmt der Hass gegen die bestehende Gesellschaftsordnung und gegen meine Mutter. Eingeschüchtert und ihrer Biographie wegen im Visier der Obrigkeit, schärfte sie mir jeden Morgen vor der Schule ein, gewissenhaft alles aufzunehmen, was die Lehrer lehrten, nicht zu widersprechen und mich aktiv bei den Pionieren und später im Komsomol zu beteiligen. Der Hintergrund meines Stiefvaters – eines Kämpfers der siegreichen Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg – schützte meine Mutter. Ein Hintergrund, der mit der roten Farbe der Wahrheit einen anderen Hintergrund übermalt hatte: dass er im unabhängigen Lettland im Wachdienst des Präsidenten angestellt war und dass sein Bruder sich freiwillig zur deutschen Armee gemeldet hatte. Bruder gegen Bruder: die blutige Polka der Geschichte.
Spätabends in der Küche sprachen meine Mutter und mein Stiefvater über ihre Brüder. Der Bruder meines Stiefvaters war als Vaterlandsverräter mit dem Tod bestraft worden. Zuvor hatte man ihn wegen eines ihm selbst unbekannten Verrats gefoltert. Die russischen Hunde, sagte mein Stiefvater mit gepresster Stimme. Mir war das unerklärlich. Mit diesen Hunden war er doch Schulter an Schulter fast bis Berlin marschiert; zu den Feiertagen im Mai und November ging er auf die Kundgebungen dieser Hunde und bekam ein Päckchen mit Lebensmitteln, die man im Laden nicht kaufen konnte, zum Beispiel geräucherte Hartwurst, löslicher Kaffee und eingelegte Gurken und Tomaten aus dem Bruderland Bulgarien.
Der Bruder meiner Mutter lebte gesund und munter in London, von wo wir Päckchen mit unerhörten Dingen erhielten: wunderschöne Stoffe, Garnrollen und Schnittmuster, nach denen meine Mutter Kleider schneiderte. Dort in London besaß mein Onkel eine Kleiderfabrik. Zweimal pro Jahr schrieb meine Mutter ein Gesuch an die sowjetischen Behörden mit der Bitte, ihren Bruder besuchen zu dürfen. Zweimal pro Jahr erhielt sie eine offizielle Antwort mit dem Bescheid: unbegründet, abgelehnt. Ihre zehn Jahre währende Korrespondenz mit den Behörden endete mit dem letzten Gesuch, dem um Erlaubnis, zur Beerdigung ihres Bruders nach London zu fahren. Auch darauf erhielt sie den Bescheid: unbegründet, abgelehnt.
Ungeachtet dieser Absurditäten fuhr meine Mutter zielstrebig fort, mich auf die gerade Bahn einer rechtschaffenen und vertrauenswürdigen jungen Sowjetbürgerin zu lenken. Und genauso zielstrebig blühte in mir der Hass gegen diese ganze Scheinheiligkeit auf, die die Menschen zu einem Doppelleben zwang. Dazu, auf den Mai- und Novemberdemonstrationen Fahnen zu schwenken zum Lobpreis der Roten Armee, der stärksten Armee der Welt, der Revolution und des Kommunismus, und dann daheim in der Küche alles mit einem Gläschen wegzuspülen, sich zu bekreuzigen und auf die englische Armee zu warten, die über Bolderāja einmarschieren und Lettland vom russischen Joch befreien würde.
Wenn ich meine heuchlerische Rolle in der Schule gewissenhaft erfüllt hatte, zog ich mich immer weiter in mich zurück und las das Lexikon der Medizin, das nach dem Tod des Professors in unseren Besitz gekommen war. Er hatte ganz allein in der Wohnung über uns gewohnt, und die neuen Mieter hatten seine Bibliothek einfach zum Fenster hinaus geworfen. Im Hof entstand rasch ein riesiger Bücherhaufen, von dem sich jeder nehmen konnte, was er wollte. Meine Mutter staunte nicht schlecht, als ich die Bände des großen Lexikons die Treppen hoch schleppte, machte aber keine Einwände, um die wachsende Kluft zwischen uns nicht noch zu vergrößern.
Da war sie: die Wahrheit über das erbärmliche und heuchlerische Geschöpf, das man Mensch nannte. Ein Gewirr von Blutbahnen, aufgewickelte Därme, Drüsen und Sekrete, Lymphen und Arterien, Phalli und Vaginas, Hodensäcke und Gebärmütter.
Die göttliche Wahrheit, in der so viele feine Lebensmechanismen zusammenwirkten, in der jeder Zufall zu einem Verhängnis werden konnte, aber es nicht wurde, denn dieses Gebilde war erschaffen zum Leben, nicht zum Sterben. Und der Tod war in dieser Geschichte nur ein zufällig unvermeidbarer Haltepunkt.
*
Wenn ich an meine Mutter denke, an ihre und meine Geburt, wird mir immer bewusst, dass alles so verdammt abhängig ist von den äußeren Umständen, die selbst entweder Folge eines ebenso verdammten Zufalls sind oder Teil eines großen, unverständlichen Plans. Ort und Zeit unserer Geburt bestimmen unser Leben. Wir hätten ein anderes Leben gehabt, wenn wir nur woanders geboren wären. Ich hätte zum Beispiel eines der Kinder sein können, die im August 1969 in Woodstock geboren wurden. Wie man weiß, sind während des Festivals drei Menschen gestorben – einer an einer Überdosis Heroin, der zweite wurde von einem Traktor überfahren und der dritte fiel von einem hohen Gerüst. Und zwei Kinder wurden geboren. Außerdem kamen neun Monate nach dem Festival noch Tausende Kinder auf die Welt, die in Woodstock gezeugt worden waren.
In meiner Vorstellung sehe ich meine Mutter nicht als Medizinstudentin im sowjetischen Lettland, die sich ein Kind eingefangen hat, das sie nicht gewollt hatte, die durch das graue herbstliche Riga geht in einem zu engen Mantel, den der Bruder ihrer Mutter, den sie nie sehen wird, aus London geschickt hat. Der Mantel wird nur von einem Knopf über ihrem dicken Bauch zugehalten, ihre Stiefel sind schon stark abgetragen, und unterm Arm trägt sie ihre Mitschrift aus der Endokrinologie. Nicht so sehe ich sie, sondern mit langen glatten Haaren, einem bunten Stirnband, der dicke Bauch nur halb versteckt unter einer geblümten Bluse, darunter lockere Jeans. Alles ist anders: in diesem Paralleluniversum herrscht das Chaos der Freiheit, es duftet nach Gras und Sperma. The Who singen „See me, feel me“, und als das Lied beginnt, geht die Sonne auf. Freiheit und Welt kennen keine Grenzen. Vor lauter Glück und nach dem zweiten Joint setzen bei meiner Mutter die Wehen vorzeitig ein.