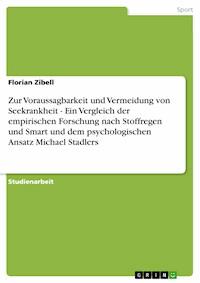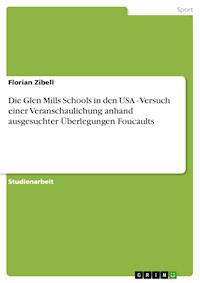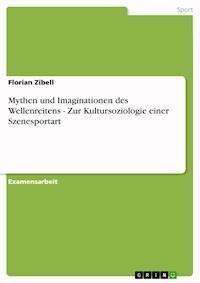
Mythen und Imaginationen des Wellenreitens - Zur Kultursoziologie einer Szenesportart E-Book
Florian Zibell
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Sport - Sportsoziologie, Note: 2.0, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Fragen nach den Kernthemen der Wellenreiterszene, die sich in den Mythen und Imaginationen der Szene äußern. In der anfänglichen Einengung auf das Szenekonzept sind Fragen nach der Konstitution von Szenen sowie der speziellen Kultur von Szenen angelegt, die ich in Form einer datengestützten Analyse und Konstruktion der (Kern-)Themenbereiche versuche zu beantworten. Fragen nach historischer Werdung, Hintergründen und möglicher Anbindung der Themen an bestehende Untersuchungen und theoretische Konzepte wird nachgegangen. Ziel ist es dabei, anhand unterschiedlicher Materialien die geteilten mythenhaften Erzählungen, Vorstellungen und mögliche Wissensbestände der Szene darzustellen und tiefer gehend zu beleuchten. In einem weiteren Punkt soll in verkürzter Form ausgesuchten Fragen nach der tieferen Verbindung der Praktiken und Imaginationen, sowie den Mythen des Wellenreitens nachgegangen werden. Wissenschaftliche Betrachtungen zum Wellenreiten sind kaum vorhanden, die wenigen Abhandlungen, die ich hier benutze, stammen fast ausschließlich aus dem englischsprachigen Raum. Sie behandeln, abgesehen von dem hervorragenden Werk von Nick Ford und David Brown1, meist kleine Teilbereiche des weiten Feldes des Surfens. Ich möchte unter anderem im Rückgriff auf die theoretischen Grundlagen des Szenekonzeptes von Hitzler, Bucher und Niederbacher versuchen, ein vertieftes Verständnis dreier ausgewählter Kernbereiche der Surfszene, noch genauer formuliert der Kultur dieser Szene, zu ermöglichen und somit einen weiteren, bisher wenig beachteten Teilbereich zu beleuchten. Neben dem Nachweis der besonderen Stellung und der herausragenden Bedeutung dieser Themen soll es also darum gehen, einige der Gründe anzuführen, die zu dem vertieften Interesse und den resultierenden Wirkungen auf Szenegänger beitragen mögen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien
Thema: Mythen und Imaginationen des Wellenreitens - Zur
Name des Kandidaten: Florian Zibell
Bearbeitungszeitraum vom 1. August 2006 bis 1. Dezember 2006
Page 2
1. Einleitung
Seit ich 1999 in Australien meine persönliche Initiation in das Surfen durch den freundlichen Chef eines Backpackerhostels mit den ungefähren Worten „You just take that thing down to the water and give it a go!“ erhielt, fasziniert mich die Auseinandersetzung mit den Kräften des Meeres. Mit Aufnahme des Sportstudiums und insbesondere der Beschäftigung mit unterschiedlichen Themen der Sportsoziologie wuchs nicht nur mein persönliches, sondern auch mein wissenschaftliches Interesse an einem sich mir immer mehr öffnenden Sonderbereich der Sportausübung. Hatte ich mich noch vor meinen ersten eigenen praktischen Erfahrungen gar nicht mit dem Surfen auseinandergesetzt, so konnte ich in den folgenden Jahren feststellen, wie ich in immer tiefere Schichten einer ‚Sportszene’, wie sie hier genannt werden soll, vordrang. In beeindruckender Form konnte ich feststellen, wie sich meine auf Wellen und Orte bezogenen Wahrnehmung änderte, ich meinen Sprach- und Kleidungsstil zumindest in Teilen an andere Surfern anglich und meine Urlaubsplanungen sich zunehmend in Bahnen vorher nicht bekannter Ideen und Vorstellungen entwickelten. Die wiederkehrenden Mythen und Imaginationen - die ich mit vielen anderen Wellenreitern zu teilen schien - und an denen ich mich vermehrt orientierte, die ich hörte, erzählte und lebte, haben mich dabei schon immer in besonderem Maße interessiert. Meine Arbeit verstehe ich somit auch als Hinterfragung meiner eigenen Entwicklung.
Wissenschaftliche Betrachtungen zum Wellenreiten sind kaum vorhanden, die wenigen Abhandlungen, die ich hier benutze, stammen fast ausschließlich aus dem englischsprachigen Raum. Sie behandeln, abgesehen von dem hervorragenden Werk von Nick Ford und David Brown1, meist kleine Teilbereiche des weiten Feldes des ‚Surfens’.
Ich möchte - unter anderem im Rückgriff auf die theoretischen Grundlagen des Szenekonzeptes von Hitzler, Bucher und Niederbacher - versuchen, ein vertieftes Verständnis dreier ausgewählter Kernbereiche der Surfszene, noch genauer formuliert der Kultur dieser Szene, zu ermöglichen und somit einen weiteren,
1Ford, Nick/Brown, David: Surfing and Social Theory. Experience, embodiment and narrative of the dream glide, New York: Routledge 2006
Page 3
bisher wenig beachteten Teilbereich zu beleuchten. Neben dem Nachweis der besonderen Stellung und der herausragenden Bedeutung dieser Themen soll es also darum gehen, einige der Gründe anzuführen, die zu dem vertieften Interesse und den resultierenden Wirkungen auf Szenegänger beitragen mögen.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinen Eltern, die es mir erst ermöglicht haben die diversen ‚Forschungsreisen’ durchzuführen, die nötig waren um ein vertieftes Verständnis der Wellenreiterszene zu erlangen und somit einen Teil des Fundamentes dieser Arbeit zu schaffen.
2. Fragestellung und Erkenntnisinteresse
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Fragen nach den Kernthemen der ‚Wellenreiterszene’, die sich in den Mythen und Imaginationen der Szene äußern. In der anfänglichen Einengung auf das Szenekonzept sind Fragen nach der Konstitution von Szenen sowie der speziellen Kultur von Szenen angelegt, die ich in Form einer datengestützten Analyse und Konstruktion der (Kern-)Themenbereiche versuche zu beantworten. Fragen nach historischer Werdung, Hintergründen und möglicher Anbindung der Themen an bestehende Untersuchungen und theoretische Konzepte wird nachgegangen. Ziel ist es dabei, anhand unterschiedlicher Materialien (siehe 6.) die geteilten mythenhaften Erzählungen, Vorstellungen und mögliche Wissensbestände der Szene darzustellen und tiefer gehend zu beleuchten. In einem weiteren Punkt soll in verkürzter Form ausgesuchten Fragen nach der tieferen Verbindung der Praktiken und Imaginationen, sowie den Mythen des Wellenreitens nachgegangen werden.
Page 4
3. Aufbau der Arbeit
Nach den einleitenden Worten, der Formulierung des Erkenntnisinteresses und der Erklärung des Aufbaus der Arbeit in Punkt 1,2 und 3 folgt eine kurze Darstellung der historischen Entwicklung des Wellenreitens in Punkt 4. Der folgende Punkt 5 beinhaltet Betrachtungen zur Szene, welche unterteilt sind in eine Begründung der Auswahl (5.1) des Szenekonzeptes, eine Definition des Szenebegriffes, die unter anderem zwölf grundlegende Kategorien enthält (5.2), eine Kurzbeschreibung der Wellenreiterszene (5.3) sowie eine Fokussierung auf den Bereich der Szenekultur (5.4).
In Punkt 6 werden ausführlich die Methode zur Auswahl der drei Komplexe und damit einhergehende Überlegungen sowie die vorliegende Datensammlung aus „Szenedokumenten“ vorgestellt.
Die folgende Darstellung der Themenbereiche in Punkt 7 beginnt je mit einer sehr kurzen Einleitung, gefolgt von Ausführungen zur (historischen) Entwicklung, auch im Rückgriff auf Punkt 4 (Geschichte des Wellenreitens). Im Weiteren werden der Bereich und seine bedeutendsten Eigenschaften, sowie szeneinterne Bedeutungen und Deutungsschemata beschrieben. Diese werden dabei je mit Beispielen versehen und wo möglich an bestehende Untersuchungen und theoretische Ansätze angebunden, um abschließend je noch einmal kurz zusammengefasst zu werden. Der Punkt wird von einem Zwischenfazit abgerundet.
In Punkt 8 wird weiterführenden Fragestellungen nachgegangen, die Konzentration liegt dabei auf der möglichen Verbindung von Imaginationen und Praktiken. Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit in Punkt 9, das unter anderem zusammenfasst, ein Resümee der Arbeit zieht und einen Ausblick gibt.
Ein Großteil der fast ausschließlich englischsprachigen Zitate wird in der Arbeit im Original wiedergegeben, um eine korrekte Wiedergaben des Sinnes zu gewährleisten. Ebenso verwende ich ausschließlich die männliche Form. Handelt es sich bei einem Großteil der von mir zitierten und untersuchten Personen zwar tatsächlich um Männer, so sind grundsätzlich doch immer beide, Frauen und Männer gemeint.
Page 5
4. Historischer Abriss zur Entwicklung des Wellenreitens
Ich werde hier einleitend einen stark verkürzten Abriss der Geschichte des Wellenreitens geben, der die kulturelle Werdung und Veränderung dieser Lebens-und Bewegungsform aufzeigt und als Grundlage zu den weiteren Ausführungen unerlässlich ist.
Ich beziehe mich dabei grundsätzlich in der gesamten Arbeit nur auf das im englischen als „Stand-up-surfing“ bezeichnete, also auf das Abreiten von Wellen im Stand, betrieben mit Hilfe eines Surfbretts. Die Begrifflichkeiten des Surfens und Wellenreitens werden dabei synonym verwendet.
Im Gegensatz zu den im deutschen Sprachgebrauch heute als Szenesportarten bezeichneten, wie etwa Skate- oder Snowboarding, BMX-fahren oder Paragliding, kann sich das Wellenreiten auf eine weit zurückreichende Geschichte berufen, im Rahmen derer trotz einiger Veränderungen die Auseinandersetzung mit den Wellen und dem Ozean als elementarster Bestandteil immer im Vordergrund stand.
Anfang und Ende
Schätzungen bewegen sich dahingehend, dass Wellenreiten als polynesische Erfindung auf den hawaiianischen Inseln seit ca. dem Jahr 1000 unserer Zeitrechnung betrieben wird, verwandte Formen sogar deutlich länger.2Der Praktik, die von einem Großteil der Bevölkerung ausgeübt wurde, wird eine tiefe Verwurzelung in der hawaiianischen Kultur, beladen mit religiösen Zügen, nachgesagt.3Wellenreiche Tage sollen dazu geführt haben, dass andere Beschäftigungen ruhten,4Könige sicherten sich die besten Wellen und Plätze, es gab sogar Wettkämpfe5und bei Ausbleiben geeigneter Dünung hatte ein spezieller
2Vgl. Warshaw, Matt: The encyclopedia of Surfing, Orlando (u.a): Harcourt 2005, S.XIII, gemeint ist etwa das Abreiten von Wellen mit Hilfe von aus gebündeltem Schilf bestehenden Schwimmkörpern.
3Vgl. etwa: Kampion, Drew/Brown, Bruce: Stoked. Die Geschichte des Surfens, Los Angeles: Evergreen 1997, S.29/30.
4Vgl. Duane, Daniel: Caught Inside: A Surfer´s Year on the Californian Coast, New York: North Point Press 1996, S.85.
5Vgl. etwa Wardlaw, Lee: Cowabunga! The Complete Book of Surfing, ohne Ortsangabe: Avon Books 1991, S.5.
Page 6
Priester, ein so genannterKahunaZeremonien abzuhalten, die helfen sollten Wellen heraufzubeschwören.6
Seine erste schriftliche Erwähnung findet das Surfen bei Captain James Cook, der nach der anfänglichen Fehlannahme, der von ihm beobachtete Hawaiianer habe etwas von einem seiner Boote gestohlen und befinde sich nun auf der Flucht, die wiederholten Ritte eines Kanu-Surfer auf einer Welle im Jahr 1777 mit den folgenden Worten beschreibt:
„I could not help concluding that this man felt the most supreme pleasure while he was driven on so fast and so smoothly by the sea.“7
Cook scheint, einer Form eines gemeinsamen Verständnisses des Meeres gleich, die Freude zu verstehen, die der Hawaiianer beim Ritt auf der Welle empfindet. Auch Cooks Erster Leutnant James King ergeht sich später auf derselben Reise im Bezug auf stehende Surfer voller Begeisterung:
„their first object is to place themselves on the summit of the largest surge, by which they are driven with amazing rapidity toward shore”.8
Surfboards, die so genannten „Paipos“, „Alaias“ und „Olos“ waren damals üblicherweise aus den verschiedenen vorhandenen Harthölzern gefertigt, wogen bis zu 75 Kilo und waren ungefähr 12 bis 17 Fuß lang. Der Prozess der Herstellung war extrem langwierig und wurde von verschiedenen religiösen Ritualen begleitet.9Insgesamt nahm das Wellenreiten damit eine zentrale Stellung in der polynesischen Gesellschaft ein.10
Interessant zu folgen ist dazu auch der Argumentation Martin Reeds, der Verbindungen von den Anfängen der Surfkultur und ihrer entscheidenden Rolle im Alltag der Hawaiianer - bezüglich der lockeren Einstellungen der Hawaiianer zu Arbeit, Freizeit und Müßiggang - zu den vermeintlichen später und auch heute noch in Teilen, dem Wellenreiten grundlegenden Einstellungen und Grundhaltungen herstellt. In diesem Zusammenhang erwähnt er beispielsweise auch, Cook habe in seinem Logbuch explizit das Desinteresse der Hawaiianer ihm
6Vgl. Kampion/Brown 1997 S.30f.
7Cook in Duane 1996, S.18.
8King 1784, zitiert in Finney/Houston 1996, S.21, in Reed, Michael Allen: Waves of Commodification: A Critical Investigation Into Surfing Subculture, Unveröffentlichte Arbeit zur Erlangung des Master-Titels, vorgelegt an der San Diego State University 1999.
9Vgl. Wardlaw 1991, S.9f und Kampion/Brown 1997, S.30.
10Vgl. Warshaw 2005, S.XIII.
Page 7
gegenüber erwähnt, wenn sie gerade dem Surfen nachgingen, eine Vorstellung, die sich mit der völligen Hingabe heutiger Surfer deckt.11
Hatten die Freuden der Hawaiianer an der Beschäftigung mit dem Meer und den Wellen also eine lange Tradition, so kam das Ende umso abrupter. Das Ende brachte die Besiedlung durch amerikanische Calvinisten und die Ankunft von Missionaren ab 1820.12War ein beachtlicher Teil der Bevölkerung schon vorher von durch Seefahrer eingeschleppten Krankheiten dahingerafft worden, so setzten die Missionare dem nach ihrem Ermessen unproduktiven, sündenbehafteten Lebensstil der Hawaiianer und damit auch dem Spiel in den Wellen nun endgültig ein Ende.13
Renaissance
Mark Twain beschreibt zwar bereits 1850 inRoughing Itseine Erfahrungen mit dem Surfbrett,14doch erst deutlich später, am Anfang des 20ten Jahrhunderts, erlebt das Surfen, infolge des abnehmenden Einflusses der Missionare und des zunehmenden Tourismus auf den Inseln seine Wiedergeburt.15Romantisierte Reiseberichte über das Surfen, wie der Jack Londons imWomen´s Home Companion16, erweckten vermehrtes Interesse bei den vornehmlich reichen amerikanischen Touristen, die nach Hawaii reisten.17Dort gründeten Alexander Ford und George Freeth dann auch die erste „Surforganisation“, denOutrigger Canoe and Surfboard Club.18Diese Beiden, sowie ein Mann namens Duke Kahanamoku waren es, die sich zu den bedeutendsten Persönlichkeiten dieser frühen Ära entwickelten. Freeth war 1907 der Erste, der das Surfen im Rahmen einer Werbeveranstaltung für eine Eisenbahnlinie auf dem amerikanischen Festland vorführte,19Ford schrieb in seiner Funktion als Journalist diverse Artikel
11Vgl. Reed 1999, S.19.
12Vgl. Warshaw, Matt: Zero Break. An Illustrated Collection of Surf Writing 1777-2004, ohne Ortsangabe: Harcourt 2004, S.XII.
13Vgl. Kampion/Brown 1997, S.33.
14Vgl. Duane 1996, S.20.
15Vgl. Warshaw 2005, S.XIV.
16Vgl. Reed 1999, S.21.
17Ormrod, Joan: Endless Summer (1964): Consuming Waves and Surfing the Frontier, In: Film and History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies. Ausgabe 35.1 2005 S.45.
18Vgl. Kampion/Brown 1997, S.36.
19Vgl. ebd., S.37.
Page 8
über den Sport20und Kahanamoku, als späterer Olympia-Goldmedaillengewinner und Inbegriff desBeachboys,nutzte seine enorme Popularität zur weiteren Bekanntmachung der Sportart auch etwa in Australien und Neuseeland.21Die hawaiianischenBeachboyszu denen auch Kahanamoku zählte22, waren es auch, die schon früh das Bild des sorgenfreien, immer fröhlichen und entspannten Surfers prägen, der andere Ziele verfolgt, als viel zu arbeiten und reich zu werden.23Der Sport erfreute sich insbesondere auf den Inseln, aber vermehrt auch auf dem Festland Amerikas und in Australien zunehmender Beliebtheit und erhielt 1928 mit der Erfindung des hohlen und damit deutlich leichteren Surfboards durch Tom Blake erstmals starken Zulauf.24Die Erfindung des so genanntenHot-Curl-Boards1937 erlaubte es Wellenreitern zum ersten Mal, Wellen nicht nur in gerader Richtung auf den Strand zu, sondern fast parallel abzureiten. Den Entwicklungen neuer Techniken und einer vermehrten Zuwendung zu der noch jungen Sportart, wurde durch den Zweiten Weltkrieg jedoch ein vorläufiges Ende gesetzt.
1945-1966
Nach dem Weltkrieg kam es zu verschiedenen bedeutenden Entwicklungen. Zum einen wanderte das Zentrum der Surfkultur von den hawaiianischen Inseln auf das amerikanische Festland, genauer in die Gegend um Malibu, wo schon seit längerem ein hawaiianisch inspirierter Lebensstil von einer eingeschworenen Gemeinschaft von Aussteigern gepflegt wurde.25Hier fand auch eine der großen Innovationen der Zeit statt: die Erfindung desMalibu-oderPotato-Chipboardsum 1940, das sich durch eine vorne leicht aufgebogene Form, die Verwendung von sehr leichtem Balsaholz und die Ummantelung mit Fiberglas, sowie das Anbringen einer Finne auszeichnete.26Dieses fand seinen Weg interessanterweise aber erst in den 1950ern nach Australien, dem zweiten großen Zentrum der Wellenreitbewegung.27Mit seinen nur noch 30 Pfund Gewicht, aber einer gleich
20Vgl. Warshaw 2005, S.XIV.
21Vgl. ebd.
22AlsBeachboyswurden junge, meist einheimische Männer bezeichnet, die sich ihr Geld mit Surfunterricht,Lifesavingund anderen kleinen Arbeiten für die Hotels am Strand verdienten.
23Vgl. Warshaw 2005, S.XV, sowie insbesonders S.48.
24Vgl. Wardlaw 1991, S.27f.
25Vgl. Kampion/Brown 1997, S.53f.
26Vgl. zur Entwicklung der neuen Bretter die ausführliche Geschichte in: Warshaw 2005, S.121 oder Kampion/Brown 1997, S.56/57.
27Vgl. Warshaw 2005, S.XVI.