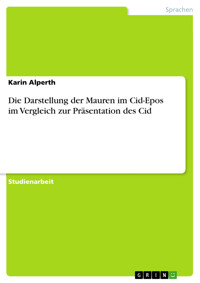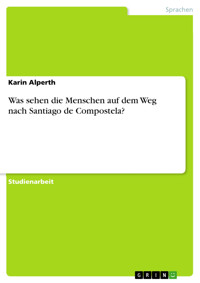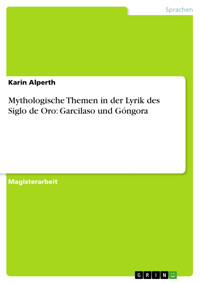
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Romanistik - Hispanistik, Note: 2,4, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Romanisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Mythologische Themen begleiten und beeinflussen seit Jahrtausenden das Leben und Denken der Menschen. Die vormals religiöse Bedeutung mythologischer Figuren in der Antike wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem schöngeistigen Interesse in Literatur und Kunst. Somit eroberte die Mythenwelt der Griechen und Römer anhand zahlreicher rezipierter Stoffe und mythologischer Kompilationen auch das nachchristliche Europa, einschließlich der Iberischen Halbinsel. Die Rezeption klassisch-mythologischer Quellen in der spanischen Literatur ist dabei von so großem Umfang, daß hier nur die mythologischen Themen in der Lyrik des Siglo de Oro am Beispiel von Garcilaso de la Vega und Luis de Góngora y Argote vorgestellt und untersucht werden sollen. Beide Dichter waren herausragende Persönlichkeiten und Repräsentanten ihrer jeweiligen Epochen: Garcilaso revolutionierte die Renaissancelyrik, während Góngora der Barockliteratur eine nachhaltige Prägung verlieh. Aus dem außerordentlich umfangreichen Werk dieser Autoren beschränken wir uns auf eine Auswahl ihrer mythologische Sonette, die Einblicke in deren Rezeption mythologischer Themen geben soll. Dabei kommt dem Petrarksimus und der italienischen Renaissancelyrik eine besondere Bedeutung zu, wie im Folgenden anhand der antikisierenden und italianisierenden Tendenzen beider Dichter zu sehen sein wird. Ehe die Sonette einer eingehenden Analyse auf syntagmatisher, pragmatischer und semantischer Ebene unterzogen werden, soll zunächst geklärt werden, was sich hinter dem Begriff der Mythologie verbirgt, und welche Zwecke und Funktionen sie im Laufe der Jahre hatte. In diesem Zusammenhang sollen Quellen aufgezeigt werden, die in Mittelalter und Neuzeit die Grundlage mythologischer Rezeption und Verarbeitung in Europa, insbesondere natürlich auch in Spanien, gebildet haben könnten. Im analytischen und wichtigsten Teil der Arbeit, der insbesondere auf der Sonettinterpretation aufbaut, wird anhand der Sonettinhalte versucht werden, die Funktion mythologischer Einschübe in den Texten zu ermitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Mythologische Themen begleiten und beeinflussen seit Jahrhunderten, ausgeweitet auf das Klassische Altertum sogar seit Jahrtausenden, das Leben der Menschen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Die ursprünglich religiöse Bedeutung mythologischer Figuren in der Antike wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem schöngeistigen Intresse seitens der Schriftsteller und Künstler. Somit eroberte die Mythenwelt der Griechen und Römer anhand zahlreicher rezipierter Stoffe und mythologischer Kompilationen auch das nachchristliche Europa, einschließlich der Iberischen Halbinsel. Die Rezeption klassisch- mythologischer Quellen in der spanischen Literatur ist dabei von so großem Umfang, daß eine Einschränkung des Arbeitsthemas vorgenommen werden mußte. Aus diesem Grund beschränkt sich die folgende Analyse nunmehr auf die mythologischen Themen in der Lyrik des Siglo de Oro am Beispiel zweier Autoren, Garcilaso de la Vega und Luis de Góngora y Argote. Beide Dichter waren herausragende Persönlichkeiten und Repräsentanten ihrer jeweiligen Epochen: Garcilaso revolutionierte die Renaissancelyrik, während Góngora der Barockliteratur eine entscheidende Prägung verlieh. Beide Schriftsteller haben eine Vielzahl lyrischer Werke verfaßt, welche in dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden konnten. Deshalb wurde eine Auswahl mythologisch gefärbter Sonette getroffen, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und lediglich einen Einblick in die Verarbeitungsweise mythologischer Themen in den Werken dieser Autoren geben soll. Dabei kommt dem Petrarksimus und der italienischen Renaissancelyrik eine besondere B edeutung zu, wie im Folgenden anhand der antikisierenden und italianisierenden Tendenzen beider Dichter zu sehen sein wird. Ehe die Sonette einer eingehenden Analyse auf syntagmatisher, pragmatischer und semantischer Ebene unterzogen werden, soll zunächst geklärt werden, was sich hinter dem Begriff der Mythologie verbirgt, und welche Zwecke und Funktionen sie im Laufe der Jahre zu erfüllen hatte. In diesem Zusammenhang sollen auch Quellen vorgestellt werden, die in Mittelalter und Neuzeit die Grundlage mythologischer Rezeption und Verarbeitung in Europa gebildet haben könnten. Auch hier wird keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, zumal die Fülle des Materials über den zur Verfügung stehenden Umfang dieser Arbeit hinausginge. Die Mythenrezeption des spanischen Mittelalters und der Neuzeit stellt einen weiteren Unterpunkt der Arbeit dar. Hier wird versucht werden, ein Resümee des
Page 4
Rezeptionsumfangs klassischen Gedankenguts zu erstellen. Darüberhinaus spielen die spezifischen lyrischen Tendenzen und geis tigen Haltungen der Renaissance und des Barock in einem weiteren Arbeitspunkt eine wichtige Rolle. Sie legen die Qualifikationen beider Dichter dar, auf denen auch die epochale Zuordnung Garcilasos und Góngoras beruht. Im analytischen Teil der Arbeit, der insbesondere auf der Sonettinterpretation aufbaut, wird anhand von Sonettaussagen versucht werden, die Funktion jeweiliger mythologischer Einschübe in den Texten zu ermitteln. Abschließend sollte erwähnt werden, daß aufgrund des eingeschränkten Umfangs die ser Arbeit, nicht alle Aspekte, die ein Leser der Abhandlung möglicherweise als fehlend empfinden könnte, erwähnt werden konnten. Dies kann natürlich Fragen unbeantwortet lassen, ist jedoch unvermeidlich, da lediglich die zentralen Punkte eines jeden Arbeitsteils in die Analyse einfließen konnten. Der Schwerpunkt dieser Studie liegt auf der Analyse der Sonette. Es kann sich aus dem Textfluß ergeben, daß einige Seiten nicht vollständig beschrieben wurden, was damit zu erklären ist, daß auf diese leeren Stellen die Sonette folgen, welche unbedingt durchgehend, ohne Seitenumbruch, abgebildet werden sollten. Die Literaturangaben in den Fußnoten geben die neustmöglichen Auflagen und Werkausgaben an, die während des Verfassens dieser Studie zugänglich waren. Den Ausführungen liegt die alte Rechtschreibung zugrunde.
2. Mythen und ihre Funktion
Gegenstand dieser Arbeit ist das Aufgreifen mythologischer Themen in der Lyrik des Siglo de Oro. Aber was genau sind Mythen, was ihre Funktion und weshalb spielen sie in der Literatur der Renaissance und des Barock eine so entscheidende Rolle? Dieser Frage soll hier nachgegangen werden, um Aufgabe und Bedeutung mythologischer Elemente im Wandel der Zeit besser einschätzen und bewerten zu können. An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß es sich um die griechisch - römische Mythenwelt handelt, welche nachhaltig Eingang in die europäische Literatur- und Kunstgeschichte gefunden hatte und somit unseren Studien zugrunde liegt. Es handelt sich beim folgenden Mythologie - Diskurs nur um einen einleitenden Überblick ins Thema, da eine Vertiefung der Materie über den
Page 5
hier zur Verfügung stehenden Rahmen hinausginge. Als Einstieg ins Sachgebiet soll ein enzyklopädisches Zitat dienen:
„[Mythen sind] meist Erzählungen, die ›letzte Fragen‹ des Menschen nach sich und seiner als übermächtig, geheimnisvoll und von göttl[ichem] Wirken bestimmt empfundenen Welt artikulieren und dieses Ganze von seinen Ursprüngen her verständlich zu machen suchen [...]. So handeln sie vom Anfang der Welt [...] und von ihrem Ende [...], vom Entstehen der Götter [...] und ihren Taten, vom Werden und Vergehen der Natur im Wechsel der Jahreszeiten, von Tag und Nacht [...].“1
Dies läßt erkennen, daß sich Zivilisationen von jeher mit Fragen nach der Entstehung der Welt befaßt und Erklärungen für das Leben auf Erden gesucht haben. Mythen boten Lösungen für das Gute wie das Böse auf Erden, für Krankheiten und Tod, für Krieg und Frieden, kurzum für Alltagssituationen, mit denen jeder Einzelne im Volk konfrontiert wurde. Auch existieren Mythen über den Ursprung von Stämmen und Völkern, der Begründung des Rechts sowie der staatlichen Ordnung eines Landes.2Mythologische Geschichten konnten auch als Leitfaden für das eigene Leben aufgefaßt werden, sozusagen als Belehrung oder Orientierung in bestimmten Situationen. Das Verständnis für mythologische Erzählungen und Figuren war im kulturellen Wissen der Antike verankert. Man benötigte auch als einfacher Bürger keine besondere Bildung, um mythologische Bezüge erfassen, verstehen und gegebenenfalls eine Lehre daraus ziehen zu können. Bei Lurker ist zum Thema Mythos Folgendes zu lesen: „Grundform menschlichen Erschließens der Wirklichkeit, die sich von Wissenschaft radikal unterschiedet, aber auch nicht Religion und Dichtung [...] gleichzustellen ist. M[ythos] ist eine bildliche Sinndeutung der Wirklichkeit, die sie verständlich macht, nicht aber durch wissenschaftliche Begriffe und Theorien, sondern durch Appell an eine imaginäre Welt von göttlichen und halbgöttlichen W esen, von historisch niemals existenten Helden, von phantastischen Geschöpfen und Elementen.“3
Lurker siedelt demnach Mythen jenseits der Wissenschaftlichkeit an, zumal sie ursprünglich auch nur mündlich tradiert worden sind („Das Wort ist das eigentliche Element des M[ythos]. Der M[ythos] ist eine Erzählung, die nur durch sprachliche Kommunikation und Überlieferung möglich ist.“4) und sich insbesondere in der Vorstellungskraft der Menschen manifestierten. In einer Zeit, in der die Wissenschaft
1BROCKHAUS. Die Enzyklopädie, Bd. 15, Leipzig / Mannheim201998, s.v.Mythos.
2Vgl. Ebd. s.v.Mythos.
3LURKER, Manfred (Hg.):Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart51991, s.v.Mythos.
4Ebd. s.v.Mythos.
Page 6
noch in den Kinderschuhen steckte, schienen Mythen die plausibelsten Erklärungen für bestehende, nicht real nachvollziehbare Zustände zu sein. Die Wissenschaft konnte noch nicht ›über den Tellerrand schauen‹, um die tatsächlichen Gründe des Daseins einer Kultur zu erfassen. Mythen übernahmen diese Aufgabe und appellierten an die imaginären Fähigkeiten der Bürger. Jeder Mensch erdachte für sich ein eigenes phantastisches Abbild der Wirklichkeit anhand mythologischer Schilderungen. Sie appellierten an die Sinnes- und Gefühlswelt des Volkes, ihr Verständnis erfolgte gewissermaßen von innen, aus dem Bauch, heraus. Ebenso hatten die Menschen die Möglichkeit in den Liebschaften, Streitereien und Problemen der Götter ihre eigenen Sorgen und Nöte wiederzuerkennen. Sie verfügten gewissermaßen über eine göttliche Vorgabe für die Lösung ihrer Anliegen und Nöte. Die Götter waren den Menschen durch ihre nahezu humanen Streitereien, Eifersüchteleien und Nöte sehr nahe; man fürchtete sie zwar, wußte jedoch auch, daß selbst sie Schwächen hatten. Ein Wesenszug, der sie um so menschlicher erscheinen ließ. Im Laufe der Jahrhunderte gab es eine Bedeutungsverschiebung der mythologischen Erzählungen, die schließlich nicht mehr als Glaubensangelegenheit betrachtet wurden, sondern aus denen Dichtern und Künstlern eine umfangreiche Quelle der Inspiration erwuchs. Eine der bedeutendsten Quellen für antike mythologische Stoffe ist Ovids zwischen 1 v. Chr. und 10 n. Chr. entstandenes episches Sagengedicht „Metamorphoseon Libri“5, das ein weites Spektrum mythologischer Erzählungen aufgriff und verarbeitete. Der Grundgedanke dieses Werkes, worin rund 250 Verwandlungssagen der griechischen und römischen Mythologie zum Hauptgegenstand erhoben wurden, ist das Prinzip der Verwandlung. Ovid folgte beim Verfassen seines Gedichts einem festgelegten Ablauf: „hinter der endlosen Reihe von Einzelmetamorphosen spielt sich die entscheidendste aller Verwandlungen ab, die Verwandlung der Welt vom Chaos ihres Beginns zur imperialen Ordnung der Augusteischen Epoche“6.
Er führt den Leser aus dem Dunkel der Prähistorie ins kultivierte Zeitalter des Kaisers Augustus. Aber weshalb machte Ovid die antiken Mythen zum Hauptthema seines Gedichts? Welche Funktion hatte er ihnen zugedacht? Eine mögliche Erklärung hierfür könnte man in der damaligen politischen Situation des Landes suchen. Nachdem Augustus den römischen Staat neu geordnet hatte - er knüpfte
5Vgl. JENS, Walter (Hg.):Kindlers Neues Literaturlexikon,Bd. 12, München 1991, s.v.Ovid.
6Ebd., s.v.Ovid.
Page 7
politisch an die römisch-republikanische Tradition an und erschuf damit ein gewissermaßen republikanisches Kaiserreich - strebte er eine Kräftigung des römischen Volkstums an, das unter den Wirren der Revolution stark gelitten hatte.7„Er [Augustus] knüpfte [...] bewußt an die alten Traditionen an und suchte die röm[ischen] Tugenden der Sittenstrenge[,] Hingabe an den Staat und soldatische Zucht neu zu wecken. [...] Er zog die geistig bedeutendsten Männer seiner Zeit, vor allem Künstler und Dichter, aber auch Historiker und Juristen an sich und regte sie an, durch Schilderungen der röm[ischen] Vergangenheit dem Volke zum Bewußtsein zu bringen, wo die Wurzeln seiner Kraft lagen.“8
Daraus ließe sich der Schluß ziehen, daß Ovid diesem Aufruf gefolgt war und eine „Verbindung der romantischen Welt griechischer Legende mit der vertrauten Welt römischer Geschichte“9schuf. DieMetamorphosengriffen die genealogischen Wurzeln des Volkes auf und präsentierten sie äußert geschmackvoll und erfolgreich der römischen Gesellschaft, ganz im Sinne des Kaisers. Daß es Ovid beim Verfassen derMetamorphosenzweifellos um die Gunst des Kaisers ging, bestätigt die Lektüre des Schlusses, der in einer Apotheose des Augustus´ endet.10Also könnte es Ovid speziell darum gegangen sein, die genealogische Linie des römischen Volkes in den Götter- und Heldengestalten der griechischen Mythologie zu verankern. Dies hätte den Römern ein gewissermaßen ›göttliches Prestige‹ eingebracht und, im Rahmen der römischen Identitätsfrage, auch psychologisch gestärkt. Jahrhunderte später entdeckten mittelalterliche Schriftgelehrte das antike Mythenerbe neu. Problematisch war zwar dessen heidnischen Ursprung, es wurde aber dennoch nicht völlig verworfen.
„Gewollt war sie [die Verwerfung der Mythologie] auch nicht, da es sich in der christlichen Idee des Auswählens aus dem antiken Erbe nicht so sehr darum handelte, das Mythische aus den dichterischen Werken der Heiden auszuklammern, sondern vielmehr darum, in den bestehenden Mythen das Erbauliche und selbst auch das Fromme hervorzuheben beziehungsweise herauszuinterpretieren.“11
7Vgl. LAMER, Hans:Wörterbuch der Antike,Stuttgart101995, s.v.Augustus.
8Ebd., s.v.Augustus.
9Einleitung von L. P. WILKINSON in : BREITENBACH, Hermann (Hg.):Publius Ovidius Naso: Metamorphosen,Stuttgart 2001, S. 18.
10Vgl. Ovid,Metamorphosen, 15,758ff.
11DOMÀNSKI, Juliusz:Bienen-Metapher und Mythologiekritik in der Renaissance,in: GUTHMÜLLER, Bodo/ KÜHLMANN, Wilhelm:Renaissancekultur und antike Mythologie,Tübingen 1999, S. 7.
Page 8
Moralisierende und allegorisierende Tendenzen traten an die Stelle der ursprünglich religiös geprägten Deutungsweise der Mythen, zumal die polytheistische Welt der Antike im Mittelalter nicht anders verarbeitet werden konnte. Man sah darin nicht mehr belehrende Erzählungen vom Ursprung der Welt, sondern versuchte dem christlichen Glauben folgend, darin einen tieferen, monotheistisch haltbaren Sinn zu finden.
„The mythology of the ancients was perceived as symbolical material capable of revealing hidden truths through allegorical interpretation. Christian truths were clothed in the attractive garb of fable in keeping with the medieval system of thought and imagination. During this period the reverence for the classics satisfied a moral end only [...].“12
Demnach schätzten Gelehrte zwar die äußere Form der Mythen, die polytheistische Grundhaltung der Antike stellte jedoch einen Affront für die christliche Kirche mit ihrer monotheistischen Glaubenshaltung dar. Wie konnte man also die für Literaten und Künstler attraktiven mythologischen Figuren und Geschic hten auch dem gläubigen Publikum präsentieren, ohne in Widerspruch zum christlichen Glauben zu treten? Es scheint, als sei die moralisierende Tendenz des Mittelalters eine optimale Lösung gewesen zu sein, zumal dieser These besonders die Geschichte und Bandbreite der Mythenrezeption Recht geben.13Zwischen 1350 und 1375 entstand schließlich das WerkGenealogie deorum gentilium,eine mythologische und mit wissenschaftlichem Anspruch verfaßte Enzyklopädie von Giovanni Boccaccio. Darin wurden aus zahlreichen Q uellen Stammbäume römischer und griechischer Götter rekonstruiert. Hierbei spielte auch Petrarcas Vorarbeit auf diesem Gebiet eine entscheidende Rolle.14Gleichzeitig offeriert Boccaccio unterschiedliche Deutungsweisen von Mythen, etwa die rationalistische, die physisch - naturhafte und die moralische Methode.15Cammarata bezeichnet Boccaccios Werk, dem insbesondere OvidsMetamorphosenals Quelle dienten, als „mythology´s bridge from the Middle Ages to the Renaissence.“16Und weiter:
12CAMMARATA, Joan:Mythological Themes in the Works of Garcilaso de la Vega,Potomac 1983, S. 10.
13Zur Vertiefung vgl. SEZNEC, Jean:The Survival of the Pagan Gods,New York 1953, S. 84ff.
14Vgl. JENS, s.v.Giovanni Boccaccio.
15Vgl. hierzu ebd., s.v.Giovanni Boccaccio.
16CAMMARATA, S. 10.
Page 10
höfischen Milieu dienten sie mit ihrem lobpreisenden Charakter als anspruchsvoller Zeitvertreib und zur Legitimation seines Machtanspruchs. Gleichzeitig profitierte auch das einfache Volk vom mythologischen Einfluß, jedoch als Leitfaden für moralisches Verhalten und auch als „Schatzhaus des gelehrten Wissens“.21Italiens 16. Jahrhundert scheint ohnehin eine bedeutende Rezeptionsepoche für OvidsMetamorphosengewesen zu sein, zumal zahlreiche Bearbeitungen des Werkes während dieser Zeit entstanden. Die damaligen Dichter waren existentiell auf ihre Leserschaft angewiesen, insbesondere auf die gebildeten und höfischen Kreise, die die nötige Kenntnis besaßen, um auch mythologische, gelehrte Anspielungen nachvollziehen zu können; dementsprechend mußten Dichter den besonderen literarischen Geschmack der gesellschaftlichen Elite treffen. „Die gehobene Bevölkerungsschicht huldigte der absoluten Monarchie und war auf die Erhaltung ihres Status quo, ihrer Distinguiertheit und Überlegenheit bedacht. Sie übte sich in Selbstbespiegelung und Selbstrepräsentation. Die Götter und Helden der griechischen Sagenwelt waren dabei so etwas wie Vorbilder, denen man nacheiferte. An den Höfen und in den Städten wurde das Theaterspiel gepflegt. Eine ganze Reihe von Episoden aus den Metamorphosen wurde zu Bühnenstücken verarbeitet.“22
In der Renaissance kommt schließlich noch die Frage der Mythologie als Exemplum auf:
„Erasmus macht deutlich, daß die Mythologie durch die Rhetorik, d.h. durch das Mittel des Exemplums, argumentativ verfügbar gemacht wird. [...] Um es pointiert auszudrücken, das Exemplum ist in der Rhetorik und in der Literatur der Renaissance das herausragende Mittel des Rückgriffs auf die klassische Mythologie. Wenn sich ein Autor in diesem Zeitalter auf die klassische Mythologie bezieht, geschieht das sehr oft in Form des Exemplums, das in einer großen Vielfalt der Formen und Funktionen in Erscheinung tritt.“23
Es scheint, als dienten Mythen insbesondere der Verbildlichung von Aussagen, die dem Publikum das Verständnis erleichtern sollten, aber auch als feinsinnig verpackte Kritik an bestehenden Verhältnissen, politischer oder aber gesellschaftlicher Art. Curtius sieht den Kern dieser antikisierenden Bewegung in Homers Schriften, mit denen die „abendländliche Verklärung der Welt, der Erde, des Menschen“
21GUTHMÜLLER, Bodo:Studien zur antiken Mythologie in der italienischen Renaissance,Weinheim 1986, S.X(Vorwort).
22WISSMÜLLER, Heinz:Ovid. Einführung in seine Dichtung.Neustadt/ Aisch 1987, S. 199f.
23MÜLLER, Wolfgang G.:Das mythologische Exemplum in der englischen Renaissance,in: GUTHMÜLLER/ KÜHLMANN, S. 185.