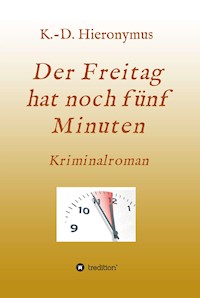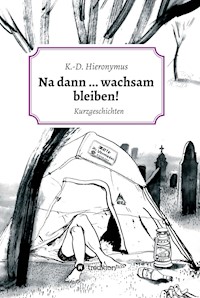
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Kurzgeschichten sind der Beweis dafür, dass Gedanken ihre Richtung ständig ändern, weil der Kopf rund ist. Sinn, Unsinn, Schwachsinn - die Schwestern vom Wahnsinn - wetteifern amüsant in den acht Erzählungen miteinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
www.tredition.de
K.-D. Hieronymus
Na dann … wachsam bleiben!
Kurzgeschichten
Illustrationen von YAXIN YANG
www.tredition.de
© 2019 K.-D. Hieronymus
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-4386-1
Hardcover:
978-3-7482-4387-8
e-Book:
978-3-7482-4388-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
P.F.
Der Bucklige
In Ewigkeit, Amen
Der Tubist
Ausgelost
Die Wette
Carla
Was wäre, wenn
Crex crex
P.F.
In einer überregionalen Tageszeitung wurde kürzlich über einen erstaunlichen Fall berichtet. Die Meldung titelte journalistisch geschickt: Pathologischer Eigensinn.
So eine Überschrift macht natürlich neugierig. In dem Artikel wurde über einen Mann berichtet, der sich selber als „Gerichteter“ bezeichnete. Ein juristisch zweifelhafter Begriff.
Worum ging es?
Der Mann wollte sein kleines Grundstück auf dem Kirchhof der Gemeinde auf ganz ungewöhnliche Weise nutzen. Nach Ansicht des zuständigen Richters stellte das aber einen „einfältigen Angriff auf das Gemeinwohl und im Besonderen auf Trauer, Totengedenken und Besinnung“ dar. Das sah der Mann ganz anders. Er gab sich mit dem Urteil nicht zufrieden und wollte der deutschen Rechtsprechung gründlich auf den Zahn fühlen indem er das nächst höhere Gericht anrief. Die Entscheidung dieser richterlichen Instanz stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus, war zu lesen.
Der Vorfall ereignete sich in einem kleinen Dorf in Nordfriesland. Was die Geschichte so außergewöhnlich machte, dass selbst die überregionale Tagespresse davon Kenntnis nahm, war die Tatsache, dass der Mann das erworbene Nutzungsrecht für eine Grabstätte auf dem idyllisch gelegenen Friedhof der Gemeinde völlig zweckentfremdet und nach Ansicht des Gerichtes „frevelhaft“ anwendete. - Er wollte auf eben dieser Grabstätte, in einem kleinen Einmannzelt, so eines wie die Bergsteiger es mit sich führen, einen Kurzurlaub verbringen.
Die Polizei sorgte für einen frühzeitigen Abbruch, was der Betroffene, der in dem Zeitungsbericht mit P. F. bezeichnet wurde, als ungerecht empfand.
Die Abkürzung P. F. sagte mir etwas, und ich wollte herausfinden, ob es sich tatsächlich um den P. F. handelte, den ich aus meiner Schulzeit kannte.
Der P. F., den ich kannte, hatte schon in der Oberstufe des Christian-Albrecht-Gymnasiums gezeigt, über welch kreatives Potenzial er verfügte. Allerdings blieb ihm die verdiente und von ihm mit bemerkenswerter Ausdauer angestrebte offizielle Anerkennung versagt.
Emotional viel zu engagiert, rhetorisch jedoch nicht ungeschickt, versuchte er vergeblich den Schulleiter, der Geschichte unterrichtete, davon zu überzeugen, dass das Auswendiglernen von Geschichtszahlen Zeitverschwendung und eine längst überholte, somit abzulehnende Lern- und Lehrmethode sei.
Als seine Überzeugungsversuche von der Gegenseite genau so hartnäckig abgelehnt wurden, wie von ihm vorgetragen, verlegte er seine zukunftsweisenden Reformideen auf die naturwissenschaftlichen Fächer, indem er ausführte, dass lateinische Pflanzennamen und chemische Formeln im Falle einer entsprechenden Profession in jeder Bibliothek nachzulesen seien und nicht das Gedächtnis eines Schülers jetzt schon belasten müssen. Der Gedanke des bedarfssynchronen Lernens überzeugte allerdings die Lehrer nicht.
P.F. - ein engagierter Pazifist - verbiss sich unglücklicherweise an dem Beispiel des Berufssoldaten, wobei er Soldatsein und Totgeschossenwerden als logische Kette einführte. Er argumentierte, dass es keinem Abiturienten, der dieses Gymnasium mit dem Ziel einer erfolgreichen militärischen Kariere verlässt, von Nutzen sei, wenn er den lateinischen Namen der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliophyta oder Brennesselgewächs) im Schützengraben kennt, in dem ihn der Feind totschießt. Die Kollegen des Schulleiters blieben bei dieser Argumentation uneinsichtig, fanden die Auseinandersetzungen aber als erfrischende Abwechslung im gymnasialen Alltag und ließen P.F. bis zum Abitur mit zwei Ehrenrunden hinreichend Zeit nach besseren Argumenten zu suchen.
Seine Mutter begab sich nach jedem Sitzenbleiben weinend in die Obhut eines Nervenarztes. Sein Vater, ein katholischer Priester, nahm es als gottgegeben hin.
Somit erlangte P.F. schon vor Abschluss seiner Schulausbildung eine gewisse latente Berühmtheit, die er mit lässiger Bescheidenheit und überlegenem Lächeln genoss.
Stieg er in den Schulbus ein, sprangen die Sextaner - ihn anhimmelnd - auf und blickten sich stolz im Kreis ihrer Klassenkameraden um, wenn P.F. das Platzangebot wohlwollend annahm.
Wir Älteren, die wir im Unterricht Zeugen seiner aussichtslosen Gefechte gegen das Schulsystem gewesen waren, schauten eher mitleidig auf den Zurückgebliebenen. Möglich, dass auch bei dem einen oder anderen Neidgefühle über soviel individuelle Entfaltungskraft aufkamen.
Ich erinnere mich gut, dass zehn Jahre später die Japaner für ihr „Just in time“ System weltweit gelobt wurden, welches besonders den Autoproduzenten zum Vorteil gereichte, weil sie ihre Lagerhallen auf die Straße verlegten. Der eigentliche Erfinder, der nie dafür gerühmt wurde, war aber P.F. mit der Idee des bedarfssynchronen Lernens.
P.F. hieß mit vollem Namen Peter Friedhofen und war tatsächlich in gerader Linie mit dem Peter Friedhofen verwandt, der 1850 die Kongregation der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf gegründet hatte.
Der Name blieb mir auch deshalb gut im Gedächtnis, weil der berühmte Vorfahre Peter Friedhofen im Jahr 1985 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen wurde. Ich war mir sicher, dass die Nachfahren von P.F., falls es solche geben sollte, vergeblich auf die Nachricht warten würden, dass ihr Vorfahre in die Schar der Heiligen aufgenommen werden soll.
Zuletzt wurde P.F. auf einem Schulfest der Ehemaligen gesehen. Nach seiner ausgedehnten Schulzeit hatte er ein Medizinstudium begonnen. Als er in der Pathologie zum ersten Mal einen T-Schnitt durchführen sollte, fand er das eklig, erbrach sein ausgiebig genossenes Mittagessen über den Leichnam und wechselte in die philosophische Fakultät. Dort sorgte er mit satirischen Beiträgen in den religionsphilosophischen Vorlesungen gleichermaßen für Belustigung und Unruhe. Nach zwei Semestern gefiel ihm auch das nicht mehr. Er versuchte es mit der Juristerei. Ein Semester lang unterhielt er Kommilitonen und Professoren mit spitzfindigen Fragen, dann entschloss er sich, gar nichts mehr zu werden und verließ die Universität als „Universalgelehrter ohne Abschluss“ wie er stolz herumerzählte.
Seine Telefonnummer war leicht ausfindig zu machen und ich rief ihn an. Nein, erinnern könne er sich nicht an mich. Aber wenn ich wollte und genug Schnaps mitbrächte, würde es vielleicht klappen und wir könnten uns auch über die Friedhofsgeschichte unterhalten, obwohl sie ja noch gar nicht zu Ende sei.
Einen Tag später saßen wir zusammen und unterhielten uns über Gott und die Welt, wie man so sagt, um die spürbare Entfremdung nach so langer und biografisch unterschiedlich verlaufender Zeit zu überbrücken. Die von mir mitgebrachte Flasche Korn erleichterte die emotionale Bereitschaft die frühere Schülerfreundschaft wieder aufleben zu lassen.
P.F. machte seinem selbsternannten Status, Universalgelehrter ohne Abschluss‘ alle Ehre, indem er pausenlos über wissenschaftliche Probleme philosophierte, die es gar nicht gab, die aber nach seiner Überzeugung kommen würden und die es galt jetzt schon zu lösen. Solch zukunftsweisender Wissensdrang machte ihn enorm durstig und nach jedem dritten Satz sagte er: „Na komm, einer geht noch.“ Mit fortschreitender Stunde ging schon nach jedem zweiten Satz noch einer.
Auf die Geschichte mit dem Friedhof kamen wir an diesem Abend nicht mehr. Die Kornflasche rollte leer unter den Tisch und P.F. rollte sich in seinem Sessel zusammen, wie eine Katze.
Ich verließ das Haus ohne Abschiedsgruß, um ihn nicht zu wecken.
Am nächsten Vormittag sah mich die Verkäuferin in dem Kiosk misstrauisch an, als ich diesmal zwei Flaschen Korn verlangte. Das nötigte mich, eine Erklärung abzugeben, und ich sagte ihr, es seien doch mehr Gäste gekommen, als ich erwartet hatte, und für heute seien doppelt so viele eingeladen. Sie tat die Flaschen in eine Plastiktüte, stellte sie außerhalb meiner Reichweite auf den Tresen und hielt mir die offene Hand entgegen. Erst als sie den zwanzig Euroschein kassiert hatte, schob sie mitleidig lächelnd die Flaschen samt Wechselgeld zu mir herüber.
P.F. saß auf der Südseite des Hauses im Garten. Da er mein Klingeln nicht hörte, ging ich um das Haus herum, wobei ich über sein Einmannzelt, was da im Weg lag, beinahe gefallen wäre.
Als er das Klappern der Flaschen hörte, fuhr er herum.
„Hallo“, sagte ich als Begrüßung und er antwortete „Ich hole Gläser.“
Da seit gestern geklärt war, dass es sich um P.F. aus meiner Schulzeit handelte, wollte ich eigentlich nur noch die kuriose Geschichte hören, mit der es auf Seite eins der größten überregionalen Zeitung geschafft hatte und nicht wieder heimlich die halbe Flasche Korn in eine Blumenvase kippen.
Ich bat ihn die Flaschen zum Kühlen erst einmal im Eisschrank aufzubewahren. Er nahm mir die Tüte ab und marschierte ohne ein Wort zu sagen ins Haus. Noch bevor er die Tür erreichte hörte ich das Drehen des Schraubverschlusses.
Aufgeräumt kam er nach kurzer Zeit wieder nach draußen, setzte sich mir gegenüber und legte die Füße auf den freien Stuhl.
Im Grunde genommen gehe es nur um die Begriffsbestimmung Friedhof und Kirchhof, begann er verächtlich grinsend seinen Bericht.
Eine Tante väterlicherseits hatte ihm testamentarisch eine Grabstätte auf dem Kirchhof vermacht. Eigentlich wollte die Tante dort selbst begraben werden, aber als sich ihr irdisches Ende abzeichnete, wurde sie von anderen Verwandten überredet davon abzusehen. Die Grabpflege, für die sie, die anderen Verwandten, sorgen müssten, sei in Kiel viel besser zu bewerkstelligen als in dieser kleinen abgeschiedenen nordfriesischen Gemeinde. Die Tante willigte ein und verfügte, dass der Sohn ihres Bruders, die, auf zwanzig Jahre im Voraus von ihr bezahlte Grabstätte und ihr bescheidenes Häuschen erben solle.
P.F., der sich nie um seine Tante oder sonstige Verwandte gekümmert hatte, nahm seine geerbte Grabstätte von 1.25 m x 2,25 m schon bald darauf in Augenschein und fand auf dem Kirchhof alle sanitären Voraussetzungen, die ein schlecht geführter Campingplatz auch hat. So kam ihm der Gedanke, die Grabstätte als Zeltplatz zu vermieten.
Die Gemeinde hatte sonst keine touristischen Attraktionen zu bieten, und zwei bis drei Nächte, allein auf einem Gräberfeld zwischen all den Toten und ungewohnten Geräuschen, sei jedenfalls unterhaltsamer als den ganzen Tag irgendwo am Strand herumzusitzen, fand er.
Eine gewisse Schwierigkeit den Plan zu realisieren sah er in der Friedhofssatzung, die er sich bei der Gemeindeverwaltung besorgt hatte.
Aber nach genauem Studium entdeckte P.F. scharfsinnig die Hintertür im Gesetzestext, durch die er auf den Friedhof schlüpfen könnte, um seine Urlaubspläne dort zu verwirklichen.
Ein Verwaltungsbeamter hatte, ohne sich der Folgen bewusst zu sein, folgenden Text einer Mustersatzung einfach übernommen:
§ 1 Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gemeindegebiet gelegenen Friedhöfe und Friedhofsteile, die Eigentum der Gemeinde sind und von ihr verwaltet werden.
Nun hieß aber der Friedhof nicht Friedhof, sondern Kirchhof. Dokumentiert wurde das durch ein weißes Hinweisschild am Eingang, auf dem in schwarzen Buchstaben zu lesen stand: Auf dem Kirchhof sind Hunde an der Leine zu führen. Es war die einzige Begräbnisstätte dieser Gemeinde und wurde - obwohl von Steuergeldern der Gemeinde gepflegt und unterhalten - der Einfachheit wegen vom Kirchenbüro verwaltet. Der Gottesacker selber gehörte zum Eigentum der Kirche.
Das alles entsprach also nicht § 1 Geltungsbereich, der Friedhofssatzung.
P.F. folgerte messerscharf, dass die Friedhofssatzung gar nicht auf den Kirchhof anzuwenden sei. Außerdem sei Friedhof niemals gleich Kirchhof. Alleine wegen des unterschiedlichen kulturhistorischen Hintergrundes.
Er kaufte sich ein Einmannzelt, um sein attraktives Campingangebot selber durch einen Kurzurlaub zu testen. Gewöhnlich rechnet man für einen Kurzurlaub mindestens so an die drei Tage. Dieser dauerte nur wenige Stunden.
Vor Gericht verteidigte P.F. vehement seinen Standpunkt. Und als der Richter das Ganze eine Schnapsidee nannte, rächte er sich mit einem schier endlos gehaltenen Vortrag über den Zentralbegriff „Idee“ bei Platon in der antiken Philosophie, bis zur Gewinnung von Schnaps bei einem Siedepunkt von 78,3° C.
Der Siedepunkt des Richters war längst überschritten. P.F. wurde zur Zahlung eines schmerzhaft hohen Bußgeldes verdonnert.
„Na, komm, einer geht schon.“ beendete er seinen Bericht und ging ins Haus.
Als die erste Flasche Korn ihren ungefüllten Zustand wieder erreicht hatte und P.F. davon schwärmte, dass Camping auf dem Friedhof in wenigen Jahren der Renner unter den Erlebnis-Urlaubsangeboten sein würde, nutzte ich die Verrichtung einer Notdurft als Gelegenheit mich aus dem Haus zu schleichen, ohne mich zu verabschieden.
Ich habe nie wieder etwas von P.F. gesehen, gelesen oder gehört.
***
Der Bucklige