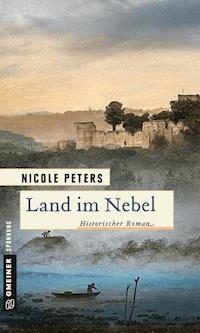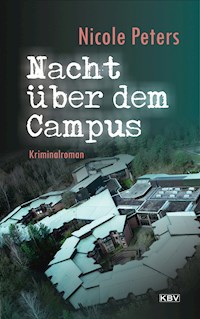
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Helen Freitag
- Sprache: Deutsch
Wenn es dunkel wird in Hennef … Helen Freitag ermittelt in ihrem zweiten Fall Rechtsanwältin Helen Freitag ist als Dozentin der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung in Hennef tätig. Oliver Schönbom, einer der Studenten, wird am Morgen nach einer Party in seinem Zimmer auf dem WohnCampus tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Suizid mit Tabletten und Alkohol hin, doch Yuna Bäcker, die Freundin des Toten, kann das nicht glauben. Oliver hatte vor Jahren einen schweren Autounfall, bei dem seine Eltern ums Leben kamen und er selbst lebensgefährlich verletzt wurde. Seitdem lehnt er, der jahrelang von Schmerzmitteln abhängig war, Drogen ab. Helen beginnt sich für diesen Fall zu interessieren, denn nur wenige Tage vor seinem Tod hatte Schönbom versucht, sie zu kontaktieren. Sie fängt an, Fragen zu stellen, erhält darauf aber keine Antworten. Ihr Freund, der Journalist Rabe, gräbt unterdessen alte Zeitungsberichte über Olivers Familie aus. Es gab Gerüchte, dass der Unfall mit einem Bankenskandal zusammenhängen könnte. Je mehr sich Helen bei den Studenten und den Universitätsangehörigen umhört, desto mehr bekommt sie den Eindruck, dass sich in der Nacht und am Wochenende, wenn die Studenten unter sich sind, der Campus in eine andere Welt verwandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Letzte Ausfahrt Auerberg
Nicole Peters (* 1968) hat in Bonn Geografie studiert, entschied sich anschließend jedoch dazu, im Lektorat eines Verlages zu arbeiten. Sie ist eine der Mörderischen Schwestern und Mitglied der Literaturwerkstatt Hennef, ihrer Heimatstadt. Land im Nebel, einen historischen Roman, veröffentlichte sie 2018. Ihr Krimidebüt Letzte Ausfahrt Auerberg erschien 2019.
Nicole Peters
Nacht überdem Campus
Originalausgabe
© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von© Wolkenkratzer / Wikimedia Commons /»Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,Akademie Hennef, 003.jpg« / CC BY-SA 4.0
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-95441-559-5
E-Book-ISBN 978-3-95441-568-7
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
1. Kapitel
Sein Atem ging stoßweise. Er stolperte die Treppe hinauf und erreichte das Erdgeschoss des Campus. Um mehrere Ecken herum passierte er die große Aula, das Musikzimmer und die Mensa. Kopflos. Er blickte hinter sich, ohne stehen zu bleiben. Überlegte, ob er doch den Autoschlüssel aus seinem Zimmer holen sollte. Nein. Er musste hier raus. Ließ die Turnhalle links liegen. Im Vorbeilaufen warf er einen Blick durch das Plexiglas auf das darunterliegende Sportfeld. Die bunten Linien und Kreise darauf zeigten ein Labyrinth, ebenso verwirrend, wie es der gesamte Campusbereich war. Das Volleyballnetz hing schlaff herunter, ein Basketball lag verlassen in einer Ecke. Wo waren alle anderen? Alles schien verwaist. Kein Laut war zu hören. Und so hallten die Worte, die er gehört hatte, schmerzend hinter seiner Stirn nach. Sie hatten Bilder hervorgerufen, Erinnerungen geweckt, die lange und tief in ihm verborgen gewesen waren. Sie trieben ihn weiter. Er erreichte das Foyer. Auch hier war niemand zu sehen. Der Informationstisch war nicht mehr besetzt. Nur die indirekte dämmrige Beleuchtung der Pflanzenoasen spendete ein wenig Licht. Draußen war es stockfinster. Warum brannten die Laternen nicht?
Abrupt hielt Oliver an, sodass die gummierten Sohlen seiner Sportschuhe auf dem Boden ein quietschendes Geräusch von sich gaben, so als sei er auf eine Maus getreten.
Hastig schob er seinen Hemdsärmel zurück, warf einen Blick auf die goldene Armbanduhr. Ein Relikt aus einer anderen Zeit. Aber für ihn bedeutete die Uhr mehr als ihr Wert in Gold. Sie hatte seinem Vater gehört. Schon halb acht. Mist. Die Vordertür war bestimmt verschlossen. Das Campusleben hatte sich längst auf den Wohnbereich verlagert. Oder in den Schankraum im Untergeschoss. Und jeder Vernünftige, der einen Ausflug nach draußen unternahm, wählte den kurzen Weg aus einer der Seitentüren direkt zu den Parkplätzen. Trotzdem trat er an die Vordertür. Sie bewegte sich nicht.
»Na, noch nicht beim gemütlichen Teil des Abends, Herr Schönbom?«
Er erschrak. Wandte sich in Richtung des Zimmertraktes, von wo die Stimme gekommen war. Sofort strömte Erleichterung durch ihn, und seine Schultern sackten herunter. Es war nur Herr Karl, der Hausmeister.
»Nein, muss etwas in der Stadt besorgen«, sagte er geistesgegenwärtig. »Können Sie mir kurz aufschließen? Ich habe nicht dran gedacht, dass hier vorne schon geschlossen ist, und wenn ich jetzt noch mal durch den ganzen Trakt muss, schaffe ich es nicht bis zum Ladenschluss.«
»Also, ich kenne keinen Laden in der Hennefer City, der jetzt noch geöffnet ist. Außer den Supermärkten. Und die haben bis zehn offen.«
Natürlich hatte der Hausmeister recht. Aber er musste hier raus. So schnell wie möglich. »Bitte, Herr Karl.«
Karl zog die Schultern hoch. »Na gut, junger Mann.« Klirrend zückte er seinen dicken Schlüsselbund und schlenderte zur Tür. Der gedrungene Mann verkörperte jedes Klischee seiner Zunft. Dennoch war er einer der wenigen hier, denen Oliver nicht mit Misstrauen begegnete. Das Gespräch, das er mit angehört hatte, hatte seinen Glauben in die Menschen um ihn herum erschüttert. Wenn Yuna nicht wäre, würde er sofort alles hinter sich abbrechen und von hier verschwinden.
»Ist auch alles in Ordnung mit Ihnen, Oliver?«, fragte der Hausmeister, während er ihm die Tür aufhielt. Oliver nahm sich zusammen und nickte.
»Dann passen Sie auf, wohin Sie treten. Vor allem an den Treppen. Bei den Renovierungsarbeiten ist heute irgendetwas schiefgelaufen mit der Elektrik. Die komplette Außenbeleuchtung ist ausgefallen.«
»Danke. Mache ich, Herr Karl. Sie sind der Beste.« Oliver schlüpfte durch die Tür und tauchte ein in die Dunkelheit der Außenanlage des Campus. Trotz Herrn Karls Mahnung sprang er in drei Sprüngen die flache Treppenflucht hinunter, ignorierte den dumpfen Schmerz in seiner Hüfte und dem Knie. Bog nach links auf die Straße ab. Kurz bevor er den Parkplatz vor der Klinik erreichte, hörte er ein Motorrad starten. Weit genug entfernt. Beruhige dich. Niemand außer Herrn Karl wusste, dass er den Campus verlassen wollte. Oder doch? Hatten sie ihn bemerkt, als er ihrem Streitgespräch gelauscht hatte?
Er erhöhte sein Tempo. War nie ein guter Läufer gewesen. Spätestens seit dem Unfall nicht mehr. Er hechtete den düsteren, schmalen Weg zwischen dem Zaun des Wildgeheges und dem Klinikgelände entlang, erwartete jeden Augenblick, einem der Patienten zu begegnen, die hier ihre Raucherpausen abhielten. Doch niemand war zu sehen. Dennoch fühlte er sich beobachtet. Spürte die Blicke des Damwilds hinter dem Zaun, das aus der Dunkelheit heraus bestimmt jeden seiner Schritte verfolgte. Erst als er die Sicherheit der baumgesäumten Holztreppe erreicht hatte, die zum Kurpark führte, verlangsamte er seinen Sprint und verfiel in ein Joggingtempo. Bis in die Stadt würde er so eine Viertelstunde brauchen. Er hoffte nur, dass er es rechtzeitig bis zum Wirtshaus schaffen würde. Solange sie dort war. Denn ihre private Telefonnummer oder Adresse kannte er nicht. Wusste nur, dass sie irgendwo in Hennef wohnte. In einem der hundert Dörfer. Ihre Kanzlei lag in Bonn. Die Telefonnummer wäre leicht herauszufinden. Aber dort wäre die Rechtsanwältin erst am Montag wieder erreichbar. Zum Glück hatte Oliver nach ihrer letzten Vorlesung am Mittwoch zufällig mitbekommen, dass sie sich für heute Abend mit einem Kollegen im Hennefer Wirtshaus verabredet hatte. Jetzt konnte er nur hoffen, dass diese Verabredung noch stand und er sie dort antreffen würde. Denn er kannte am Campus keinen anderen als Rechtsanwältin Helen Freitag mehr, den er hätte einweihen können. Nur sie konnte ihm jetzt helfen. Er hatte eine Anzeige zu machen. Nach all den Jahren würde endlich eine Anklage erhoben werden.
2. Kapitel
Mein Gott, ist das voll hier.« Helen winkte ihrem Kollegen über den Tisch hinweg zu, bevor sie sich ebenfalls setzte. Er hatte sich in eine Ecke gequetscht. »Und laut«, schob sie hinterher. Sie musste sich anstrengen, um gegen den Geräuschpegel des voll besetzen Lokals anzukommen.
»Freitagsspiel in der Bundesliga. Ich habe gerade schon am Nachbartisch nachgefragt, ob es etwas Besonderes gibt. Aber es ist nur Fußball. Gladbach spielt. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommt man die Freitagsspiele überhaupt nicht mehr zu sehen. Da ist hier im Wirtshaus wohl immer der Teufel los. Habe den letzten Platz überhaupt ergattert«, erzählte Henning Petersen, während Helen ihren Blazer über den Stuhl hängte. Es war entsprechend aufgeheizt im Lokal. Fußball verfolgte sie selbst kaum, aber bei Mönchengladbach dachte sie sofort an Rabe. Das war sein Verein.
»Schöne Bescherung. Hätte ich aber eigentlich wissen können. Genau deshalb hat der Vogel mir heute abgesagt.«
Petersen zog fragend die Augenbrauen hoch. »Was für ein Vogel denn, Kollegin?«
Helen musste lachen. Sie konnte es sich nicht abgewöhnen, Rabe mit seinem Spitznamen aufzuziehen.
»Entschuldige, Henning. Das kannst du nicht wissen. Aber du kennst doch meinen Bekannten Ralf Peter Voss, den Redakteur vom General-Anzeiger?«
»Deinen Bekannten? Ich dachte, da wäre etwas mehr zwischen euch.«
Helen ließ die Frage unbeantwortet im Raum stehen. Petersen hatte ja recht. Aber Rabe so offiziell gegenüber Dritten als ihren Freund oder sogar Partner vorzustellen? Das konnte sie einfach noch nicht.
Petersen ging zum Glück über die peinliche Stille hinweg. »Ja, Voss ist mir nicht verborgen geblieben. Er ist ja nicht ganz unbeteiligt an der Schrader-Sache gewesen.«
Helen nickte. »Genauso ist es. Aber er ist ja gar kein komischer Vogel, sondern sein Spitzname ist Rabe. Ich kann es nur einfach nicht lassen, meine Witze darüber zu machen. Vielleicht kannst du mir ja dazu mal deinen fachlichen Rat als Psychologe zukommen lassen.«
Henning Petersen schob seine Brille zurecht. Er konnte das gut. Diesen Analytikerblick. Seine Stimme klang plötzlich ernster. Tiefer und melodischer. »Ja, das ist tatsächlich interessant. Da verbirgt sich etwas. Den Partner durch solche Bemerkungen gefühlsmäßig auf Abstand halten. Ganz typisches Verhalten bei Bindungsängsten.«
»Jetzt hör aber auf.« Helen rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Für so eine gemütlich wirkende Gaststätte waren die Stühle doch recht hart. »Ich wollte mich mit dir treffen, um über Marie zu sprechen, nicht über mich.«
»Wenn du das sagst, muss es wohl so sein.«
Hennings Entgegnung ging fast im weiter anschwellenden Lärm des Wirtshauses unter. Ein Blick auf den Bildschirm bestätigte Helen, dass das Spiel gleich anfangen würde. Die Mannschaften liefen auf den Platz, jeder der Spieler hielt ein Auflaufkind an der Hand. Schöne Idee eigentlich. Wie lange gab es das schon? Und wie hatte das begonnen? Mit irgendeiner Weltmeisterschaft? Sie machte sich eine geistige Notiz, das beim nächsten Treffen Rabe zu fragen. Gleichzeitig wurde ihr bewusst, dass genau so etwas die treffende Kurzanalyse ihres Gegenübers bestätigte. Sie hielt sich Rabe immer noch vom Leib. Versuchte, ihre Gespräche auf Belanglosigkeiten zu lenken. Small Talk eben. Und das trotz allem, was sie im letzten Jahr zusammen erlebt hatten. Trotz all seines Einsatzes für ihren Fall und für sie.
Aber genau deshalb war sie jetzt hier. Wirklich nicht, um über sich zu sprechen, sondern um zu erfahren, wie ihre Auszubildende Marie mit ihrem Schicksal klarkam. Helen hatte dem Mädchen empfohlen, nein, sie hatte darauf bestanden, dass Marie sich in die professionellen Hände eines Psychologen begab. Und ihr Kollege bei der Hochschule in Hennef, Henning Petersen, war ihre erste Wahl. Sie hatte ihn schon öfter an Mandanten empfohlen, die etwa durch ein Trauma nach einem Verkehrsunfall psychische Probleme bekamen. Einmal mehr wurde ihr bewusst, wie wichtig ihr die Nebentätigkeit an der Hochschule der gesetzlichen Unfallversicherung war. Ihre Mittwoche waren ihr heilig, nicht nur wegen der Lehrtätigkeit. Auch der Austausch mit den Kollegen aus den unterschiedlichen Fachbereichen war wertvoll. Helen war eine große Befürworterin einer ganzheitlichen Herangehensweise bei ihren Rechtsfällen. Denn gerade in den Fällen, die ihr häufig begegneten, seit sie sich einen Namen als Opferanwältin gemacht hatte, war man für die Mandanten meist viel mehr als nur Anwältin. Mehr Mediatorin, Beraterin und Beistand in allen Lebenslagen. Und sie war gut darin. Nur für ihr eigenes Leben hatte sie nicht die richtigen Ratschläge parat. Aber war es nicht immer so? War nicht der Schuster derjenige mit den schlechtesten Schuhen?
Wieder schwoll der Lärmpegel an. Anpfiff beim Fußball.
»Sollen wir uns nicht besser nach draußen setzen? Ich verstehe hier kaum mein eigenes Wort«, rief sie zu Henning herüber. So konnte man sich unmöglich über die psychischen Probleme einer lieb gewonnenen Auszubildenden unterhalten.
»Von mir aus gerne. Es sind ja schon ganz erträgliche Temperaturen für April«, antwortete Henning. Zumindest glaubte Helen, das verstanden zu haben.
Sie nickte. »Und zur Not habe ich ja meinen Blazer.«
Sie standen gleichzeitig auf und suchten sich einen Platz im Biergarten vor dem Wirtshaus. Auch hier waren so früh im Jahr etliche Plätze besetzt. Der ganze bisherige April war ungewöhnlich warm gewesen. Sie ergatterten einen am Rand gelegenen Platz, wo man sich ungestört unterhalten konnte.
»Also, wie macht sich meine Auszubildende?« Helen fiel unbesorgt mit der Tür ins Haus. Marie Glücklich hatte Henning Petersen ihr gegenüber von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden.
»Sie macht sich gut.« Henning nahm einen Schluck von seiner Fassbrause, bevor er die Aussage präzisierte. »Sie spricht offen über ihre Gefühle. Zu Anfang fiel es ihr schwer, aber mittlerweile weiß sie genau, dass nichts von dem, was geschehen ist, ihre Schuld war. Zumindest verstandesmäßig. Aber gerade solche frühkindlichen Belastungen werden sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben begleiten. Sie muss nur lernen, damit umzugehen. Sie in den rechten Kontext zu setzen. Das ist ein langer Weg.«
Marie war mit zwei Jahren von ihrem leiblichen Vater an ihren Adoptivvater Georg Glücklich verkauft worden. Das allein zu begreifen, wäre schon schwer. Damit nicht genug, war ihre leibliche Mutter durch beide Väter getötet worden, als sie sich nach zwanzig Jahren dagegen aufgelehnt hatte. Der Schrader-Fall war letztes Jahr mit der Verhaftung beider Männer abgeschlossen worden. Für die Angehörigen, allen voran Marie, war das Abschließen naturgemäß nicht so einfach.
»Und meinst du, es ist wirklich so eine gute Idee, dass sie Georg Glücklich im Gefängnis besuchen will?«
Henning nahm sich Zeit mit seiner Antwort. »Ich denke, sie ist bereit. Den größten Schritt hat sie schon getan, als sie seine Briefe gelesen hat. Das persönliche Treffen ist der nächste Schritt. Und er ist ja kein Unmensch. Der Glücklich. Er war ihr immer ein guter Vater.« Henning nahm seine Brille ab und begann sie zu putzen, während er fortfuhr: »Was mir momentan mehr Sorgen bereitet, ist, dass Marie von ihrer Mutter sehr beansprucht wird. Die scheint sich nämlich völlig zurückzuziehen. Das Verhältnis der beiden hat sich total umgekehrt. Marie ist nun diejenige, die versucht, ihre Mutter aus deren Tief herauszuziehen. Aber das kann sie nicht leisten. Und auf der anderen Seite scheinen ihre neu gewonnenen Großeltern sie auch auf eine gewisse Weise zu bedrängen. Sie wollen wohl all das nachholen, was sie bei ihrer Tochter verpasst haben.«
Helen hatte das auch schon beobachtet. »Ja, Marie macht manchmal solche Bemerkungen. Ich hatte so etwas schon befürchtet.«
Henning nickte. »Vielleicht kannst du ja mal mit ihnen sprechen. Sie sind schließlich deine Mandanten.«
»Ja, das sind sie. Scholz, also Maries leiblicher Vater, hat Berufung eingelegt. Der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Zumindest Georg Glücklich aber hat das Urteil akzeptiert.«
»Trotzdem, über ihre Großeltern nimmt Marie auch dieser anstehende Prozess noch mit. Es wäre wirklich gut, wenn du die Eheleute Schrader diesbezüglich einmal ansprichst. Marie will und muss damit abschließen.«
Bevor Helen zu einer Antwort ansetzen konnte, klingelte ihr Handy. Sie schaute auf das Display. »Moment. Das ist meine Mutter. Da muss ich mal schnell rangehen. Sie war in letzter Zeit nicht gut zurecht.«
»Mutter?«
Erst ein Rauschen. Dann erst vernahm Helen die Stimme von Ruth Freitag. »Leni?«
»Ja, Mama. Ich bin es. Was ist los? Ich verstehe dich kaum.«
»Es geht mir nicht so gut.« Ihre Mutter klang leise, fast zart, und ihre Stimme war ein wenig undeutlich.
»Mama, was ist passiert?«
»Hab den Notarzt gerufen.«
Helen sprang auf. »Ich komme sofort. Bleib ganz ruhig. Ich bin gleich da.«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
»Henning, ich muss weg. Meine Mutter …«
»Ja, hab es mitbekommen. Geh. Ich übernehme das hier.« Er deutete auf ihre Getränke.
»Danke. Ich melde mich bei dir.« Helen griff ihren Blazer und rannte zu ihrem Auto, das sie auf der Frankfurter Straße geparkt hatte.
3. Kapitel
Gretchen! Ich bin dann weg.« Marie Glücklich stand am Treppenabsatz und rief nach oben. Ihre Mutter lag noch im Bett. Marie hatte sich vor dem Duschen versichert, dass sie wach war. Hatte sie gefragt, ob sie nicht doch mitkommen wolle. Doch Gretchen hatte abgelehnt. Wollte nichts davon wissen oder hören. Gretchen war wie ein zugeschlagenes Buch, bei dem das Lesezeichen herausgefallen war. Aber darum konnte Marie sich jetzt nicht kümmern. Denn heute war es so weit. Besuchstag in der Justizvollzugsanstalt in Siegburg. Seit ihrer Zeugenaussage bei der Verhandlung im Landgericht Bonn hatte Marie ihren Vater nicht mehr gesehen. Das war jetzt fast ein Jahr her. Und auch da hatte sie es vermieden, ihn anzusehen, seinen Blick zu erwidern. Nur beim Betreten des Gerichtssaals hatte sie einen kurzen Blick von der Seite auf ihn geworfen. Zuerst hatte sie seine im wöchentlichen Rhythmus eintreffenden Briefe nicht gelesen. Sich geschworen, nie wieder auch nur ein Sterbenswörtchen mit ihm zu reden. Sie wollte keine Entschuldigung, sie wollte kein Flehen, sie wollte ihn vergessen. All das vergessen, was er ihr angetan hatte. Er hatte sie belogen, ihr Leben lang. Hatte ihr nicht nur verschwiegen, dass sie adoptiert war, dass er sie der leiblichen Mutter entrissen hatte, dass er sie vom leiblichen Vater gekauft hatte wie ein Spielzeug. Nein, er hatte ihr auch die Möglichkeit genommen, ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Für immer. Denn er hatte sie getötet. Getötet! Das konnte man doch nicht verzeihen. Das konnte sie nur versuchen zu vergessen.
Marie warf einen letzten Blick nach oben. Kein Geräusch drang aus dem Schlafzimmer. Sie zuckte mit den Schultern. Es überstieg ihre Kraft, ihrer Adoptivmutter zu helfen. Sie hatte es ein paarmal versucht. Ihr geraten, auch eine Therapie anzufangen, so wie sie selbst. Helen Freitag, ihre Chefin, hatte darauf bestanden, dass Marie schon während des Prozesses gegen den Vater einen Psychiater aufsuchte. Und das hatte Marie wirklich geholfen. Mit Herrn Petersen konnte sie über alles reden. Er sagte gar nicht viel, hörte ihr dafür umso mehr zu. Gab hier und da ein paar Erklärungen, machte Vorschläge, aber ließ Marie im Wesentlichen ihre eigenen Entscheidungen erarbeiten. So hatte sie nach und nach erkannt, dass sie sich ihrem Adoptivvater stellen musste. Dass sie das Geschehene nicht einfach vergessen konnte, sondern dass sie es aufarbeiten musste. Zuerst hatte sie daher dessen bisher ungeöffnete Briefe gelesen. Und nun, nach einem Jahr, war sie bereit dazu, ihn zu treffen.
Marie verließ das Haus. Sie war früh genug dran. Der Bus fuhr erst in einer halben Stunde. Bis zur Haltestelle in Ruppichteroth war es nur ein Fußweg von einer Viertelstunde. Aber sie wollte nichts dem Zufall überlassen. Es war gar nicht so einfach gewesen, diesen Besuchstermin zu bekommen. Wie alles im deutschen Rechtsstaat bedurfte es einer Menge Formulare, die auszufüllen waren. Der Nachweis der Verwandtschaft, Datenschutzbestimmungen und was nicht noch alles. Zum Glück hatte Frau Freitag ihr geholfen.
Marie nahm sich Zeit und warf einen Blick zurück auf das Haus. Würden sie und Gretchen es überhaupt allein halten können? Und war es nicht viel zu groß für sie beide? Gretchen hatte sofort nach der Verurteilung von Georg Glücklich die Scheidung eingereicht. So viel Energie hatte sie immerhin aufgebracht. Ansonsten blieb alles liegen. Und die Scheidung war noch nicht durch. Auch das war nicht so einfach, wenn einer der Ehepartner im Gefängnis saß. Und wie es mit den Finanzen stand, konnte Marie überhaupt nicht einschätzen. Hatte sich nie über so etwas überhaupt Gedanken gemacht. In der Einfahrt vor der Garage stand das Auto ihrer Mutter. Drinnen das von Georg Glücklich. Konnten sie es verkaufen? Wenn sie gleich zu ihrem Vater nichts zu sagen wusste, konnte sie ihn ja fragen, wie das jetzt alles finanziell weitergehen sollte.
Sobald Marie das Grundstück verließ, setzte sie ihre Kopfhörer auf. Sie brauchte sie nicht mehr wirklich, wenn sie sich in der Welt bewegte. Das war vor einem Jahr auch noch anders gewesen. Sie hatte sich sehr verändert, wurde ihr in diesem Augenblick klar. Zumindest gab die Musik von Linkin Park im Ohr ihr jetzt den nötigen Schub, um diesen besonderen Tag anzugehen.
Gerade als sie die Haltestelle erreichte, kam der Bus. Heute aber war sie keine normale Pendlerin, die wie seit über einem Jahr wochentags zur Arbeit in die Rechtsanwaltskanzlei Freitag & Vettweiss nach Bonn fuhr. Trotz Musik gelang ihr das Eintauchen in die Pendlerblase heute nicht. Sie fühlte sich, als ob ihr das Ziel ihrer Fahrt auf die Stirn geschrieben stand. All die Leute im überfüllten Bus schienen sie anzustarren.
»Was für ein Wochenende.« Helen steuerte nach dem Betreten der Kanzlei direkt den Schreibtisch von Friederike Vettweiss an, stellte ihre Aktentasche darauf ab und stützte sich mit beiden Händen auf. Dabei bedankte sie sich innerlich dafür, dass es neben ihrer Mutter andere Konstanten in ihrem Leben gab. Frieda gehörte definitiv dazu.
»Dir auch einen guten Morgen.« Frieda hatte ihre Arbeit am PC unterbrochen und begrüßte sie in der ihr eigenen schnippisch-liebevollen Art und Weise.
»Entschuldigung, Frieda, guten Morgen wünsche ich dir. Obwohl meiner nicht sehr gut war. Ich habe kaum geschlafen.«
»Was ist denn los?«
»Meine Mutter. Sie ist im Krankenhaus. Ist am Freitag zusammengebrochen. Hat selbst den Notarzt gerufen. Die haben sie erst nach Siegburg gebracht. Verdacht auf Schlaganfall.«
»Oh nein.« Frieda stand auf, kam Helen entgegen.
»Nein, war keiner. Aber sie haben sie nach Bonn ins Uniklinikum verlegt. Für weitere Untersuchungen. Die Ärzte vermuten Parkinson.« Helen rieb sich die Augen. Der Schreck vom Freitag lag ihr noch in den Gliedern. Ihre Mutter war die stärkste Konstante in ihrem Leben, schon immer. Helen war ein Einzelkind, und ihr Vater hatte ihre Mutter und sie verlassen, als Helen vier Jahre alt war. Er war in seine irische Heimat zurückgekehrt. Ruth Freitag hatte ihre Tochter allein großgezogen, war immer für sie da gewesen. War ihr erster Anlaufpunkt und ihre letzte Zuflucht. Und erst jetzt begriff Helen, wie sehr ihr dieses Gefühl Sicherheit gegeben hatte. Wie sie davon abhängig war, die Mutter immer in ihrem Rücken zu wissen. Dass diese Sicherheit so plötzlich wegbrechen konnte, machte Helen wahnsinnige Angst.
Frieda nahm sie kurz in den Arm. »Komm, ich mache uns erst einmal einen Kaffee. Und dann erzählst du mir mal genau, was passiert ist.«
Helen nickte. Sie folgte ihrer Kollegin und Freundin in die Küche der Kanzlei, deren Zentrum der Kaffeevollautomat bildete.
»Matthias ist bei Gericht?«, fragte Helen.
Frieda nickte, während sie zwei Tassen unter den Automaten schob.
»Und Marie?«
»Die hat doch heute Morgen den Besuchstermin in der JVA Siegburg.« Frieda erhob ihre Stimme, um gegen das laute Mahlgeräusch der Kaffeemaschine anzukommen.
»Oh, Mann, ja. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Konnte am Freitag auch gar nicht richtig mit Petersen darüber reden. Mitten in unserem Treffen kam der Anruf meiner Mutter.«
»Jetzt erzähl.« Die beiden setzten sich an den Tisch, der gerade Platz für zwei bot. Mit dem frischen Kaffee in der Hand berichtete Helen vom Gesundheitszustand ihrer Mutter. Sie hatte beim Backen einen Schwächeanfall erlitten, war vor dem Ofen zusammengesackt und kurz bewusstlos gewesen. Das konnte sie so genau sagen, weil der eingestellte Ofentimer nur wenige Minuten heruntergelaufen war. Danach hatte sie den Notarzt gerufen.
»Und dann hat sie erst den Ofen und den Herd ausgestellt, auf dem schon die Schokokuvertüre für den Kuchen schmolz. Sie wollte ja nicht, dass das Haus abbrennt. Dann erst hat sie mich angerufen. Ich saß mit Petersen im Hennefer Wirtshaus. Ich kam gerade rechtzeitig zu Hause an, dass ich hinter dem Notarztwagen herfahren konnte.«
Der Rest war schnell erzählt. Die ersten Untersuchungen im Notarztwagen hatten zumindest bezüglich eines Schlaganfalls Entwarnung gegeben. Im Siegburger Krankenhaus wurden aber andere Unregelmäßigkeiten festgestellt. »Genaues haben die uns nicht sagen können oder wollen. Nur dass weder ein Schlaganfall noch ein Herzinfarkt vorlag. Eine Verlegung nach Bonn für weitere Untersuchungen sei nötig. Das war dann gestern am Sonntag. Ich hab mir gedacht, wenn die das sogar am Wochenende machen, muss es doch ernst sein. Meine Mutter war die ganze Zeit bester Laune. Stell dir das mal vor, sie hat mir eine Liste geschrieben, auf was ich zu achten habe. Vor allem im Garten. Im Frühjahr gibt es viel zu tun.« Helen ahmte die Stimme ihrer Mutter nach und prustete. »Ich und mein nicht vorhandener grüner Daumen.«
Frieda grinste. »Das kann ich bestätigen. Unsere Kanzleipflanzen hätten schon lange aufgegeben, wenn ich nicht wäre und ihnen das lebensnotwendige Nass zukommen lassen würde.«
»Jaja. Fang du auch noch an.« Helen zog einen handgeschriebenen Zettel aus der Tasche und zeigte ihn Frieda. »Hier, guck dir das an. Für den Garten gibt es einen Extra-Zettel. Den hat sie mir gestern Abend mitgegeben. Haarklein alles aufgeschrieben. Als ob es jetzt keine anderen Sorgen gäbe.«
»Parkinson hast du gesagt. Das ist die Diagnose?«
»Nicht endgültig, aber es deutet einiges darauf hin.«
Das Telefon klingelte.
»Ich geh schon«, sagte Friederike, »bleib du sitzen und trink den Kaffee in Ruhe aus. Hattest bestimmt noch kein Frühstück.«
Dankbar nickte Helen. »Wie immer ist mein Kühlschrank ziemlich leer.«
Helen trank ihren Kaffee zu Ende und studierte dabei die Gartenaufgaben. Rasenmähen war noch das Einfachste. Aber Düngen und Lüften der Gemüse- und Pflanzbeete, Einpflanzen der Stecklinge. Davon hatte sie überhaupt keine Ahnung, und sie hatte sich auch nie dafür interessiert. Aber jetzt konnte sie ihre Mutter nicht hängen lassen. Der Garten war der ganze Stolz von Ruth Freitag.
Ein Lächeln huschte über Helens Gesicht. Vielleicht hatte Rabe ja Ahnung vom Gärtnern. Sie leerte ihre Tasse, und dann wartete zunächst einmal ihre eigene Aufgabenliste. Sie musste einiges schaffen, bevor sie nach der Arbeit wieder ihre Mutter besuchen würde. Immerhin war es eine Erleichterung, dass sie in der Uniklinik hier in Bonn war. Und nach dem Krankenbesuch könnte Helen direkt in Bonn bleiben und bei Rabe übernachten. Sie machte eine mentale Notiz, ihn gleich anzurufen. Denn obwohl sie schon seit einem Jahr zusammen waren, führten sie eine recht lose Beziehung, die immer noch aus Verabredungen bestand. Jetzt wäre es aber vorerst das Einfachste, bei Rabe zu übernachten. Außer am Mittwoch, wenn sie am Vormittag ihre Vorlesung in der Hochschule in Hennef abhielt.
4. Kapitel
Vor ein paar Wochen hatte Marie den Besuchstermin mit der Justizvollzugsanstalt vereinbart. Ihrem Vater hatte sie ihn in einem Brief angekündigt. Sie hatte nicht viel geschrieben. Ganz kurz. Nur die Fakten, der genaue Termin, den sie bekommen hatte. Montag, 23. April, 14 Uhr. Und nur ein »Hallo«, kein »Hallo Papa«.
Jetzt lief sie hinter dem Vollzugsbeamten her, der sie eilig über den Hof zum Besucherraum führte. Ihre Knie zitterten bei jedem Schritt. Sie konnte kaum Anschluss halten. Sie folgten einem gepflasterten schmalen Pfad. Rechts eine Häuserreihe mit verklinkerten roten Ziegeln, links eine Mauer aus den gleichen Ziegeln. Schon auf dem Weg hinein ins Gefängnis bekam sie Platzangst. Zwischen ihr und dem Beamten schlich sich eine Katze an der Häuserwand entlang. Marie kam sich vor wie in ein anderes Zeitalter versetzt. Sie erwartete jeden Moment, dass ihr eine Frau von einem der oberen Fenster einen Eimer dreckigen Wassers vor die Füße kippte. Es gab keine Gitter an den Fenstern. Wer mochte dort wohnen? Die Gebäude der JVA Siegburg waren alt. Seit 1886 befand sich hier schon ein Gefängnis. Es gab neuere Anbauten, aber grundsätzlich waren das alles noch sehr alte Gemäuer, die nach und nach renoviert wurden. All das hatte sie nachgelesen, während sie herausgefunden hatte, wie man so einen Besuchstermin überhaupt arrangierte. Klar hätte sie Frau Freitag bitten können, alles für sie zu übernehmen. Aber bei der Entscheidung, es überhaupt zu tun, hatte sie die Homepage der JVA besucht und dabei die Besuchsregeln studiert. Und irgendwann, als ihr zum dritten oder vierten Mal die Telefonnummer ins Auge gesprungen war, hatte sie gewählt. Und einen Termin gemacht.
Als sie das Gebäude betraten, wuchs ihre Beklemmung. Ihr Vater saß in Haus 1. Der Beamte wartete an der Tür auf sie, hielt sie ihr auf. Marie schlüpfte hinein. Ein Flur, mehrere Türen. Hier sah es moderner aus. Weiß gestrichen, farbige Bilder an den Wänden. Wohl schon ein renovierter Teil der Anlage. Der Beamte schritt wieder voran, deutete auf eine der Türen. »Hier hinein. Und dann der erste Tisch auf der rechten Seite. Ihr Vater wird dann gleich dazukommen.«
Die Hälfte der Tische im Besucherraum war besetzt. Quadratische Holztische. Jeweils vier Stühle, mit blauem Stoff überzogen. An den besetzten Tischen saßen zwei oder drei Leute in Unterhaltungen vertieft. Sie konnte nur erahnen, welche die Gefangenen waren. Alle trugen normale Kleidung. Kein Gefängnisanzug oder so etwas, wie sie es aus Filmen von US-Gefängnissen kannte. Das hier war ein Männergefängnis, also konnte sie die Frauen, die hier waren, schon einmal als Besucher erkennen. Das war aber auch das einzige Unterscheidungsmerkmal.
Und dann kam Georg Glücklich. Sein Blick schweifte kurz durch den Raum. In dem Moment, in dem er seine Tochter sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Marie aber erstarrte. Ihr Vater trug einen marineblauen einfachen Pulli, Jeans. Nicht so verschieden von seiner üblichen Kleidung. Aber sein Gesicht war furchtbar fahl, genau wie sein Haar. War er schon immer so grau gewesen? Oder erschien er nur im grellen Licht so? Zwischen den weiß gestrichenen hellen Wänden? Er kam direkt auf sie zu. Streckte seine Arme ein wenig aus. Erwartete er, dass sie aufstand und ihn in den Arm nahm? Marie blieb sitzen.
»Marie. Ich bin so froh, dass du gekommen bist.« Er setzte sich ihr gegenüber. Ließ sich keine Enttäuschung anmerken, dass sie nicht aufgestanden und auf ihn zugegangen war.
»Hallo.« Mehr bekam sie nicht raus. Er aber sprach weiter. Ließ keine Stille zwischen ihnen entstehen.
»Wie geht es dir denn? Ich habe so viele Fragen. Ich möchte dir alles erklären.«
»Ganz gut.« Sie schaffte es nicht, ihn dabei anzublicken. Schaute sich die Bilder an den weißen Wänden an. Das eine zeigte eine Blumenvase mit weiß und rot blühenden Blumen vor einem blauen Hintergrund. Stimmig in der Farbe mit den Besucherstühlen.
»Das ist schön. Und Gretchen?« Er machte eine Pause. »Hat sie meine Briefe gelesen?«
Das hatte sie nicht. Sie sprach nicht einmal über ihn. Obwohl es für Marie, für sie beide doch so wichtig wäre, sich auszutauschen. Schließlich hatte er sie beide belogen. Aber Gretchen Glücklich war stumm. Ihre einzige Reaktion war es gewesen, die Scheidung einzureichen.
Marie blinzelte zu ihrem Vater hinüber. Seine Hände lagen flach auf dem Tisch. Er strich über die glatte Oberfläche. Und er trug noch seinen Ehering. Wusste er überhaupt davon, dass sich Gretchen von ihm scheiden lassen wollte?
Jetzt schnellten ihre Augen hoch und trafen auf seine. Sie blickte ihn direkt an und sah die aufflammende Hoffnung darin. Es widerte sie an. »Was glaubst du? Natürlich hat sie deine Briefe nicht gelesen. Sie will nichts mehr von dir wissen. Und ich bin auch nur hier aus Eigennutz. Nicht damit du dich besser fühlst. Weißt du eigentlich, was du uns angetan hast, was du mir angetan hast?« Der Ausbruch kam für Marie selbst unerwartet. Aber es befreite sie aus ihrer Starre. Sie war ihm nichts schuldig, er musste das aushalten. Es ging um ihre Gefühle, nicht um seine. Jetzt hatte sie die Gelegenheit, ihre Wut auf ihn herauszuschreien. Das war die Chance, all das loszuwerden, was sich in ihr aufgestaut hatte. Er war das Ventil, musste es sein.
»Es tut mir so leid. Ich wollte das doch alles nicht.«
»Und ich will deine Entschuldigung nicht. Das kann man überhaupt nicht entschuldigen, was du getan hast.« Sie wurde immer lauter. Die Leute von den Nebentischen lugten zu ihnen hinüber. Versuchten so zu tun, als hörten sie sie nicht. Aber es war ihr völlig egal.
»Na…natürlich ni…nicht«, stotterte er. »Du hast recht, na…natürlich hast du recht.« Er hob beschwichtigend die Hände. »Aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann nur versuchen, euch … dir … irgendwie zu helfen. Was kann ich tun? Sag es mir, bitte.«
Was konnte er tun? War sie nur hierhergekommen, um ihm diese Dinge an den Kopf zu werfen? Oder wollte sie ihn leiden sehen, hier im Knast? Sehen, ob es ihm schlecht ging? Damit sie sich besser fühlen konnte?
»Bitte, Marie. Sag mir, was ich tun kann. Ich möchte etwas tun.«
»Gib uns dein Auto zum Verkauf!« Was Blöderes hätte ihr in diesem Augenblick nicht einfallen können.
»Braucht ihr Geld? Gretchen hat doch die Vollmachten für all unsere Konten. Es ist ihr Auto genauso wie meins. Uns gehört doch alles gemeinsam.«
Plötzlich wurde es Marie eiskalt. Geld, als ob es darum ging. »So wie ich? Wie viel hast du eigentlich für mich bezahlt? Hm? Sag schon. Hast du das Geld auch von einem eurer gemeinsamen Konten genommen?« Sie stand auf. Es war eine blöde Idee gewesen herzukommen.
»Nein, Marie. Das war ganz anders. Bitte bleib doch. Ich möchte dir das erklären. In Ruhe.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Bitte, Marie.«
Sie wandte sich ab. Wie viel Zeit war vergangen? War die Stunde schon rum? Konnte sie einfach hier rausgehen oder musste sie warten, bis sie der Vollzugsbeamte wieder abholte?
»Marie, warte doch. Kann ich dir schreiben? Wirst du mich noch einmal besuchen? Bitte.« Tränen liefen ihm die Wangen hinunter. Sie hatte ihn noch nie weinen sehen.
Marie schluckte. Er war immer gut zu ihr gewesen. Das hatte sie jedenfalls gedacht. Sie hatte ihn geliebt. Sie hatte sich bei ihm geborgen gefühlt. Er hatte sie vor der Welt beschützt. Sie nie bedrängt. Sie vermisste dieses Gefühl. Es war von heute auf morgen weggebrochen. Hatte ihr den Boden unter den Füßen weggezogen.
»Vielleicht«, brachte sie heraus. Sie sehnte sich nach diesem Gefühl. Für einen kurzen Moment wollte sie ihn umarmen, seine Tränen trocknen. So wie er es bei ihr stets geschafft hatte. Alles Vergangene vergessen. Doch das war nicht möglich. Das war ihr in den vielen Gesprächen mit Petersen klar geworden. Vergessen war keine Option. »Vielleicht«, wiederholte sie, kehrte ihm den Rücken zu und verließ diesen sterilen Raum.
5. Kapitel
Denken Sie daran, insbesondere das neunte Kapitel im Standardwerk über Psychologie für die kommende Prüfung durchzuarbeiten. Und dann Schluss für heute. Bis nächste Woche. Gleiche Zeit, gleicher Ort.« Oliver hatte Petersens Standardphrase zum Ende seiner Vorlesung heute mehr als sonst herbeigesehnt. Nachdem er Frau Freitag nicht mehr im Wirtshaus angetroffen hatte, war er das ganze Wochenende mit seinen Gedanken allein gewesen. Konnte man sich schwindelig denken? Ihm war es so vorgekommen. Denn die Gedanken hatten immer größere Kreise in seinem Kopf gedreht, weil er sie mit niemandem teilen konnte. Denn auch Yuna hatte er das ganze Wochenende weder gesehen noch gesprochen. Sie war auf einer Familienfeier in Ostdeutschland gewesen. Familie väterlicherseits. Yunas Mutter hatte ja keine Verwandten hier in Deutschland. Nie gehabt. Sie war als eine der Boatpeople Ende der Siebziger aus Vietnam gekommen. Allein. Vielleicht fühlte sich Oliver deshalb mit ihr verbunden. Nach dem tödlichen Unfall seiner Eltern hatte auch er ganz plötzlich allein dagestanden. Als Teenager. Nur eine Oma in Süddeutschland, die ihn aufgenommen hatte. Verlust der Eltern, neue Umgebung, die Schule wechseln, neue Freunde. Zu viel Neues für einen Vierzehnjährigen, der selbst gezeichnet war von den Unfallfolgen.
Erst bei Yuna und ihrer Familie fühlte er sich wieder angekommen. Und das nach all den Jahren, trotz der Hilfe, die er von den Freunden seiner Eltern bekommen hatte und obwohl er Yuna erst ein paar Monate kannte.
Oliver klemmte sich seinen Ordner unter den Arm und verließ den Seminarraum im Laufschritt. Die Flure und Treppenfluchten bildeten ein verwirrendes Labyrinth. Aber den Weg zur Campusbibliothek kannte er im Schlaf. Dort hatte er sich schon immer am wohlsten gefühlt. Die Bibliothek besaß keine Außenfenster. Dennoch war sie für ihn wie das Herz der gesamten Anlage. Pflanzeninseln und offene Lichträume, die über zwei Etagen reichten, boten Luft zum Durchatmen, und die Reihen der Bücherregale spendeten Geborgenheit. Schon bevor Yuna hier ihre Praktikumsstelle angefangen hatte, hatte Oliver sich immer in die Bibliothek zurückgezogen, um zu lernen. Sein eigenes Zimmer war für ein Studentenzimmer luxuriös. Wo bekam man schon Fernseher und WLAN frei Haus, ein eigenes Bad? Und das alles umsonst. Vom Arbeitgeber finanziert. Als Teil des Studiums. Trotzdem. Er hatte sich dort nie häuslich eingerichtet. Kaum Dekoration mitgebracht. Außer einem Foto von sich und seinen Eltern, das er überall mit sich trug. Zudem bekam man jedes Semester ein neues Zimmer zugewiesen. Und Wurzeln zu schlagen, fiel ihm ohnehin schwer. Seit dem Unfall.
Er lief an der oberen Etage der Bibliothek vorbei. Nur die Bibliotheksleiterin stand am Empfangsdesk. Yuna war nicht zu sehen. Vielleicht sortierte sie Bücher ein und verbarg sich hinter einem der Regale. Noch eine Treppenflucht, und er erreichte die Eingangstür.
»Hallo, Frau Stankowski.«
»Hallo, Herr Schönbom. Kommen Sie wieder, um zu lernen? Ihr Lieblingsplatz oben ist frei.«
»Nein, heute nicht. Ich will Yuna abholen.«
»Oh, sie ist schon weg. Hat etwas früher Schluss gemacht heute. Ist zum Sport verabredet, glaube ich.«
»Zum Sport?«
»Ja, Badminton. Drüben in der Sporthalle.«
Oliver stutzte. Seit wann hier? Sie spielte in Bonn im Verein, ja. Aber hier? Mit wem? Nein! Das konnte nicht sein. Sie würde doch nicht?
Er machte auf dem Absatz kehrt.
»Ihnen auch noch einen schönen Tag, Herr Schönbom«, rief ihm die Bibliotheksleiterin nach. Oliver nahm es nicht mehr richtig wahr. Seine Gedanken rasten, während er in einen Laufschritt verfiel. Die Treppenflucht wieder aufwärts. Richtung Mensa. Zur Plexiglasscheibe, die eine freie Sicht auf das tiefer liegende Spielfeld geben würde. Er begann zu schwitzen. Wischte seine Hände an den Hosenbeinen ab. Fast entglitt ihm dabei der Ordner, den er unter den Arm geklemmt hielt. Nein! Yuna hatte sich nicht breitschlagen lassen. Nicht von diesem Blender. Nicht Yuna. Sie durchschaute den Typen doch. Letzte Woche hatte der Kuschel sie angequatscht. Eine Woche, bevor er, Oliver, Worte gehört hatte, die alles verändert, die die Erinnerung zurückgebracht und seine Welt ins Wanken gebracht hatten, schon wieder. Er war mit Yuna in der Mensa gewesen. Oliver saß schon bei Nudeln mit Gulasch an ihrem Lieblingstisch auf der Empore mit Blick in den gesamten Raum hinein. Yuna stand am Salatbüffet. Da hatte sich dieser Boris Kuschel von hinten an seine Freundin angeschlichen, ja fast angekuschelt. Da war der Name Programm. So ein Frauenheld. Oliver hatte nie begriffen, was die Kommilitoninnen an ihm fanden. Seine gegelten blonden Haare und die immer sportlich-adrette Kleidung konnten es doch nicht sein. Das war kein Alleinstellungsmerkmal in dieser gut situierten Hochschule. Woran es auch lag, dass die Frauen auf den Kuschel flogen, der Typ ließ nie etwas anbrennen. Aber Yuna fiel doch nicht auf den rein. Dennoch hatte sie ihn angelächelt, als er ihr etwas ins Ohr flüsterte.
»Ich war doch nur nett«, hatte sie gesagt, als sie mit dem gefüllten Salatteller zu Oliver an den Tisch kam.
»Was wollte der denn?«
»Ach, er hat von irgendwo gehört, dass ich Badminton spiele, und mich gefragt, ob ich Lust hätte, mal mit ihm zu spielen.«
»Du hast natürlich Nein gesagt.«
»Nicht direkt. Nein. Warum auch? Er spielt sicher gut. Er ist ja eine richtige Sportskanone, was man so von ihm hört, und ich kann vor den Meisterschaften noch ein wenig mehr Training gebrauchen.«
Oliver hatte sie gebeten, sich nicht auf diesen Boris einzulassen. Nicht mit ihm zu spielen. Er sei gefährlich. Oliver hatte ein Feingefühl in dieser Hinsicht, und bei Boris war die Warnnadel sofort bei ihrer ersten Begegnung in den roten Bereich ausgeschlagen. Doch er hatte Yuna nur davor gewarnt, dass Boris die Frauen reihenweise um den Finger wickele und dann eiskalt wieder fallen ließe. Yuna hatte nur gelacht. Sie könne schon auf sich aufpassen, und von Boris drohe ihm keine Gefahr. Der sei doch gar nicht ihr Typ, sondern Oliver. Auf diese muskulösen Männer könne sie gut verzichten, Olivers schlanken, feingliedrigen Körperbau, den mochte sie, weil er sein liebes Inneres wiederspiegele. Auch wenn ihm das in Boris’ Kreisen den Namen Schönling eingebracht hatte. Oliver störte es nicht, solange er Yuna gefiel, wie er war. Und sich genau darauf verlassend, konnte sie ihn beschwichtigen. Wenn ihm aber so viel daran läge, würde sie das Badmintonspiel mit Boris halt lassen. Und Oliver hatte ihr das geglaubt. Denn vor einer Woche war ja alles in Ordnung gewesen. Da hatte er noch sicher mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden.
Jetzt hatte er die Turnhalle fast erreicht. Er schlich sich an die Plexiglasscheibe heran. Die Dämmerung war hereingebrochen und das Licht hier im Durchgang noch nicht eingeschaltet. Von dort unten konnte man ihn nicht sehen, er die grell erleuchtete Halle dagegen schon. Oliver hielt die Luft an. Noch ein Schritt weiter, und er würde sehen können, mit wem Yuna dort spielte. Als er sie sah, wich alle Spannung aus seinem Körper. Der Ordner fiel zu Boden. Konnte er sich denn auf niemanden mehr verlassen? Dort war seine Yuna, das lange schwarze Haar zu einem Zopf gebunden, in knappen Shorts und einem eng anliegenden, ihre sportlich-schlanke Figur betonenden Shirt. Einträchtig spielte sie mit dem Blender Badminton, und das auch noch gemeinsam auf derselben Seite im Mixed. Die beiden schienen so vertraut miteinander, hatten ihr Spiel perfekt aufeinander abgestimmt. Das konnte nicht das erste Mal sein, dass sie zusammen spielten. Hatte Yuna nur ihm gegenüber so kühl über den Kuschel gesprochen?
Hatten sich denn alle gegen ihn verschworen? Sogar seine Freundin? Oder sah er überall Gespenster? Wie damals nach dem Unfall, als er aus dem künstlichen Koma erwacht und sogar vor seiner Oma zurückgeschreckt war, die sich gerade über sein Bett beugte. Er sah nicht das liebevoll besorgte Gesicht, sondern nur die Spiegelung der Krankenhauslichter in ihren Brillengläsern, und er glaubte, es seien die Scheinwerfer des Autos, das auf ihn zuraste und seine kleine heile Welt zum ersten Mal ins Wanken brachte. Aber das waren nur die Schmerzmittel gewesen, die ihn benebelt hatten.
Seiner Yuna aber konnte er doch vertrauen. Nur noch ihr. Und er musste unbedingt mit ihr reden. Mit irgendwem teilen, was er am letzten Freitag erfahren hatte, und besprechen, ob es wirklich eine gute Idee war, die Sache zur Anklage zu bringen und die Rechtsanwältin zu beauftragen. Yuna war diejenige, mit der er das alles besprechen konnte, die Einzige, die blieb.
Rühr sie ja nicht an, du Schwein, dachte er. Doch Yuna schien wie geblendet. Sie lachte den schmierigen Typen an, nachdem er einen Schmetterball verwandelte. Dass sie ihm nicht um den Hals fiel, war alles. Die leichte Berührung an seinem Arm war schon zu viel. Sie konnte ihn doch jetzt nicht im Stich lassen. Nicht auch noch sie! Oliver wollte es nicht länger mit ansehen. Er wich zurück, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand neben dem schwarzen Brett und ließ sich hinunter zu Boden sinken.
6. Kapitel
Setz dich zu mir und entspanne dich, Helen.« Ralf Peter Voss hatte ihr, schon im Jogginganzug, die Tür geöffnet, und nachdem sie ihre Jacke an der Garderobe aufgehängt und ihre Tasche im Flur abgestellt hatte, saß er schon wieder auf dem Sofa. »Was liest du?« Sie strich die Pumps von den Füßen und setzte sich zu ihm. Nach der Arbeit war sie zu ihrer Mutter ins Krankenhaus geeilt, und so war es recht spät geworden. Ihre Füße schmerzten von einem langen Tag in den engen Schuhen. Und auch ihr linkes Schienbein machte sich bemerkbar. Der Bruch vom Unfall im letzten Jahr war zwar völlig verheilt, aber manchmal wurde es von einem dumpfen Schmerz durchzogen. Bei nasskaltem Wetter oder wenn sie es über Tag stark belastet hatte.
»Michelle Obama.« Rabe hielt den Einband hoch, damit sie einen Blick darauf werfen konnte. Becoming prangte in dezenter weißer Schrift über dem hinreißenden Foto der ehemaligen First Lady.
»Und?«
»Tolle Frau. Kann natürlich nicht mit dir mithalten.«
»Sehr witzig.« Helen verzog den Mund. »Steht aber auch noch auf meiner Liste ungelesener Bücher.«
»Ich kann es dir wärmstens empfehlen. Und ohne Scherz, du hast viel mit ihr gemeinsam, Helen.«
»Weil sie Anwältin ist, meinst du?«
»Nicht nur. Aber lies es selbst.«
»Ja, sicher. Aber ich weiß gar nicht, wann. Meistens bin ich nach den ganzen Akten, die ich so am Tag lese und durcharbeite, zu kaputt, um abends auch noch aus Spaß zu lesen. Oder ich schleppe mir die Arbeit mit nach Hause. Da fällt mir etwas ein.« Helen stand auf und schlurfte in den kurzen Flur, wo sie ihre Aktentasche abgestellt hatte, zog eine ihrer Handakten heraus und setzte sich wieder aufs Sofa. »Ich hab hier einen Fall, bei dem du mir helfen könntest.«
»Worum geht’s?«
»Dieser Mandant von mir hier hatte einen Arbeitsunfall. Böse Sache. Er ist Maler und Lackierer und vom Gerüst gestürzt, weil das nicht richtig montiert war. Hat sich einen Nackenwirbel gebrochen und ist knapp an einer Querschnittslähmung vorbeigeschrammt. Seinen Beruf kann er jedenfalls nicht mehr ausüben.«
Rabe legte das Buch auf den gläsernen Couchtisch. »Und wie kommst du da ins Spiel?«
»Der Gerüstbauer war ein anderer als die Firma, bei der mein Mandant angestellt ist. Das nimmt die gesetzliche Unfallversicherung zum Anlass und will nicht eintreten.«
»Und wie willst du mir jetzt den Ball zuspielen?«
»Würdest du mit diesen Sportmetaphern aufhören?« Manchmal glaubte Helen, Rabe nähme sie nicht ernst. Was nicht stimmte. Das wusste sie. Trotzdem konnte sie nicht aus ihrer Haut und reagierte dementsprechend abweisend. Im nächsten Moment tat es ihr schon wieder leid.
Rabe hatte auch dieses Mal ein dickes Fell. »Ich höre schon auf. Aber dennoch verstehe ich nicht, was ich da tun kann. Von diesen juristischen Spitzfindigkeiten habe ich keine Ahnung.«
»Ich dachte, du könntest einen Artikel drüber bringen. Nicht speziell zu diesem Fall, aber generell zu den Abwicklungspraktiken der Versicherungen. Die machen mich nämlich rasend.« Helen erhob sich und schritt hinüber zur kleinen Anrichte vor der Durchreiche zur Küche, wo Rabe seinen Whiskyvorrat aufbewahrte. »Du auch einen?« Sie drehte sich mit einem Glas in der Hand zu ihm um und sah seinen spöttischen Blick. »Ich weiß, Alkohol ist keine Lösung. Meine eigenen Worte. Aber da versuche ich, jeden Mittwoch in den Vorlesungen die zukünftigen Entscheider für die Seite der Versicherungsnehmer zu sensibilisieren, und habe dennoch in meinem Beruf täglich vor Augen, wie wenig das zu fruchten scheint. Die gesetzlichen Versicherungen legen die gleichen Praktiken an den Tag wie die privaten.« Mit zwei gefüllten Gläsern kehrte sie zurück, reichte ihm eines und nahm wieder auf dem Sofa Platz. Sie stießen an.
»Ich verstehe dein Anliegen. Aber das ist nicht mein Metier. Ich könnte dich an einen Kollegen empfehlen. Charly Reuter macht manchmal etwas in dieser Richtung.«
Sie winkte ab. »Ach, lass. Ist nicht so wichtig. Bringt ja auch nichts für den Fall meines Mandanten. Außerdem sollte ich meine Fälle vielleicht auch mal alleine lösen.«
Rabe lehnte sich zu ihr herüber, legte den Arm um sie. »Was ist wirklich los mit dir? Ist es deine Mutter? Ist es doch schlimmer als befürchtet?«
Sie nahm einen Schluck Whisky. Spürte dem Geschmack nach und wie sich das warme Gefühl in ihr ausbreitete. Sie entspannte ein wenig.
»Nein, nein. Ihr geht es gut. Den Umständen entsprechend. Hat mir schon eine riesige Liste an Aufgaben mitgegeben, die im Haus und Garten zu erledigen sind. Du hast nicht zufällig einen grünen Daumen?«
Er lachte auf. »Nur, wenn es um den Rasen auf dem Fußballfeld geht. Aber du bist doch ein Profi auf dem Golfrasen. Und zudem von der grünen Insel.«
Helen ging nicht auf seine Frotzelei ein. Auch wenn er ihr den Ball für eine entsprechende Entgegnung so schön zugespielt hatte. »Weißt du, es ist mir klar geworden, dass meine Mutter nicht immer für mich da sein wird. Sie wird eben alt, und der Parkinson ist zwar noch nicht weit fortgeschritten, aber das wird sie trotzdem immer mehr einschränken. Jetzt muss ich für sie da sein.«